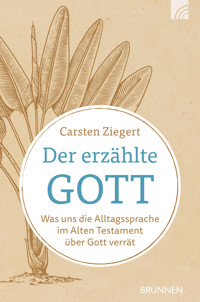
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Brunnen Verlag Gießen
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Sprache: Deutsch
"Barmherzigkeit", "Gnade", "Güte" - Begriffe, die seit Jahrhunderten zum religiösen Fachvokabular gehören. Was sagen diese abstrakten Begriffe eigentlich über Gott aus? Welches Gottesbild vermitteln sie? Verstehen wir sie noch richtig? Und was haben diese Begriffe zur Zeit des Alten Testamentes (dem ersten Teil der christlichen Bibel) bedeutet? Um das herauszufinden, geht Carsten Ziegert einen besonderen Weg: Er präsentiert keine theologischen Abhandlungen, stattdessen erzählt er lebendige Geschichten. Und zwar solche, in denen nicht Gott, sondern das Handeln von Menschen mit diesen Begriffen beschrieben wird. Erst am Ende jeder Geschichte, erklärt er, was mit den Begriffen "Barmherzigkeit", "Gnade" und "Güte" über Gott ausgesagt wird. Ein Buch für alle, die ihre Vorurteile über Gott hinterfragen wollen und tiefer verstehen möchten, wer und wie Gott ist.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 100
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Carsten Ziegert
Der erzählte
GOTT
Was uns die Alltagsspracheim Alten Testamentüber Gott verrät
© der deutschen Ausgabe:
2025 Brunnen Verlag GmbH, Gießen
Gottlieb-Daimler-Str. 22, 35398 Gießen
www.brunnen-verlag.de
Die Nutzung von Bild-, Sprach- und Textdaten für sog. KI-Training und ähnliche Zwecke ist nur nach vorheriger schriftlicher Genehmigung erlaubt.
Lektorat: Uwe Bertelmann
Umschlagfoto: KOSIM/Adobe Stock
Umschlaggestaltung: Jonathan Maul
Satz: Brunnen Verlag GmbH
ISBN Buch 978-3-7655- 2208-6
ISBN E-Book 978-3-7655-7744-4
Stimmen zum Buch
In einem weitgehend säkularen Umfeld stehen Christen und Gemeinden vor der Herausforderung, verständlich und wahrheitsgemäß von Gott zu reden. Dazu gehört zunächst ein solides Grundwissen darüber, wer Gott ist. Das Buch von Carsten Ziegert vermittelt dieses Wissen und macht uns sprachfähig – kompetent und kreativ.
Prof. Dr. Philipp Bartholomä,
Professor für Praktische Theologie, FTH Gießen
Die fesselnden Geschichten, die Carsten Ziegert hier erzählt, helfen uns nicht nur, Gott besser kennenzulernen, sondern lassen uns auch neu über ihn staunen. So muss Theologie sein: spannend, praxisnah und lebendig! Unbedingt lesen!
Torsten Pfrommer, Pastor, FeG Gießen
Wie soll man Unbegreifliches greifbar machen? Wie soll man Unbeschreibliches beschreiben? Das Buch von Carsten Ziegert hilft dabei, den unsichtbaren Gott mithilfe einer verständlichen Sprache sichtbar werden zu lassen.
David Kröker, ChristusForum Deutschland
Ein Buch, das wie ein Poliertuch wirkt und alte, schon etwas abgenutzte Begriffe neu zum Glänzen bringt. Carsten Ziegert verbindet spannende und unterhaltsame Prosa mit sprachwissenschaftlichem Fachwissen und macht auf diese Weise grundlegende Eigenschaften des jüdisch-christlichen Gottes für Herz und Verstand zugänglich. Ein Buch für Wortliebhaberinnen und Spurensucher.
Hanna Löffler, Theologin bei Central Arts
Gott spricht keine Theologen-Sprache! Carsten Ziegert hat ein faszinierendes Buch mit großem Gewinn für alle Bibelleser geschrieben – ganz gleich ob Laien oder Theologen. Ihm gelingt es, auf einfache Weise durch anschauliche Bibelgeschichten die Brücke von der hebräischen Ursprache des Alten Testaments in unsere Alltagssprache zu schlagen. Dabei lernt der Leser etwas ganz Grundlegendes darüber, wie Sprache funktioniert, und erhält dabei erfrischend tiefe Einsichten über Gottes Wesen.
Marco Maier,
Direktor der Evangelischen Gesellschaft für Deutschland
Geschichten erklären uns die Welt. Durch Geschichten gewinnen wir Einblicke in Kulturen und lernen so die Bedeutung ihrer Sprache. Carsten Ziegert gelingt es hervorragend, durch die Erzählung von Geschichten die Sprache und die Bedeutung der Welt des Alten Testaments neu verständlich zu machen. Wer sich für Gott und sein Wort interessiert, wird dieses Buch mit Gewinn lesen. Für die, die predigen oder auf andere Weise Gottes Wort verkündigen, ist dieses Buch eine Pflichtlektüre.
Dr. Jürgen Schulz, Rektor des Theologischen Seminars Adelshofen
Inhalt
Wozu dieses Buch?
Die Frauen
Die Fremde
Brüder
Die Flucht
Von Wörtern und Welten
Wo die Erzählungen in der Bibel stehen
Wozu dieses Buch?
Wenn Christen über ihren Glauben reden, habe ich oft den Eindruck, dass sie eine etwas merkwürdige Insider-Sprache verwenden. Ich frage mich dann, ob ihre nichtchristlichen Nachbarn und Freunde etwas mit Begriffen wie „Segen“ oder „Gnade“ anfangen können. Und ich frage mich auch, ob Christen selbst immer verstehen, was sich hinter solchen theologischen Begriffen verbirgt.
Um nicht falsch verstanden zu werden: Ich finde es gut, wenn Christen über ihren Glauben reden. Auch mit Nichtchristen. Denn das Evangelium von Jesus Christus ist für alle Menschen da und soll an alle Menschen weitergegeben werden.
Übrigens: „Evangelium“ ist auch so ein Fachbegriff. Man kann ihn mit „Gute Nachricht“ oder „Frohe Botschaft“ übersetzen, aber der Ausdruck „das Evangelium“ (mit dem bestimmten Artikel „das“) bezeichnet nicht irgendeine „gute Nachricht“, sondern die beste gute Nachricht aller Zeiten: Gott wird ein Mensch (das geschah vor ungefähr 2000 Jahren, Christen feiern das zu Weihnachten); dieser Mensch namens Jesus wird unschuldig zum Tod verurteilt, an ein Holzkreuz genagelt und stirbt (daran denken Christen an Karfreitag); überwindet aber durch seine „Auferstehung“ (Fachbegriff!) den Tod (das feiern Christen zu Ostern), wodurch alle Menschen die Möglichkeit haben, ewig in Gemeinschaft mit Gott zu leben – so weit die Kurzfassung des Begriffs „Evangelium“.
Fachbegriffe sind zunächst einmal nicht schlimm. Und wie das Beispiel „Evangelium“ zeigt, sind sie hilfreich, um knapp und präzise über komplexe Dinge zu reden. Wissenschaftler verwenden sie hemmungslos, weil es die Kommunikation mit anderen Wissenschaftlern erleichtert – zumindest dann, wenn sie in demselben Fachgebiet arbeiten. Versucht man aber, die Grenzen des eigenen Fachgebiets zu überschreiten, dann wird es schwierig. Wenn ich (Theologe) mit meinen Kollegen rede, versteht meine Frau (Ärztin) nicht viel. Und wenn sie mit ihren Kollegen redet, komme ich mir vor wie ein Idiot.
Fachbegriffe einer Gruppe haben also die unangenehme Eigenschaft, dass sie zunächst nur für Angehörige dieser Gruppe verständlich sind. Wenn ein Christ im Gespräch mit einem Nichtchristen das Wort „Gnade“ verwendet, dann hat der Nichtchrist vielleicht eine mehr oder weniger konkrete Vorstellung von der Bedeutung – vielleicht aber auch nicht. Denn „Gnade“ ist ein speziell christlicher Fachbegriff, den der Christ erklären sollte, wenn er verständlich kommunizieren will.
Manchmal kann es sogar passieren, dass auch Christen ihre eigenen Fachbegriffe nicht verstehen. Machen wir einen Test: Was genau bedeutet „Gnade“? Und was bedeutet es, wenn Gott als „gnädig“ bezeichnet wird? Vielleicht denken wir bei diesem Wort an die altertümliche Anrede „gnädige Frau“. Oder wir verbinden den Begriff damit, dass sich Kaiser und Könige früher als „Herrscher von Gottes Gnaden“ verstanden und dass sich Adlige mit „Euer Gnaden“ anreden ließen.
Wozu also dieses Buch? Ich habe dieses Buch geschrieben, um ein paar christliche Fachbegriffe zu erklären. Und zwar nicht irgendwelche Begriffe, sondern solche, mit denen in der Bibel Gottes Wesen beschrieben wird (Fachbegriff „Bibel“: heiliges Buch der Christen, bestehend aus den Teilen „Altes Testament“ und „Neues Testament“; beide Teile bestehen aus mehreren Büchern verschiedener Autoren). Bei diesen wichtigen Begriffen über Gottes Wesen habe ich die Befürchtung, dass sie kaum noch verstanden werden, auch von vielen Christen nicht. Es geht also in diesem Buch um die Frage, wer Gott ist und wie Gott ist. Nicht mehr und nicht weniger.
Mein eigenes Fragen nach der Bedeutung von christlich-theologischen Fachbegriffen wurde durch einen Bibeltext ausgelöst, in dem Gott sich selbst vorstellt (2. Mose 34,6): „der HERR, der HERR, ein barmherziger und gnädiger Gott, langsam zum Zorn und reich an Güte und Treue.“ Hier werden einige von Gottes Wesenszügen genannt, von denen ich drei erklären will: Barmherzigkeit, Gnade und Güte.
Das Besondere an diesem Buch ist nun, dass ich zu diesen drei Fachbegriffen keine theologischen Abhandlungen präsentiere. So etwas gibt es nämlich schon. Stattdessen erzähle ich Geschichten. Dabei handelt es sich um Geschichten aus dem Alten Testament (dem ersten Teil der christlichen Bibel), in denen nicht Gott, sondern Menschen mit diesen Begriffen beschrieben werden. Erst danach, also wenn die Geschichte fertig erzählt ist, erkläre ich, was mit dem entsprechenden Fachbegriff über Gott ausgesagt wird. Wir versuchen also, durch Geschichten über Menschen etwas von Gottes Wesen zu verstehen. Warum dieses Vorgehen sinnvoll ist, erkläre ich in dem Abschnitt „Von Wörtern und Welten“ am Ende des Buchs.
Ich habe mir erlaubt, die Erzählungen aus der Bibel in „dichterischer Freiheit“ auszuschmücken. Diese Ausschmückungen sind allerdings nicht völlig aus der Luft gegriffen. Einige von ihnen machen Details anschaulich, die in den Bibeltexten nur angedeutet werden. Dabei habe ich etwas spekuliert, wie es sich zugetragen haben könnte. Gelegentlich habe ich auch Personen erfunden, die in der Bibel nicht vorkommen (wie die Händler Ethan und Berija in „Die Flucht“). Beim Erzählen habe ich aber nichts in die Texte hineinfantasiert, was dem Sinn des Originals widerspricht. Die Bibeltexte, die den Geschichten zugrunde liegen, sind am Ende des Buchs angegeben.
Übrigens: Das Alte Testament wurde ursprünglich auf Hebräisch abgefasst. Deshalb nenne ich in den Geschichten nicht die deutschen, sondern die hebräischen Fachbegriffe. Das soll dabei helfen, den deutschen Begriff und das, was man sich darunter vorstellt, so weit wie möglich auszublenden. Und es bietet eine Gelegenheit, tiefer in die ursprünglich auf Hebräisch geschriebenen Geschichten einzutauchen und die Bedeutung der Begriffe genauer zu erfassen. Aber keine Angst: Man muss nicht Hebräisch lernen, um diese Wörter zu verstehen, sondern ihre Bedeutung ergibt sich durch die Erzählung. Und zwar besser und anschaulicher, als das durch eine Vokabelangabe möglich wäre.
Und nun kann die Reise beginnen. Eine Reise in die oft rätselhafte Welt des Alten Testaments. In eine Welt, in der Gott sich den Menschen bekannt macht und sich ihnen freundlich zuwendet.
Die Frauen
Der Weg durch die Stadt ist mühsam, die Hitze staut sich in den engen Gassen, es ist noch lange nicht Mittag. Auf den großen Straßen ist es fast genauso eng und heiß, die Eile des Vormittags hat die Morgenstille verschlungen.
Sie muss zum Palast, sie will ihr Kind zurückhaben.
Die Andere trägt den Säugling, mit festem Griff hält sie ihn, sie will ihn nicht wieder hergeben.
Lieber würde sie ihn selbst tragen, zu schön wäre es, wenn die Andere ihn zurückgeben würde. Doch das ist Illusion, denn dann wäre der Weg zum Palast nicht nötig, den beide zusammen gehen.
Der Streit war heftig gewesen. Mit einem toten Kind im Arm war sie am Morgen aufgewacht, aber es war nicht ihr Kind, es war das Kind der Anderen.
Die Andere muss die Kinder ausgetauscht haben, ihr totes gegen das lebende, schlafende, dann war sie in ihr Zimmer zurückgeschlichen.
Natürlich stritt die Andere alles ab, als könnte man sein eigenes Kind nicht erkennen. Sie selbst hatte getobt, das tote Kind im Arm, immer lauter hatte sie geschrien, die Andere war bei ihrer Geschichte geblieben. Doch sie kennt ihr Kind, jetzt hat es die Andere und meint, mit ihrer Lüge würde sie durchkommen.
Aber es gibt Recht und Gesetz in Israel, und es gibt einen unbestechlichen Richter, ausgestattet von Gott mit Weisheit, Gut und Böse zu unterscheiden. Dahin führt ihr gemeinsamer Weg; zum König, der wird ein gerechtes Urteil fällen. Die Andere musste sich mit ihr auf den Weg machen, sie wäre sonst handgreiflich geworden, wenn das Schreien und Toben schon nichts nützt.
Zu dumm, dass man so weit gehen muss, um Recht zu bekommen, bequemer wäre es, wenn ein Mann im Haus wäre, der das Sagen hat.
Immer wieder waren Männer in ihrem gemeinsamen Haus gewesen, natürlich hatte keiner die Aufgabe übernommen, für Recht zu sorgen, sie waren gekommen und schnell wieder gegangen. Das Haus, das sie mit der Anderen zusammen bewohnt, ist ein Gasthaus am äußeren Rand der Stadt, Reisende kehren hier ein, meist nur für eine Nacht. Sie bekommen Unterkunft und Verpflegung; wer mehr zahlt, bekommt weitere Dienstleistungen, die die Betreiberinnen von Gasthäusern in den Städten anbieten.
Die Stadt ist nicht ihre Heimat. Sie verabscheut die Unruhe, die breiten Straßen, die lauten Verkäufer, die auf dem ständig überfüllten Markt ihre Waren anbieten. Ihre Familie hatte ein Landstück besessen im Stammesgebiet von Manasse. Dort war es ruhig. Jerusalem war drei Tagereisen entfernt. Niemand kommt gerne in die Königsstadt. Nicht wenn er stattdessen auf dem Land vor seinem eigenen Haus im Schatten sitzen und den Ertrag seines Feldes genießen kann.
Doch dann kamen die Missernten. Es gab nicht genug Regen, und die Felder trugen nicht. Drei Jahre in Folge. Ihre Familie traf es besonders hart. Sie war fast noch ein Kind, als sie lernte, was Hunger bedeutet.
Dann kam eines Tages Elon vorbei, der reichste Mann des Ortes. Er wolle helfen, sagte er. Das sei seine Pflicht vor Gott. Schließlich habe er Rücklagen, deshalb hätten die Missernten ihn nicht so stark getroffen. Er könne ihrem Vater einen Kredit anbieten. Gott habe ihm viel geschenkt, deshalb sei er verpflichtet, seinen Mitmenschen zu helfen. Die Tilgung des Kredits erwartete er erst nach der nächsten Ernte. Und selbstverständlich verlangte Elon nur wenig Zinsen.
Ihr Vater ging auf Elons Angebot ein. Das war die einzige Möglichkeit, um halbwegs über die Runden zu kommen. Doch im nächsten Jahr gab es wieder eine Missernte, und er konnte den Kredit nicht zurückzahlen.
Irgendwann stand Elon wieder vor der Tür. Man müsse eine Lösung finden, sagte er. Ihr Vater wusste keine. Die Familie war am Ende. Doch Elon wusste Rat. Er kaufte ihrem Vater das Land ab. Mit dem Geld wurden die Schulden bezahlt. Viel blieb davon nicht übrig. Die Familie durfte weiterhin auf dem Grundstück wohnen, arbeitete aber jetzt für Elon. Einen kleinen Teil des Ertrags durften sie behalten, der reichte aber kaum zum Leben.





























