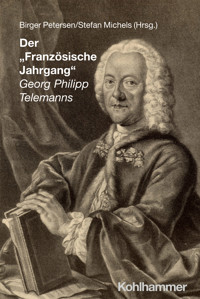
Der "Französische Jahrgang" Georg Philipp Telemanns E-Book
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Kohlhammer Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Der "Französische Jahrgang" für die Sonn- und Festtage 1713/1714, den Georg Philipp Telemann während seiner Frankfurter Zeit als städtischer Musikdirektor und Kapellmeister komponierte, wurde zeitgleich in Frankfurt und in Eisenach aufgeführt. Er nimmt hinsichtlich der Vollständigkeit, Besetzungsvielfalt und des Formenreichtums eine Sonderstellung ein. Der Sammelband präsentiert die Ergebnisse der interdisziplinären Tagung an der Johannes Gutenberg-Universität Mainz im Herbst 2022 im Rahmen des "Telemann Project". Er ist ein Beitrag zur weltweit ersten Gesamteinspielung dieses Jahrgangs in Kooperation mit Canberra Baroque, dem Klassik-Label cpo, der Telemann-Gesellschaft Frankfurt und dem Zentrum für Telemann-Pflege und -Forschung Magdeburg.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 324
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Musik und Theologie
Herausgegeben von
Stefan MichelsBirger Petersen
Band 1
Umschlagabbildung: picture alliance/Bildagentur-online/UIG
Birger Petersen/Stefan Michels (Hrsg.)
Der »Französische Jahrgang« Georg Philipp Telemanns
Verlag W. Kohlhammer
1. Auflage 2026
Alle Rechte vorbehalten
© W. Kohlhammer GmbH, Stuttgart
Gesamtherstellung: W. Kohlhammer GmbH, Heßbrühlstr. 69, 70565 Stuttgart
Print:
ISBN 978-3-17-045739-3
E-Book-Formate:
pdf: ISBN 978-3-17-045740-9
epub: ISBN 978-3-17-045741-6
Für den Inhalt abgedruckter oder verlinkter Websites ist ausschließlich der jeweilige Betreiber verantwortlich. Die W. Kohlhammer GmbH hat keinen Einfluss auf die verknüpften Seiten und übernimmt hierfür keinerlei Haftung.
Dieses Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwendung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechts ist ohne Zustimmung des Verlags unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und für die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
Der »Französische Jahrgang« für die Sonn- und Festtage 1713/1714, den Georg Philipp Telemann während seiner Frankfurter Zeit als städtischer Musikdirektor und Kapellmeister komponierte, wurde zeitgleich in Frankfurt und in Eisenach aufgeführt. Er nimmt hinsichtlich der Vollständigkeit, Besetzungsvielfalt und des Formenreichtums eine Sonderstellung ein. Der Sammelband präsentiert die Ergebnisse der interdisziplinären Tagung an der Johannes Gutenberg-Universität Mainz im Herbst 2022 im Rahmen des »Telemann Project«. Er ist ein Beitrag zur weltweit ersten Gesamteinspielung dieses Jahrgangs in Kooperation mit Canberra Baroque, dem Klassik-Label cpo, der Telemann-Gesellschaft Frankfurt und dem Zentrum für Telemann-Pflege und -Forschung Magdeburg.
Birger Petersen ist Professor für Musiktheorie an der Johannes Gutenberg-Universität Mainz.
Stefan Michels ist Professor für Kirchengeschichte an der Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt.
Inhaltsverzeichnis
1 Das Telemann ProjectFelix Koch2 »Lust und Fleiß kann Wege finden …«Carsten Lange3 Der »Französische Jahrgang« Georg Philipp Telemanns: VorwortBirger Petersen und Stefan Michels4 Die ›Kantate‹ als theologischer TextStefan Michels5 Das originale Libretto zum »Französischen Jahrgang« TelemannsMarc-Roderich Pfau6 Die Kurmainzer Hofmusik im Umfeld der Kaiserkrönung Karls VI. (Frankfurt 1711) und Georg Philipp TelemannKlaus Pietschmann7 »Ich wurde des Lulli, Campra, und anderer guten Autoren Arbeit habhafft«Daniela Philippi8 Komposition und BearbeitungWolfgang Hirschmann9 Zum Verhältnis von Edition und AufführungspraxisUte Poetzsch10 Jesus sei mein täglich WortAnn Kersting-Meuleman11 Die Behandlung von Choralmelodien in Telemanns »Französischem Jahrgang«Gabriela Krombach12 Inventio und ExecutioBirger Petersen13 Strategien der Distanzierung in den Autobiographien TelemannsImmanuel Ott14 Überlegungen zum Verständnis von ›Digitalität‹ in der Musikwissenschaft in den 2010er JahrenStefanie Acquavella-Rauch15 Telemann recyceltBenjamin Lang16 Verzeichnis der Autorinnen und Autoren1 Das Telemann Project
Felix Koch
Das Telemann Project des Collegium musicum der Johannes Gutenberg-Universität Mainz und des Forum Alte Musik Frankfurt am Main in Kooperation mit dem Verlag Canberra Baroque, dem Klassik-Label cpo, der Telemann-Gesellschaft Frankfurt, dem Zentrum für Telemann-Pflege und -Forschung Magdeburg, dem SWR (Südwestrundfunk), der Stiftung der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau und der Hochschule für Musik an der Johannes Gutenberg-Universität Mainz widmet sich im Rahmen des bis 2027 geplanten Projekts der weltweit ersten Gesamtaufführung und Gesamteinspielung des »Französischen Jahrgangs« mit 72 groß besetzten Gottesdienstmusiken von Georg Philipp Telemann, die vermutlich zwischen 1713 und 1715 komponiert und erstmals in Eisenach und Frankfurt erklungen sind.
21 Werke des ersten, vornehmlich in Kopien und Abschriften nahezu vollständig erhaltenen Frankfurter Jahrgangs wurden bislang von verschiedenen Verlagen und Institutionen herausgegeben. 51 Handschriften wurden im Rahmen des Telemann Project in Kooperation mit dem australischen Musikverlag Canberra Baroque editorisch aufbereitet und stehen als musikpraktisches Aufführungsmaterial für die konzertante Wiederaufführung nach über 300 Jahren und die weltweite Ersteinspielung des gesamten ›Französischen Jahrgangs‹ beim Label cpo zur Verfügung.
Neben dem Barockorchester Neumeyer Consort wurden 2020 die Gutenberg Soloists als zwölfköpfiges Vokalensemble 2020 speziell für das Telemann Project an der Johannes Gutenberg-Universität Mainz gegründet: In Besetzungsgröße und Stimmzuschnitt folgt es den Gegebenheiten der im 18. Jahrhundert üblichen Aufführungspraxis. Die jeweiligen Solopartien werden dabei von Mitgliedern des Ensembles übernommen. Das internationale Ensemble setzt sich zusammen aus professionellen jungen Sängerinnen und Sängern aus Deutschland, England, Luxembourg, den Niederlanden, Österreich und der Schweiz und wird ergänzt durch jeweils wechselnde artists in residence, wie unter anderem Elisabeth Scholl, Sabine Goetz, Agnes Kovacs, Georg Poplutz, Hans Jörg Mammel, Hans Christoph Begemann, Gotthold Schwarz und Klaus Mertens.
Seit 2020 werden jährlich zwischen 10 und 15 Gottesdienstmusiken in Konzerten in der Rhein-Main Region sowie bei internationalen Festivals u. a. in Magdeburg, Saarbrücken, Andernach und Luxembourg präsentiert. Von der internationalen Presse wird das musikalische Unterfangen als »großartiges Telemann-Projekt mit faszinierenden Frankfurter Kompositionen« (MDR Kultur) gefeiert. »Aus dem Staunen über die hohe Originalität dieser Musik kommt man kaum heraus« (DLF Kultur). »Für den Zuhörer also ein Füllhorn an Freuden« (Musicweb international). »Das verdankt sich maßgeblich der Qualität der Interpretationen, denen Felix Koch am Pult der exzellenten Ensembles Gutenberg Soloists und Neumeyer Consort zu großer Präzision und Lebendigkeit verhilft« (FonoForum).
Dass mit diesem Projekt eine enge Verzahnung zwischen Musikwissenschaft und Musikpraxis ermöglicht und durch eine Intensivierung der Diskussion und Auseinandersetzung zu Telemanns Gottesdienstmusiken in Form der Mainzer Tagung 2022 sowie zahlreicher Bachelor- und Masterarbeiten an der Johannes Gutenberg-Universität Mainz angeregt wurde, ist zudem besonders zu erwähnen.
www.Telemann-project.de
2 »Lust und Fleiß kann Wege finden …«Anmerkungen zu den Anfängen des Telemann Project
Carsten Lange
Ich freue mich, ein kurzes Grußwort aus der Telemannstadt Magdeburg seitens des Zentrums für Telemann-Pflege und -Forschung und der Internationalen Telemann-Gesellschaft e.V. überbringen zu können. Dafür den Veranstaltern ein herzlicher Dank!1
Mit Prof. Felix Koch verbindet uns Magdeburger inzwischen eine langjährige Zusammenarbeit, aus der auch ein freundschaftliches Miteinander wurde. Erste Begegnungen gab es in der Geburtsstadt Georg Philipp Telemanns im Jahr 2001, als er mit dem zu den Wettbewerbspreisträgern zählenden Ensemble Mediolanum am 1. Internationalen Telemann-Wettbewerb teilgenommen hat. Vorsitzender dieses neuen, dem Werk des Namenspatrons gewidmeten Wettbewerbs war damals Prof. Gustav Leonhardt aus Amsterdam. Seit 2010 ist Felix Koch alle zwei Jahre anlässlich der Magdeburger Telemann-Festtage mit speziell entwickelten »Telemann für Schüler«-Veranstaltungen in Magdeburg und im nördlichen Sachsen-Anhalt zu Gast. Mit pädagogischer Kompetenz und didaktischem Sachverstand bereitete der studierte Cellist, Musikvermittler und Musikpädagoge immer wieder gleichermaßen spannend und informativ einzelne Themen aus dem Telemannschen Oeuvre für Mitmach-Konzerte auf, die sich an einen jungen Hörerkreis wendeten. Er begeisterte damit bisher mehr als 12.500 Schülerinnen und Schüler im Grundschulbereich für Telemann und sein Werk. Und ich weiß, dass dies dem Mainzer Stadtmusiker seit 2018 immer wieder gelingt, wo er mit seinen Programmen zu Gast ist – mit den Schülerprogrammen z. B. in der Frankfurter Oper und beim Domplatzsingen in Mainz.
Nach einem erfolgreichen »Telemann-Marathon« mit Kirchenliedern nach des Komponisten Veröffentlichung Fast-Allgemeines Evangelisch-Musikalisches Liederbuch (Hamburg 1730) im Telemannjahr 2017 initiierte Felix Koch ein Jahr später ein weiteres Mammutprojekt: Ich erinnere mich noch gut an ein Telefonat im August 2018, in dem er seine Idee der vollständigen Einspielung eines Jahrgangs mit Kirchenmusiken von Georg Philipp Telemann vorstellte – und mich um meine Meinung bat. Der Tonfall von Felix Koch besaß den ihm eigenen Enthusiasmus und suggerierte gleichermaßen Ernsthaftigkeit und Mut sowie Optimismus und Zuversicht, dass ein solches Langzeitvorhaben – immerhin sprechen wir von idealerweise 72 Kirchenmusiken zu den Sonn- und Festtagen des Kirchenjahres – gelingen würde, wenn es gut vernetzt geplant und durchgeführt werden würde. Daran lag Felix Koch von Anfang an.
Neben dem besonderen Reiz, den ein solches Ansinnen in sich trägt, kommen in solch einem Moment natürlich auch einige der Herausforderungen in den Sinn, die es in sich birgt. Natürlich stand neben Fragen der Finanzierung inhaltlich sofort die Auswahl des Jahrgangs und der Aufführungsmaterialsituation im Raum. Bislang gibt es von den erhaltenen kirchenmusikalischen Jahrgängen Telemanns nur wenige, die in modernen kritischen Ausgaben vollständig veröffentlicht sind:2
• Harmonischer Gottes-Dienst (Hamburg 1725/26),3 Dichtung: Matthäus Arnold Wilkens und andere,
• die Fortsetzung des Harmonischen Gottes-Dienstes (Hamburg 1731/32),4 Dichtung: Tobias Heinrich Schubart,
• die Ariensammlung Auszug derjenigen musicalischen und auf die gewöhnlichen Evangelien gerichteten Arien (Hamburg 1727),5 Dichtung: Johann Friedrich Helbig.
Von anderen Jahrgängen liegen Segmente in einzelnen Bänden der im Bärenreiter-Verlag erscheinenden Reihe Georg Philipp Telemann. Musikalische Werke (Telemann-Ausgabe) vor und innerhalb dieser Reihe wird gegenwärtig mit dem Jahrgang Geistliches Singen und Spielen (Eisenach 1710/11) auf Texte von Erdmann Neumeister ein weiterer Jahrgang mit Kirchenmusiken Telemanns als kritische Ausgabe publiziert.6 Entstanden ist dieser erste Jahrgang Telemanns für den kirchenmusikalischen Gebrauch während seiner Eisenacher Dienstzeit.
Natürlich gibt es darüber hinaus zahlreiche Einzelausgaben von Kirchenmusiken, doch ein vollständiger Jahrgang ließe sich damit im Sinne des von Felix Koch angedachten Projektes nicht füllen. Zu konstatieren war im Blick auf das Projekt also, dass drei der zahlreichen Telemannischen Jahrgänge zu allen Sonn- und Festtagen des Kirchenjahres in gedruckten kritischen Ausgaben inzwischen zugänglich sind und an der gedruckten Herausgabe eines weiteren Jahrgangs gearbeitet wird.
Ist die Auseinandersetzung mit den Telemannischen Jahrgängen zu den Sonn- und Festtagen des Kirchenjahres anhand einiger moderner Ausgaben möglich, bestätigte der Blick in die Telemann-Diskographie,7 dass das systematische musikalische Erschließen eines kompletten Jahrgangs mit Einspielungen nach wie vor ein Desiderat ist. Zwar gibt es zahlreiche Produktionen von Einzelwerken z. B. aus dem für Singstimme, obligates Begleitinstrument und Basso continuo angelegten Harmonischen Gottes-Dienst, doch bislang ist es nicht gelungen, die 72 Kirchenmusiken eines gesamten Jahrgangs in einem überschaubaren Zeitraum vollständig und noch dazu von einem Ensemble einzuspielen und bei einem CD-Label zu veröffentlichen. Mehrere ernsthafte Versuche dazu gab es im Zusammenhang mit dem Harmonischen Gottes-Dienst und am weitesten ist ein norwegisches Projekt mit dem Ensemble Bergen Barokk vorangekommen: Zwischen 2005 und 2013 spielte es sieben CDs mit 44 Kirchenmusiken für das Label Toccata Classics ein.8
Als am Anfang des von Felix Koch geplanten Projektes die Wahl des einzuspielenden Jahrgangs noch nicht feststand, war jedoch eines klar: Der Harmonische Gottes-Dienst sollte es nicht sein. Doch welcher Jahrgang dann? Für die Telemann-Auswahlausgabe ist – wie erwähnt – Telemanns erster kirchenmusikalischer Jahrgang Geistliches Singen und Spielen (Eisenach 1710/11) in Arbeit. Doch die vollständige wissenschaftliche Ausgabe wird voraussichtlich erst Ende der 2020er Jahre abgeschlossen sein. Für eine Einspielung, die sofort beginnen und bis spätestens Ende der 2020er Jahre zu Ende gekommen sein sollte, kam sie daher nicht in Frage.
Es ist nicht anders zu sagen: Auch bei diesem Projekt spielte der Zufall eine nicht unmaßgebliche Rolle. Nahezu zeitgleich zu den Überlegungen zur Jahrgangsauswahl kam ich in Kontakt mit dem Organisten, Cembalisten und Chorleiter Peter Young aus Canberra. Er hatte bereits praktische Ausgaben verschiedener Telemann-Jahrgänge für seine Reihe Canberra Baroque edition9 eingerichtet und berichtete im Zuge seines Antrags auf eine Mitgliedschaft in der Internationalen Telemann-Gesellschaft e.V. davon, dass er gerade eine moderne Ausgabe aller Kirchenmusiken des Französischen Jahrgangs (Frankfurt am Main 1714/15, evtl. 1713/14) anfertigen würde. Schnell war der Kontakt zwischen Felix Koch und Peter Young hergestellt und die Zusammenarbeit der beiden trägt inzwischen eindrucksvolle und ebenso sicht- wie hörbare Früchte.
Auch im Blick auf die Vermittlung eines CD-Labels konnten wir von Magdeburg aus helfen. Prädestiniert für die Veröffentlichung von Kompositionen außerhalb des Mainstreams des Konzert- und Musiklebens und insbesondere von weitgehend oder gänzlich unbekannten Werken ist das Klassiklabel cpo (Classic Production Osnabrück) des Medienversandhändlers jpc (jazz – pop – classic). Hier agiert seit 1991 mit Burkhard Schmilgun ein ebenso enthusiastischer wie feinsinniger Produzent mit bestem Gespür für sogenannte vergessene Meisterwerke als Director A&R (Artists and Repertoire), der mit seiner »Neugier auf Neue Musik der Vergangenheit« den Hörer in geradezu aufklärerischer Haltung zu »Entdeckungsreisen in die vielgestaltige Welt der Musikgeschichte« ermuntern will, um auf Basis eigener Hörerfahrungen Musik zu beurteilen.10 Und dass Burkhard Schmilgun mit seiner spürbaren Verbundenheit zum Œuvre Georg Philipp Telemanns sich auch vor Langzeitprojekten nicht scheut, wurde bereits mit der Produktion aller überlieferten Solokonzerte für Bläser und der Konzerte für verschiedene Instrumentengruppen (Gruppenkonzerte) aus Telemanns Feder deutlich.11 Dank seines Vertrauens auf die Qualität der Werke Telemanns und angetan von dem Gedanken, mit der vollständigen Einspielung eines kirchenmusikalischen Jahrgangs mit dazu beitragen zu können, den für Telemanns Schaffen bedeutsamen Werkbereich der Kirchenmusik besser zugänglich und bekannt zu machen, ließ er sich schnell von dem ambitionierten Projekt begeistern. Sein Besuch der Proben für die erste CD-Aufnahme bestätigte seinen Entschluss nicht nur hinsichtlich der kompositorischen Vielfalt und des klangfarblichen Abwechslungsreichtums der bisweilen üppig besetzten Werke dieses Jahrgangs, sondern auch im Blick auf die Interpretierenden.
Die Anfangsphase des Projekts wurde ganz wesentlich auch vom Südwestrundfunk (SWR) unterstützt, den eine langjährige Partnerschaft sowohl mit dem Label cpo als auch mit den vielseitigen Aktivitäten von Felix Koch verbindet. So stellte der SWR als Kooperationspartner von 2020 bis 2023 die Aufnahmeräume zur Verfügung und realisierte die Produktion der ersten 40 Kirchenmusiken für 4 Doppel-CDs.12
Geschickt und ganz im pädagogischen Sinne Telemanns hat Felix Koch die künstlerische Realisierung durch die unter seiner Leitung musizierenden Gutenberg Soloists und das Neumeyer Consort für das Telemann Project auch mit einem Exzellenz-Förderprojekt für junge Sängerinnen und Sänger verbunden.13
Im mehrfachen Sinne ist das Telemann Project ein nachhaltiges Vorhaben, dessen Realisierung von vielen Schultern getragen und dessen Finanzierung dank des unermüdlichen Wirkens von Felix Koch von namhaften Förderern begleitet wird.
Wenn ich die Anfänge des Telemann Project zur Gesamteinspielung von Telemanns Französischem Jahrgang ausführlicher vorstelle, so nicht nur, um diese festzuhalten. Vermittelt werden soll auch, dass sich von Beginn an viele Beteiligte mit Begeisterung in das Langzeitprojekt einbringen und ein Netzwerk bilden, das beste Voraussetzungen für einen erfolgreichen Verlauf und Abschluss bietet. Von Magdeburg aus wird das Projekt weiter inhaltlich und auch mit Konzertübernahmen zum Beispiel im Zusammenhang mit den Magdeburger Telemann-Festtagen 2024 begleitet und gefördert.
Es ist ganz im Sinne einer vielseitigen Annährung an diesen Jahrgang und seine Erschließung, ihn im Umfeld der musikpraktischen Auseinandersetzung auch in den Mittelpunkt einer wissenschaftlichen Tagung zu rücken. Nahe liegt, sich den von ihm ausgehenden Fragen der Editionspraxis zuzuwenden und der musikalischen Stilistik sowie der verwendeten kompositorischen Techniken insbesondere vor dem Hintergrund der Namensgebung »Französischer Jahrgang«. Auch die diesen Jahrgang überliefernden Quellen rücken ins Blickfeld und dabei ebenso Überlieferungsaspekte. Natürlich liegt es nahe, auch Telemanns Kontakte nach Frankreich nicht außer Acht zu lassen, seiner Auseinandersetzung mit der französischen Musik nachzuspüren, deren großer Freund er war, und vieles mehr. Wie in der Musik Telemanns selbst gibt es auch hinsichtlich der Person und ihres Einflusses auf das Musikleben im 18. Jahrhundert nach wie vor vieles zu entdecken und zu erforschen – wenn mitunter am Ende auch oft mehr Fragen entstehen als Antworten gefunden werden.
Zu spüren ist mit jeder Tagung, dass die Telemannforschung ein spannendes Arbeitsgebiet mit großem Potential ist. Vor diesem Hintergrund ist es überaus erfreulich, dass sich mit den auch hier Referierenden der Kreis von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern vergrößert, die sich – aus ganz verschiedenen Richtungen kommend – Themen der Telemannforschung zuwenden, und dass zu diesem Kreis sehr viele junge Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler gehören. Schon zu Beginn der Tagung lässt sich das als ein großer Gewinn festhalten. Dass bei diesem Tagungsthema mit Konzerten mehrfach die Brücke in die Musik- und Aufführungspraxis geschlagen wird, ist ebenfalls nicht hoch genug zu würdigen.
Allen Referierenden im Namen des Zentrums für Telemann-Pflege und -Forschung und auch im Namen des Präsidenten der Internationalen Telemann-Gesellschaft e.V., Prof. Siegfried Pank, ein herzliches Dankeschön für ihre Teilnahme und den Künstlerinnen und Künstlern für die Gestaltung der Konzerte.
Mit einem besonderen Dank an die Veranstalter seien der Tagung ein erfolgreicher Verlauf und uns allen neben spannendem Gedankenaustausch viele neue und faszinierende Hörerlebnisse in den Konzerten gewünscht.
Vor dem Telemann Project liegt bis zum erfolgreichen Abschluss noch ein weiter Weg, der von allen Beteiligten einen immensen Einsatz erfordert. Georg Philipp Telemann hat angesichts großer Aufgaben und Herausforderungen in seiner ersten Autobiographie einmal motivierende Verse formuliert, die gut auch zur Realisierung des Telemann Project passen und daher am Abschluss meines Grußes stehen sollen:
»Lust und Fleiß kann Wege finden /Ob sie noch so tieff verschneyt /Und ein kühnes UnterwindenTrotzet der Unmöglichkeit.Zeigen sich gleich grosse Berge?Frisch gewagt! du kommst hinan.Sieh die Schwürigkeit für Zwerge /Dich für einen Riesen an.«14
3 Der »Französische Jahrgang« Georg Philipp Telemanns: Vorwort
Birger Petersen und Stefan Michels
Der Jahrgang für die Sonn- und Festtage, den Georg Philipp Telemann während seiner Frankfurter Zeit als städtischer Musikdirektor und Kapellmeister an der Barfüßerkirche vermutlich bereits in den Jahren 1713 und 1714 komponierte,1 wurde zeitgleich in Frankfurt am Main und in Eisenach aufgeführt. Den Beinamen »Französischer Jahrgang« erhielt die Sammlung nicht zuletzt aufgrund der Adaption der aus Frankreich stammenden Idee der theatralischen, affekthaften Musik – der Hineinnahme des etwa von Jean-Baptiste Lully für die Oper entwickelten Stils in die lutherische Kirchenmusik. Ihr auffälligstes Merkmal ist die Vielfalt vor allem an Sätzen vom schlichten Kantionalsatz über die unterschiedlichsten komplexen Wechsel von Solo- und Tuttisätzen bis hin zu einer überdurchschnittlich hohen Anzahl von Chorälen.2
Mit seinen 72 Teilwerken nimmt der »Französische Jahrgang« hinsichtlich der Vollständigkeit, der Besetzungsvielfalt und des Formenreichtums eine Sonderstellung ein. Das Telemann Project des Collegium musicum der Johannes Gutenberg-Universität Mainz und des Forum Alte Musik Frankfurt am Main unter der Leitung von Felix Koch widmet sich seit 2021 auf drei Realisierungsebenen der weltweit ersten Gesamteinspielung dieses Jahrgangs von Telemann – in Kooperation mit dem Verlag Canberra Baroque, dem Klassik-Label cpo, der Telemann-Gesellschaft Frankfurt, dem Zentrum für Telemann-Pflege und -Forschung Magdeburg und der Hochschule für Musik Mainz: Die Werke werden im Telemann Project editorisch aufbereitet und als Aufführungsmaterial allgemein zugänglich gemacht, in Konzerten aufgeführt und in einer Ersteinspielung dokumentiert.
Die Tagung, die am 31. Oktober und 1. November 2022 an der Johannes Gutenberg-Universität Mainz stattgefunden hat und von zwei Konzerten – eines mit Gottesdienstmusiken von Telemann in Nieder-Saulheim, eines in der Hochschule für Musik Mainz mit von Telemann inspirierten Neukompositionen – flankiert wurde, gehört zu denjenigen Maßnahmen, die das großangelegte Projekt begleiten, bereichern und unterfüttern. Beigesteuert hat die Tagung vor allem drei wissenschaftliche Perspektiven, die in dem vorliegenden Band dokumentiert sind: Kontext – Edition – Kompositionstechnik.
3.1 Kontext. Telemann in Frankfurt
Die Texte des »Französischen Jahrgangs« verfasste Erdmann Neumeister und publizierte sie unter dem Titel Geistliche Poesien, mit untermischten Biblischen Sprüchen und Choralen vor Beginn des Kirchenjahrs 1714/15. Erdmann Neumeister war Telemanns erklärter Lieblingsdichter: 1714 lobte er ihn in einem Brief als den »beste[n] Dichter in geistlichen Sachen«. Telemanns Lob der Poesie Neumeisters beruhte vermutlich auf Kenntnis der Texte aus allen sechs Kirchenmusik-Jahrgängen des Dichters, die bis zu diesem Zeitpunkt entstanden waren.3 Neumeister konzipierte insbesondere große Rondeau-Komplexe, aus Bibelversen – bevorzugt aus Psalmen – oder Zeilen einer Liedstrophe. Obwohl zunächst für Frankfurt vorgesehen, komponierte Telemann den »Französischen Jahrgang« für den herzoglichen Hof in Eisenach, von dem er auch die Honorierung Neumeisters einforderte: Vermutlich war der Auftrag des Eisenacher Hofes recht kurzfristig erfolgt. Sowohl die Anlage der Texte, die sich durch Verzahnung kurzer Textglieder bzw. Verse auszeichnet, als auch die Kenntnis, dass die Eisenacher Hofkapelle »nach frantzösischer Art eingerichtet war« und den französischen Stil pflegte, sprachen für eine Vertonung unter Verwendung französischer Stilelemente.
Der »Französische Jahrgang« wurde zu Lebzeiten Telemanns – vor allem von den Amtsnachfolgern Telemanns – bis in das späte 18. Jahrhundert hinein rezipiert und gehört so den wirkmächtigsten Zyklen seiner Zeit: um so erstaunlicher, dass er bis heute nur begrenzt wahrgenommen wurde. Der erste Teil des Bands fragt nach dem Kontext des »Französischen Jahrgangs«: nach der Textvorlage Neumeisters, seiner liturgischen Funktion im protestantischen Gottesdienst des frühen 18. Jahrhunderts, der zyklischen Gestalt eines solchen Jahrgangs und seiner Rezeption.
Der einleitende Beitrag von Stefan Michels nimmt die Textvorlagen Erdmann Neumeisters in den Blick, während Marc-Roderich Pfau seine Forschungen zur Datierung des »Französischen Jahrgangs« präsentiert sowie Klaus Pietschmann die kurmainzer Szene im zeitlichen Umfeld der Kaiserkrönung Karls VI. Um implizite Fragestellungen des Repertoires geht es in den Beiträgen von Daniela Philippi und Gabriela Krombach.
3.2 Edition. Das Verhältnis zur musikalischen Praxis
In der Frankfurter Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg befindet sich eine der weltweit bedeutendsten Sammlungen geistlicher Musik des 18. Jahrhunderts mit über 1.500 Manuskripten. Dabei machen Musikhandschriften mit Werken von Georg Philipp Telemann den größten Anteil aus: Sie umfassen nahezu 830 Quellen, wobei eine einzelne Komposition häufig in mehreren Quellen überliefert ist. Einen beachtlichen Teil der hier gesammelten Werke hat Telemann während seiner Frankfurter Wirkungsjahre geschaffen, so auch den »Französischen Jahrgang«. Von der Hand Telemanns sind allerdings vor allem Stimmenmaterialien erhalten; alle weiteren Materialien stammen von Telemanns Frankfurter Amtsnachfolgern Johann Christoph Bodinus, Johann Balthasar König und Johann Christoph Fischer.
Die Musikwissenschaft wurde erst spät auf Telemann aufmerksam, und anders als bei vielen anderen seiner Zeitgenossen liegt nach wie vor keine wissenschaftliche Gesamtausgabe seines Œuvres vor – auch der Vielfalt und der schieren Menge der Kompositionen geschuldet. Die vom Zentrum für Telemann-Pflege und -Forschung Magdeburg und vom Institut für Musikwissenschaft der Universität Halle-Wittenberg verantwortete Auswahlausgabe der Musikalischen Werke Telemanns hatte die Aufgabe, der Unüberschaubarkeit des Telemannschen Schaffens – bedingt durch dessen Fülle und Vielseitigkeit – entgegenzutreten; das ursprünglich an der Mainzer Akademie der Wissenschaften und der Literatur angesiedelte Projekt wurde aber nur bis 2010 über das Akademienprogramm finanziert. Bis 2010 sind 50 Bände mit Kritischen Berichten sowie drei Supplement-Bände erschienen; seitdem wird die im Bärenreiter-Verlag Kassel publizierte Reihe nun als Kooperationsprojekt der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg und der Landeshauptstadt Magdeburg geführt und aus Mitteln des Ministeriums für Wissenschaft und Wirtschaft des Landes Sachsen-Anhalt gefördert.
Die Telemann-Auswahlausgabe als wissenschaftlich-kritische Ausgabe berücksichtigt zugleich Anforderungen der musikalischen Praxis, will aber vor allem eine »repräsentative Auswahl aus einzelnen Gattungen und Schaffensperioden des Komponisten bieten«. Die Editionsprinzipien der Auswahlausgabe sind an den gültigen Standards einer wissenschaftlichen Edition ausgerichtet. Der edierte Notentext soll den Intentionen des Komponisten möglichst nahekommen und »sowohl für die wissenschaftliche Beschäftigung mit der Musik Telemanns wie auch für deren stilgerechte Interpretation« eine verlässliche Grundlage bieten.4 Notationseigenarten der Zeit, wie etwa die Partiturordnung, aber auch für Telemann charakteristische Besonderheiten wie die Verwendung deutschsprachiger Bezeichnungen sind konsequent beibehalten worden.
Entsprechend ist eine zweite Perspektive der Gegenüberstellung editorischer Ansätze gewidmet; hier sollen aber auch die Probleme speziell in der Edition des »Französischen Jahrgangs« verhandelt werden – zumal inzwischen ein Dutzend kritische Editionen von Frankfurter Gottesdienstmusiken Telemanns als Abschlussarbeiten von Absolvent:innen der Hochschule für Musik an der Johannes Gutenberg-Universität Mainz entstanden sind, die im Rahmen der Sektion auch präsentiert worden sind. Sowohl der Leiter der Telemann Auswahl-Ausgabe Wolfgang Hirschmann als auch Ute Poetzsch als Mitarbeiterin dieser Ausgabe, die für den bislang einzigen Band mit Werken aus dem »Französischen Jahrgang« verantwortlich zeichnet, nehmen Stellung zu spezifischen Problemen der Edition von Telemanns Frankfurter Gottesdienstmusiken. Stefanie Acquavella-Rauch zeigt in ihrem Diskussionsbeitrag Aspekte der digitalen Musikedition auf, und Ann Kersting-Meuleman äußert sich zu Quellenproblemen exemplarisch bei drei Gottesdienstmusiken zum 4. bis 6. Sonntag nach Trinitatis.
Die mit dem Telemann Project verbundene Edition des australischen Musikverlags Canberra Baroque transkribiert die Kompositionen des »Französischen Jahrgangs« aus den handschriftlichen Quellen und veröffentlicht diese über Canberra Baroque als praktische Editionen in modernem Notensatz und allgemein zum freien Download. Leider konnte der Beitrag des Gründers von Canberra Baroque Peter Young nicht in diesem Rahmen publiziert werden.
3.3 Kompositionstechnik. Inszenierungen bei Telemann
Georg Philipp Telemann publizierte eine Reihe pädagogischer Sammelwerke wie Den getreuen Music-Meister, die Methodischen Sonaten, zwei Menuett-Sammlungen, XX kleine Fugen und die Singe-, Spiel- und Generalbaßübungen; im Vorwort zu den XX kleine(n) Fugen spricht Telemann von einem »abgezielten Zweck« seiner methodischen Werke, nämlich »den Lernenden ein Muster an die Hand zu geben«.5 Bezieht sich dieser Satz zwar direkt auf die kleinen Fugen, so liegt es doch nahe, ihn auf andere Werke Telemanns zu übertragen: So geht aus der Ankündigung der Singe-, Spiel- und Generalbassübungen in der Zeitung Hamburger Presse eindeutig hervor, was Telemann mit der Publikation dieses Werkes bezwecken wollte: Ihm zufolge handelt es sich dabei um eine »musikalische Darreichung für Jedermann zum Singen ebenso wie zum Spielen auf dem Clavier«, gleichwohl aber auch um eine Generalbass-Schule.6
Die Kombination ihrer Merkmale machen Telemanns Kompositionen zu didaktisch wertvollem Anschauungsmaterial für die Musik des 18. Jahrhunderts. So sind seine Choräle als Vorbilder für Stilkopien hinsichtlich ihrer geringen Komplexität eine für den Pflichtfachbereich gut zu bewältigende Aufgabe: Telemann verwendet einen schlichten Generalbasssatz, der ähnlich auch bei Bach zumindest zeilenweise Anwendung findet. Das Ergebnis ist die Kombination aus einer – aufgrund des weitgehenden Fehlens von Durchgängen und Chromatik – an den Kantionalsatz erinnernden Satzstruktur und der einfachen Generalbassharmonik des frühen 18. Jahrhunderts. Telemann spricht in seinem Unterricht selber davon, dass die »Harmonie theils nach der alten, theils nach der neuen Ahrt«7 gestaltet sei: Seine Werke repräsentieren vielfach eine für die erste Hälfte des 18. Jahrhunderts typische, aber überschaubare Harmonik.
In diesem Sinn widmen sich mehrere Beiträge sowohl den in den Sätzen des »Französischen Jahrgangs« wiederzufindenden musikalischen Formen und ihrer Analyse als auch ihrer Anwendbarkeit im Unterricht in der historischen Satzlehre – als Plädoyer für die kreativ-didaktische Nutzung von historischen Quellen. Dieser Ansatz kann dabei für sich stehen, aber auch eine Vorbereitung für die analytische und kompositorische Beschäftigung mit komplexen Kompositionsansätzen des 18. Jahrhunderts sein.
Die Beiträge von Immanuel Ott und Birger Petersen prüfen den Zusammenhang zwischen dem Frankfurter Komponieren Telemanns und der zeitgenössischen Kompositionslehre. In eine vergleichbare Richtung geht Benjamin Lang, der sich allerdings zeitgenössischen Kompositionen aus Mainz und Rostock, deren Umgang mit den Vorlagen Telemanns und deren Wert für die Didaktik der Musiktheorie widmet. Der Beitrag stand in unmittelbarem Zusammenhang mit einem der beiden Konzerte, die mit dieser Tagung verbunden waren, während Jan Philipp Sprick sich mit den Choralsätzen Telemanns und damit mit einem nicht nur nominell sehr umfangreichen Repertoire widmete und Derek Remes Telemanns Singe-, Spiel- und General-Baß-Übungen und die Frage der Nutzbarmachung von Telemanns Übungen in der Musiktheorie-Lehre der Gegenwart in den Mittelpunkt der Betrachtung nahm.
In ihrer verdienstvollen Dissertation zu den Frankfurter Jahrgängen Georg Philipp Telemanns stellt Christiane Jungius heraus:
»Die vollständige Edition der Werke ist wünschenswert. Die hierzu erforderlichen Vorarbeiten, zum Beispiel die Differenzierung der in Frankfurt erhaltenen Abschriften in bezug [sic] auf ihre Chronologie, stehen jedoch noch weitgehend aus. Auch die Zugehörigkeit der Kantaten zu einem Jahrgang […] erfordert weitere Korrekturen und Ergänzungen. Kritisch zu betrachten ist darüber hinaus die Datierung der Kantatenjahrgänge sowie einzelner Kantaten. […] Voraussetzung für das Erkennen jahrgangsbezogener kompositorischer Merkmale ist das Verständnis für die hiervon zu differenzierenden, durch den zu vertonenden Text bedingten Merkmale.«8
Dieser Auftrag gilt auch für diesen Band, deren Autor:innen dem »Französischen Jahrgang« Georg Philipp Telemanns etwas näher kommen wollen. Er steht programmatisch am Beginn der Reihe »Musik und Theologie« im Kohlhammer Verlag.
Danken möchten wir an dieser Stelle im Namen der Johannes Gutenberg-Universität Mainz insbesondere den Mitarbeiter:innen vom Collegium Musicum, namentlich vor allem Felix Koch, Frank Wittmer und Astrid Hübner für ihre unermüdliche Unterstützung, ebenso aber auch den Kolleg:innen von der Hochschule für Musik Mainz und vom Institut für Kunstgeschichte und Musikwissenschaft der Johannes Gutenberg-Universität Mainz, außerdem für ihre Unterstützung der Arbeitsgemeinschaft Musikgeschichte am Mittelrhein e.V., dem Zentrum für Telemann-Pflege und -Forschung Magdeburg und seinem Leiter Carsten Lange, der Frankfurter Telemann-Gesellschaft e.V. und dem Forum Alte Musik Frankfurt am Main.
4 Die ›Kantate‹ als theologischer Text1Anmerkungen zur theologiegeschichtlichen Dignität der sogenannten ›Neumeister-Kantate‹
Stefan Michels
»Zugleich war die Kantate eine Gattung, die vor der Ausbildung des öffentlichen Konzerts wie keine andere Musik einem weiten Hörerkreis zugänglich war. Sie war zwar in die Liturgie integriert, ohne jedoch ganz in ihr aufzugehen […]. Zu ihrem Ansehen gehörte auch, daß sie kein bloß musikalisches, sondern ebenso ein poetisches Genus war.«2
Zu dieser von der Telemann-Expertin Christiane Jungius angeführten Reihung an Bedeutungsebenen dessen, was mit dem innerhalb der musikologischen Forschung nicht unumstrittenen Gattungsbegriffs der ›Kantate‹ umschrieben ist, ließe sich gut und gerne noch Weiteres anführen; insbesondere die theologische Ebene der ›Kantate‹ als figural gestaltete Gottesdienstmusik. Dass dies so ist, liegt sicher weniger daran, dass die theologische Ebene schlicht vergessen wurde als vielmehr darin begründet, dass es an theologiegeschichtlichen Untersuchungen zur Gattung ›Kantate‹ weithin mangelt.3 Besonders deutlich fällt dieser Mangel innerhalb der kirchenhistorischen Zunft ins Auge. Ob nun die anhaltende musikwissenschaftliche Gattungsdebatte4 den Ausschlag für das Umgehen einer der zentralen geistlichen Musikgattungen des ausgehenden 17. und beginnenden 18. Jahrhunderts ist, mag dahingestellt bleiben. Die theologisch-theologiegeschichtliche Deutungsmöglichkeit von derartigen Gottesdienstmusiken liegt dabei auf der Hand. Zum einen sind figurale Gottesdienstmusiken Spiegel der Frömmigkeits- und Liturgiegeschichte, denn an ihrer Text- und Ausdrucksgestalt zeigt sich das Frömmigkeitsprofil nicht allein des Verfassers eines Kantatentexts, sondern auch breitere, gesellschaftlich tiefgreifendere Frömmigkeitstendenzen, da Kantatentexte nicht selten auch gesellschaftskritische Tendenzen aufnehmen5 und somit eine Blaupause bilden, die »den kulturellen Wandel im sozialen Raum sinnlich erfahrbar« machen »als Transformationen einer soziokulturellen Praxis«.6 Als solche Erfahrbar- und Erlebbarmachung religiöser Ortungsvollzüge durch Musik und Poesie bilden die Gottesdienstmusiken des 17. und 18. Jahrhunderts einen zentralen Bezugspunkt für frömmigkeitsgeschichtliche und kirchenhistorische Erkundungsgänge zu zentralen Fragen religiöser Praxis in der kulturgeschichtlich dynamischen Zeit um 1700.7 Die Transformationsdynamik jener Jahrhundertschwelle bildete sich auf vielen Ebenen des gesellschaftlichen Lebens ab, was auch Formen des religiösen Lebens in konfessionell deutlich konturierten Denominationen betraf. Sowohl das theologische Nachdenken über komplexe Konstellationen der spürbaren Transitionsdynamik um 1700 als auch die konkrete Frömmigkeitspraxis hatten sich diesen polyvalenten Herausforderungen zu stellen. Das Ergebnis war eine breite Binnendifferenzierung innerhalb der etablierten Konfessionen, allen voran des Luthertums. Seit Ende des 17. Jahrhunderts sah es sich mit Abgrenzungsbewegungen im inneren des eigenen Konfessionsgefüges konfrontiert, die schließlich eine polymorphe Ausbildung verschiedentlicher Frömmigkeitsströmungen und theologischer Ansätze mit sich brachte. Die Differenzierung von ›Pietismus‹ und ›lutherischer Orthodoxie‹ ist für den Kontext der Entstehung der ›Kantate‹ als Gattung gottesdienstlicher Musik von erheblicher und einschlägiger Bedeutung. Gerade mit Blick auf das poetische Schaffen des dichtenden Pfarrers und Superintendenten Erdmann Neumeister (1671–1756),8 dem Georg Philipp Telemann und mit ihm andere bedeutende Musikschaffende der Zeit um 1700 viele Texte zu ihren Gottesdienstmusiken zu verdanken haben,9 ist der Sog der Binnendifferenzierung innerhalb des Luthertums ein möglicher Weg zur Herleitung dieser poetisch-musikalischen Gattung und eine Erklärung ihrer fortan intensiven gottesdienstlichen Nutzung bis zur (Selbst-)Marginalisierung der ›Kantate‹ im Zusammenhang mit der späteren Aufklärung.10 Mit dem Ende, oder besser: der intellektuellen, aber auch politisch gewollten Einhegung binnenkonfessioneller Grabenkämpfe ab der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts verliert auch die Gattung der ›Kantate‹ in ihrer Rolle als indirekte transkonfessionelle Polemik, aber auch als Richtungsweiser eines gelingenden christlich-moralischen Lebens11 sowie im liturgischen Kontext an Bedeutung. Der Wandel des evangelischen Gottesdienstes im Zuge der breiten Unionsbemühungen zwischen Calvinisten und Lutheranern tat sein Übriges.12
Über die engeren frömmigkeits- und liturgiegeschichtlichen Kontexte hinaus bieten Gottesdienstmusiken um 1700 auch weitreichende Einblicke in Funktionen der Bewahrung, Tradierung und Überformung bestehender theologiegeschichtlicher Überlieferungsstränge in konzentrierter poetischer und musikalischer Form. Die Breite des semiotischen Deutungspotenzials barockzeitlicher poetischer Texte13 und Musik liegt für andere Komponisten dieser Zeit, allen voran Johann Sebastian Bach, auf vielen Ebenen offen vor Augen und ist bereits häufig Gegenstand von forschenden Erkundungen geworden.14 Selbiges wird für das umfassende geistliche Werk Georg Philipp Telemanns (1681–1767) zu gelten haben, wenngleich das theologische Nachdenken zum Schaffen des Meisters noch in seinen Anfängen steckt15 und, sobald es explizit Gegenstand wird, immer wieder von Denkmustern durchdrungen ist, die der Forschung an der Musik Johann Sebastian Bachs entspringen.16 Die fehlende methodische und hermeneutische Trittsicherheit im theologischen Umgang mit dem geistlichen Vokalwerk Georg Philipp Telemanns mag auch darin begründet liegen, dass die Forschung zu seinen Textvorlagen, insbesondere zu den Texten Erdmann Neumeisters aus kirchenhistorischer Sicht erhebliche Lücken aufweist. Es ist vor allem einer an Neumeisters Galanterie interessierten literaturwissenschaftlichen Forschung zu verdanken, dass der spätere bedeutsame Hamburger Hauptpastor weiterhin im Fokus der Aufmerksamkeit bleibt.17 Den Poeten und Literaten Neumeister kann die Forschung im Gefolge der ersten literaturhistorischen Bemühungen des Heidelberger Germanisten Max’ von Waldberg (1858–1938)18 umfassend beschreiben, da auch die Forschung zur Galanterie als Stilblüte zwischen 1680 und 1730 weit fortgeschritten ist. Anders ist es hinsichtlich kirchenhistorisch-theologiegeschichtlicher Klarheit zur Geschichte des Luthertums und seiner Binnendifferenzierung um und nach 1700. Die fehlende mitunter auch terminologische Klarheit sowie die Auflösung lutherischer Binnenstrukturen in einen schwer greifbaren, weil immer stärker fluiden Begriffs ›Luthertum‹ sorgt, so lässt sich vermuten, auch für Schwierigkeiten im Umgang mit dem poetischen Werk Erdmann Neumeisters. Die zentralen Fragen und Forschungsprobleme, die der geistliche Dichter Neumeister aufwirft, werden in vereinzelten theologischen Fachbeiträgen von Fragen zu Neumeisters konfessioneller Polemik19 oder seinen auch rechtlich-juristischen Bemühungen in der Bekämpfung des Pietismus20 flankiert. Alternativ wurden die kirchenhistorisch wesentlichen Rückfragen nach der geistesgeschichtlichen Verortung Neumeisters als Anschauungsbeispiel einer ganzen Epochendynamik in allgemeinere biographische Betrachtungen verflüchtigt.21 Der gezielte theologie- und kirchenhistorische Zugriff auf die Person, das Denken wie das Schreiben und Dichten des Hamburger Pastors vor dem Hintergrund der umfassenden konstellativ-kontextuellen Dynamik der Zeit um und nach 1700 ist bisher ausgeblieben. Dabei sind die konstellativen Ermöglichungsräume einer theologischen Karriere, wie jener Neumeisters, um 1700 aufschlussreich und verweisen auf die Notwendigkeit einer präziseren auch terminologischen Bestimmung des ›Luthertums‹ der frühen Neuzeit im Gegensatz zu einer weitgehenden, meist ideengeschichtlich abgeleiteten Relativierung und Verflüchtigung theologischer Beschreibungskriterien dessen, was als ›pietistisch‹ oder eben auch ›lutherisch orthodox‹ gelten kann. Die ›lutherische Orthodoxie‹ etwa ist dann weniger ein ›historisches‹ als vielmehr historiographisches ›Problem‹ der kirchenhistorischen Forschung, wenn sie, ihren wesentlichen Grundanliegen entgegen, als ideengeschichtliches Phänomen begriffen wird.22 Im Konzert der interdisziplinären Forschung zu Phänomenen wie der geistlichen Dichtung Neumeisters, dessen Texte Grundlage vieler Gottesdienstmusiken, vor allem Telemanns, wurden, sorgt eine erweiterte Begriffs-Fluidität der Binnendifferenzierung des Luthertums um 1700 für Unklarheiten, die letzten Endes zu fragwürdigen Zuschreibungen führen, wie jenen Dieterich Buxtehudes oder Telemanns zum Pietismus.23 Der erheblichen theologischen Kommunikationsvielfalt des Luthertums um 1700 ist hier mit der nötigen terminologischen Klarheit zu begegnen, die erst das Bergen dieses kirchenhistorischen Schatzes möglich macht und somit zu inhaltlich wie methodisch zufriedenstellenden Lösungen führt.
Für die Frage nach der theologischen Dignität der als ›Kantate‹ firmierenden lutherischen figuralen Gottesdienstmusiken um und nach 1700 spielt das poetologische und poetische Werk Erdmann Neumeisters eine führende Rolle. In Neumeisters bemerkenswert breitem literarischen und theologischen, homiletischen und poimenischen, polemischen und erbaulichen Schaffen spiegeln sich innerlutherische Verortungsbemühungen einer gesamten Epoche zwischen lutherischer Orthodoxie, dem aufkommenden Pietismus, dem Neumeister während seiner Leipziger Studienjahre erstmals, als Superintendent in Sorau in intensivierter Form begegnete, sowie der frühen Aufklärung, die Neumeister vor allem in Hamburg beschäftigen sollte, in erstaunlich konzentrierter Weise. Neumeister ließ es sich nicht nehmen, seine polemischen Geschütze auf alle Tendenzen zu richten, die der Bewahrung eines lehrreinen Luthertums im Sinne des Wittenberger Reformators entgegenliefen, worunter neben Pietismus und Aufklärung vor allem unionstheologische Bemühungen seiner Zeitgenossen in der theologischen Vermittlung von Luthertum und Calvinismus zu zählen sind.24
Seine Kämpfe führte der Hamburger Pastor erbittert und in bleibender Sorge um das Seelenheil seiner ihm anvertrauten Gemeinde. In gleich mehreren Ausführungen kommt Neumeister auf seine Amtspflichten zu sprechen, die er sehr gewissenhaft nahm. Die Fundamente seiner geistlichen Grundhaltung als Vertreter einer lutherischen Gelehrsamkeit wie Seelsorge formuliert er bereits 1704 in seinem Amtseid als Diakon am Hof zu Weißenfels, zu dem er bereits vorher in Kontakt stand, wie die Zueignung und Übermittlung seiner Geistlichen Cantaten25 an den Weißenfelser Hof und in die Hände Johann Philipp Kriegers (1649–1725)26 nahelegt.27 In seinem Amtseid verweist der junge Hofdiakon Neumeister auf seine wesentlichen Pflichten, zugleich Ausdruck seiner geistlichen Haltung mit Blick auf das Amt, das er auszuüben hat:
»Ich, der Magister Erdmann Neumeister, Pastor und Adjunkt zu Bibra, zum Hof-Diaconus berufen, mit der Konkordienformel rechtschaffen vertraut, hinreichend ermahnt, der Wahrheit gewiß, von keinem Zweifel angekränkelt, von keinem als dem klaren Verständnis [der Heiligen Schrift, der Verf.] erfüllt, das die Worte hergeben, nicht verstrickt in vorgefaßte oder verborgene Meinungen, habe die Unterschrift frei geleistet, aufrichtig, ohne einen Vorbehalt im Sinn zu haben, und habe zugleich Frömmigkeit gegen Gott, Ehrerbietung und Gehorsam gegen meine Oberen, Sorgfalt im Gebet, Strebsamkeit in den Studien, Treue in der Amtsführung, Wachsamkeit, Fleiß, Redlichkeit im Leben, Einigkeit mit meinen Kollegen und meinen Hörern feierlich versprochen. Am 25. April 1704.«28
Ausgehend von einem reformatorischen Bekenntnistext, der Formula concordiae von 1577, bekennt sich Neumeister als junger Geistlicher zur Tradition des Luthertums – auch hinsichtlich seines Schriftverständnisses. Die Konkordienformel, die den Weg der lutherischen Bekenntnisbildung als Ergebnis eines Jahrzehnte andauernden Ringens um Klarheit in der Lehre innerhalb des sich bereits unmittelbar nach Luthers Tod zu differenzieren beginnenden Luthertums verbindlich abschloss, bildete und bildet die Grundlage der lutherischen Konfessionsfamilien. Gerade weil der sich in den Abschnitten der Formula Concordiae auffindbaren religiösen und theologischen Kontroversen abbildende Prozess der Bekenntnisbildung die ganze Bandbreite lutherischer Theologie in der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts dokumentiert, eignet sich die Formula Concordiae in herausragender Weise als Bekenntnistext, dessen Kenntnis für die Ausübung des geistlichen Amts unabdingbar war. In den wesentlichen Lehrpunkten konnte – auch auf Drängen und Vermittlung der Obrigkeiten29 – ein Konsens erzielt werden, der, zumindest auf dem Papier, langlebig war.
Neumeister war die theologische Traditionslinie, in der er stand, offenbar sehr bewusst – und er bildet die Linie der ›Erben Luthers‹30 in hervorstechender Weise mit Eifer und Fleiß ab, wie er in seinem oben zitierten Amtseid bekennt und an vielen Stellen seines umfangreichen theologischen Werks abbildet. Erdmann Neumeister erweist sich auf der Grundlage seiner theologischen und kirchenamtlichen Äußerungen und Handlungsweisen als einer der prominenteren Vertreter der um 1700 profilierten und aktiven lutherischen Orthodoxie. Die Formierung einer deutlich sichtbaren und messbaren Binnendifferenzierung des Luthertums jenseits ideengeschichtlicher Konstrukte zeitgenössischer Forschung und daraus folgenden, eher projizierenden als quellenbasierten Annahmen einer sich ins Grenzenlose verflüchtigenden Formation ›Luthertum‹ um 1700 lässt sich insbesondere an den innerlutherischen Auseinandersetzungen jener Tage darlegen,31 an denen Neumeister auf allen Ebenen eine Beteiligung geradezu suchte. Im Streit sowohl mit Vertretern einer pietistischen Lesart des theologischen Erbes der Reformation als auch mit Unionstheologen, katholischen Theologen und geistesgeschichtlich schwer zuzuordnenden Denkern, wie Johann Conrad Dippel (1673–1734),32 entwickelt Neumeister das Profil lutherisch-orthodoxer Theologie im Modus der Auseinandersetzung immer weiter. Der Pastor Neumeister wusste um die Bedeutsamkeit dieser Kämpfe im Bemühen um die Bewahrung eines lehrreinen Luthertums angesichts der breiten konfessionellen Ausdifferenzierung seiner Zeit.
Erdmann Neumeister war aber aufgrund seiner professionsbezogenen Orientierung nicht allein lutherischer Geistlicher, sondern, insbesondere mit Blick auf die Frühzeit seines öffentlichen Schaffens auch ein Poet, der sich im Spiegel seines Frühwerks einer anderen, ebenfalls umfassenden, allerdings literarischen Reformbewegung zwischen 1680 und 1730, der Galanterie, zuordnen lässt – ohne völlig im ›galanten‹ Stil aufzugehen.33 Der spätere geistliche Würdenträger Neumeister legte seine galant-poetische Vergangenheit je länger je mehr ab,34 ohne dabei aber die Bedeutung der Poesie und der gebundenen Rede für eine rechtgläubige Erbauung der ihm anvertrauten Gemeinden jemals unterschätzt zu haben. Vielmehr lässt sich Entstehung des sogenannten ›Neumeister-Kantaten-Typs‹ mit den vielfältigen Verschiebungen und Verwerfungen innerhalb des Luthertums um 1700 in Verbindung bringen. Im Sog einer derart stark spürbaren Veränderungsdynamik ging es lutherisch-orthodoxen Erbauungsschriftstellern im Kern darum, eine rechtgläubige Alternative zum Angebot pietistischer erbaulicher Texte zu bieten. Und im doppelten Sog von religiös-konfessioneller wie literarischer Anpassungen und Erweiterungen um 1700 wirkt Erdmann Neumeister mit dem Abfassen von Texten für eine in weiten Teilen neuartige Gattung geistlicher Texte und einer neuen Generation an gottesdienstlicher Musik, deren theologiegeschichtliche Würdigung in vertiefter Form bisher aussteht. Zur Frage der theologiegeschichtlichen Wertung des sog. ›Neumeister-Typs‹ an Gottesdienstmusiken ist es wichtig, nicht allein das poetische, sondern auch musikalische Umfeld des Dichterpfarrers auszuleuchten, um Funktion, Verwendung und Typisierung der ›Neumeister-Kantate‹ vornehmen zu können.
Erdmann Neumeister hat jene Form der Gottesdienstmusik, die er so eifrig pflegte und auch immer wieder variierte, nicht erfunden, wie die jüngere musik- und literaturhistorische Forschung eindrucksvoll zeigt.35 Die Vielfalt innerhalb der unscharfen Gattungsgrenze ›Gottesdienstmusik‹, ›Kantate‹ oder auch ›Kirchenkonzert‹ – alle diese Zuschreibungen bringen immer wieder erneute Typisierungs-Probleme mit sich – ist in der Zeit des Auftretens der erwähnten ›Galanterie‹ in Deutschland zwischen 1680 und 1730 immens, sodass es schlicht nicht möglich ist, einen einheitlichen Gattungsbegriff herzuleiten und diese Musiken entsprechend zu systematisieren.36 Jedes Bemühen um eine systematisch strukturierende Erfassung dieser komplexen poetischen Texte ist schon allein dadurch erschwert, dass auch die Dichter – mit Sicherheit von der ›Freiheit‹ der ihnen geschenkten Möglichkeiten in Stylo Recitativo





























