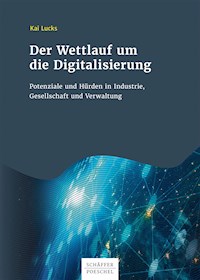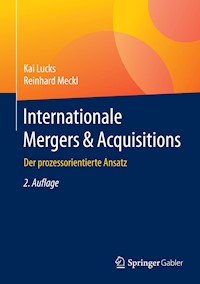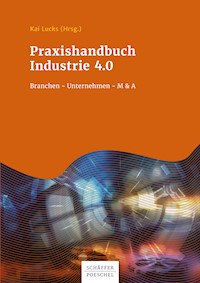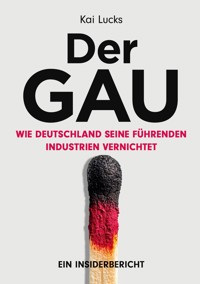
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Multimedia Industrieverlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Warum dieses Buch? Managementliteratur und die Wirtschaftsgeschichte beschäftigen sich fast ausschließlich mit unternehmerischen Erfolgen und Erfolgsrezepten. Über Misserfolge wird eher selten geschrieben. Das hat juristische Hintergründe, denn solche Berichte schlagen sich unmittelbar in Börsenkursverlusten nieder. Dafür würde das Management zur Verantwortung gezogen. Systematische wissenschaftliche Beiträge über fatale Unternehmensentwicklungen sind bislang seltene Ausnahmen. Da es meist an Insiderwissen fehlt, basieren diese auf Presse-Verlautbarungen und Statistiken. Im Ergebnis werden Fehlentwicklungen zumeist mit Managementfehlern begründet. Dieser Schluss ist zu einfach. Tatsächlich gehen Fehlentwicklungen zumeist auf zahlreiche Faktoren und eine Vielzahl von Beteiligten innerhalb und außerhalb des jeweiligen Unternehmens zurück. Das hier vorgestellte Buch füllt eine Lücke in der Wirtschaftsliteratur, indem es sich speziell mit dem Niedergang großer Unternehmungen und dem Verlust ganzer Branchen widmet, und dabei die vielfältigen Verstrickungen aufdeckt. Fokus und Relevanz Der Insiderbericht eines Mannes, der über 50 Jahre unmittelbar an den Hebeln der Großindustrie tätig war. Berichtet wird, wie Deutschland weltweite Führungspositionen verspielte. Das komplizierte Netzwerk von Tätern und Verantwortlichen sowie die Prozesse der Vernichtung wird dokumentiert. Das Buch hat höchste Relevanz in der aktuellen Diskussion über Wachstumsprobleme, Fehlentwicklungen, Fehlverhalten von Politikern und Vorständen sowie nachteilige Rahmenbedingungen der deutschen Wirtschaft. Der Autor geht in Details und belässt es nicht bei einseitigen Schuldzuweisungen. Wir können aus der Vergangenheit lernen und dadurch unsere Zukunft besser gestalten. Branchenbeispiele u.a.: Flugzeug- und Raketenbau, Bankensektor, Chemie und Pharma, Fotoindustrie, Elektroindustrie, Energiewirtschaft, Bahntechnik, Kommunikationsindustrie. Computersysteme, Mikroelektronik, Stahlbranche, Konsumelektrik und -Elektronik, Lampenindustrie, Maschinen- und Anlagenbau.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 458
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
1. Zu diesem Buch
1.1 Nicht nur in Deutschland
1.2 Das große Versagen der Denkmodelle
1.3 Untergänge in der Industrie
1.4 Forschungsintensive Branchen fallen zurück
2. Unternehmenswerte
2.1 Top-down oder Bottom-up?
2.2 Einladungen zur Zerlegung
2.3 Die Guten und die Bösen
2.4 Der Unternehmer ist nicht immer schuld
3. Wie die Welt aus den Angeln gerät
3.1 Risiko-Kategorien
3.2 Klimakrise trifft auf verwundbare Bevölkerung
3.3 Kriege
3.4 Finanz- und Wirtschaftskrisen
4. Bankensektor – Rückgrat der Wirtschaft
4.1 Grundfunktionen der Banken
4.2 Der Kriminalfall Wirecard
4.3 Die Deutsche Bank übernimmt
4.4 UniCredit kommt ins Spiel
4.5 Zusammenfassende Wertung
5. Verluste wissensbasierter Industrien
5.1 Rocket Science – ist Krieg der Vater aller Dinge?
5.2 Aufstieg und Fall der „Apotheke der Welt“
5.3 Abwanderung der Fotoindustrie
5.4 Kernkraft-Aufstieg und Fall
5.5 Wie die Politik den Transrapid ausschaltete
6. Konzerne im Untergang
6.1 Das Aus der Kommunikationsindustrie
6.2 Abschied von deutschen Computersystemen
6.3 Auf- und Niedergang von ThyssenKrupp
6.4 Aufstieg und Fall der AEG
6.5 Wie bei Osram das Licht ausging
6.6 Wie Monsanto Bayer in die Knie zwang
6.7 Wie Vodafone die Mannesmann AG zerschlug
7. M&A bei Krise und Insolvenz
7.1 Wissensbasierte Industrien
7.2 M&A-Management in Krisenzeiten
7.3 Brennpunkte und Erfahrungsmanagement
7.4 Steuerung externer Kräfte
8. Opportunitätsverluste
8.1 Einführung zur Vorgehensweise
8.2 Erster und Zweiter Weltkrieg
8.3 Maßnahmen vor und im Zweiten Weltkrieg
8.4 Ergebnisse des Zweiten Weltkriegs
8.5 Bewertung von Opportunitätsverlusten
8.6 Zusammenfassung der Fall-Ergebnisse
9. Anhang
9.1 Deutschland, wohin?
9.2 Nachwort
9.3 Hintergrundmaterialien Bedienungsanleitung
9.4 Zum Autor
9.5 Quellenverweise
1. Zu diesem Buch
Unternehmensuntergänge vollziehen sich meist im Stillen, über lange Zeit unbemerkt, dann plötzlich in der Insolvenz. Ganz anders als das Untergehen von Schiffen in tosenden Gewässern und unter Tsunami-Wellen. Oder Brücken, die plötzlich unter Krachen in sich zusammenbrechen. Über alles gibt es beredte Beispiele, die uns berühren und erschrecken.
Die Fachliteratur über die Wirtschaft kennt fast nur die positive Seite. Einerseits Erfolgsbeispiele, die die Börsenwerte nach oben getrieben haben. Auf der Seite finden sich Management-Kurse über grundlegende Erfolgsstrategien, die sich oft wie Kochbücher lesen.
Berichte über spektakuläre Unternehmenspleiten finden sich vor allem in der Regenbogenpresse. Manager berichten höchst ungern von ihren Fehlentscheidungen. Wer gibt schon gern seine Fehler zu, egal zu und in welcher Lebenssituation! In der Wirtschaft können unerwartete Berichte über Probleme verheerende Wirkung erzeugen und sogar zu rechtlichen Konsequenzen führen, wenn dadurch die Kapitalwerte ins Rutschen geraten. Die Börse ist unerbittlich. Offenlegungen von Problemen oder sogar Selbstbezichtigungen aus dem Kreis von Managern und Unternehmern belasten das Vertrauen in das Management. Die Börsen reagieren schroff: Abstürze von Aktienkursen und der Entzug von Kapital sind die Folgen. Eine
Ausnahme sind Unternehmenswarnungen vor Entwicklungen, die wahrscheinlich zu Kursverlusten führen können. Der Aktionärsschutz fordert sogar solche Meldungen. Unterbleiben diese, kann ein Vorstand zur Rechenschaft gezogen werden.
Manager und Unternehmer gehören nicht zur Kategorie der bestbeleumundeten Berufsgruppen wie etwa Ärzte. Die breite Öffentlichkeit neidet ihnen gern die hohen Gehälter oder Gewinne. Wenn ein Konzern ins Schlingern gerät, dann wird reflexhaft das Management der Fehler bezichtigt.
Wissenschaft und Praxis
Wissenschaftler der Organisations- und Managementpraxis brachten Theorien zur erfolgreichen Führung von Unternehmen hervor. Dazu zählen die renommierten Ingenieure Frederick Winslow Taylor, (1856-1915), der Prinzipien zur Steuerung von Arbeitsprozessen entwickelte und auf den der Begriff des Taylorismus zurückgeht sowie der Franzose Henri Fayol (18411925), der eine universelle Management- und Verwaltungslehre entwickelte. Weniger bekannt ist Mary van Kleeck,(1883-1972), die amerikanische Wegbereiterin der Industrieforschung. Sie prägte den Begriff „Management“ als Bezeichnung eines neuen Tätigkeitsfelds. Die Liste berühmter Management-Lehrer und der daraus gewonnenen Lehren lässt sich mit vielen bekannten Namen füllen.
Der vielleicht schlagkräftigste Ansatz wurde nach dem Zweiten Weltkrieg bei Toyota entwickelt: das Toyota Produktionssystem TPS, eine Konzeption, um jedwede Art von Verschwendung zu vermeiden. Der Sohn des Toyota-Gründers, Toyoda Kiichiro (1894-1952) hatte bereits 1937 die Grundlagen für das Just-in-time-Konzept entwickelt, aber die eigentliche Ausarbeitung erfolgte erst nach demZweiten Weltkrieg unter Taiichi Ohno (1912-1990), der als Vater des Toyota Produktionssystems1 bezeichnet wird. Die Entstehung des Produktionssystems TPS ging auf Rohstoffknappheiten zurück und die Verweigerung wirtschaftlicher Hilfe aus den USA.
Dieser gesamtunternehmerische Ansatz behandelt nicht nur den Produktionsprozess, sondern auch Dienstleistungen und Verwaltung. Darin flossen schon sehr früh Qualitätsstrategien ein, die der US-Amerikaner William Edwards Deming (1900-1993) formuliert hatte und die in seinem Heimatland auf taube Ohren gestoßen waren. Das Gesamtkonzept wurde mit der Zeit um viele Elemente und Methoden ergänzt, sodass es heute branchenübergreifend und weltweit Anwendungen findet, so zum Beispiel das Total Quality Management (TQM) und kontinuierliche Verbesserungsprozesse, in Japan als Kaizen bezeichnet. Als zum Beispiel Porsche wegen Kosteneskalationen kurz vor dem Konkurs stand, wurde das TPS-Konzept herangezogen, Toyota konsultiert und eine werkstattbasierte Fertigung eingeführt. Diese rettete das Unternehmen vor dem Konkurs. Das Toyota-Produktionssystem (TPS) gilt weltweit als Benchmark für hocheffiziente Produktion in den verschiedensten Industriezweigen. „Toyota ist das Synonym für Konsequenz“, sagte der ex-Porsche-Chef Wendelin Wiedeking. Er ist bekennender Bewunderer und Nachahmer des Toyota-Produktionssystems.2
Forschung und Lehre
Ein Klassiker der deutschen Fachliteratur ist die von Edmund Heinen (1919-1996) erstmals 1978 herausgegebene Industriebetriebslehre, ein Standardwerk, an dem ein Student der Betriebswirtschaftslehre wohl kaum vorbeikommt.
Solche Werke leben von speziellen Systematiken zur erfolgreichen Unternehmensführung. Sie implizieren auch, dass das Abweichen von derartigen Regeln zu Misserfolgen führt. Wie diese Misserfolge entstehen, wo sie herkommen und wer sie zu verantworten hat, wird kaum angesprochen. Selbst groß angelegte wissenschaftliche Untersuchungen jüngerer Zeit richten sich bei einer Problemsuche vorwiegend auf Managementfehler. Eine verbreitete Erklärung besteht darin, dass die strategische Idee, die zur Gründung eines Unternehmens führte und die über viele Jahre den Erfolg des Betriebes „garantierte“, unverändert weiterverfolgt wird, ohne dass große Veränderungen und Innovationen an Markt, Wettbewerb und Kundenverhalten berücksichtigt werden. Damit geriet das Unternehmen in eine Schieflage. Das hatte sogar große und renommierte Konzerne in den Untergang geführt.
1.1 Nicht nur in Deutschland
Dieses Buch mag den Eindruck erwecken, dass Verluste von Unternehmungen und Branchen vor allem in Deutschland auftreten, insbesondere vor dem Hintergrund schlecht laufender Wirtschaft. Das ist nicht der Fall: Auch andere Länder verzeichnen konjunkturelle Einbrüche und beklagen große Verluste, die regelrecht Löcher in der Volkswirtschaft hinterlassen. Solche Einbrüche finden oft länder- und kontinentalübergreifend statt und sind Ausdruck international wirksamer Veränderungen, etwa von Konjunkturen, neuen Technologien und klimatischen Zwängen. Sie können auch Ausdruck einer Gesundung sein, wenn kränkelnde Spieler einen Markt verlassen, um Gesunden Platz zu machen. Tod und Geburt spielen Hand in Hand.3 Sie sind Teil eines sich ständig wandelnden gesunden Ökosystems. Das sind Regeln aus der Physik. Aus ihnen leiten sich Kenntnisse für die Biologie und für das sozialwirtschaftliche Gemeinwesen ab. Dem Tod folgt Verwesung und übrig bleibt Muttererde.
Der Verfall alter Unternehmen setzt Menschen, Kapital, Investitionen und Infrastrukturen frei. Diese frei gewordenen Einsatzfaktoren ermöglichen die Gründung neuer Unternehmen. Nach den Gesetzen wandlungsfähiger Ökosysteme sind für Umwandlungen auch externe Energien erforderlich. In der Biologie sind das zum Beispiel die Kräfte der Sonne. In unseren Industrien sind das etwa neue Ideen und neue Investoren. Somit repräsentieren die Beispiele in diesem Buch nicht nur Krankheit und Verfall von Wirtschaftsbetrieben. Sie öffnen auch Wege zur Gesundung und Erneuerung.
Beispiel aus dem Ausland: Kodak
Ein berühmt-berüchtigter Fall war der Untergang von Kodak, einst Weltmarktführer der Fotoindustrie.
Dieser Konzern führte seit seiner Gründung um die Wende zum zwanzigsten Jahrhundert hin den Weltmarkt für Fotografie an. Kodak wurde zum Synonym für Farbfotografie und Farbfilme. Große technische Leistungssteigerungen gehen auf Kodak zurück. Als die ersten Konzepte zur Digitalfotografie aufkamen, wurden bei Kodak Teams zur Entwicklung der neuen Technik eingesetzt. Kodak war sogar einer der Ersten, der funktionsfähige Digitalkameras in seinen Labors zeigen konnte.
Falsches Technikvertrauen
Der Glaube an die Überlegenheit der analogen Fotografie mit ihren hohen Bildqualitäten und die bis dato schwache digitale Bildleistung verleitete den Konzern dazu, die Weiterentwicklung der Digitaltechnik zurückzufahren und diese zu verkaufen. Ein Interesse für die Kodak Digital Technik war der i-Phone Hersteller Apple. Verhandlungen mit Kodak liefen über mehrere Jahre. Der Wert der Kodak Digitaltechnik erodierte. Das Geschäft mit der Analogtechnologie implodierte, weil die Japaner den Fotomarkt angriffen und mit Preiskämpfen die großen westlichen Hersteller vom Thron stürzen konnten. Damit war der Untergang des einst so stolzen Kodak-Konzerns besiegelt. Die Digitaltechnik musste billig an Apple verkauft werden, weil sie mittlerweile rückständig war. Das Kerngeschäft mit analogen Kameras und Filmen brach zusammen, und Kodak musste seine Tore schließen.
Multikausalität
Der Kodak-Untergang bestätigt zwar, dass die Untergänge von Unternehmen im Wesentlichen auf Managementfehler zurückzuführen sind. Die Prozesse, die zum Untergang ganzer Unternehmen und zum Verlust gesamter Branchen führen, sind aber äußerst vielfältig. Jeder Fall ist anders gelagert. Aus jedem Fall kann man auch Lehren ziehen.
1.2 Das große Versagen der Denkmodelle
Die größten Denkmodelle der Wirtschaftswissenschaften waren bisher nicht in der Lage, Erfolge zu garantieren.
In den USA gab es zum Beispiel den Long Term Capital Management (LTCM) Hedgefonds, der in den 1990er Jahren bekannt wurde. LTCM wurde von einer Gruppe renommierter Wirtschaftswissenschaftler gegründet, darunter zwei Nobelpreisträger, Robert C. Merton und Myron S. Scholes, die für ihre Arbeiten zur Finanzmathematik und insbesondere für die Entwicklung des Black-Scholes-Modells zur Bewertung von Optionen bekannt sind. Der Fonds wurde von weiteren prominenten Akademikern und Finanzexperten geleitet, darunter John Meriwether, ein ehemaliger Leiter des Anleihehandels bei Salomon Brothers.
LTCM setzte mathematische Modelle und komplexe Finanzstrategien ein, um zu investieren. Das Modell war sehr erfolgreich, bis es im Jahr 1998 zu einem plötzlichen und unerwarteten Marktcrash kam, ausgelöst durch die Asien- und die russische Finanzkrise. Die Märkte entwickelten sich unvorhersehbar, und LTCM konnte den plötzlichen Marktschwankungen nicht standhalten. Der Fond erlebte große Verluste, und die von ihm angewandten Modelle erwiesen sich als nicht ausreichend, um mit den unvorhergesehenen Risiken umzugehen. Schließlich musste der Fonds mithilfe der US-Notenbank und einer Rettungsaktion von großen Finanzinstitutionen abgewickelt werden.
LTCM ist ein Beispiel dafür, wie sich mathematische Modelle in einem dynamischen und unvorhersehbaren Markt als unzureichend herausstellen können, wenn menschliche Entscheidungsfindung und Marktpsychologie eine größere Rolle spielen als ursprünglich angenommen.
Nicht nobelpreiswürdig?
Selbst die höchste Instanz der Wirtschaftswissenschaften, nämlich die Riege der bisher 93 Wirtschaftsnobelpreisträger, hat keinen Vertreter hervorgebracht, der ein anhaltend sicheres Model zur Unternehmensführung und Wertsicherung entwickeln konnte.4
Wahrscheinlich ist eine Suche nach einem grundlegenden Erfolgsmuster auch der falsche Weg. Wie die Management-Modelle zeigen, können viele Wege zum Erfolg führen, wobei jeder seine Risiken hat. Die Vielfalt der Optionen zur Führung eines Unternehmens ist unendlich groß.
Grenzen KI-basierter autonomer Unternehmensführung
Kluge und fantasiereiche Vorstände sind gefragt, um einen Konzern erfolgreich um alle Klippen der Konjunkturen herumzusteuern. Was gestern richtig war, kann morgen falsch sein. Bisher war es nicht möglich, Führungsentscheidungen zu automatisieren. Es ist höchst fraglich, ob ein Unternehmen sich selbst autonom führen kann. Die weitere Entwicklung der Künstlichen Intelligenz kann weitere Möglichkeiten erschließen. Sie dürfte nach heutiger Einschätzung als Hintergrund-Instrument zur Auswahl und Absicherung von Management-Entscheidungen hilfreich sein. Das letzte Wort wird weiterhin der Mensch haben. Wir sollten uns vor dem Zukunftsglauben hüten, dass eine KI in der Lage sein wird, jedwede Besonderheit und jedwede Störung eines Systems durch systemexterne Faktoren berücksichtigen zu können. Letztlich arbeitet KI vergangenheitsbasiert und sammelt Erfahrungen, die nach statistischen Regeln zusammengeführt werden. Beweise dazu liefern langjährige Entwicklungsarbeiten bei anderen Wissens- und Erfahrungsfeldern wie dem autonomen Fahren, das nach Kenntnis der führenden Entwickler nicht in der Lage sein wird, jede Besonderheit und jeden systemexternen Faktor einzubeziehen. Im Vergleich zum autonomen Fahren liegt die Führung eines Unternehmens noch um mehrere Komplexitätsstufen höher. Darüber hinaus muss ein guter Unternehmer eine unsichere Zukunft antizipieren. Das kann die KI, so wie wir sie heute kennen, nicht.
Höchste Komplexität
Die Wirklichkeit ist kompliziert. Sie sprengt jedes Modell. Die Gründe für den Untergang von Unternehmen und den Verlust ganzer Branchen sind äußerst vielfältig. Es gibt viele Gruppen, Individuen, innere und äußere Umstände, die zu einem Untergang führen. Meist kommen viele Faktoren, unglückliche Umstände, gefährliche Eingriffe zusammen, bis ein Unternehmen stirbt. Oft zeichnet sich ein kommender Untergang im weiten Vorfeld kaum wahrnehmbar ab, wie das bekannte Bild vom Schmetterling, dessen Flügel nur sanft die Luft bewegen. Langsam zunehmende Turbulenzen können am Ende einen Hurrikan erzeugen, der Menschen, Infrastrukturen und Unternehmen in den Abgrund reißen kann.
Warum Fallbeispiele?
Um den Problemen und Herausforderungen näherzutreten, wählten wir reale Beispiele untergegangener Großunternehmen und den Verlust ganzer Branchen aus, die Deutschland zu beklagen hat. Deshalb werden in diesem Buch große Fälle genauer vorgestellt. Der kluge Leser möge daraus Lehren ziehen, was passieren kann und wie vorausschauende Planungen als Mittel gegen Zusammenbrüche eingesetzt werden können. Verschiedene Systematiken werden vorgestellt.
1.3 Untergänge in der Industrie
Wie zu zeigen ist, gibt es sowohl externe als auch unternehmensinterne Faktoren, die zu einem Untergang beitragen können. Zu den externen Gründen zählen jedwede Arten von Krisen und Katastrophen, die unter anderem auf Klima und Wetter zurückgeführt werden können. Das kann natürliche oder menschengemachte Ursachen haben. Des Weiteren sind Marktmechanismen zu nennen wie Konjunkturen, Wirtschaftskrisen, Branchen-, Technologie-, Länder- und Wettbewerbsrisiken. Die internen Gründe lassen sich zumeist auf das Wirken und die Teilhabe an den unternehmerischen Prozessen zurückführen. Dafür sind folgende Shareholder-Gruppen verantwortlich:
Vorstände und Aufsichtsräte,
Geschäftsführer und Regionalleiter,
Leiter und Funktionsträger in allen Wertschöpfungsstufen,
Leiter und Funktionsträger in den Stäben.
Untergänge von Unternehmen in Deutschland
Im Jahr 2023 sind in Deutschland rund 176.000 Unternehmen geschlossen worden. Insbesondere der Maschinenraum Deutschlands – die Industrie und die Bauwirtschaft – ist davon betroffen. Im verarbeitenden Gewerbe hatten zuletzt 2004 so viele Betriebe aufgegeben.5 Bei einem Großteil von ihnen verlief das still und leise, lediglich 11 Prozent der Schließungen sind Folge einer Insolvenzanmeldung.6
"Die Schließungen in der Industrie treffen den Kern unserer Volkswirtschaft“, sagt Patrik-Ludwig Hantzsch, Leiter der Wirtschaftsforschung bei Creditreform. So ist die Anzahl an Schließungen im Baugewerbe von 2022 auf 2023 um 2,4 Prozent auf 20.000 Unternehmen gestiegen – im verarbeitenden Gewerbe um 8,7 Prozent auf 11.000 Schließungen. Das ist der höchste Stand seit 2004.7 Alarmierend ist, dass damit nicht nur die industrielle Basis schwindet.
1.4 Forschungsintensive Branchen fallen zurück
Unterscheidet man innerhalb des verarbeitenden Gewerbes nach dem jeweiligen Innovationsgrad, fällt auf, dass die Zahl der Schließungen mit plus 12,3 Prozent in forschungsintensiven Wirtschaftszweigen in forschungsintensiven Wirtschaftszweigen deutlich stärker ansteigt als in nicht-forschungsintensiven Bereichen. In besonders forschungsintensiven Branchen wie etwa der Chemie und Pharmaindustrie, dem Maschinenbau und bei technologieintensiven Dienstleistungen scheiden besonders viele Unternehmen aus dem Markt aus. Der Effekt ist dort gravierend, weil den Schließungen keine kompensierenden Neugründungen gegenüberstehen. Wenn ein Unternehmensbestand nicht nachwächst, wird mit der Zeit eine ganze Branche Deutschland langsam verlassen. Das leise Sterben vieler kleinerer Betriebe und hochspezialisierter Unternehmungen ist besonders folgenschwer, wird aber von Turbulenzen bei prominenten und großen Unternehmen überschattet. Hauptgründe für den deutschen Unternehmenstod sind hohe Energie- und Investitionskosten, unterbrochene Lieferketten, Personalmangel und politische Unsicherheit. Das ist für die Wirtschaft ein toxischer Cocktail.8
Insolvenzen
2023 wurden in Deutschland 101tausend Insolvenzverfahren eröffnet, darunter 17.800 Unternehmensinsolvenzen. Damit liegt dieses Jahr etwa im Mittel der Dekade seit 2012.9 2022 gab es in Deutschland rund 3,16 Millionen steuerpflichtige Unternehmen mit jährlichen Lieferungen und Leistungen über 22.000 Euro. Das bedeutet, dass jährlich davon rund 0,6 Prozent pro Jahr wegen Insolvenz aufgeben.
Der wirtschaftliche Schaden, der durch eine Insolvenz entsteht, ist größer als bei einer stillen Schließung eines Unternehmens, da Gläubiger bei einer Insolvenz zusätzlich auf Zahlungen für Lieferungen und Leistungen verzichten. Somit findet eine weit größere Kapitalvernichtung als bei einer schuldenneutralen Schließung statt. Das schlägt sich weder in den Unternehmensbewertungen nieder, noch in den Börsenwerten. Auch die heute gängigen Verfahren zur Unternehmensbewertung geben keinen ausreichenden Aufschluss über Stabilität und Perspektiven von Unternehmen:
Neue Bewertungsverfahren erforderlich
Das heute als gerichtsfest bezeichnete allgemein anerkannte Verfahren zur Unternehmensbewertung basiert zum Teil auf vergangenheitsbezogenen Daten und lässt wichtige zukunftsorientierte Daten außen vor. Somit ist dieses Verfahren insbesondere für Unternehmen in dynamischen Märkten ungeeignet. Von Professor Dr. Werner Gleißner von der Technischen Universität Dresden wurde in Zusammenarbeit mit Kai Lucks ein neues Bewertungsverfahren entwickelt, das vergangenheitsbasierte Daten ausschließt und vollständig auf zukunftsbasierte Daten aufsetzt.10 Dazu zählt das Insolvenzrisiko des jeweils zu bewertenden Unternehmens. Dieses wird statistisch aus Markt- und Wettbewerbsszenarien branchenspezifisch ermittelt. Aus umfangreichen Untersuchungen hat sich ein branchenübergreifender Mittelwert von 1 Prozent als jährliche Insolvenzwahrscheinlichkeit für deutsche Unternehmen herauskristallisiert. Das bedeutet, dass jedes zehnte in Deutschland ansässige Unternehmen binnen zehn Jahren Konkurs anmelden muss.
1.5 Dunkle Wolken am Horizont
In den Corona-Jahren mussten zuallererst Gaststätten und andere lokale Dienstleister ihr Geschäft aufgeben. Das waren zumeist Unternehmen, die nur über geringe Rücklagen und schmalste Kapitaldeckungen verfügten. Somit war eine Kapitalvernichtung im Insolvenzfall gering. Die nächste Welle traf deren Zulieferer, die über größere Kapitaldeckungen verfügten. Durch ihre Insolvenzen wurde der Kapitalschaden für die Volkswirtschaft bedeutend größer. Sollte dieser Dominoeffekt zu in einer weiteren und größeren Welle führen, dann würde der volkswirtschaftliche Schaden weiter eskalieren. Diese Modellbetrachtung ließe sich fortsetzen, sodass schließlich ein wirtschaftlicher Tsunami über unser Land fegen würde. Daraus könnte eine weitere Finanz- und Wirtschaftskrise entstehen, in deren Strudel viele Volkswirtschaften geraten könnten. Wir können viele Warnungen davor hören. Und wir können froh sein, dass dieses Schreckensszenario bisher nicht eingetroffen ist.
Stehen wir vor einer weit größeren Weltwirtschaftskrise?
Wir konnten die wellenförmige Ausbreitung nationaler Finanzkrisen bereits vor der Weltwirtschaftskrise von 2008 beobachten. Die davor erfolgten nationalen Wirtschaftskrisen fanden vor allem in Lateinamerika und in einzelnen Ländern Afrikas und Asiens statt, deren Wirtschaftskraft und deren Bedeutung für den Export von industriellen Wirtschaftsgütern sehr begrenzt sind. Dennoch mündeten die verschiedenen Wellen nationaler Engpässe in die große Weltwirtschaftskrise von 2007/2008. Sollte Deutschland etwa infolge eines „Finanz-Tsunamis“ in Probleme geraten und seine ausländischen Industriepartner mitreißen, könnte das zu einer Weltwirtschaftskrise von weit größerem Ausmaß führen.
Experten sehen die Stabilität der Finanzmärkte bedroht. Dabei gibt es nicht mehr die eine Gefahr, es zeichnet sich eine gefährliche Gemengelage ab.
2. Unternehmenswerte
2.1 Top-down oder Bottom-up?
Der Geldwert eines Unternehmens kann durch interne Daten und Rechenverfahren ermittelt werden oder durch externe Betrachtungen wie dem Börsenwert. Oder anders ausgedrückt: das Erste ist der Wert, das Zweite ist der Preis. Die Erfahrung zeigt, dass die Summe der Teilwerte eines Unternehmens meist höher liegt als der Gesamtwert, wenn er Top-down ermittelt wird. Theoretisch müsste beides zur selben Zahl führen. In der Praxis ist es aber so, dass es innerhalb eines Unternehmens wirtschaftlich besser oder weniger gut arbeitende Teile gibt. Aus verschiedensten Gründen schleppt man aber die weniger gut performenden Abteilungen mit: aus sozialen Gründen, wegen der Erwartung besserer Zeiten, zur Zukunftssicherung und wegen anstehender Umbauten, in denen Schwächere zukünftig stärkere Rollen spielen werden. Die Schwächeren ziehen also den real bestehenden Gesamtwert nach unten. Wenn dagegen ein Investor auf ein Unternehmen blickt, dann sieht er vor allem die Underperformer, die er rausstreichen kann, wodurch er den Wert eines Unternehmens oder eines Unternehmensteils verbessern kann. Welchen Wert ein Unternehmen hat, ist also sehr stark von der Perspektive des Betrachters abhängig.
2.2 Einladungen zur Zerlegung
Je größer ein Unternehmen ist, je diversifizierter und je internationaler, desto mehr lädt es zu seiner Zerstückelung ein. Dafür gibt es mehrere Gründe:
In einem vielfältig strukturierten Unternehmen werden immer Teile mitgeschleppt, die nicht optimal aufgestellt sind.
Je tiefer ein Unternehmen strukturiert ist (etwa in einer langen Wertschöpfungskette und breiter regionaler Aufstellung mit Präsenz in vielen Ländern), desto mehr Teile sind zu finden, die unzureichend operieren. Sie belasten das Gesamtergebnis der Firma und senken die geforderte Kapitalrendite.
Je mehr solche Teile sich finden lassen, desto mehr Möglichkeiten zur Abspaltung, Zerlegung und zur Restrukturierung der Teile bieten sich an.
Diversifikation, Wertschöpfung und Regionalität
Summa summarum bietet jedes größere Unternehmen zahlreiche Möglichkeiten, durch dessen Zerlegungen zusätzliche Werte geschaffen oder offengelegt werden können. Die Vielfalt der Schnitte, die sich zum Auseinandernehmen eines Unternehmens anbieten, liegt
beim Diversifikationsgrad (Zerlegen in die verschiedenen Geschäfte des betreffenden Unternehmens),
bei seiner Wertschöpfung (Zerlegen nach Wertschöpfungsstufen) und
seiner regionalen Aufstellung (Zerlegung zum Beispiel nach Ländern und in Form der Bildung unabhängiger Landesgesellschaften).
2.3 Die Guten und die Bösen
Es gibt gute und böse Stakeholder, und manchmal kann man zwischen Gut und Böse nicht unterscheiden. Die Guten wie auch die Bösen können sich außerhalb des Unternehmens oder innerhalb unternehmerischer Schranken befinden. Einer der bisher gut war, kann plötzlich böse werden, indem etwa ein Vorstand plötzlich Entscheidungen trifft, die allein seinem Vorteil dienen und sogar das Unternehmen schädigen. Dazu gehören etwa gezielte Maßnahmen, um die Vorstandsgehälter zu steigern, ohne dass der Unternehmenswert verbessert wurde.
Zerstörungswille
Das wäre noch ein eher geringer Schaden, der einem Unternehmen zugefügt werden kann. Egomanen können aber auf die Zerlegung und Vernichtung ganzer Konzerne erpicht sein. Dieser Fall ist gar nicht so selten. Er trägt Bezeichnungen wie Korruption, Aktivistische Investoren, mafiöse Strukturen, Ungeziefer, Rachsucht, Steuerflucht und vieles mehr.
Angreifer überall
Die Täter kommen aus allen Ecken: innerhalb und außerhalb der Unternehmen, aus allen Ebenen, aus Aufsichtsräten, Mitarbeitern, Beratern und Dienstleistern. Mal handeln sie aus besonderen Strukturen heraus, wenn etwa eine Investmentbank mit Gewalt ihren Deal durchsetzen will, da es viel zu verdienen gibt, wohlwissend dass die zerlegten Teile des Unternehmens gar nicht lebensfähig sind. Es können auch Geheimbünde entstehen, wenn sich etwa ein Vorstand auf die Seite eines Aktivistischen Investors schlägt, der die Zerlegung (Zerschlagung) des Unternehmens im Auge hat. Das Motiv eines Vorstands ist in diesem Fall, dass zeitnah und schlagartig enorme Gelder winken, während im mühseligen Klein-Klein der Tagesgeschäfte nur geringe Margen herauskommen. Vernichtende Kräfte können sich auch bei den sogenannten Seilschaften bilden. Hierbei handelt es sich um alte Freundschaften und Verbindungen, die sich formlos quer durch die Organisation ziehen. Oft sind dies ehemals leitende Mitarbeiter, die nach einem unternehmerischen Umbau ihrer Aufgaben entbunden wurden, ihre Bedeutung und Rolle im Unternehmen verloren haben und sich zurückgesetzt fühlen.
Schläfer
Oft stehen die Täter allein und isoliert in der Organisation. Niemand erkennt sie, niemand kennt ihre Motive. Man nennt dies Schläfer, die abwarten, bis sie zuschlagen können, oder es bietet sich eine auch für sie unerwartete Gelegenheit, sich auf Kosten eines Unternehmers zu bereichern oder sich für eine vergangene Ungerechtigkeit zu rächen. Im ersten Fall ist dies meistens Diebstahl, im zweiten Fall oft Sabotage. Die Täter sind keine Kleinkriminellen wie etwa Kaufhausdiebe oder Gelegenheitstäter, die Alkohol an der Kasse vorbeischmuggeln. Hier geht es vielmehr um Taten, die ein großes Unternehmen zu Fall bringen können, z. B. den Raub des gesamtem Goldbestandes eines Unternehmens, das Gold für seine Produktion elektronischer Bauteile benötigt. Auch kleine Böswilligkeiten gegenüber einem Vorgesetzten stehen hier nicht zur Debatte, sondern Bosheiten von Größenordnungen, deren Tragweite sich ein Täter zunächst gar nicht bewusst sein muss, etwa durch Entwicklung und Einschleusung von Malware, um sich an einem Vorgesetzten zu rächen. Wegen geringerer IT-Sicherheit ist dies in kleineren Unternehmungen leichter möglich. Werden diese von einem Größeren geschluckt, werden solche Schädlinge mangels IT-Due Diligence nicht erkannt. Werden dann solche Bomben gezielt zeitverzögert gezündet dann können Schäden und Bedrohungen gewaltig sein. Das hat schon ganze Konzerne in den Untergang geführt. Wir kommen im Abschnitt über Mergers & Acquisitions darauf zurück.
Versicherungen zahlen nicht
Ein Vorstand haftet sowohl für Risiken, die er erkennt, als auch für solche, die er nicht erkannt hat. Teilweise werden dazu Versicherungen angeboten, etwa mit Spezialpaketen im Industriebereich für M & A, Steuerschulden (Tax Liability) und Absicherungen von Unternehmensprüfungen (Due Diligence).
Mal unterlaufen Fehler durch Unaufmerksamkeit oder sogar Dummheit – Unternehmensführer sind auch ganz normale Menschen –, mal klüger, mal weiser, mal schwächer. Und es wäre vollkommen falsch, den Managern bzw. den Vorständen alle Schieflagen in die Schuhe zu schieben. Sie sind meistens Täter (sonst wären sie ja nicht in ihre verantwortungsvollen Positionen gekommen), aber sie können auch Opfer sein oder sogar zugleich Opfer und Täter in Personalunion zugleich.
2.4 Der Unternehmer ist nicht immer schuld
Die Gründe für den Untergang eines Unternehmens können vielfältig sein. Zu unterscheiden sind externe Faktoren wie Umwelt, Katastrophen, Epidemien, intermediäre Faktoren wie Markt, Wettbewerb und Lieferketten sowie interne Gründe. Dazu gehören Missmanagement, Ressourcen-Engpässe (etwa knappe Energie, zu hohe Energiekosten, überraschende Zölle, fehlendes Personal) und Geschäftsrisiken (etwa Finanzierung, Projektrisiken). Eine einheitliche Kategorisierung gibt es nicht. Grenzen zwischen den vorgenannten Faktoren können fließend sein und ein Problem kann ein anderes nach sich ziehen, sogenannte Domino-Effekte.
Abbildung: Unternehmens-Stakeholder
3. Wie die Welt aus den Angeln gerät
Wir leben wahrscheinlich in der riskantesten Periode der modernen Industriegesellschaften. Mit seinen zahllosen Schlachten und Regionalkriegen hat der Mensch noch nie so viele Katastrophen verursacht wie in heutiger Zeit. Hinzu kommen die größten Unfälle, wie zum Beispiel eine Ölpest in den Weltmeeren, die das gesamte Ökosystem zerstören können. Bald haben wir den Kipppunkt der Weltmeere erreicht, dem der größte Organismus der Erde, der dann nicht mehr gerettet werden kann.11
Wenn wir aber den Menschen als einzigen Verursacher für den Klimawandel benennen dann begehen wir einen Fehler. Wenn wir den Klimawandel für alle wetterbedingten Katastrophen verantwortlich machen, ist das auch falsch. Beide Faktoren treffen zusammen, überlagern sich und bilden Kraventsmänner (Seemanns-Sprache für größte Wellen) ungeahnten Ausmaßes – geradezu Tsunamis, die Länder und Subkontinente unter sich begraben können.
Wir müssen uns den Erkenntnissen und der Wahrheit stellen, auch wenn diese höchst unangenehm sind. Wenn Diktatoren und Oligarchen aus Ost und West sich auf Flügeln von Fakes davontragen lassen und glauben, dass ein stärkerer Staat einen kleineren zerdrücken darf, dann bricht die Weltordnung zusammen, die unsere Väter nach den Erfahrungen der beiden Weltkriege („Der Dreißigjährige Krieg des 20. Jahrhunderts“) geschaffen haben und die uns über 70 Jahre Weltfrieden beschert hat, abgesehen von furchtbaren Regionalkriegen, wie in Vietnam, Korea, auf dem Balkan, in Afghanistan, Georgien und in der Ukraine.
Weltweit sind nach Ende des Zweiten Weltkriegs mindestens 60 bis 65 Millionen Menschen durch Kriege gestorben. Im 20. Jahrhundert verloren circa 100 bis 185 Millionen Menschen durch Kriege ihr Leben. Über 90 Prozent der Kriege nach 1945 fanden in den Regionen der Dritten und ehemaligen Zweiten Welt statt.12 Kaum abschätzbar sind Umweltschäden durch Kriege und durch die Vernichtung von Kulturgütern ganzer Länder, um Feinden ihre geistige Heimat, religiöse und regionale Identität zu rauben. Russland macht das so und kennt nur die Feuerwalze, die alles Leben, alle Werte, allen Glauben vernichtet.
Die größten in diesem Zusammenhang von Menschen gemachten Fehler sind Desinformationen und Unwahrheiten. Damit gefährden wir den Zusammenhalt sowohl unserer Weltgemeinschaft als auch unserer Sozialgesellschaft. Wir verlieren dann die Bereitschaft, nach diplomatischen Lösungen zu suchen und das in unserer Hand Liegende auch umzusetzen. Wer seinen Beitrag dazu nicht leistet, macht sich mitverantwortlich für Gefährdungen und den Untergang von Unternehmungen.
Ein Beispiel: Allein infolge der Corona-Pandemie standen in Deutschland 100.000 Unternehmen vor der Insolvenz. Dies konnte nur durch gesetzgeberischen Schutz verschoben und durch steuerliche Maßnahmen abgemildert werden. Erst jetzt, nach Auslauf der Schutzfristen, kommt die große Welle der Insolvenzen in Bewegung. Das ist nicht überraschend, denn davor hatte dies der gesetzliche Schutzwall verhindert. Nun ergießt sich ein Schwall von Konkursen über Deutschland, als wenn ein Deich während einer Flut geöffnet würde.
Wenn wir uns dem Zusammenwirken von Krisen, Kriegen und Katastrophen nicht erfolgreich entgegenstellen und der wachsenden Zahl autoritärer Herrscher nicht erwehren können, dann brechen auch die Strukturen unserer Sozialgesellschaft. Das reißt unsere Unternehmungen mit in den Abgrund. Dann brauchen wir uns mit dem (untergeordneten) Thema dieses Buches nicht mehr zu beschäftigen.
3.1 Risiko-Kategorien
Der Global Risk Report 2024 des Weltwirtschaftsforums (World Economic Forum) warnt „vor einer globalen Risikolandschaft, in der bereits erzielte Fortschritte in der menschlichen Entwicklung allmählich wieder erodieren. Verschiebungen in der globalen Machtdynamik, im Klima, in der Technologie und in der Demografie bringen die Anpassungsfähigkeit sowohl von Staaten als auch Einzelpersonen an ihre Grenzen.“ 13
Er nennt fünf Hauptkategorien von Risiken: ökologische, technologische, geopolitische, wirtschaftliche und gesellschaftliche. Innerhalb jeder Kategorie werden die zehn größten Risiken der nächsten zwei Jahre (kurzfristige Risiken) sowie der nächsten zehn Jahre (langfristige Risiken) aufgelistet.
Multipolare Weltordnung
„Das World Economic Forum warnt vor einer globalen Risikolandschaft, in der bereits erzielte Fortschritte in der menschlichen Entwicklung allmählich wieder erodieren. Verschiebungen in der globalen Machtdynamik, im Klima, in der Technologie und in der Demografie bringen die Anpassungsfähigkeit sowohl von Staaten als auch Einzelpersonen an ihre Grenzen.“14
Die Weltordnung ist gefährdet
Im Report wird davor gewarnt, dass die Kooperationsbereitschaft bei der Bewältigung drängender globaler Probleme zunehmend bröckeln könnte. Dies erfordert neue Ansätze in der Risikobewältigung. Zwei Drittel der globalen Experten geht davon aus, dass sich in den nächsten zehn Jahren eine multipolare oder fragmentierte Weltordnung herausbilden wird, in der Mittel- und Großmächte in Konkurrenz zueinander neue Regeln und Normen setzen – aber auch durchsetzen – werden. Die Ergebnisse zeigen, dass die globalen Aussichten kurzfristig überwiegend negativ eingeschätzt werden und sich langfristig sogar noch weiter verschlechtern. Für die kommenden beiden Jahre erwarten 30 Prozent der globalen Experten eine erhöhte Wahrscheinlichkeit globaler Katastrophen. Für die nächsten zehn Jahre steigt dieser Anteil auf fast zwei Drittel.
Fehl- und Desinformationen
Als größtes kurzfristiges Risiko werden Falschinformationen genannt. Die Folgen wirken sich bereits auf Milliarden von Leben aus: KI-generierte Fehl- und Desinformationen, eine Krise der Lebenshaltungskosten, Cyberangriffe und gesellschaftspolitische Polarisierung stehen uns bevor.
Die Auswirkungen und der Zeitrahmen jedes Risikobereichs sind unterschiedlich, ebenso wie unsere Chance, diese zu mindern oder sich darauf vorzubereiten. Und wenn sie kombiniert werden, erhöhen sich die Risiken – Konflikte schädigen den Planeten direkt und unmittelbar und verhindern dringend benötigte gemeinsame Maßnahmen gegen den Klimawandel. Fortschritte in der KI können zu Cyber-Schwachstellen führen. Hohe Zinsen bringen kleine und mittlere Unternehmen sowie hochverschuldete Länder in eine Schuldenkrise.
3.2 Klimakrise trifft auf verwundbare Bevölkerung
Die Klimakrise bringt Gefahren wie Überschwemmungen, Dürren oder Waldbrände mit sich. Doch Katastrophen, die entstehen, wenn solche Gefahren auf eine gefährdete, verwundbare Bevölkerung und ihre Unternehmungen treffen, sind menschengemacht. Wir dürfen nicht zulassen, dass die globale Klimakrise als einziger Grund für alle wetterbedingten Katastrophen herangezogen wird. Der Klimawandel ist nicht für alles verantwortlich, und internationale Bemühungen zur Begrenzung des globalen Temperaturanstiegs sind nicht der einzig wichtige Weg, den wir gehen müssen, um Katastrophen abzumildern.
Global betrachtet, verschlimmert der Klimawandel Überschwemmungen, Dürren, Wirbelstürme und Waldbrände in vielerlei Hinsicht. Er ist das größte Problem unserer Zeit, und es ist von entscheidender Bedeutung, dass die Menschheit zusammenarbeitet, um Lösungen anzugehen. Wir dürfen nicht zulassen, dass Politiker den Klimawandel allein für alle Katastrophen und ihre Auswirkungen verantwortlich machen. Sie dürfen sich damit auch nicht ihrer Verantwortung entziehen. Es ist niemandem geholfen, wenn wir die Klimakrise so vereinfacht darstellen, dass sich ein falsches Bild ergibt.15
Wirkungen von Naturkatastrophen auf die Wirtschaft
Naturkatastrophen verursachen wirtschaftliche Schäden in Milliardenhöhe. Naturkatastrophen häufen sich. Das wirkt sich auch auf die Wirtschaft aus.
„Wenn etwas vernichtet wird durch die Natur, dann müssen wir dies wieder ersetzen. Und das kostet Ressourcen, das kostet Zeit und Geld … Mittel- und langfristig kann das schleichend Wachstumsverluste mit sich bringen“,
so Jan-Egbert Sturm, Leiter der Konjunkturforschungsstelle der ETH Zürich. Das seien Ressourcen, die anderswo, beispielsweise für die Entwicklung neuer Technologien, fehlten. Diese zu beziffern, sei schwierig.16 Die versicherten Schäden aus Naturkatastrophen allein haben sich seit der Jahrtausendwende vervielfacht. 2021 betrugen sie 105 Milliarden Dollar.
„Wir müssen realisieren, dass dieser Klimawandel nicht ganz aufgehalten werden kann und dass wir teilweise eine andere Art von Wirtschaftsstruktur brauchen. Das erfordere Anpassungen, die schon stattfänden. Wir sind aber sicherlich noch nicht am Ende.“17
Klimawandel, Unwetter, Überschwemmungen und lange Trockenperioden belasten auch Unternehmen. Deren Wirkungen können zu Wirtschaftskrisen, Zerstörungen, Zerfall, Insolvenz und Totalschäden für die Betriebe führen.
Die vielfältigen und komplexen Zusammenhänge zwischen Ursachen und Wirkungen, die ein Unternehmen für seine Entscheidungen zu berücksichtigen hat, lassen sich aus der Grafik ablesen:
Grafik: Die Welt im Transformationsmodus
(Quelle: Corporate M&A -Kongress München 2022. Einführung Lucks)
Die in diesem Bild genannten Faktoren sind Beispiele, die je nach Unternehmenstyp, seiner Branche, seiner Wertschöpfung und regionaler Ausrichtung ausgetauscht werden können.
Der Unternehmer ist in den meisten Fällen nicht der Verursacher der Probleme, die zu bewältigen sind. Er steht aber in der Verantwortung, die für sein Unternehmen angemessenen Maßnahmen zur Abwehr, zu Vorwärtsstrategien und entsprechenden Umsetzungen abzuleiten. Macht er das nicht, dann haftet er, denn er steht letztlich in ganzheitlicher Verantwortung für seinen Betrieb.18
3.3 Kriege
Kriege und Katastrophen sind im Normalfall von einer Sachversicherung ausgeschlossen. Auch der Unternehmer haftet nicht in diesen Fällen. Ereignisse wie der Krieg in der Ukraine sowie die Angriffe der Huthi-Rebellen auf Handelsschiffe im Roten Meer lassen Forderungen nach dem Versicherungsschutz einzelner Policen der Versicherung von Unternehmen im Zusammenhang mit Krieg aufkommen. Vor diesem Hintergrund stellt sich die Frage, welche Schäden durch Krieg versichert sind bzw. welche Schäden in Kriegsgebieten versichert werden können.19
Krieg und Haftungsausschluss
Da Schäden durch einen Krieg auch für den Versicherer ruinös sind, werden Schäden in der Sach- und Haftpflichtversicherung zunächst grundsätzlich ausgeschlossen.
Beispielhaft lautet eine solche Klausel unter den allgemeinen Ausschlüssen (nicht versicherte Schäden) – hier im Bereich der Feuerversicherung – wie folgt:
Ausschluss Krieg:
Die Versicherung erstreckt sich ohne Rücksicht auf mitwirkende Ursachen nicht auf Schäden durch Krieg, kriegsähnliche Ereignisse, Bürgerkrieg, Revolution, Rebellion oder Aufstand.
Ausschluss innere Unruhen:
Die Versicherung erstreckt sich ohne Rücksicht auf mitwirkende Ursachen nicht auf Schäden durch innere Unruhen.
Ausschluss Kernenergie:
Die Versicherung erstreckt sich ohne Rücksicht auf mitwirkende Ursachen nicht auf Schäden durch Kernenergie, nukleare Strahlung oder radioaktive Substanzen.
Der Kriegsausschluss
gilt global. Dabei ist zu beachten, dass ein kausaler Zusammenhang zwischen dem Krieg sowie dem Schaden bestehen muss. Die Beweislast trägt in der Regel der Versicherer.
Versicherbarkeit von Sanktionen
In den Versicherungsverträgen ist zu prüfen, inwieweit auch Sanktionen den Versicherungsschutz einschränken. Die meisten Versicherungsverträge beinhalten nämlich Klauseln, nach denen auch Effekte aus Sanktionen nicht versichert sind.
3.4 Finanz- und Wirtschaftskrisen
Finanzkrisen sind weder seltene noch neue Erscheinungen. Allein zwischen 1970 und 2007 wurden 124 Bankenkrisen, 326 Währungskrisen und 64 Staatsverschuldungskrisen auf nationaler Ebene gezählt.20 Historisch betrachtet hängt die Anfälligkeit für Krisen nicht vom Entwicklungsstand einer Ökonomie ab. Bezogen auf die Jahre seit 1945 gibt es kaum einen Staat, der nicht mindestens einmal von einer Bankenkrise betroffen war. Spätestens seit Ende der 1990er-Jahre steht das Verhindern von Finanzkrisen auf der Tagesordnung internationaler Institutionen.
Anzahl der Finanzkrisen
Die weitaus meisten Finanzkrisen in den 1970er- und 1980er-Jahren haben in den ökonomisch sich entwickelnden Staaten stattgefunden, oft als Währungskrisen. In ihrem Verlauf brachen feste Wechselkurse zusammen, und es fanden massive Kapitalabflüsse statt. Aber auch in den ökonomisch entwickelten Staaten gab es bereits vor 2007 krisenhafte Ereignisse mit erheblichen Folgen, so etwa in den 1990er-Jahren in Schweden, Norwegen und Japan.
Regionale Ausdehnung
Nicht selten dehnt sich eine Krise regional aus, so zum Beispiel in Lateinamerika in den 1970er- und 1980er-Jahren oder bei der Asienkrise 1997/98. In den Jahren vor der letzten globalen Finanzkrise, also vor 2007, gab es vergleichsweise wenige Krisen. Eine Erklärung dafür ist, dass zahlreiche Mechanismen entwickelt wurden, um Krisen abzuwehren bzw. fehlerhafte Entwicklungen zu korrigieren. Die Umgehung von Mechanismen zur Regulierung und das übermäßige Vertrauen in die Funktionsweise der Finanzmärkte hatten allerdings zu einer umso tieferen Krise geführt.
Seit1945 gibt es kaum einen Staat, der nicht mindestens einmal von einer Bankenkrise betroffen war. Lediglich in den 1950er- und 1960er-Jahren gab es eine längere Phase, in der Finanzkrisen vergleichsweise selten auftraten.
3.4.1 Die Finanzkrise 2008
Auslöser
Die Finanzkrise wurde durch die jahrelang steigenden Immobilienpreise in den USA ausgelöst, die sich zu einer Immobilienblase entwickelt hatten. Bei steigenden Kreditzinsen und fallenden Wiederverkaufswerten konnten viele Kreditnehmer ihre Kreditschuld nicht mehr begleichen.
Mehrere große amerikanische Finanzunternehmen, die direkt oder indirekt mit der Verbriefung der Schuldscheine im Immobiliensektor aktiv waren, mussten im Zuge der Krise Insolvenz anmelden oder von der Regierung gerettet werden (Lehman Brothers, Merrill Lynch, AIG, Bear Stearns, Fannie Mae, Freddie Mac). Rasante Kurseinbrüche an den globalen Aktienmärkten verschärften die Krise, und der Interbankenmarkt kam weltweit nahezu vollständig zum Erliegen.
Fast jeder war kreditwürdig
Später kamen Gerüchte auf, dass der amerikanische Hypothekenfinanzierer New Century Financial Corp. in Liquiditätsschwierigkeiten steckte. Das Unternehmen war nach Countrywide Financial der zweitgrößte Verkäufer von sogenannten Subprime-Hypothekarkrediten. Diese minderwertigen Hypotheken werden an jene Kunden vergeben, die finanziell eher auf wackeligen Füßen stehen. Später hat man sie auch als Ninja-Kredite bezeichnet. Ninja steht für „no income, no job, no assets“, also für eine Kundengruppe, die im Extremfall weder über Einkommen noch über einen Job noch über Sicherheiten verfügt.
In dieser Ära der Kreditpolitik stieg die Anzahl der Hausbesitzer in den Vereinigten Staaten von 1994 bis 2006 um rund fünf Prozentpunkte auf 69 Prozent an. Auf die US-Wirtschaft wirkte dieser Bauboom wie ein gewaltiges Konjunkturprogramm.
Staatsversagen
Auf dem Hoch des Immobilienbooms im Jahr 2006 gehörte ein Viertel der vergebenen Kredite diesem Segment an. Das war zunächst für alle ein gutes Geschäft. Firmen wie New Century Financial verdienten sich mit diesen Krediten eine goldene Nase. Sie konnten für das große Ausfallrisiko hohe Zinsen verlangen. Einen Teil der minderwertigen Hypotheken verkauften sie gleich an finanzierende Banken weiter. Diese bündelten die Kredite und verpackten sie als Derivate. Aus minderwertigen Krediten wurden nun scheinbar respektierliche Anlagen mit Namen wie Mortgage-Backed Securities. Anleger griffen mutig zu.
Betrugsverdacht
Ende Winter 2006/07 kursierten an der Börse erste Gerüchte, wonach Geschäftsbanken den Geldhahn zudrehen würden. Mit ihren Krediten überbrückten sie den Zeitraum zwischen der Auszahlung der Hypothek auf der einen und dem Verkauf der Hypothek auf der anderen Seite. Von Seiten der Behörden kam der Verdacht von Betrug auf. Am 2. April 2007 musste New Century Financial Konkurs anmelden. Die Finanzkrise nahm ihren Lauf.
3.4.2 Wie die Geldmaschine der Wall Street implodierte
Weil sich immer mehr Banken beteiligten, flossen Milliarden in den Immobilienmarkt. Die Preise für Häuser und Wohnungen stiegen rasant. Hausbesitzer lösten ihren Kredit einfach durch einen neuen ab, wenn sie den alten nicht mehr tilgen konnten. Sie gerieten mit ihren Raten in Verzug oder gaben die Zahlung ganz auf. Millionen Amerikaner verloren schließlich ihr Zuhause. Bei den Investoren stiegen die Verluste. Hinzu kam, dass sich Banken einen großen Teil der Mittel für ihre Hypotheken über kurzfristige Kredite besorgt hatten. Das hatte fatale Folgen für das Finanzsystem. Denn angesichts der steigenden Kreditausfälle zögerten Anleger, den Banken weiter Kapital zu leihen. Damit erreichte die Krise nach dem Immobilienmarkt auch das Finanzsystem.
3.4.3 Der Kollaps von Lehman Brothers
Mit dem Kollaps der amerikanischen Großbank Lehman Brothers im September 2008 wurde das weltweite Ausmaß der Finanzkrise deutlich. Es war der größte Konkursfall der US-Geschichte. Dann erreichten die Schockwellen auch deutsche Anleger. Auch andere große Banken standen vor der Insolvenz. Bürger fürchteten um ihre Ersparnisse. Angela Merkel versicherte den Deutschen wieder und wieder, ihr Geld sei sicher. Sie gab eine Garantieerklärung für die Spareinlagen ab.
Rezession
Diese Krise löste in vielen Industriestaaten eine tiefe Rezession aus und war letztlich mitverantwortlich für die Eurokrise. Die Folgen sind bis heute spürbar – nicht nur wirtschaftlich, sondern auch politisch. Die versprochenen Reformen des Finanzmarktes, damit so etwas nicht noch mal vorkommt, sind bis heute nur zum Teil umgesetzt.
3.4.4 Nachwirkungen
Zehn Jahre später, hatte die amerikanische Volkswirtschaft wohl auch die letzten Folgen der Finanz- und Wirtschaftskrise überwunden. Die Amerikaner schleppen heute eine sehr viel geringere Schuldenlast mit sich herum als damals. Doch so glanzvoll ist der Zustand des amerikanischen Hypothekenmarktes immer noch nicht. Denn in gewisser Weise ist der amerikanische Staat in Form der Behörde Federal Housing Administration (FHA) in die Lücke getreten, die der Rückzug der privaten Subprime-Anbieter hinterlassen hat. Die FHA wiederum finanziert sich über die Weitergabe dieser Kredite in Form von Derivaten an private Investoren. Die Verbriefung übernimmt dabei die staatliche Agentur Ginnie Mae das Ausfallrisiko, also der Staat.20
3.4.5 Geschichte wiederholt sich
Finanzkrisen treffen die Volkswirtschaften in mehr oder weniger regelmäßigen Abständen. Insofern wiederholt sich die Geschichte. Die Ursachen sind meist auf finanztechnischen Feldern zu finden: etwa ein überhitzter Immobilienmarkt durch zu lockerere Vergabe von Hypotheken oder zu großzügige Autokredite im Subprime-Markt. Nach den bösen Erfahrungen dürften diese Fehler als Ursache für die nächste Krise vorerst auszuschließen sein. Fällige Korrekturen im seit Jahren boomenden Markt für Unternehmensanleihen oder am Aktienmarkt könnten vermutlich eher zur nächsten großen Verwerfung der Volkswirtschaften führen.21
4. Bankensektor – Rückgrat der Wirtschaft
4.1 Grundfunktionen der Banken
Die Hauptaufgabe der Banken liegt darin, den Wirtschaftskreislauf in Gang zu halten. Sie agieren als Vermittler zwischen verschiedenen Interessengruppen und tragen dazu bei, den Geldstrom (Liquidität) aufrechtzuerhalten. Im Jahr 2024 standen Banken jedoch vor neuen Herausforderungen. Die sich verlangsamende und divergierende Weltwirtschaft sowie Risiken wie Unterbrechungen von Lieferketten, geopolitische Spannungen und wetterbedingte Extremereignisse beeinflussten das globale Wirtschaftswachstum.
Das System der Privatbanken in Deutschland
Das System der Privatbanken in Deutschland ist geprägt von einer Vielzahl von Instituten, die sowohl große, international tätige Banken als auch kleinere, regional ausgerichtete Banken umfassen. Ein Hauptunterschied zum europäischen Ausland liegt in der starken Rolle der Sparkassen und Genossenschaftsbanken, die in Deutschland eine bedeutende Marktstellung einnehmen.
Die Eingriffe der EU-Kommission in das deutsche Privatbankensystem sind oft darauf ausgerichtet, einheitliche Standards und Wettbewerbsbedingungen innerhalb der EU zu schaffen. Diese Maßnahmen können sowohl als notwendig für die Stabilität des Finanzmarktes als auch als potenziell nachteilig für die deutschen Privatbanken angesehen werden, insbesondere in einem bereits überbesetzten Markt.
Ob Brüssel die deutschen Privatbanken benachteiligt, ist umstritten. Einige argumentieren, dass die Regulierung zu einer Erhöhung der Wettbewerbsbedingungen führt, während andere der Meinung sind, dass die spezifischen Bedürfnisse und Strukturen des deutschen Marktes nicht ausreichend berücksichtigt werden. Letztlich hängt die Beurteilung von der Perspektive ab, aus der man die Maßnahmen betrachtet.
Neue Bankenkrise am Horizont?
Der IWH-Präsident Reint E. Gropp warnt vor einer erneuten Bankenkrise. Der Finanzsektor sei durch die Corona-Rezession stark angeschlagen. Der Zustand könnte sich in Zukunft noch verschlimmern. Tausende Firmen können aufgrund der Krise ihre Kredite nicht zurückzahlen. Die dadurch drohenden Kreditausfälle bringen viele Banken in Existenznot.
Auch das Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung Halle (IWH) warnt. Die ausfallenden Kreditzahlungen der Unternehmen könnten Hunderte Banken in Existenznot bringen. Davon betroffen sind vor allem Sparkassen und Volksbanken. Sollte sich die Wirtschaft wieder schnell erholen, sind der Studie zufolge günstigenfalls „nur“ sechs Prozent der Banken in Deutschland gefährdet. Falls sich die Wirtschaft jedoch nicht so schnell wieder stabilisiert, könnten in einem pessimistischen Szenario 28 Prozent und damit hunderte Banken vor dem Aus stehen.
Risikoszenarien
Die vom Ausfall bedrohten Kredite belaufen sich im optimistischen Szenario auf 127 Milliarden Euro und im pessimistischen Szenario auf 624 Milliarden Euro, heißt es in einer IWH-Analyse vom September 2020: „Selbst wenn es für die deutsche Wirtschaft sehr gut läuft, halten wir eine neue Bankenkrise für wahrscheinlich“, sagt IWH-Präsident Gropp. Und weiter: „Der Staat hat sich zuletzt verständlicherweise um die Realwirtschaft gekümmert, sollte aber mögliche Gefahren nicht übersehen, die im Finanzsektor lauern“.22
4.2 Der Kriminalfall Wirecard
Wirecard ist die Geschichte von einem steilen Aufstieg, einem tiefen Fall und einem Wirtschaftsskandal, den es in dieser Größe in der Bundesrepublik Deutschland nicht gegeben hat. Begonnen hat dieses Drama Anfang der 2000er-Jahre, als Markus Braun von einer Unternehmensberatung zum Zahlungsdienstleister nahe München kam und ihn fortan nach seinen Wünschen formte.
Der Riesen-Betrug wurde möglich durch totales Versagen der Wirtschaftsprüfer, durch Versagen aller Kontrollinstanzen in allen Ämtern und Stellen, die mit Wirecard zu tun hatten, angefangen vom Wirtschaftsministerium, bis zur Kanzlerin Merkel, die sich wiederholt und ungeprüft für Wirecard einsetzte. Die Bürger verloren damit Milliarden an Aktienvermögen, das nach aktueller Einschätzung wohl als Totalverlust abzubuchen ist.
Das Geschäftsmodell von Zahlungsdienstleistern
Zahlungsdienstleister arbeiten damals wie heute im Hintergrund. Der normale Verbraucher bemerkt sie kaum und kennt sie schon gar nicht beim Namen, auch wenn er sie häufig in Anspruch nimmt. Kauft der Kunde eine Hose im Internet, läuft das ebenso über solche Firmen, wie wenn er bei C&A oder H&M mit Kreditkarte bezahlt. Bei jeder Transaktion erhält der Zahlungsdienstleister eine Gebühr, die umso höher ausfällt, je größer das Risiko ist. Besonders bei Wirecard ging man in den ersten Jahren gern auf Risiko, machte Geschäfte im Glücksspiel- wie auch Pornogeschäft, eben in der Schmuddelecke des Internets.
4.2.1 Wirecard als erfolgreicher Finanzdienstleister?
Es klang seriös und innovativ: “Wirecard ist eine der am schnellsten wachsenden digitalen Plattformen im Bereich Financial Commerce, und zwar weltweit.” So stand es auf der Homepage des Unternehmens. Und weiter: “Wir bieten sowohl Geschäftskunden als auch Verbrauchern innovative Mehrwertservices rund um den digitalen Zahlungsverkehr: online, mobil und am Point of Sale.”
Wirecard sollte dafür sorgen, dass Zahlungsströme in Milliardenhöhe bargeldlos zwischen Millionen Kunden und Hunderttausenden Händlern fließen konnten. Konkret heißt das: Wenn irgendwo im Internet oder in einem Laden am Kartengerät elektronisch bezahlt wurde, sorgte Wirecard dafür, dass das Geld beim Empfänger ankam, und kassierte dafür eine Gebühr. Diese Art von Geschäft benötigt Treuhandkonten. Denn bisweilen kauft jemand ohne gedecktes Konto ein. Dann begleichen von Wirecard gefüllte Treuhandkonten als eine Art Versicherung für den Händler die offenen Beträge.
Die Wirecard Bank in Europa
In Europa betrieb Wirecard für diese Geschäfte eine eigene Bank. In Ländern, in denen Wirecard keine eigenen Lizenzen hatte, war der Konzern auf Drittanbieter angewiesen. Um Geschäfte zwischen zwei Vertragspartnern abzusichern, deponierte Wirecard Geld auf Treuhandkonten.
Treuhandkonten in Fernost
In Asien verfügte Wirecard, anders als in anderen Teilen der Welt, nicht über eigene Geschäftslizenzen. Dort war alles über rund 100 Partner gelaufen. Wirecard vermittelte nur zwischen diesen Dritten. Dennoch waren dort Treuhandkonten nötig. Diese wurden für Asien bis 2018 in Singapur und ab 2019 auf den Philippinen geführt. Jedenfalls wurde dies in Wirecard-Bilanzen behauptet, bevor im Frühjahr 2020 Wirtschaftsprüfer feststellten, dass 1,9 Milliarden Euro, die eigentlich auf derartigen Treuhand-konten sein sollten, fehlten. Berichte über Unregelmäßigkeiten gab es jedoch schon lange. Und damit fing der eigentliche Skandal erst an.
Wachstum
Der Konzern wuchs unter der Leitung von Markus Braun stark. Der Österreicher wurde größter Anteilseigner, Vorstandsvorsitzender und – wie könnte es in einer modernen Tech-Geschichte anders sein – Visionär mit Aktionären als Fans. Sie vergötterten den medienscheuen Wirtschaftsinformatiker als einen, der angeblich wusste, wie die Zukunft aussieht, und vertrauten ihm in Form von Aktien viel Geld an. Der Aktienkurs stieg stark. 2006 enterte Wirecard den Tec-DAX, 2018 dann den DAX, Deutschlands Aktienindex für die 30 wichtigsten Unternehmen des Landes. Dies war der Höhepunkt der Erfolgsgeschichte.
Angela Merkel in China
Im September 2019 trat Bundeskanzlerin Angela Merkel eine Reise nach China an. Ex-Verteidigungsminister Karl-Theodor zu Guttenberg hatte zuvor die Bundesregierung über den geplanten Markteintritt von Wirecard in China informiert und diese gebeten, die Pläne wohlwollend zu unterstützen. Guttenberg arbeitete nämlich über seine Firma Spitzberg Partners als Berater für Wirecard. Diese Mission kam Merkel nicht ungelegen. Sie äußerte sich während ihrer Amtszeit als Bundeskanzlerin nur zurückzuhaltend über die Deutsche Bank. Mit diesem lahmenden und skandalgeschüttelten Finanzinstitut konnte sie in China nicht punkten. Mit der dynamischen Wirecard konnte sie dagegen in China glänzen und beweisen, dass auch Deutschland über ein führendes Fintech-Unternehmen verfügte.
China bei Fintecs weit vorn – Deutschland ganz hinten
Ihre Sorge war berechtigt: Die Chinesen lagen im internationalen Vergleich weit vorn. In der weltweiten Top-Liga der Fintechs sind sie besonders stark vertreten.
So warb Merkel aus persönlicher Überzeugung für Wirecard, als das erfolgreichste und innovativste Finanztechnologie-Unternehmen („Fintec“) Deutschlands. Etwas scheinbar Gleichwertiges konnte Deutschland seinerzeit nicht bieten.
Das Ranking der Besten Fintecs weltweit liest sich (Stand 2016) so:
Platz 1: Ant Financial, China, ehemals Alipay – ein Unternehmen aus dem Netzwerk des Online-Händlers Alibaba. Es bietet Zahlungsservices, Vermögensmanagement, individuelle Kreditwürdigkeitsprüfungen, Reporting sowie Leistungen aus dem Private Banking und Cloud Computing an.
Platz 2: Qudian, China, vergibt über zwei Plattformen Kredite an Privatpersonen, darunter auch Mikrokredite an Studenten.
Platz 3: Oscar, USA, bei Gesundheit und Versicherungen aktiv.
Platz 4: Lufax, China, bietet eine Internetplattform für Kreditvergabe und Vermögensmanagement an.
Platz 5: Zhongan, China, 2013 gegründetes Start-up, bietet seinen Nutzern eine umfassende Analyse des Marktes von Versicherungen aus Gesundheit, Reise und Finanzanlage.
Platz 6: Atom Bank, Großbritannien, bietet Bankdienstleistungen via App an und arbeitet mit Gesichts- und Stimmerkennung.
Platz 7: Kreditech, Deutschland, bietet digitale Finanzdienstleistungen an und setzt dabei auf Nutzerfreundlichkeit.
Platz 8: Avant, USA, 2012 gegründet. Bietet online Konsumentenkredite an.
Platz 9: Sofi, USA, 2011 gegründetes Start-up. Bietet Finanzprodukte zur Refinanzierung von Studenten- oder Hypotheken- und allgemein Konsumentenkredite an.
Platz 10: JD Finance, China, 2019 gegründetes Start-up. Ist in unterschiedlichen Bereichen aktiv, unter anderem bei Konsumen-tenfinanzierung, Crowdfunding, Vermögensmanagement, Zahlungsservices und Versicherungen.23
Wirecards Plan zum Einstieg in den chinesischen Markt
Wegen seiner Pläne zur China-Expansion wandte sich Guttenberg auch an das Finanzministerium von Olaf Scholz. Auf Anfrage des Spiegel erklärte das Finanzministerium, dass Staatssekretär Wolfgang Schmidt im Juni 2019 “seinen chinesischen Counterpart, Vizeminister Liao Min im Ministry of Finance, über das Interesse von Wirecard am Markteintritt informiert” habe.24
Der Einstieg
Im November 2019 verkündete Wirecard den Einstieg bei AllScore Payment Services in China, der wenige Monate später auch vollzogen wurde. Das Unternehmen ist skandalumwoben: 2020 musste AllScore eine Rekordstrafe wegen Verflechtungen in der Glücksspielbranche zahlen.
4.2.2 Die Financial Times wird aktiv
Als die Financial Times durch Recherchen des Journalisten Dan McCrum Anfang 2019 aufzeigte, dass Wirecard-Mitarbeiter in Asien Zahlen fingiert hatten, war das der Anfang vom Ende. Zwar verteidigte sich Wirecard vehement gegen weitere Berichte, bekam sogar Zuspruch von der Finanzaufsicht BaFin. Doch eine Sonderprüfung der Wirtschaftsprüfer von KPMG hinterließ Zweifel an der Existenz von insgesamt 1,9 Milliarden Euro, die auf asiatischen Konten hätten liegen sollen.
Die BaFin verlässt sich auf das EY-Testat
Die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft EY hatte die gefälschten Bilanzen des früheren DAX-Konzerns Wirecard über Jahre testiert. Mehrere Male hatte die Bankenaufsicht BaFin eine Sonderuntersuchung vorgenommen. Allerdings verließ sie sich auf das Testat der Wirtschaftsprüfer von EY, die in der Buchhaltung von Wirecard bis dato keine Unregelmäßigkeiten erkennen konnten. Doch nach der KPMG-Sonderprüfung versagten auch die Bilanzprüfer von Ernst & Young dem Konzern das Testat, und der Aktienkurs rauschte in die Tiefe.
Untersuchungsausschuss
Im Dezember 2020 wird Guttenberg vor den Wirecard-Untersuchungsausschuss des Bundestages zitiert. Er sähe sich mittlerweile als Opfer, Wirecard habe "uns alle getäuscht", wie er zu Protokoll gibt. Doch nicht nur zu Guttenberg hatte sich für das Unternehmen eingesetzt. Auch etwa der Ex-Geheimdienstkoordinator im Kanzleramt, Klaus-Dieter Fritsche, hatte Lobbyarbeit für Wirecard betrieben.
Die Bundesregierung gerät unter Druck
Im Skandal um mutmaßlichen Milliardenbetrug beim insolventen DAX-Konzern Wirecard gerät die Bundesregierung unter Druck. Finanzminister Olaf Scholz war einem Bericht seines Ministeriums zufolge bereits im Februar 2019 darüber informiert worden, dass die Finanzaufsicht Bafinden Fall Wirecard wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Verbot der Marktmanipulation untersucht.
Die Opposition dringt auf Aufklärung. “Die Bundesregierung stand trotz schwerster Vorwürfe und der laufenden Ermittlungen hinter Wirecard”, sagte der finanzpolitische Sprecher der FDP, Florian Toncar. Was als Bilanzskandal begonnen habe, sei “im Herzen der Bundesregierung angekommen”. Wenn die Regierung nicht “reinen Tisch” mache, “dann stolpert sie einem Untersuchungsausschuss immer näher”.
4.2.3 Wirecard wird insolvent
Aufgrund des Bilanzskandals stellte Wirecard Ende Juni 2020 den Insolvenzantrag. Verwalter bestätigten, was mittlerweile klar war: Wirecard war ein Kartenhaus, aufgebaut auf Geschäfte, die es nur auf dem Papier gab.
Jan Marsalek im russischen Geheimdienst
Noch bevor das in das Bewusstsein der Öffentlichkeit sickerte, flüchtete Vorstandsmitglied Jan Marsalek, ehemals engster Vertrauter von Markus Braun und Nummer zwei im Vorstand, über Österreich nach Belarus und von dort vermutlich nach Moskau. Bis heute ist er verschwunden, wird gesucht, manchmal geortet, und dann geht seinen Haschern aus Interpol und Presse wieder die Fährte verloren. Der flüchtige Ex-Wirecard-Manager Jan Marsalek arbeitet offenbar seit Jahren für russische Geheimdienste. Das geht aus gemeinsamen Recherchen von Spiegel, ZDF, dem österreichischen Standard und der russischen Investigativplattform The Insider hervor.25
Das Insolvenzverfahren
Am 25. August 2020 eröffnete das Amtsgericht München das Insolvenzverfahren über das Vermögen von Wirecard und sechs Tochterunternehmen. Dr. Michael Jaffé wurde zum Insolvenzverwalter bestellt. Forderungen waren bis zum 26. Oktober 2020 anzumelden.26
Gehen die Aktionäre leer aus?
Das Landgericht München I hatte darüber zu entscheiden, ob eine Forderung geschädigter Aktionäre und Aktionärinnen eine Insolvenzforderung im Rang des § 38 InsO darstellt oder nicht. Die Kapitalverwaltungsgesellschaft Union Investment hatte auf Feststellung von Schadenersatzforderungen zur Insolvenztabelle geklagt. Das LG München wies die Klage aber zurück. Kapitalmarktrechtliche Schadenersatzforderungen der Aktionäre und Aktionärinnen von Wirecard könnten demnach nicht als Insolvenzforderung zur Insolvenztabelle angemeldet werden (Urteil vom 23.11.2022, Az. 29 O 7754/21).
Geduld gefordert
Das Urteil ist nicht rechtskräftig. Es ist zu erwarten, dass erst ein Urteil des Bundesgerichtshofes (BGH) Rechtsklarheit bringen wird. Medienberichten zufolge hat Union Investment bereits angekündigt, den Präzedenzfall, ob Anteilseigner insolvenzrechtlich Gläubiger und Gläubigerinnen der Gesellschaft sind und Forderungen im Insolvenzverfahren anmelden können, höchstrichterlich klären zu lassen. Kapitalmarktrechtler schätzen die Chancen für Betroffene vor dem Bundesgerichtshof als sehr gut ein. Jedoch wird bis zu einer Entscheidung durch den BGH erwartungsgemäß viel Zeit vergehen.
Der Wirecard-Fall wird immer dubioser
Der Verkaufsprozess für die lukrativen Teile von Wirecard begann im Juli 2020. Mehr als hundert Interessenten hätten sich bislang gemeldet, teilte der vorläufige Insolvenzverwalter Michael Jaffé nach einer Sitzung des Gläubigerausschusses mit. Der Bilanzskandal bei Wirecard wird immer dubioser. Offenbar gibt es nicht nur ein Kompetenzwirrwarr auf Bundes- und Länderebene. Es bleibt ungeklärt, wer für die oberste Kontrolle des Zahlungsdienstleisters eigentlich zuständig ist. Dies betrifft auch die Frage nach dem Verbleib der Unternehmens-teile, denn auch ein Insolvenzverwalter braucht eine Stelle, an die er berichtet, die ihn steuert und die über die Vorlagen des Insolvenzverwalters entscheidet.
4.2.4 Institutionelles Versagen
Ermittlungen der staatlichen APAS
Im Oktober 2019, unmittelbar nach dem Bericht der Financial Times über Scheinumsätze bei Wirecard, wurde die beim Wirtschaftsministerium unter Peter Altmaier angesiedelte staatliche Wirtschaftsprüferaufsicht APAS aktiv. Sie hatte früh auf Hinweise reagiert27 und nahm erste Vorermittlungen gegen EY auf. APAS untersuchte sämtliche EY-Abschluss-prüfungen bei Wirecard seit 2015 auf die Einhaltung der gesetzlichen und berufsrechtlichen Vorgaben. Aber erst im März 2023 verhängte APAS schmerzhafte Strafen gegen EY und fünf ihrer Wirtschaftsprüfer. Sieben Prüfer hatten sich einer Strafe entzogen.28 Ganze drei Jahre (!) hatte die Untersuchung bei der APAS gedauert, bis sie die Vorwürfe gegen EY als begründet anerkannte.
Schadenersatz-Ansprüche bedroht
Die Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger (SdK) begrüßte das Urteil grundsätzlich, kritisierte aber die lange Verfahrensdauer, vor allem vor dem Hintergrund, dass Ende 2023 die Verjährung der Schadenersatzansprüche der EY-Aktionäre drohte. Kritisch sieht die SdK zudem, dass das Verfahren der APAS nicht öffentlich ist und Anleger keine Einsicht in Zeugenaussagen und Verfahrensunterlagen hätten. Die SdK beanstandet zudem, dass die Marktkonzentration der Anbieter an Abschlussprüfern nun zunehme: Aus den "Big Four" der größten Wirtschaftsprüfungsgesellschaften würden durch den EY-Ausschluss nur drei. Durch noch mehr Konzentration würde das System nicht besser werden.
Versagen der BaFin
Wegen des Wirecard Skandals feuerte der damalige Finanzminister Olaf Scholz den Chef der BaFin. Zum Nachfolger berief Scholz den Briten Mark Branson zum obersten deutschen Finanzaufseher. Branson hatte erst im Banking Karriere gemacht und sich dann als Chef der Schweizer Finanzaufsicht einen brillanten Ruf erarbeitet.
Die BaFin hatte unter dem Branson-Vorgänger alle Warnungen ignoriert und war gegen Journalisten vorgegangen, die das Geschäftsmodell von Wirecard analysiert hatten. In Bransons erstem amtlichen Jahresbericht für 2021 heißt es bereits, die BaFin-Methode habe sich bei Wirecard "als nicht effizient erwiesen". Bei der Europäischen Zentralbank und der Bundesbank, die ebenfalls mit Bankenaufsichten befasst sind, galt die BaFin ohnehin als zahnloser Tiger.
Ende mit Schrecken
Das Vertrauen, das die Kanzlerin Angela Merkel ausstrahlte, brachte den Aktionären wieder die Kauflaune zurück. Das war auch bitter nötig. Nach Beschwichtigungen deutscher Finanzbehörden, die sogar die Chuzpe besaßen, die Journalisten der Financial Times wegen Falschaussagen zu verklagen, setzte mancher Aktionär wieder auf die Wirecard-Scheine. In diesem Wechselbad der Meinungen und Gefühle hatte mancher Anleger seine Aktien zu niedrigen Kursen verkauft, um verärgert feststellen zu müssen, dass die Kurse wieder angezogen hatten. Um Verluste auszugleichen, wurden Aktienpakete zu erholten Kursen neu gekauft oder nachgekauft. Damit wurden per Saldo die Kursverluste noch weiter gesteigert.
Ein desaströser Ausgang
Das Rad, das sie in dieser Kasinostimmung erwarben, wuchs immer mehr an. Andere Beteiligungen wurden zur Finanzierung dieser Rallye verkauft. Weil der Anteil der Wirecard-Aktie am Portfolio der Beteiligungen immer größer wurde, entstanden erhebliche Klumpenrisiken. Es gab Kleinaktionäre, die ihre ganze Altersvorsorge in Wirecard investierten. Sie folgten dem, was die Kanzlerin durch ihre Kommunikationskanäle verkünde ließ, dass nämlich die Wirecard-Aktie eine sichere Anlage sei.
Wettbewerb der Börsenwerte