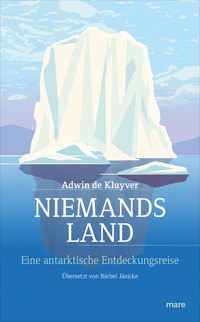18,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: mareverlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Einmal das Nordlicht sehen, die Polarnacht erleben – das steht heutzutage auf jeder zweiten Bucket List. Doch der Norden fasziniert bereits seit Jahrhunderten und verleitete Forscher, Philosophen und Fanatiker zu den gefährlichsten Expeditionen, den größten Schandtaten und den abstrusesten Theorien. Adwin de Kluyver begibt sich auf die Spuren abenteuerlustiger Entdecker und unverbesserlicher Träumer, vom Reisenden Pytheas im 3. Jahrhundert v. Chr. bis zum russischen Forscher Pawel Senko in den 1940er-Jahren, die sich tatsächlich oder in Gedanken auf den Weg gen Pol machten und dabei angetrieben wurden von den seltsamsten Vorstellungen (über ein subtropisches Polarmeer, unerschöpfliche Goldvorräte und Eingänge ins Innere der Erde) sowie von höchst wichtigen Fragen – wie derjenigen, ob die Erde eher einer Mandarine oder einer Zitrone gleicht.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 355
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Adwin de Kluyver
DERGETRÄUMTENORDEN
Arktische Geschichten von waghalsigen Forschern, fragwürdigen Philosophen und unverbesserlichen Fantasten
Aus dem Niederländischen
von Bärbel Jänicke
Eine Welt ist neugeboren nach diesem Schnee Und ich bin wieder ein Kind nach dieser Nacht.
Martinus Nijhoff, »Con Sordino«, in: De wandelaar, 1916
»Was, glaubst du, ist auf der anderen Seite?«
»Wer weiß? Noch mehr von dieser Landschaft, würde ich vermuten.«
»Eine trostlose Gegend, ohne jede Spur von Leben.«
»Das hast du schön gesagt.«
Magnus Mills, Die Entdeckung des Jahrhunderts, 2008
INHALT
UNST, GROSSBRITANNIEN – EIN PROLOG
THULE – EIN ÄUSSERSTES
LINDISFARNE, GROSSBRITANNIEN – EIN ANGRIFF
FRISLAND – EINE KARTE
STATENEILAND, KARASEE – EIN EISBÄR
VESUV, ITALIEN –EIN LOCH
UPPSALA, SCHWEDEN – EINE URZEIT
AAVASAKSA, FINNLAND – EINE EXPEDITION
BLACKHEATH, GROSSBRITANNIEN – EINE SCHNEEFLOCKE
NOTRE DAME BAY, KANADA – EIN GEMÄLDE
MORRISTOWN, VEREINIGTE STAATEN – EIN WEIHNACHTSMANN
KAP TROST, NOWAJA SEMLJA – EIN MONUMENT
DÄNENINSEL, SPITZBERGEN – EIN LUFTSCHIFF
KAP YORK, GRÖNLAND – EIN »ESKIMO«
MÜNCHEN, DEUTSCHLAND – EINE »RASSE«
BERGEN, NORWEGEN – EIN POLHELD
DER NORDPOL – EINE FLAGGE
NORDKAP, NORWEGEN – EIN EPILOG
EINE BIBLIOGRAFIE
EIN DANKESWORT
EINE ZUGABE
UNST, GROSSBRITANNIEN – EIN PROLOG
60°50'N, 0°53'W
Um ein Haar hätte ich im höchsten Norden mein Ende gefunden. Nur ein Meter trennte mich von einem gespaltenen Schädel, gebrochenen Gliedmaßen und hervorquellenden Eingeweiden. Ich lag rücklings auf dem Eis und schaute zwischen meinen Füßen hindurch auf das Panorama vor mir. Eine Beinlänge entfernt begann der Abgrund, unten zerstoben die Wellen auf den Klippen in chaotischen Fontänen. Dort in der Tiefe lag Muckle Flugga, eine schräg aus dem Meer aufragende Felseninsel, bekrönt von einem weißen Leuchtturm. Dahinter reckte noch Out Stack sein dunkles Haupt aus den Wellen empor, das nördlichste Stückchen britischen Felsens. Danach begann das leere, wässrige graue Nichts. Der Atlantische Ozean, dann das Nördliche Eismeer, danach der Nordpol. Und irgendwo jenseits der dünnen Trennlinie zwischen Hellgrau und Dunkelgrau musste auch Ultima Thule liegen, das mythische Land im hohen Norden, nach dem Entdeckungsreisende und Wissenschaftler suchten und von dem Schriftsteller und Philosophen träumten. Der griechische Seefahrer Pytheas, der Namensgeber von Thule, war im 4. Jahrhundert v. Chr. bei seiner Suche nach dem äußersten Norden hier noch vorbeigefahren.
Eben diese Sehnsucht nach dem Norden war es auch, die mich in diese brenzlige Lage gebracht hatte. Hier auf Unst, der nördlichsten Insel des Shetland-Archipels, irgendwo auf halbem Weg zwischen Schottland und Island, ist Nord die vorherrschende Him
melsrichtung. Auf diesem aus Gras, Torf und Stein bestehenden Fleckchen Erde am äußersten Rand des Vereinigten Königreichs verband sich fast alles mit dem Norden. Das Dorf, eine Bushaltestelle, das Postamt, die Brauerei, die Schokoladenfabrik, ein Supermarkt, ein Tearoom, eine Kirche, ein Haus und das Museum, alles wurde mit dem Titel »nördlichste/nördlichster/nördlichstes« beworben.
Und so lag ich also in durchnässter Kleidung auf dem eisigen Boden von Hermaness, dem nördlichsten Kap Großbritanniens, und versuchte zu überleben. Eine Beinlänge weiter nördlich fiel die Klippenwand steil ab, hundert Meter tiefer brachen sich die Wellen an den Felsen. Es war die Verheißung des äußersten Randes, die mich hierhergelockt hatte. Der Legende nach waren die beiden Inseln Muckle Flugga und Out Stack aus den Felsblöcken entstanden, die die Riesen Herma und Saxa aufeinander geworfen hatten. Beide hatten um die Hand derselben Meerjungfrau angehalten. Als dieser das Gezänke zu viel wurde, verschwand sie Richtung Nordpol. Die beiden Riesen folgten ihr und ertranken im Meer.
Ein anderes Opfer des Lockrufs des Nordens meldete sich hier im Jahr 1854. Lady Jane Franklin hatte seit neun Jahren nichts mehr von ihrem Mann gehört. Sir John Franklin, ein in die Jahre gekommener Admiral, war 1845 mit den Schiffen Terror und Erebus und 133 Mann Besatzung von Greenhithe aus in See gestochen, um sich oberhalb von Kanada auf die Suche nach der Nordwestpassage zu machen und damit eine schnelle Handelsroute nach China zu erschließen. Danach blieb es sehr lange Zeit still. Bis der Bericht des schottischen Chirurgen und Entdeckungsreisenden John Rae durchsickerte. Rae hatte von einer Gruppe kanadischer Inuit gehört, dass die Mitglieder der Franklin-Expedition mit ihren Schiffen im Packeis festgefroren seien. Die letzten Überlebenden hätten sich dem Kannibalismus hingegeben. Die trauernde Lady Jane weigerte sich, dies zu glauben, und ließ sich auf Out Stack absetzen, um ihrem vermissten Mann möglichst nahe zu sein. Untröstlich starrte sie nach Norden, in der Hoffnung, dass am Horizont Segel auftauchen würden.
Auch ich wollte einmal nach Norden starren. Zwischen Out Stack und dem Nordpol lag keine Landmasse mehr im Weg.
Zu Anfang war die Wanderung über Kap Hermaness noch ein vergnüglicher Spaziergang. Der Boden war zwar sumpfig, es schneite, aber die Temperatur lag über null, die Schneekristalle schmolzen langsam, nachdem sie den Boden berührt hatten. Der Weg über den 200 Meter hohen Gipfel war weiterhin erkennbar. Bis die Route zur Felskante hin abfiel. Am Nordhang drangen die spärlichen winterlichen Sonnenstrahlen nicht durch. Der nasse Schnee verwandelte sich in eine brüchige Eiskruste, durch die ich sofort hindurchsackte. Je näher ich dem Rand kam, desto fester wurde die Kruste. Plötzlich hielt das Eis auf diesem kalten Nordhang meinem Gewicht stand, und ich fand mich auf einer abfallenden spiegelglatten Fläche wieder. Beim nächsten Schritt, den ich machte, ging ich zu Boden. Langsam glitt ich dem Abgrund entgegen. Auf der Suche nach Halt krallte ich wild um mich. Ich versuchte, mit den Beinen das Eis zu durchstoßen. Das Adrenalin schoss in die Höhe, mein Herz pochte, mein Mund fluchte, während ich in Zeitlupe Meter um Meter in die Tiefe glitt. Erst als ich mich auf den Rücken drehte, verlangsamte sich meine Rutschpartie etwas. Der raue Stoff und die Schnallen meines Rucksacks verstärkten die Reibung auf dem Eis. Ein Grasbüschel, das durch die Eisschicht ragte, gab mir etwas Halt. Mit meinem Fuß auf den spärlichen Halmen und meinem möglichst weit ausgestreckten Körper war der Widerstand groß genug, um den Kampf gegen die Schwerkraft zu gewinnen. Still und starr blieb ich liegen. Währenddessen betrachtete ich keuchend die Aussicht, derentwegen ich gekommen war. Wie immer diese Reise auch enden würde, ganz umsonst war sie nicht gewesen.
Nachdem sich mein Herzschlag beruhigt hatte, bewegte ich mich Zentimeter um Zentimeter seitwärts, zu dem Teil des Hangs, zu dem die Sonne manchmal noch durchdrang und an dem die Eisschicht dünner und brüchiger war. Meine Füße fanden auf dem Abhang wieder Halt. Mit einiger Mühe trat ich durch die verkrustete Schicht. Ein paar Meter weiter ging sie schon in nassen Eisblubber über. Mit zittrigen Beinen kam ich zum Stehen, überglücklich, dass niemand diesen alles andere als heldenhaften Entdeckungsreisenden sich wie ein Aal an Land hatte winden sehen. Selbst in Todesnöten denkt ein Mensch offenbar noch an sein öffentliches Image.
Klatschnass stapfte ich über Kap Hermaness. Meine Schuhe versanken im sumpfigen Hochmoor. Verschwitzt und durchnässt kam ich auf dem Parkplatz des verlassenen Besucherzentrums an. Die nördlichste Toilette auf den Britischen Inseln erwies sich als verschlossen. Bei meinem Auto zog ich Hose, Pullover und Jacke aus, die von Schweiß und Schmelzwasser durchtränkt waren. Um mich warm zu halten, zog ich eine Regenmontur an. Wie ein Hochseesegler in einem gemieteten Suzuki Alto fuhr ich nach Süden. Den Titel nördlichster Toter ersparte ich mir.
* * *
Wer nach Süden reist, erwartet ein angenehmes Klima, Spaß, Kultur, Städte, Plätze mit Brunnen, Decken mit Fresken und gutes Essen auf dem Tisch. Der Süden hat etwas Weibliches. Ganz anders als der Norden; das ist ein Gebiet der Abgeschiedenheit, niedriger Temperaturen und natürlicher Hindernisse, hoher Berge, tiefer Täler, endloser Ebenen und rauer Meere. Städte gibt es dort kaum, nur Kargheit und Mangel. Der Norden ist herausfordernd und gefährlich, doch auf eine seltsame Weise auch anziehend. Die Oberseite der Weltkugel könnte man als männlich bezeichnen.
Aber das sind natürlich nur Stereotype. Der hohe Norden ist letztlich nicht mehr als eine Idee, ein Sammelsurium aus Mythos, Traum, Sehnsucht und Klischee. Ein Gebiet, das mit einem schneeweißen Tuch bedeckt ist, auf das jeder seine eigenen Fantasien, Ängste und Ideale projizieren kann. Und wie bei solchen Phänomenen üblich, muss das erschaffene Bild überhaupt nicht mit der Realität übereinstimmen.
Der Norden war in den letzten Jahrhunderten vor allem ein Laboratorium, das sich offenbar hervorragend dazu eignete, nationale Stereotype aufzuzeigen, unter Beweis zu stellen und zu überhöhen. Entdeckungsreisende zogen auf der Suche nach unentdeckten Landmassen, neuen Schifffahrtsrouten oder großen Mineralienvorkommen per Schiff, auf Skiern, mit Ballons, Zeppelinen und Flugzeugen ins Polargebiet. Sie alle mussten und wollten als Erste den Nordpol erreichen, für das Vaterland und für sich selbst.
Mussolini wollte mit Luftschiffexpeditionen gen Norden die technische Überlegenheit Italiens beweisen. Charles Dickens schrieb die Franklin-Tragödie zu einem Sieg der britischen Beharrlichkeit um. Stalin schickte Flieger in die Polregion, um die Aufmerksamkeit von den zahlreichen Schauprozessen abzulenken. Die wetteifernden Amerikaner wollten unbedingt als Erste den Fuß auf den Nordpol setzen. Ungeachtet der Wahrheit oder der Fakten beanspruchten sowohl Frederick Cook als auch Robert Peary für sich das Verdienst, 1908 respektive 1909 als Erste den 90. Grad nördlicher Breite erreicht zu haben.
Der Norden ist offenkundig eine Ansammlung von Geschichten, ein mehrdeutiger Begriff, der für verschiedene Zwecke vielfältig einsetzbar ist und Raum für endlose Fantasien bietet.
Über den Norden zu fantasieren, habe ich schon als Kind geliebt. Und nichts regte meine Fantasie mehr an als ein Atlas. Mit neun Jahren sparte ich mir das Geld für mein erstes eigenes Exemplar zusammen, indem ich aus der Verpackung von King-Pfefferminzrollen (»Köstliche Erfrischung und Belebung für jeden Tag«) das Porträt eines Mannes mit Brille – wahrscheinlich sollte die Zeichnung einen Apotheker darstellen – ausschnitt. Wer seine gesammelten Porträts einschickte, bekam gegen einen Aufpreis den King Atlas Nederland voor School en Toerisme (King-Atlas der Niederlande für Schule und Tourismus) zugesandt. Die topografischen Karten mit Ortsnamen und Eisenbahnlinien interessierten mich nicht besonders. Meine Aufmerksamkeit galt den Höhenkarten, auf denen die Pastelltöne in skurrilen Formen von Grün über Gelb und Orange bis hin zu Braun ineinander übergingen. Als Junge aus Brabant griffen meine Finger nach der Karte des fern gelegenen Frieslands, wo im Südwesten an der Küste die früheren Zuiderzee-Klippen liegen mussten; das Grün wurde dort gelb. In meiner Fantasie ragten dort steile Wände aus dem IJsselmeer auf. Die erträumte Steilküste sollte dreißig Jahre später in der Praxis jedoch etwas anders aussehen. Inzwischen wohnte ich im niederländischen Norden und bezwang joggend regelmäßig das Reade-Kliff, einen während der Eiszeit an den Ufern des Sees zusammengedrängten Geschiebelehm-Rücken, eine bescheidene Erhebung von etwa zwölf Metern in dem ansonsten so flachen Land.
Die Liebe zu Atlanten war mit dem hauchdünnen King-Büchlein allerdings erst geweckt worden. Auf einem fancy fair – so nannte man früher bei uns einen Flohmarkt – kaufte ich für einen Viertelgulden den Atlas voor de Volkschool (Atlas für die Volksschule). Es handelte sich um die dreißigste Ausgabe aus dem Jahr 1922, und den Gestaltern zufolge war es eine Heidenarbeit gewesen, so kurz nach dem Ersten Weltkrieg all die geänderten Grenzen und neuen Flugbasen einzutragen. In diesem Atlas blätterte ich immer wieder zu einer Abbildung von Helgoland, einer Felseninsel in der Deutschen Bucht mit sechzig Meter hohen Felswänden. Das waren echte Klippen, so war der Norden.
Ich bekam ein neues Nachschlagewerk mit Karten, den unübertroffenen Grote Bosatlas (Großer Bosatlas), die 48. Auflage, ein Muss für jeden Schüler der Sekundarstufe. Ein Atlas mit zwei Deutschlands, einer Tschechoslowakei und ohne baltische Staaten. Auch in ihm lockten die friesischen Klippen, die jetzt namentlich genannt wurden – das Oudemirdumer Kliff, das Mirnser Kliff und das schönste, das Rote Kliff –, aber mit einem so weltumspannenden Buch konnte ich nun noch weiter blicken. Ich spielte ein Spiel. Ich legte eine Augenbinde an und tippte mit dem Finger blind auf eine Karte; dorthin würden wir in den Ferien fahren, oder wenn es zu exotisch war, würde ich später dorthin reisen. Ich war mir der Grenzen einigermaßen bewusst. Als Kind aus einer Arbeiterfamilie war die Weltkarte etwas zu hoch gegriffen, aber ein europäisches Reiseziel sollte doch erreichbar – sprich: erschwinglich – sein. Meine Schwestern schauten feierlich zu wie Zeuginnen bei einer offiziellen Zeremonie. Ich bedeckte meine Augen, mein Finger senkte sich mit einer bewussten Abweichung nach Norden und landete im Blau des Atlantiks, irgendwo zwischen Schottland und Norwegen. Ich wollte einen weiteren Versuch wagen, doch unter meiner Fingerspitze verbarg sich ein Reiseziel: die Shetlandinseln. Das gewählte Ziel wurde zu Hause mehrheitlich abgelehnt. Für ein Auto mit Wohnwagen unerreichbar.
Jahre später kam endlich eine neue Sammlung von Schatzkarten in greifbare Nähe: The Times Atlas of the World. Ein Gedichtband in 179 detaillierten Karten, der mit der Arktis und der Antarktis endete, zwei weiß-blauen Landkarten, auf denen die Welt aus einer Fischaugenperspektive betrachtet wurde, wie es schien. Nach dem Bosatlas mit seinen überflüssigen thematischen Karten über Bergbau, Industrie, Bevölkerungsverteilung und historische Entwicklungen war der Times Atlas angenehm zeitlos und unpolitisch. Die Karten gaben Formen und Konturen wieder, die Anhöhen in der Landschaft und die Namen von Siedlungen, Bergen, Meeren und Flüssen. Mehr visueller Poesie bedurfte es nicht, um die Fantasie zu beflügeln. Reisen ist zum Teil Träumen und ist auch sehr gut zu Hause am Schreibtisch oder im Lehnstuhl möglich.
Im Times Atlas fand ich auch die Shetlands wieder. Die Inseln lagen zu weit vom schottischen Festland entfernt, um mit ihm auf eine Karte zu passen. Stattdessen bekamen sie eine eigene Zusatzkarte, was das Ziel noch etwas unerreichbarer machte. Die Karte war auch detaillierter als in den anderen Atlanten. Die einzelnen Inseln hatten nun plötzlich Namen wie Foula, Papa Stour, Yell und Unst. Das schienen Worte aus einer unverständlichen nordischen Sprache zu sein, gesprochen von mürrischen Männern, die die Hälfte der Konversation verschluckten. »What Unst? No Yell, you Foula!«
In diesem Buch gehe ich wieder auf Reisen; ich schlage den Atlas auf und fahre mit dem Finger auf der Karte nach Norden. An meinen Reisezielen treffe ich Personen – Entdeckungsreisende, Wissenschaftler, Künstler, Schriftsteller, Philosophen, Scharlatane und Fantasten –, die alle im Laufe der Jahrhunderte etwas zur Vorstellung vom Norden beigetragen haben, getrieben von einem immer wiederkehrenden Verlangen, das manchmal romantisch, manchmal wirtschaftlich und dann wieder politischer Natur war.
Was folgt, ist eine Entdeckungsreise entlang fantastischer Welten und schon längst vergessener Weltbilder. Unsere Vorfahren glaubten einst, dass es am Nordpol einen magnetischen Berg gebe; dass sich im äußersten Norden ein offenes subtropisches Polarmeer befinde, das vom Rest der Welt durch einen fast unzugänglichen Eisring abgeschottet sei; dass es in Kanada Gebiete gebe, in denen man das Gold buchstäblich nur aufsammeln müsse; dass oberhalb von Russland paradiesische Inseln lägen, die von überglücklichen Einheimischen bewohnt würden, die unbegrenzt Obst von immer Früchte tragenden Bäumen aßen; dass sich am Nordpol ein Eingangstor zu einer hohlen Erde befinde; oder dass die Welt zwar rund, aber oben und unten abgeflacht sei. Heute lachen wir vielleicht darüber, aber früher waren das plausible Weltanschauungen. Das kennzeichnet unsere sich ständig wandelnde Vorstellung vom Norden. Bis weit ins Mittelalter hinein betrachteten wir das Gebiet als Peripherie, als primitives Land mit einer niedrigen, mäßig interessanten Kultur. Nach der Reformation und der Romantik wurde es schließlich Teil der Hochkultur. Dort oben im Norden lag eine Quelle der Zivilisation und Inspiration. Eine erhabene Landschaft, die den Anschein von Reinheit erweckte.
* * *
Aber wo liegt er denn nun, dieser einigermaßen abstrakte Norden, wo geht er in den hohen Norden über, und wo beginnt das Polargebiet? Darauf sind im Laufe der Jahrhunderte viele Definitionen angewendet worden. Wenn ich es mir einfach machen wollte, würde ich postulieren, dass der Norden oberhalb des Polarkreises, des 66,5. Breitengrads, beginnt. Auf dieser Linie geht die Sonne ein Mal im Jahr nicht unter und ein Mal im Jahr nicht auf. Die Klimatypen und Vegetationszonen halten sich jedoch ganz und gar nicht an solche geraden Linien. Die Zehn-Grad-Juli-Isotherme, die Grenze, oberhalb derer die durchschnittliche Sommertemperatur unter zehn Grad bleibt, nimmt einen kapriziösen Verlauf. Das winzige Städtchen Oimjakon – in der russischen Republik Jakutien weit unterhalb des Polarkreises – gilt als der kälteste bewohnte Ort der Erde. Die durchschnittliche Wintertemperatur beträgt dort minus fünfzig Grad, es wurden aber auch schon minus 81,2 Grad gemessen. Das sind Temperaturen, bei denen Nadelbäume mit einem Knall aufplatzen. Die Permafrostzone, das Gebiet, in dem der Boden das ganze Jahr über gefroren ist, erstreckt sich in Sibirien bis zum gleichen Breitengrad wie Italien.
Die Baumgrenze ist noch so eine Trennlinie. In subarktischen Gebieten gibt es boreale Wälder, die die Russen die Taiga nennen, die ewig singenden Wälder aus Kiefern, Tannen, Lärchen, Weiden und Birken. In der Polarzone gibt es keine Bäume, und in der Tundra wächst nur niedrige Vegetation. Aber auf Island, das unverkennbar zum Norden gehört und in der subarktischen Zone liegt, sind dank der ersten Wikinger, die nach ihrer Ankunft auf der Insel etwas allzu enthusiastisch die Axt schwangen, fast alle Bäume verschwunden.
Und um die Sache noch komplexer zu machen, gibt es auch noch unterschiedliche Nordpole. Der geografische Nordpol liegt auf dem 90. Grad nördlicher Breite, dem Punkt, an dem die imaginäre Achse, um die sich die Welt dreht, auf die Oberfläche trifft. Der magnetische Nordpol ist der Punkt, auf den die Kompassnadeln zeigen. Hier verschwinden die Strahlen des Erdmagnetfeldes vertikal im Boden. Der magnetische Nordpol ist nicht mit dem geografischen Nordpol identisch; Ersterer verschiebt sich mit einer Geschwindigkeit von etwa vierzig Kilometern pro Jahr. In der Zukunft wird auch eine Umkehrung des geomagnetischen Feldes erwartet, wie sie einmal alle halbe Million Jahre auftritt, sodass die Kompasse von da an nach Süden zeigen werden. Der dritte Pol ist der Nordpol der Unzugänglichkeit, der Punkt im Nördlichen Eismeer, der am weitesten von Landmassen entfernt liegt. Und als Zugabe gibt es noch drei Dörfer mit dem Namen North Pole: eines in Alaska, eines im Bundesstaat New York und eines in Westaustralien. Dieser letzte Flecken ist allerdings für seine Rekordtemperaturen von bis zu 49 Grad in den Sommermonaten bekannt. Seinen Namen müssen wir daher wohl vor allem als einen ironischen Wunsch nach Kühle verstehen.
Lage, Niederschlag, Temperatur, Zugänglichkeit, Bevölkerungsdichte, Flora und Fauna: Das alles sind Faktoren, die eine entscheidende Rolle dabei spielen, ob ein Gebiet zum »Norden« gehört oder nicht. In den Siebzigerjahren entwickelte der kanadische Geograf Louis-Edmond Hamelin den Begriff »Nordizität« und damit eine Skala, die anhand dieser Maßeinheiten den Grad der Nördlichkeit eines Gebiets angibt. Für kanadische Entscheidungsträger ist dies immer noch eine nützliche Formel, doch für eine kulturgeschichtliche Rundreise auf dem Weg der Figuren, die das Bild des Nordens geprägt haben, ist Nordizität weniger geeignet.
Natürlich könnte ich es auch einfach angehen und meiner Intuition folgen: Von wo an habe ich selbst ein nördliches Gefühl? Ich schlage den Times Atlas auf und folge, den Blick auf die Karte gerichtet, mit meinem Finger dem 60. Breitengrad. Die imaginäre Linie ist genau halb so lang wie der Äquator und markiert das Grenzgebiet dessen, was ich – und ich glaube, viele andere ebenfalls – heute als »den Norden« bezeichne. Es ist keine exakte geografische Definition, sondern eher eine mentale Abgrenzung. Alles um und über dem 60. Grad nördlicher Breite fühlt sich für mich als Westeuropäer unverkennbar nördlich an. Die Linie verläuft durch den Süden Norwegens, Schwedens und Finnlands, durch einen beträchtlichen Teil Russlands, an der Unterseite von Alaska entlang, durch die Mitte Kanadas und berührt noch die südlichste Spitze Grönlands. Lassen Sie mich vorläufig davon ausgehen, dass das der Norden ist, bis zum Beweis des Gegenteils.
* * *
Auf dem 60. Breitengrad liegen auch die Shetlands, die kleine britische Inselgruppe, auf der man gerne Teil der größeren Geschichte des Nordens ist. So tragen ein Jugendclub, ein Radiosender, ein Online-Touristenmagazin, ein Bootsverleih und ein lokales Bier aus der Hauptstadt Lerwick allesamt den Namen 60° North, wobei die stolzen Shetländer immer darauf verweisen, dass auch Sankt Petersburg auf demselben Breitengrad liegt. Das klingt doch wesentlich aufregender als die langweilige schwedische Industriestadt Fagersta auf der gleichen imaginären Linie.
»There’s nothing up there«, bekam ich beim Aufbruch in Südschottland schon zu hören. Und tatsächlich, die Landschaft war kalt, nass, leer und kahl. Ein verirrter Steinhaufen, der den Wellen der Nordsee und des Atlantiks über Millionen von Jahren hinweg getrotzt hat. Dennoch ließen sich die Shetländer hier nicht aus dem Feld schlagen. The Old Rocks nennen die Einwohner ihre karge Heimat voller Stolz.
An diesen alten Felsen kamen im Laufe der Jahrhunderte eine ganze Menge Besucher vorbei. Die Hauptstadt Lerwick wäre beispielsweise ohne die Ankunft der Niederländer niemals erbaut worden. Vor dem 17. Jahrhundert bestand die Stadt aus einer Ansammlung von Plaggenhütten, bis die niederländische Heringsflotte die Bucht von Bressay als Ausgangsbasis wählte. Jeden Samstag kamen sie nach einer Woche auf See zurück an Land, um Handel zu treiben. Den Sonntag verbrachten sie dann in aller Ruhe auf ihrem eigenen Missionsschiff, das in Lerwick vor Anker lag.
Nicht immer herrschte allerdings Ruhe und Frieden zwischen den Niederländern und den Shetländern. Während des ersten Englisch-Niederländischen Seekriegs wurde der Hafen im Jahr 1654 für ausländische Schiffe gesperrt. 1673 nahmen die Niederländer Rache. Sie durchbrachen den Schiffskordon um die Inseln und setzten einen großen Teil von Lerwick in Brand. Die Feindseligkeiten waren bald vergessen, als der Handel wieder aufblühte, aber die Shetländer betrachteten die Niederländer nach wie vor als ein gieriges Volk. »Amsterdam wurde auf unserem Rücken erbaut«, erklärte mir ein Fremdenführer im örtlichen Museum.
In Lerwick fand ich kaum Spuren dieser niederländischen Vergangenheit. Nur der Hügel, auf dem sich die Fischer aus den Niederlanden mit den örtlichen Händlern trafen, hieß noch Hollanders Knowe. Ansonsten war Lerwick eine durch und durch britische Stadt, in der Grau die Lieblingsfarbe zu sein schien. Eine blaue Tür in einem der vielen Granithäuser wirkte frivol, das rote hölzerne Hafengebäude am Kai schmerzte beinahe in den Augen.
Dass es hier ganz schön rau zugehen konnte, bewies das Haus des Hafenmeisters. Seine Fenster waren mit Scheibenwischern ausgestattet, damit er jederzeit ungehinderte Sicht auf das Meer hatte. Vor dem Shetland-Museum lag ein weiterer stummer Zeuge der Stürme, die an den Inseln vorbeizogen. Die gigantische Schiffsschraube stammte von der Oceanic, dem Schwesterschiff der Titanic, die hier 1914 ihrer Verwandten nachfolgte. Im Inneren des Museums waren einige Gegenstände von den VOC-Schiffen Kennemerland und De Liefde ausgestellt, die 1664 und 1711 gesunken waren.
Die Elemente waren hier ohnehin ein wichtiges Gesprächsthema. Jede Begegnung auf den Shetlands begann mit einem Gespräch über das Wetter. Das Wetter auf den Inseln war aber auch der Traum eines jeden Meteorologen. Fast alle Vorhersagen trafen hier ein. Wer sagte, auf Regen folge Sonnenschein, hatte etwa viermal am Tag recht. Manchmal waren selbst den Shetländern all die Schauer und der Wind zu viel. Mitten im Winter, wenn der Regen zu oft in Schneeregen überging und die Sonne sich am Tag nur sechs Stunden über dem Horizont zeigte, war es Zeit für ein Fest, um etwas Licht in die tägliche Dunkelheit zu bringen.
Das war auch der Grund, warum ich hier auf den Old Rocks gelandet war. Nirgendwo manifestierte sich die Sehnsucht nach dem Norden so heftig wie während des Up Helly Aa, des Feuerfests, mit dem die Shetländer immer am letzten Dienstag im Januar versuchten, den langen Winter zu vertreiben. In Lerwick hatten sie die Straßenbeleuchtung dafür ausgeschaltet. Durch die Dunkelheit schlurften Tausende Schatten zum Startpunkt des Up Helly Aa. Eine Leuchtkugel flog in die Nacht, und das Fest konnte beginnen. Überall wurden Fackeln angezündet. Die Luft füllte sich mit Rauch und dem Geruch von Teer und brennendem Holz. Ich öffnete meine Jacke, meine Handschuhe konnte ich ausziehen, den Schal ablegen. Die Flammen der Fackeln ließen die Temperatur in Lerwick in sommerliche Höhen steigen.
Gut neunhundert Männer, allesamt in die seltsamsten Kostüme gekleidet, marschierten mit einer Fackel in der Hand hinter einem hölzernen Wikingerschiff her. Die Prozession wurde von einem Wikingerhäuptling, dem sogenannten Guizer Jarl, angeführt, der gemeinsam mit seiner bärtigen Mannschaft ein Jahr lang an dem Schiff gebaut hatte. Sie schwangen ihre Streitäxte, und aus ihren Kehlen drang raues Wikingergeschrei. Die Verkleidungen der anderen Teilnehmer verwiesen in der Regel auf aktuelle Themen, doch auf politische Korrektheit waren die Inselbewohner dabei nicht gerade bedacht. Frauen, Schwule und »exotische Ausländer« waren beliebte Verkleidungsthemen. Eine Gruppe arabischer Damen im Nikab, dreiundzwanzig Freddie Mercurys und eine Gruppe Mexikaner zogen an den Zuschauern vorbei. Eine Gruppe bärtiger Männer mit Übergewicht hatte sich in rosa Kleider gezwängt und stellte das Thema Dirty Dancing dar. Der Inbegriff des derzeitigen guten Geschmacks waren wohl die lustigen IS-Kämpfer, die das Publikum mit Krummsäbeln bedrohten. Zum Glück waren die Pokémons, Papageitaucher, Emojis, Schafe, Katzen, Piraten und Darth Vaders wesentlich unschuldiger. Die Männer mit den Masken von Laurel und Hardy waren geradezu nostalgisch.
In einem langen, feurigen Band zog die Prozession singend durch die Stadt, um sich schließlich wie eine Schlange um das Schiff zu rollen, woraufhin noch eine Ehrenrunde folgte. Dann war es Zeit für das Freudenfeuer. Neunhundert Fackeln flogen durch die Luft, die Menge jubelte, als das Schiff Feuer fing, eine Feuersäule aus Funken entschwand in der dunklen Nacht. Der Guizer Jarl stellte sich vor den brennenden Drachenkopf seines Schiffes und hob die Hände mit einem Triumphschrei gen Himmel.
»Das ist der Albtraum eines jeden Feuerwehrmanns.« Als Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr musste Alex Stove es wissen. Er hatte wegen der enormen Hitze seine Maske kurz abgesetzt und betrachtete anerkennend die Flammen, die hoch über die Häuser von Lerwick loderten. »Es ist das größte Feuer der nördlichen Hemisphäre. Man kann unsere Inseln vom Mond aus sehen«, sagte er mit glänzenden Augen. Der stramme Wikinger, der ein paar Meter entfernt stand, hatte auch schon mit den Tränen zu kämpfen. Weinend erstattete er per Mobiltelefon einem ausgewanderten Familienmitglied Bericht.
Wer all die brüllenden Wikinger sah, wie sie ihre Äxte schwangen, konnte fast meinen, es handele sich hier um ein altes Fest. Schließlich beherrschten die Normannen diese Inseln vom 7. Jahrhundert bis zum Ende des 15. Jahrhunderts. Der Name Shetland stammt von hjaltland, norwegisch für »hohes Land«, ab, und Lerwick ist wiederum eine Verballhornung von leir vik, was »schlammige Bucht« bedeutet. Obwohl die Inselbewohner nicht direkt Nachkommen des nördlichen Seefahrervolkes waren, haben sie die Wikinger nie vergessen. Treu berichtet die Regionalzeitung auf den Inseln noch jede Woche über aktuelle Ereignisse in Norwegen.
Die Ursprünge von Up Helly Aa liegen jedoch im Ausgang des 19. Jahrhunderts. Um den Jahreswechsel herum war es traditionellerweise an der Zeit, nach einem kräftigen Schluck alte Rechnungen zu begleichen. Die Häuser der Obrigkeit wurden mit Teer beschmiert, die Schaufenster der Ladenbesitzer gingen mithilfe selbst gebauter Bomben in Scherben, und die Kundschaft wurde zu Tode erschreckt, indem ein Pferdeschlitten mit brennenden Teerfässern die Hauptstraße hinuntergejagt wurde. 1855 blieb in Lerwick sogar kein einziges Fenster mehr heil, als Bösewichte die Kanonen des Forts mit toten Katzen luden und damit das Stadtzentrum beschossen. Der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen brachte, war ein Splitterbombenanschlag auf den örtlichen Steuerinspektor im Jahr 1870. Wie durch ein Wunder überlebte der Mann den »Scherz«, aber für die meisten Shetländer war das Maß damit voll. Die Honoratioren setzten sich zusammen und erfanden das Up-Helly-Aa-Festival. Das war zwar auch etwas mit Feuer, aber ein Fest für die gesamte Bevölkerung und obendrein mit einem historisch legitimierten Anstrich.
Aus dieser Zeit stammen auch die vielen geschriebenen und ungeschriebenen Regeln rund um das Fest. So bedarf es etwa der Beharrlichkeit, Hingabe und jahrelangen Führungserfahrung in einer Gruppe, um zum Guizer Jarl ernannt zu werden. Schon fünfzehn Jahre im Voraus steht fest, wer dieses ehrenvolle Amt auf den Shetlands in Zukunft bekleiden darf. Zeit genug, um sich die Haare wachsen und einen Bart stehen zu lassen – eine weitere Regel. Guizer Jarl Davie Mathewson, der sich zu diesem Anlass mit dem Namen Sigurd der Kühne schmückte, betrachtete es bereits als Höhepunkt seines Lebens. »Schöner als mein Hochzeitstag. Ich habe 1976 als Kaninchen angefangen, und jetzt stehe ich hier als Wikingerhäuptling.«
Frauen dürfen sich am Fackelzug nicht beteiligen. Ihre Aufgabe ist es, zu kochen, zu servieren und abzuwaschen. Dorothy Stove zufolge hat man das zwar schon einige Male zu ändern versucht. »Aber das waren Feministinnen aus dem Süden. Die hatten keine Ahnung von diesem Fest. Ich finde es überhaupt nicht schlimm, einmal für die Männer zurückzustecken. Zu Hause bin ich den Rest des Jahres der Boss.«
Ohne eine deftige Mahlzeit wäre das Up Helly Aa übrigens auch nicht zu überstehen. Obwohl es sich offiziell um ein alkoholfreies Festival handelt, wurde die ganze Nacht über tüchtig gebechert. Was in der Praxis darauf hinauslief, dass jeder in Innentaschen und Plastiktüten Flaschen mit Schnaps bei sich trug, der aus Limonadengläsern getrunken wurde.
Das Freudenfeuer mag der spektakuläre Höhepunkt des Up Helly Aa sein, aber eigentlich ist es nur der Anfang des Festes. Nach der Schiffsverbrennung beginnen die verschiedenen Gruppen einen Zug durch etwa zehn Säle, der bis zum nächsten Morgen dauern soll. Dort führen sie ihr Theaterstück auf, um anschließend zur Musik der Liveband mit den anwesenden Frauen zu tanzen.
Denn das Up Helly Aa ist auch ein Heiratsmarkt. Einmal im Jahr erhalten die unverheirateten Mädchen auf den Shetlands die Gelegenheit, alle geeigneten Kandidaten an sich vorbeiziehen zu lassen. Fiona aus Cunningsburgh wartete auf Danny aus Lerwick. Für ihn hatte sie ihr schönstes und freizügigstes Kleid angezogen. »Leider ist er in einer der letzten Gruppen, und ich muss bis sieben Uhr morgens warten.« Während das Publikum bei den Auftritten der umherziehenden Gruppen regelmäßig vor Lachen von den Stühlen fiel, heimlich noch einmal die Gläser füllte und sogar ich als einziger Ausländer schon gelernt hatte, den Strip the Willow zu tanzen, saß Fiona immer noch auf ihrem Stuhl, sah hübsch aus und lehnte alle Bitten um einen St. Bernard’s Waltz oder einen Boston Two Step entschieden ab. »Danny ist nun einmal der einzig Wahre.«
Am nächsten Morgen, nachdem alle Gruppen in allen Sälen getanzt hatten und Danny sein Küsschen bekommen hatte, spielte sich in Lerwick ein bizarres Schauspiel ab. Es hatte geschneit, und in der ersten Morgendämmerung standen Mütter und Töchter am Ausgang des Saales bereit, um die Väter zu stützen. Ein Pinguin hing um den Hals seiner Frau. Die hintere Hälfte einer Kuh konnte noch selbst laufen. Auf einer Bank in der Nähe der qualmenden Überreste des Wikingerschiffs saßen zwei Männer in Tiroler Tracht Arm in Arm. Kurz vor der Stadt sah ich einen Normannen auf unsicheren Beinen, der langsam durch die kahlen weißen Hügel nach Hause taumelte. Als am dunkelblauen Morgenhimmel ein Streifen grünes Polarlicht auftauchte, hob der Mann dem glühenden Firmament die Faust entgegen. »Vikings«, brüllte er mit heiserer Stimme seinen vermeintlichen Vorfahren zu, den Metallhelm schräg auf dem Kopf. Ein einsames Pony blickte unter seiner beschneiten Mähne dem schwankenden Mann nach. Ich konnte bei dieser Szene nur an eines denken: Ich war im Norden, dem geträumten Norden.
THULE – EIN ÄUSSERSTES
Es war 325 v. Chr. Es war Winter. Und Pytheas blickte in Massalia, das heute Marseille heißt, in das Dunkel über der Hafenstadt. Am Himmel stand ein unbeweglicher gelblicher Stern, der Alpha Ursae Minoris, um den sieben hell und sieben schwächer leuchtende Sterne kreisten. Zusammen bildeten sie die Hüften und den Schwanz eines großen Bären, des Ursa Major. Pytheas starrte auf den stillstehenden Mittelpunkt des Universums. Dort, unter diesen Sternen, dort lag der Norden, das wusste er. Arktikos nannten die Griechen ihn, das Land des Großen Bären.
Pytheas kannte die Geschichten. Im Norden, unter dem Drehpunkt der Sterne, lebten wilde und barbarische Völker. Die Kynokephalen, Menschen mit Hundeköpfen, und die Arimaspen, einäugige Männer, die Gold aus den Klauen von Raubvögeln rissen, oder die Skythen, die das Grasland oberhalb des Schwarzen Meeres bevölkerten. Man konnte sie aufsuchen und Handel mit ihnen treiben, sie hatten Pferde und Pelze, Zinn und Bernstein. Doch man musste vorsichtig sein, denn es waren launische und jähzornige Menschen, die das Wesen von Bären hatten. Sie verschlangen rohes Fleisch und Fett und die angebrüteten Eier von Sumpfvögeln. Es war Pack, das geradezu Albträumen entsprungen war. Wenn sie sprachen, machten sie Tiergeräusche, unerwünschte Besucher fraßen sie auf, und die Männer teilten das Bett mit ihren Töchtern und Schwestern.
Ein undurchdringliches Gebirge begrenzte die Länder der Barbaren, aus denen der bitterkalte Nordwind, der Boreas, wehte. Und dort, weit hinter diesen Bergen, in einem Gebiet über dem Wind, lebte das älteste Menschengeschlecht, die Hyperboreer, in einer Gegend, wo ewig Sommer war und die Bäume immer Früchte trugen. Es war ein Land, das angenehmer, lieblicher und fruchtbarer war als jedes andere. Die Weiden waren so nahrhaft, dass das Vieh täglich nur wenige Stunden darauf grasen durfte, da es sonst platzte. Das plätschernde Wasser erzeugte dort sanfte Musik. Die Luft flirrte vom Gesang der Mädchenchöre. Zwölfmal im Jahr wurden die Trauben geerntet. An den Weizenpflanzen wuchsen Brote. Die Menschen lebten in vollkommenem Frieden, fern von Boshaftigkeit, Tyrannei und Kriegen. Die Zeit verbrachten sie mit Gesang und Tanz, in aller Ruhe und Behaglichkeit. Die Hyperboreer arbeiteten nicht, Krankheiten waren ihnen fremd, sie waren völlig frei von Sorgen. Sie waren mit wenig zufrieden und von besinnlicher Natur. Der Tod ging an ihnen vorüber, sofern sie nach tausend Jahren nicht genug vom Leben hatten. Dann nahmen sie noch ein Festmahl zu sich und sprangen von einer Klippe ins Meer. Das war die glücklichste Art zu sterben. Zu jenem Land, diesem glückseligen Hyperborea, zog es ihn – den Seemann, Kaufmann, Astronomen – hin. Pytheas wurde Entdeckungsreisender.
* * *
Pytheas’ Welt war das Mittelmeer, unser Meer, der Mittelpunkt der zivilisierten Welt. Es war ein Gebiet mit einem angenehmen und fruchtbaren Klima, umgeben von heißen Wüsten im Süden und kalten Bergen im Norden.
Massalia, Pytheas’ Wohnort, war eine Kolonie der griechischen Hafenstadt Phokaia und wurde einst auf Anweisungen eines Orakels aus Ephesus gegründet, woraufhin die griechischen Seefahrer dort einen Tempel für die vielbrüstige Göttin Artemis errichtet hatten. Zur Zeit von Pytheas stand dieser Tempel noch immer auf einem Hügel oberhalb des natürlichen Binnenhafens, neben einem Heiligtum für Apollon Delphinios, einen Meeresgott in der Gestalt eines Delfins. In der Nähe lagen der Markt und das Theater. Die ummauerte Stadt zählte etwa 40000 Einwohner.
Der Hafenort an der Südküste Galliens war ein wichtiger Handelsknotenpunkt für die Griechen und die Kelten. Luxusgüter aus dem östlichen Mittelmeerraum, wie Weinkrüge, Töpfe und Ölkannen, wurden gegen Wein, Obst, Salz und Gewürze aus dem gallischen Hinterland getauscht. Von Massalia aus kontrollierten die Griechen den Seehandel im westlichen Mittelmeer. Sie gründeten mehrere Kolonien entlang der südgallischen und der östlichen iberischen Küste, aus denen sie Silber und Kupfer einführten. Und nicht zu vergessen das Zinn, das neben Kupfer der wichtigste Bestandteil von Bronze war, dem Metall, aus dem Waffen, Werkzeuge und Schmuck geschmiedet wurden.
Bis im dritten Viertel des 4. Jahrhunderts v. Chr. die Zinneinfuhr ins Stocken geriet. Die Karthager kontrollierten die spanischen Minen, blockierten den Zugang zum Mittelmeer bei den Säulen des Herkules und kämpften auf Sizilien gegen die Griechen. Es stand viel auf dem Spiel: Das mächtige Karthago beanspruchte von Nordafrika aus das alleinige Recht auf Seefahrt. Der Stadtrat von Massalia – der aus sechshundert Männern bestand, deren Familien seit mindestens drei Generationen in der Hafenstadt lebten – beauftragte einen gewissen Pytheas mit der Suche nach neuen Versorgungswegen. Von den Kelten hatten die Massalier Geschichten über die Zinnminen im Norden gehört.
Pytheas tat, was ihm aufgetragen worden war. Sein Vater war ein Kaufmann von bescheidener Herkunft, er gehörte nicht zur Aristokratie von Massalia. Gleichwohl hatte Pytheas eine Ausbildung genossen, die ihn für diese Reise befähigte. In der Schule hatte er Astronomie, Geografie und Mathematik studiert, als junger Mann hatte er das Mittelmeer befahren, und auf den Straßen und an den Kais von Massalia hatte er Keltoi, die Sprache der Kelten, sprechen gelernt.
Pytheas begann seine Reise in den Norden auf einer Route, die die Massalier häufig für den Weinhandel nutzten: an der Küste entlang bis zur Mündung der Aude, dann stromaufwärts nach Carcaso – dem heutigen Carcassonne – und nach einer Überquerung des Vorgebirges der Pyrenäen zum Fluss Garonne. Dort, wo der Fluss ins Meer mündete, sah er zum ersten Mal den Ozean, ein gieriges Wasserungeheuer, das in seiner unendlichen Weite die bekannte Welt umzingelte und mit seinen Klauen nach jenen ausschlug, die an seiner Unendlichkeit zu zweifeln wagten und sich auf die Suche nach dem Rand oder dem Land der Unterwelt oder nach dem Zugang zu ihm begaben. So hatte er gelesen.
Der Massalier fand sich im Ästuar der Garonne in einer ihm unbekannten Welt wieder. Das Mittelmeer kannte kaum Gezeiten. Dort, an der Ozeanküste, fiel der Meeresboden zweimal am Tag trocken. Zwischen Ebbe und Flut maß er Unterschiede von bis zu fünfzehn Metern. Er sah Inseln, die bei Ebbe plötzlich über einen Sanddamm zugänglich wurden.
Mit ortsüblichen Schiffen, die aus grobem Holz gezimmert und mit quadratischen Segeln aus Tierhäuten versehen waren, fuhr er die Küste entlang bis nach Amorica und wagte dann die 150 Kilometer lange Überfahrt nach Cornwall, über ein Meer mit bis zu zwanzig Meter hohen Wellen. Dort, auf der anderen Seite, sollten sich dem Historiker Herodot zufolge die Kassiteriden, die Inseln mit den unerschöpflichen Zinnquellen, befinden.
In Britannien wunderte sich Pytheas aufs Neue. Dies war nicht das Land der Barbaren oder der ewig glücklichen Menschen. Die Briten glichen den Griechen, mit dem einzigen Unterschied, dass sie ihr Getreide innerhalb des Hauses lagerten, weil es so oft regnete, und dass sie keinen Wein, sondern Bier tranken. Doch Handel trieben sie ebenso gerne wie die Massalier. Sie hatten viele Könige und lebten in Frieden zusammen. Und sie sprachen eine Variante des Keltoi, der Sprache, die er aus dem Hafen von Massalia kannte.
In Bodrifty, einer Siedlung in der Nähe von Land’s End, sah er die runden Häuser mit Strohdächern. Die Briten hielten Schafe, Kühe und Schweine, sie bewegten sich mit kleinen Pferden fort, die sie manchmal vor zweirädrige Karren spannten, und bauten Gerste an. Und sie schürften nach Zinn, das in dem felsigen Boden dicht unter der Oberfläche zu finden war. Sie schmolzen das Metall in heißen Feuern zu Barren, die sie ins Ausland verschifften.
Von Cornwall aus reiste er weiter hinauf, an der britischen Westküste entlang. Mit einem Gnomon, einer Reisesonnenuhr, maß er unterwegs den Sonnenstand und notierte die Länge der Tage: siebzehn Stunden auf der Isle of Man, achtzehn Stunden auf Lewis, neunzehn Stunden auf den Shetlands. Jedes Mal schätzte er die Entfernung nach Massalia. Er sah die geschützten Buchten der Hebriden. Auf den Orkney-Inseln entdeckte er einen Steinkreis, der dort seit Tausenden von Jahren stand und von dem er vermutete, dass er auch als Apollon-Tempel gedient hatte. Er selbst war hier zwar neu, doch der Mensch war hier schon alt.
* * *
Und dann stand Pytheas auf den Klippen von Hermaness, im Norden von Unst, der obersten Insel der Shetlands. Achtzehn Breitengrade hatte er überquert, mehr als alle Reisenden vom Mittelmeer aus vor ihm, und noch immer war das Ende des Nordens nicht in Sicht. Er starrte an Out Stack und Muckle Flugga vorbei in die Ferne. Dort musste noch ein Land liegen, hatten sie ihm erzählt, ein sechs Schiffstagesreisen entferntes Land, in dem die Sonne im Sommer nie schlief und das Meer zugefroren war. Er sah die Ränder des Kosmos vor sich liegen, ohne sie wirklich erreichen zu können.
Er begab sich zurück auf die Hauptinsel. Von Unst auf die Insel Yell und dann zur Siedlung Clickimin, wo in und um einen broch, einen Steinturm, Bauern lebten, die auch fischten. Auf den Schafweiden lagen die Knochen von Walen. Auf Keltoi bat er die Männer, ihm das Land am Ende der Welt zu zeigen. Sie nahmen ihre currach, lange, schmale Boote mit tierhautbezogenen Holzskeletten, und stachen in See.
Es war der Sommer des Jahres 325 v. Chr.
Hier, weit entfernt von seinem Meer, unserem Meer, seinem blauen Meer im Zentrum der Welt, trieb Pytheas auf dem Okeanos. Hier im Norden und Westen. Sie waren sechs Tage und Nächte lang gesegelt und gerudert. Dann war dort diese Insel, auf der die Bewohner Getreide anbauten, wo die Böden der Häuser aus getrocknetem Lehm bestanden und wo sie Met tranken. Das war Thule, das unerreichbare Thule, Ultima Thule. Aber er wollte noch weiter. Ein weiterer Schiffsreisetag würde ihn bis ans äußerste Ende der Welt bringen.
Und dann hörte es auf.
Das Meer war dick, die Luft war dick. Wasser und Luft waren eins. Das Wasser war weiß und konnte ihn nicht tragen, kalte Steinbrocken prallten gegen das kleine Schiff, Rudern war in dieser dicken Masse unmöglich. Die Luft war weiß, sie hatten keine Sicht. Wir sind in einer Meereslunge gefangen, notierte Pytheas, das Meer ist ein gigantischer Organismus, eine Qualle, die atmet und zittert. Er bat die Männer umzukehren. Das war das Ende. Weiter ging es nicht.
* * *
Pytheas kehrte nach Massalia zurück. Über die englische Ostküste reiste er in Richtung Dänemark, wo er Bernstein mitnahm. Über die Niederlande und die französische Westküste gelangte er wieder zu seinem Geburtsort. Dort erzählte er von den Zinnminen in Cornwall. Und er schrieb über Ultima Thule und das Ende der Welt. Peri Tou Okeanou (Über den Ozean) hieß die Papyrusrolle, in der er von seiner Reise, dem Meer, den Sternen und der Geografie des Nordens erzählte. Es war ein schockierendes Buch, mit so vielen Neuigkeiten, dass man Pytheas nicht immer glaubte.
Trotz dieser anfänglichen Skepsis erlangte Peri Tou Okeanou zu Beginn des 3. Jahrhunderts v. Chr. große Bekanntheit. Achtzehn griechische Schriftsteller zitierten aus dem Werk. Am Lykeion in Athen standen die Entdeckungen des Pytheas auf dem Lehrplan. Die Bibliothek von Alexandria – in der Antike die größte Bibliothek der Welt und das Zentrum allen Wissens – nahm Peri Tou Okeanou in ihre Sammlung auf.
Auch römische Gelehrte machten eifrig von Pytheas’ Wissen Gebrauch. Im Jahr 77 n. Chr. schrieb Plinius der Ältere in seiner Naturalis Historia, seinem allumfassenden Buch über die Welt:
In diesem Land bekräftigen die hellen Nächte des Sommers zweifellos etwas, das uns auch die Vernunft zu glauben zwingt: In der Zeit der Sommersonnenwende, wenn sich die Sonne dem Pol der Welt stärker nähert, wo ihr Licht einen engen Kreis beschreibt, erhält der darunter liegende Teil der Erde sechs Monate ununterbrochen Tageslicht. Umgekehrt ist es dort ununterbrochen Nacht, wenn sich die Sonne zum Wendekreis des kürzesten Tages zurückgezogen hat. Das zeige sich auf der Insel Thule, schreibt Pytheas von Massalia, welche sechs Schiffstagesreisen nördlich von Britannien liege.
Doch das Buch des Pytheas ging letzten Endes verloren. Bei einem der vielen Brände in der Bibliothek von Alexandria sollte auch das letzte Exemplar von Peri Tou Okeanou in Flammen aufgehen.
Was blieb, war Thule, ein Wort, von dem niemand so recht wusste, was es bedeutete, das aber bis in die Renaissance hinein auf Landkarten zu finden war. War Thule vielleicht altnorwegisch für »gefrorene Erde« oder »gefrorener Baum«? Oder altirisch für »Stille«? Altsächsisch für »Grenze«? Altarabisch für »weit entfernt«? Oder stammte es vom altgriechischen Wort thoulé ab, wenngleich niemand mehr weiß, wofür das stand? Oder sollte es von tholos abgeleitet sein, was wiederum »trübe« bedeutete?