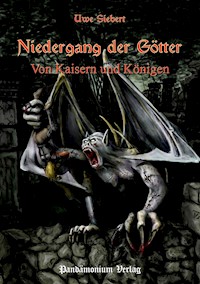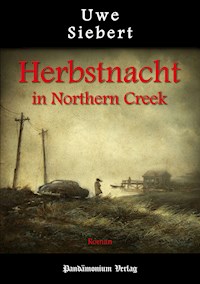Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: neobooks
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Nach seinem Sieg über Boldar die Bestie bricht Larkyen, der Sohn der schwarzen Sonne, gen Westen auf. Dort will er sich einen lang gehegten Wunsch erfüllen und die Heimat seiner Ahnen bereisen. Sein Weg führt ihn durch das Gebirgsreich Kanochien, wo er sich einem schier übermächtigen Gegner stellen muss. Denn Nordar, der Gott des Krieges, fordert Rache für ein von Larkyen verübtes Massaker. Doch der Kriegsgott verfolgt noch andere Ziele, deren Erfüllung das Ende der Welt bedeuten würde. Gemeinsam mit neuen Verbündeten stellt sich Larkyen der Bedrohung.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 136
Veröffentlichungsjahr: 2014
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Uwe Siebert
Der Gott des Krieges
Dieses ebook wurde erstellt bei
Inhaltsverzeichnis
Titel
Vorwort von Holger Pinter
Einleitendes Zitat
Einleitung
Prolog
Kapitel 1 – Im Reich des Löwen
Kapitel 2 – Ein Sturm zieht auf
Kapitel 3 – Krieg und Frieden
Kapitel 4 – In der Wildnis
Kapitel 5 – Die Festung
Kapitel 6 – Der Berg der drei Stürme
Kapitel 7 – Schwarzer Stahl
Kapitel 8 – Treue Gefährten
Epilog
Anhang
Über den Autor
Werbung
Impressum
Impressum neobooks
Vorwort von Holger Pinter
„Der mächtige Held mit den wunderbaren Kräften, der auf einem Finger den Berg Govardhan heben und sich mit dem Glanz des Universums erfüllen kann, ist jeder von uns: nicht das physische Selbst, das uns der Spiegel zeigt, sondern der innere König.“
Joseph Campbell – Der Heros in tausend Gestalten
Wie? Jeder Mensch ein Held? Gibt es überhaupt noch einen Platz für Helden, wenn der Mount Everest schon von fitten Blinden und Teenagern bestiegen werden kann? Andererseits sind es auch Zeiten, in denen ein Rentner von Jugendlichen totgeschlagen wird, die er auf das Rauchverbot an einem Bahnsteig hingewiesen hat. Zeiten, in denen doch tatsächlich darüber diskutiert wird, ob dieser Hinweis eine unnötige Provokation war.
Oder verlangen solche Zeiten mit Nachdruck nach einem Helden, der so rot sieht, wie Charles Bronson in seinem berühmten Film? Ein solcher Held brauchte wirklich Courage, denn genau in diesen Zeiten, nämlich im Frühling 2010, mußte ein Mann Schmerzensgeld an einen Einbrecher zahlen, den er mit einer Eisenstange verprügelt hatte. Dabei hat dieser Einbrecher noch vor diesem Urteil mit zwei weiteren Einbrüchen bewiesen, daß er noch nicht genug verprügelt worden war.
Heute lassen sich „Helden“ in Politikerreden beweihräuchern, die gegen Hitler oder den Klimawandel aufstehen. Und weil Hitler zu tot und der Klimawandel zu theoretisch ist, um sich zu wehren, darf heute jeder so ein „Held“ sein. Wir sollen ja auch alle gleich sein. Egal, ob Mann oder Frau. Egal, mit welchen Fähigkeiten die Natur uns ausgestattet hat. Und behindert ist man nicht, heißt es nun. Behindert wird man. Hauptsache, die Gesinnung stimmt. Daß dieser „Held“ das Weite sucht und uns im Stich läßt, wenn es gefährlich wird, müssen wir als menschliche Schwäche tolerieren, denn in unserer Defizit-Gesellschaft sind es die Schwächen, die den Menschen ausmachen. Der letzte Rest von Risiko, den wir in Zusammenhang mit diesen „Helden“ noch wahrnehmen, ist das Risiko, von ihren Geschichten zu Tode gelangweilt zu werden.
Wenn wir uns den klassischen Helden zuwenden, erkennen wir zwei besondere Helden-Typen: Den, der das Abenteuer sucht, und den, der vom Schicksal in die Rolle des Helden getrieben wird. Was beide Typen gemeinsam haben, ist die Würde, mit der sie Einsamkeit und Verzweiflung ertragen.
Der klassische Held, der das Abenteuer sucht, wird wahrscheinlich einen entsprechenden Beruf wählen. In Literatur und Film sind solche Helden oft Soldaten oder Privatdetektive. James Bond ist ein perfektes Beispiel. Ein Beispiel für den unfreiwilligen Helden finden wir im eingangs schon erwähnten „Ein Mann sieht rot“ mit Charles Bronson, wo der Protagonist wohl in seinem Architekturbüro geblieben wäre, wäre seine Familie nicht Opfer eines Verbrechens geworden.
Die ganz großen, epischen Helden haben oft beide Rollen gespielt. Odysseus suchte und fand Ruhm und Ehre in den zehn Jahren des Kampfes um Troja. Seine darauf folgende Irrfahrt, die weitere zehn Jahre dauerte, war nicht geplant. Er behauptete sich trotzdem.
Bei Uwe Sieberts Larkyen verläuft die Geschichte in umgekehrter Reihenfolge. Der Held lebt ein friedliches Nomadenleben, bis ihn das Gemetzel an seinem Stamm zum Kampf zwingt. Nachdem Larkyen mit den Übeltätern aufgeräumt hat, kehrt er aber nicht in sein altes Leben zurück. Ein Mensch, der das Potential seiner Möglichkeiten begriffen hat, kann nur noch unglücklich werden, wenn er hinter diesen Möglichkeiten zurück bleibt. Das ist, nebenbei erwähnt, die Ursache der meisten Zivilisationskrankheiten. Daß Larkyen einer Bestimmung folgt, rückt ihn in die Nähe des mythischen Helden. Und die archaische Umgebung, in der er seine Abenteuer erlebt, steht für die Zeitlosigkeit der Geschichte und sollte uns nicht den Blick darauf versperren, daß Larkyen ein Held für das 21. Jahrhundert ist. Was wir von ihm lernen dürfen, ist zu tun, was wir können, um zu werden, was wir sind. So folgen wir unserer Bestimmung, statt der breiten Masse. Ob uns das zum Helden macht, muß jeder selbst entscheiden. Denn es sind immer unsere eigenen Entscheidungen, die uns zu dem machen, was wir sind. Die Zeit der Ausreden und der Sündenböcke neigt sich dem Ende zu. Sollte Ihnen diese Philosophie zu hoch sein, können Sie sich auch einfach ganz hervorragend unterhalten lassen!
„Der moderne Held, der Mensch von heute, der es auf sich nimmt, dem Ruf zu folgen und die Stätte jener Kraft zu suchen, mit der allein unser ganzes Geschick gestillt werden kann, kann und darf nicht warten darauf, daß die Gesellschaft ihren Pfuhl von Hochmut, Furcht, heuchlerischem Geiz und verstellter Feindseligkeit bereinigt. „Lebe, als ob der Tag da wäre“, heißt es bei Nietzsche. Nicht die Gesellschaft hat den schöpferischen Heros zu lenken und zu erretten, sondern er sie. Und so teilt jeder von uns das höchste Gottesgericht und trägt das Kreuz des Erlösers – nicht in den Augenblicken großer Stammessiege, sondern im Schweigen seiner einsamen Verzweiflung.“
Joseph Campbell – Der Heros in tausend Gestalten
Einleitendes Zitat
„Kraft herrscht über alles Lebendige,
bestimmt was Recht und Unrecht ist.“
Ragnar Redbeard
Might is Right
Einleitung
In einer längst vergessenen Zeit großer Kriege und Abenteuer, lebte Larkyen, der im Schein einer schwarzen Sonne geboren wurde.
Im Mannesalter nach einer schweren Verwundung von den Toten auferstanden, besaß er fortan außergewöhnliche Fähigkeiten:
Unsterblichkeit, einer der größten Wünsche der Menschen. Insbesondere jener, die nach mehr streben als in einer natürlichen Lebensspanne zu erreichen wäre. Und ebenso all derer, die ihre fleischliche Existenz als etwas Einzigartiges und unschätzbar Wertvolles erkannt hatten.
Schiere Unverwundbarkeit – von denen herbeigesehnt, die den Klingen und Klauen ihrer Gegner niemals unterliegen wollten.
All jene, denen diese Gaben zuteil wurden, nannten sich Kinder der schwarzen Sonne.
Für die Menschen, waren sie die Götter ihrer Zeit.
Seit jeher suchte die Kinder der schwarzen Sonne ein Hunger heim, den kein anderes Lebewesen kennen konnte– der Hunger nach der Energie des Lebens.
Sie zehrten von der Lebenskraft der Menschen und Tiere, und brachten ihnen den Tod.
Dennoch wurde Larkyen, dem Sohn der dritten schwarzen Sonne, viel Ruhm unter den Menschen zuteil.
Gefürchtet als Rächer und verehrt als großer Krieger, zog er durch die Welt, in dem Wissen, dass seine Geschichte für die Ewigkeit bestimmt war …
Prolog
Über den Ufern des Kharasees kreisten die Aasvögel. Immer wieder ließen sie sich am Boden nieder, um ihren Hunger auf einem Feld aus totem Fleisch zu stillen. Hunderte kedanische Krieger lagen hier mitsamt ihren Reittieren seit dem Ende des letzten Herbstes und verrotteten. Schon nächsten Sommer würden außer Waffen und Rüstzeug nur noch sauber abgefressene Gebeine zurückbleiben. Und an all jene, die einst für große Kriege geboren wurden, würde man sich im Norden der Welt nur noch in Geschichten erinnern.
Die schimmernden Raubtieraugen des Riesen beobachteten lange Zeit dieses Feld der höchsten Ehre. Das letzte Mal, als er hier gewesen war, hatten gewaltige Gletscher diesen Teil der Welt unter sich erdrückt. Zurückgeblieben war eine endlos erscheinende Steppenlandschaft, die von den Stämmen der Majunay bewohnt wurde. Nahe dem Wasser erspähte er fünf Männer, die die Leichen derer fledderten, die sie früher zu Recht gefürchtet hätten. Er musterte sie voller Abscheu. Ihrer Gier nach schienen sie nicht den Nomaden anzugehören, sondern zu lange in zwielichtigen Vierteln einer Stadt zugebracht zu haben. Ihre Körperhaltung, ihr Gang, ihre schlaffen Muskeln, all das wies sie als geschwächte Existenzen der Zivilisation aus. Längst hatten sie sich von der Natur ihrer Art entfernt.
Nur den Starken gebührte Ehre, nur den Starken gebührte das Leben, alles andere war für die Vernichtung bestimmt.
Zu lautlos für eine Gestalt seiner Größe bewegte sich der Riese vorwärts auf seine auserkorenen Opfer zu. Die Plünderer bemerkten ihn erst, als es zu spät war. Angst stand ihnen in die Augen geschrieben, als er einen von ihnen mit seinen großen Händen packte und in die Höhe hob. Durch die bloße Berührung zerfiel der schwächliche Leib binnen eines Atemzuges zu Staub. Die anderen Plünderer teilten dasselbe Schicksal. Der Wind blies ihre Überreste über die Gewässer des Kharasees hinweg.
Fünf Leben, deren Kraft, so gering sie auch war, nun den mächtigen Leib des Riesen erfüllte.
Das Getrappel von Hufen erklang. Der Riese wand sich witternd dem Geräusch entgegen. Zwei Dutzend Soldaten der Majunay, die das Banner des schwarzen Drachen auf rotem Tuch mit sich führten, ritten auf ihn zu. Sie trugen schwarze Rüstungen aus leichtem Metall, ihren drahtigen Leibern in eleganter Form angepasst. Eiserne Masken bedeckten ihre Gesichter und imitierten durch filigran gearbeitete Konturen unmenschliche Züge.
Die Soldaten dieses Landes galten als gute Krieger. Es hieß, sie seien weise und wüssten die Stärke ihrer Gegner gut einzuschätzen. Dennoch begingen sie den Fehler, ihre Waffen zu ziehen …
Der Kampf dauerte nicht lange, dann war alles vorbei. Der Riese stand inmitten der Überreste von dreiundzwanzig toten Soldaten, deren Fleisch dem Getier frische Nahrung bieten würde. Die hinter Eisenmasken verborgenen Gesichter mochten noch von der Ehrfurcht zeugen, die sie im Moment ihres Todes empfunden hatten, als sie erkannten, wem sie da gegenüberstanden.
Ihm, der einst begonnen hatte zu atmen, während die Sonne in der Geschichte der Welt zum ersten Mal schwarz wurde. Ihm, mit Namen Nordar, den die Menschen des hohen Nordens als den Gott des Krieges verehrten.
Nur einen von ihnen hatte er am Leben gelassen. Einhändig hob er den verwundeten Mann zwischen den Überresten seiner gefallenen Kameraden hervor und sah ihm tief in die Augen. Lange war es her, dass die Lippen des Kriegsgottes Worte geformt hatten. Seine Stimme klang mehr wie ein Grollen: „Soldat, nenne mir deinen Namen.“
Der Verwundete wandte seinen Blick ab und gab winselnd Antwort: „Hauptmann Ahiro, von den Reitern des schwarzen Drachen.“
„Hauptmann, ich grüße dich. Ist dir dieses Schlachtfeld bekannt? Gehörst du zu denen aus deinem Volk, die hier letzten Herbst gegen das kedanische Heer kämpften?“
Hauptmann Ahiro nickte zaghaft.
„Kämpfte ein Krieger an eurer Seite, dessen Kampfkraft die eines gewöhnlichen Menschen übertraf?“
„Ja!“
„Wie sah er aus?“
„Er war westlicher Herkunft. Es hieß, er sei ein Kentare. An seiner linken Hand trug er ein dunkles Mal, eine lodernde Sonne. Und seine Augen waren wie deine.“
„Wie lautete der Name dieses Kriegers?“
„Er hieß Larkyen.“
Nach diesen Worten zerfiel der Leib des Hauptmanns zu Staub und bröselte auf die Rüstungen seiner gefallenen Kameraden hinab.
Kapitel 1 – Im Reich des Löwen
Zwanzig Tage waren vergangen, seitdem Larkyen begonnen hatte, von Norden aus an der Grenze Majunays entlang zu reiten. Westlich erstreckte sich das Land Kanochien über einen Teil des beinahe endlos erscheinenden Altoryagebirges. Die felsigen Regionen boten nicht viel Raum für Zivilisation. Nur wenige Siedlungen hatten die Kanochier inmitten eines von harten Wintern gepeinigten Hochlandes gründen können.
Trotz der enormen Lawinengefahr reiste Larkyen über den Pass, einen anderen Weg gab es nicht. Doch er war stets wachsam, und seine Sinne so scharf wie die besten Klingen der Völker des Ostens. Immer wieder spähte er unter der Kapuze seines Umhangs auf die umliegenden Felsgipfel. Bei den wenigen Menschen, die ihm bisher begegnet waren, handelte es sich meist um zwielichtige Händler. Sie alle hatten Larkyen gemieden, denn auch wenn sein Leib wie der eines Menschen aussah, so war er doch keiner. Schulterlange kastanienbraune Haare umrahmten ein kantiges Gesicht, das die Augen eines Raubtiers barg. Unter den dichten Brauen schimmerten sie auf fremdartige Weise in dunklem Grün. Seine Haut war glatt und frei von Makeln und erinnerte an das Antlitz einer marmornen Statue. Der Lederhandschuh an seiner Linken verbarg ein pechschwarzes Mal auf dem Handrücken, in Form einer lodernden Sonne – ein Zeugnis der Übermenschlichkeit.
Denn einst, vor über zwanzig Wintern, war Larkyen im Schein einer schwarzen Sonne geboren worden. Und wie alle, die in ihrer Finsternis zu atmen begonnen hatten, besaß auch er außergewöhnliche Gaben. Doch neben der gewaltigen Körperkraft, die seinen Leib erfüllte, den Selbstheilungskräften und der ewigen Jugend, war die Gabe, die Kraft anderer Lebewesen aufzunehmen und sie als die eigenen zu gebrauchen, die unheimlichste seiner mannigfaltigen Fähigkeiten. Trotzdem konnte er nicht verleugnen, wie sehr er seine Macht genoss.
Das Ziel der Reise war das Land Kentar. Die Heimat seiner Vorväter, gelegen im Westen der Welt. Schon zum nächsten Herbst hin, so hoffte Larkyen inständig, würde er das kleine Land an den Ufern des grauen Meeres endlich mit eigenen Augen erblicken. Welche tiefen Narben hatte der einst im Westen tobende Krieg wohl hinterlassen?
So weit der Weg dorthin auch war, er gelangte schneller voran, als es Menschen je möglich gewesen wäre. Längst verspürte er nicht mehr den Drang, essen, trinken, schlafen oder seine Notdurft verrichten zu müssen, denn der Leib eines Abkömmlings der schwarzen Sonne war von derlei Schwächen befreit. Und das riesenhafte Pferd, das er den Kedaniern abgenommen hatte, war ausdauernd und benötigte nur wenig Rast. Außerdem erwies es sich als zuverlässig und war ein geschätzter Gefährte geworden, den er nicht mehr missen wollte.
Das Tauwetter hatte eingesetzt, der Schnee schmolz vereinzelt und legte mit Felsgestein durchsetzte Wiesen frei. In großer Zahl plätscherten Bäche an den umliegenden Hängen hinab.
Am Rande eines lichten Waldstücks legte Larkyen die erste Rast in Kanochien ein. Und während das Pferd graste, wollte er sich wieder einmal in der Kampfkunst üben.
Er zog das Schwert Kaerelys aus der Scheide, die Klinge glitzerte in kühlem Blau. In Larkyens Händen war jene magische Waffe ein verheerendes Werkzeug der Massenvernichtung. Während er einen präzisen Todestanz vollführte, verursachte er nicht den geringsten Laut. Wäre er beobachtet worden, hätten die anderen lediglich einen rasenden Schatten inmitten der Wildnis erblickt und einen immer wieder durch die Luft fahrenden blauen Blitz. Mit Ehrerbietung dachte er dabei an seinen Lehrmeister Khorgo zurück, einen Veteranen der Reiterhorden Majunays. Bereits als Larkyen das erste Mal ein Schwert in die Hand genommen hatte, war er sich gewiss gewesen, dass er für den Kampf bestimmt war: Der Umgang mit der Waffe und das Töten des Feindes waren für ihn nichts, woran er sich erst hätte gewöhnen müssen. Vielleicht lag ihm der Kampf tatsächlich im Blut, wie der Lehrmeister an jenem Tage gesagt hatte. Dennoch galt es für ihn, im Streben nach stetiger Verbesserung, die erlernte Kunst auch weiterzuentwickeln.
Denn jene, die nicht strebten und sich jeglicher Entwicklung verschlossen, würden an ihrem eigenen Stillstand zugrunde gehen. – Eine Weisheit der Krieger.
Ein plötzliches Knacken im Unterholz ließ Larkyen innehalten. Sein grasendes Pferd wurde unruhig und schnaubte. Zeitgleich hatten sie etwas gewittert. Ein Bär, bei weitem größer als seine Artgenossen in den Wäldern der Täler, zeigte sich zwischen den Bäumen. Grauweiße Streifen, mit denen das braune Fell durchsetzt war, ließen ihn als einen der gefürchteten Gebirgsbären erkennen. Es gab Berichte, dass diese mächtigen Raubtiere nicht davor zurückschreckten, in ihrem Hunger nach Beute, sogar Handelskarawanen der Menschen anzugreifen.
Noch im selben Moment brach der Bär durch das Dickicht und sprintete auf das Pferd zu. Abwehrend bäumte sich der Hengst auf, trat mit den Vorderhufen. Getroffen wich das Raubtier zurück. Mit einer seiner furchteinflößenden Tatzen holte es zum Schlag aus. Die Krallen würden dem Hengst eine verheerende Wunde reißen, die früher oder später unweigerlich zum Tod führte.
Jetzt stellte sich Larkyen dem Raubtier in den Weg. Das Schwert würde er nicht brauchen. Er sah dem Bär nur in die Augen, spürte dessen Atem im Gesicht. Das Tier senkte die Tatze wieder, denn es hatte in Larkyen ein übernatürliches Wesen erkannt. Tiere wussten instinktiv, wann sie sich einem überlegenen wie auch gleichartigen Geschöpf gegenübersahen. Und so streckte der Unsterbliche seine Hand zu einer Berührung aus, die das eben noch so gefährliche Raubtier über sich ergehen ließ. Das Fell war dick und buschig, die Muskeln darunter hart. Larkyen fühlte den Herzschlag unter seinen Fingerspitzen, die Lebenskraft war beeindruckend. Larkyen hätte sie in diesem Augenblick nehmen können, doch er entschied sich anders. Es waren die Tiere, die sich ihrer Natur anpassten, mit ihr im Einklang lebten und ihrer Bestimmung nachkamen. Larkyen bewunderte sie dafür, und darum verdienten sie das Leben mehr, als manche unter den Menschen.
Als er seine Hand zurückzog, zuckte der Gebirgsbär für einen Moment zusammen. Noch einmal wandte er seinen Kopf zu dem Pferd, bevor er sich in den Wald zurückzog. Larkyen sah der Größten aller Bärenarten noch lange nach.