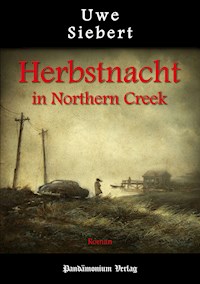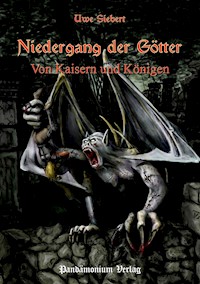
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Pandämonium
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Niedergang der Götter
- Sprache: Deutsch
Wie von Pandora geweissagt, steht eine Zeit großer Ereignisse bevor. Und so hat sich niemand anderes als der totgeglaubte König Larkyen den in Nemar stationierten Widerstandskämpfern angeschlossen. Das gefürchtete Totenheer folgt seinen Befehlen und gemeinsam beziehen sie ihre Stellung in den Sümpfen des einstigen Fürstentums. Der erwartete Großangriff erfolgt, Strygar und seine Mutter Santharia führen ihre Heere höchstpersönlich auf Nemar zu. Und während sich der Himmel verdunkelt und das Erdreich erbebt, tobt eine Schlacht, deren Ausgang eine ganze Epoche nachhaltig prägen wird.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 326
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Niedergang der Götter Teil 3
TitelseiteEinleitungPrologKapitel 1 – Die Finsternis nahtKapitel 2 – Die Einsamkeit der Gott-Kaiserin Teil IKapitel 3 – Niemand bleibt zurückKapitel 4 – Die Einsamkeit der Gott-Kaiserin Teil IIKapitel 5 – Verrat und FinsternisKapitel 6 – Die Einsamkeit der Gott-Kaiserin Teil IIIKapitel 7 – Angriff der KyaslanerKapitel 8 – Die Einsamkeit der Gott-Kaiserin: Teil IVKapitel 9 – Angriff der KultistenKapitel 10 – Die Einsamkeit der Gott-Kaiserin Teil VKapitel 11 – Die Macht der FinsternisKapitel 12 – Die Einsamkeit der Gott-Kaiserin Teil VIKapitel 13 – Ein letztes MalKapitel 14 – Die Einsamkeit der Gott-Kaiserin Teil VIIKapitel 15 – Der Tag danachKapitel 16 – Die Einsamkeit der Gott-Kaiserin Teil VIIIKapitel 17 – Der lange MarschEpilogAnhangImpressumTitelseite
Uwe Siebert
Niedergang der Götter III Von Kaisern und Königen
Pandämonium Verlag
Einleitung
In einer längst vergessenen Zeit großer Kriege und Abenteuer lebte Larkyen, der im Schein einer schwarzen Sonne geboren wurde.
Im Mannesalter nach einer schweren Verwundung von den Toten auferstanden, verfügte er fortan über außergewöhnliche Fähigkeiten:
Über die Gabe der Unsterblichkeit, einer der größten Wünsche der Menschen, insbesondere jener, die nach mehr streben als innerhalb einer natürlichen Lebensspanne zu erreichen wäre. Und ebenso all derer, die ihre fleischliche Existenz als etwas Einzigartiges und unschätzbar Wertvolles erkannt haben.
Über die Gabe der Unverwundbarkeit – von denen herbeigesehnt, die den Klingen und Klauen ihrer Gegner niemals unterliegen wollen.
All jene, denen diese Gaben zuteil wurden, nannten sich Kinder der schwarzen Sonne.
Für die Menschen waren sie die Götter ihrer Zeit.
Seit jeher suchte die Kinder der schwarzen Sonne ein Hunger heim, den kein anderes Lebewesen kennen konnte – der Hunger nach der Energie des Lebens.
Sie zehrten von der Lebenskraft der Menschen und Tiere und brachten ihnen den Tod.
Dennoch wurde Larkyen, dem Sohn der dritten schwarzen Sonne, viel Ruhm unter den Menschen zuteil.
Gefürchtet als Rächer und verehrt als großer Krieger, zog er durch die Welt, in dem Wissen, dass seine Geschichte für die Ewigkeit bestimmt war …
Prolog
Der Herzog von Eisenburg ritt inmitten des Kultistenheeres durch das Altoryagebirge. Schneeflocken umspielten seine Gestalt und ließen ihn inmitten dieser Wildnis aus Eis und Fels wie einen scharlachroten Albtraum erscheinen. Im Nachtreich erzählte man sich, dass die Eisenteile seiner Rüstung ihre Farbe bekamen, weil er sie mit dem Blut seiner Opfer bemalt hatte. Als einer der wenigen gesegneten Jünger genoss er sogar das Vertrauen des Herrn der Finsternis. Niemand anderes als Strygar persönlich hatte ihn in den großen Plan eingeweiht und ihm zudem ein besonderes Geschenk überreicht: einen schwarzstählernen Speer. Mit jener Waffe sollte er sich als Heerführer in der Schlacht behaupten. Siegehörte beileibe nicht zu den so schlicht anmutenden Erzeugnissen der damaligen Strygarer-Kriegsschmieden, sondern war durch kundige Götterhände im Zeitalter der zweiten schwarzen Sonne erschaffen worden. Dem Besitz der toten Patryous entstammend, trug der Speer noch einiges von ihrer Macht in sich. Wenn der Herzog seine Finger um den Schaft legte, flüsterte der Stahl ihm zu, berichtete von früheren Schlachten, nannte ihn mittlerweile sogar seinen neuen Gebieter. Und wer auch immer Zeuge geworden war, wie er sich damit in seiner Eisenburger Residenz in der Kampfkunst geübt hatte, bestätigte ihn als den besten Speerkämpfer weit und breit.
Zufrieden lauschte er den Gesängen seiner Soldaten:
Der Tod kommt auf Schwingen, in der Schwärze der Nacht,
mit Reißzähnen und Klauen aus Stahl.
Als seine Vorboten ziehen wir in die Schlacht,
für Gott Strygar ein letztes Mal.
Jene Verse und die dazugehörige disharmonische Melodie, in der sie wiedergegeben wurden, waren bereits vor mehreren Jahren für den langen Marsch nach Osten erdacht worden. Sie verfehlten ihren Sinn und Zweck nicht, nämlich das Heer bei kriegerischer Laune zu halten. Die Sprache der Kultisten war für die Menschenvölker jenseits des Nachtreichs noch immer unverständlich und klang für ihre Ohren wie Laute, die von tollwütigen Tieren hätten stammen können.
Zur Vernichtung erkoren: falsche Götter aus Fleisch,
Nordlands Erben zu Asche verbrannt.
Auf der alten Welt Trümmer erwächst unser Reich,
errichtet von Gott Strygars Hand.
Niemand aus ihren Reihen klagte über die Kälte, sie verspürten auch keine Furcht vor der Streitmacht des Widerstands. Und obgleich die von Larkyen auf der Donnerkuppe ausgelöste Lawine über Zweihundert von ihnen in den Tod gerissen hatte, war ihr Marsch nicht lange unterbrochen worden. Sie alle teilten die Bereitschaft, ihr Leben für Strygar zu opfern, und die Gläubigsten sehnten sich neben dem Wunsch, aus dem Brunnen des Lebens zu trinken, nach der sternenlosen Finsternis eines jenseitigen Paradieses.
Die Festung Nemar wird fallen, erbebend im Krieg,
seht unser heiliges Banner dort wehen.
Heil dir, Gott Strygar, nur dein ist der Sieg,
der Sonne Licht lass auf ewig vergehen.
Der Inhalt ihres Liedguts würde sich erfüllen, davon war der Herzog überzeugt. Denn wann immer auf einen Tag eine Nacht folgte oder ein Sturm das Licht der Sonne verdunkelte, widmete er dem Herrn der Finsternis ein inniges Gebet, und im Gegensatz zu Tausenden wurde er erhört. Beide sprachen auf diese Weise häufig miteinander, schließlich sorgte sich der fleischlose Gott um seine treuesten Jünger. Er war es auch gewesen, der den Herzog über die Vorposten des Widerstands und deren Verteidigungsanlagen informiert hatte. Nichts entging der Dunklen Allianz. Schon vor vielen Jahren hatten sie einen Spion in die Festung von Nemar entsandt, der an den von Castagyr einberufenen Versammlungen regelmäßig teilnahm.
Das Heer näherte sich der westlichen Grenze Laskuns. Zeitgleich überquerte Santharias Streitmacht den Ur-Ozean. Der Herzog lächelte in einem Anflug von Vorfreude, denn er war sich gewiss, dass das Schicksal, welches Strygar dem Volk von Kyaslan zugedacht hatte, kurz vor seiner Erfüllung stand.
Für gewöhnlich wäre für die Einwohner der Stadt Lyon-Kenyaan auch dieser Morgen von der malerischen Schönheit eines lohenden Sonnenaufgangs geprägt gewesen, doch die friedliche Idylle wurde mit der Wucht eines Kriegshammers zerschmettert, als die Flotte des heiligen Reiches am Horizont erschien. Ihre Schiffe rammten auf dem Weg in den Hafen die wesentlich kleineren Handelsschiffe und Fischerboote der Sterblichen und versenkten sie dadurch rasch. Kaum hatten sie angelegt, betraten die Götter das Festland. Wahrlich hatte es in der Geschichte der Welt größere Heere als das ihre gegeben, dafür war die Kampfkraft von Santharias Streitmacht mit einer schier unaufhaltsamen Urgewalt zu vergleichen. Hier und heute machten sie an den Ufern des Ur-Ozeans ihr Anrecht auf jenes Menschengeschlecht geltend, welches innerhalb der Stadtmauern so lange Zeit und über viele Generationen hinweg vortrefflich gedeihen durfte. Aus dem Zentrum, wo sich der Fluss über die prächtigen Kaskaden hinabstürzte und wo zu Ehren der Kyaslaner Statuen errichtet worden waren, stiegen Rauchwolken auf. Zahlreiche Gebäude hatten sie in Brand gesetzt, um die Bewohner hinaus ins Freie zu treiben. Schreie durchschnitten die Luft, hier und da winselten verängstigte Menschen vergeblich ihre Gnadengesuche. Das Heer der Götter aber war hungrig und fraß begierig die Leben Tausender, um sich für die große Schlacht zu stärken. Schon bald würde dieses Ereignis alsTag der Erntein die Geschichte der Welt eingehen.
Auf einem roten Teppich aus gerinnendem Blut und umgeben von anwachsenden Leichenbergen, schritten Santharia und der Totenflüsterer durch die Straßen. In einigem Abstand folgte ihnen der fleischlose Gott. Bevorzugt bewegte er sich inmitten der Schatten enger Gassen, Höfe und Hauseingänge. Während des ganzen Tumults bemerkten ihn nicht einmal die Kyaslaner.
Wäre der Anlass für Santharias Besuch ein anderer gewesen, hätte sie einen gebührenden Empfang erwartet. So aber nahm sie an dem Festmahl teil, grub ihre Hände in menschliche Leiber hinein, um sich immer wieder an der so vorzüglichen lyonischen Lebenskraft zu laben. Infolgedessen schimmerten ihre Augen heller denn je. Obgleich sie fühlte, wie die Narbe unter der heute genommenen Lebenskraft besser heilte als zuvor, würden Haut und Schädelknochen noch eine ganze Weile die Spuren von Castagyrs Stahl tragen. Sie legte keinerlei Wert mehr darauf, von einer Leibgarde umgeben zu sein. Eine Neigung, die sie ihrem früheren Gemahl immer ähnlicher werden ließ. Was ihr hingegen fremd blieb, war die Liebe zum Volk der Kyaslaner. Den meisten von ihnen widmete sie nicht einmal einen einzigen Blick. Ganz gleich, wie tief sie sich vor ihr verneigten oder wie hastig sie in Ehrfurcht zurückwichen – es waren doch nur Todgeweihte, Opfer auf dem zukünftigen Schlachtfeld, Futter für die Schattenbringer.
Die Villa des Statthalters war nahe. Sie freute sich darauf, ihn wiederzusehen. Kaum standen sie und der Totenflüsterer vor den Toren, als diese auch schon von zwei Wachen geöffnet wurden.
„Heil dir, Gott-Kaiserin!“, riefen sie aus.
Unter den schweren Rüstungen verbargen sich Kyaslaner. Nach Larkyens Rückkehr hatte Santharia persönlich acht Soldaten ausgewählt, um das Anwesen und den Statthalter zu schützen. So sehr sich die beiden Unsterblichen auch bemühten, ihre soldatische Haltung zu bewahren, konnten sie jene Mischung aus Angst und Ehrfurcht nicht verbergen, die ihren erbebenden Leibern innewohnte. Wie der Statthalter ihnen befohlen hatte, führten sie Santharia und ihren Begleiter durch die Korridore der Villa in den Garten. Dort hatten sich weitläufig die anderen sechs Wachen postiert und musterten aufmerksam die Umgebung. Kaum wurden sie der Kaiserin gewahr, nahmen sie Haltung an.
Auf der weitläufigen Terrasse aus hellen Sandsteinplatten knieten die sterblichen Bediensteten des Statthalters in zwei Reihen einander gegenüber. Ihre Häupter waren in einer anhaltenden Geste der Unterwerfung gesenkt. Eine Frau schluchzte leise, ein Knabe hatte sich vor Angst eingenässt. Zwischen zwei Steinsäulen stand der Statthalter selbst. Bis eben hatte er auf die tiefer liegenden Regionen der Stadt hinabgeschaut und das Wüten seiner Landsleute verfolgt. Ein Lächeln umspielte seine Mundwinkel.
„Willkommen in Lyon-Kenyaan, meine Gott-Kaiserin“, sprach der Statthalter. Dann verneigte er sich. Wie die meisten Kyaslaner verachtete auch er den Totenflüsterer und strafte ihn mit Missachtung.
„Es ist schon eine Weile her, seit ich zuletzt in dieser Stadt gewesen bin“, sagte sie. „Aber noch nie habe ich hier so gut gespeist wie an diesem Morgen. Und wie ich sehe, Statthalter Kalar, servierst du mir noch einen Nachtisch.“
„Meine persönlichen Bediensteten gehören zu den stärksten und gesündesten Lyonen überhaupt.“
Mittig schritt Santharia zwischen den beiden Reihen hindurch, dabei berührte sie ihre Opfer lediglich mit den Fingerspitzen im Nacken und entriss ihnen alle Lebenskraft. Mancher Kehle entwich noch ein letztes klagendes Seufzen. Vornüber sackten die Toten auf den Sandstein. Ein Gefühl der Ekstase durchfuhr Santharia, bescherte ihr eine wohlig warme Gänsehaut. Sie atmete mehrmals tief durch, um zu ihrer gewohnten Besonnenheit zurückzufinden. Anschließend entließ sie die Wachen aus den Diensten des Statthalters und befahl ihnen die Wiedereingliederung in die Streitmacht. Ohne eine Miene zu verziehen, verbeugten sich die Soldaten in traditioneller Ehrerbietung und verließen das Anwesen.
Auf den Straßen erklangen nur noch vereinzelte Schreie, meist aus irgendwelchen Verstecken in Kellern, Verliesen, Brunnenschächten oder Dachböden. Aber es gab kein Entkommen vor den Kyaslanern, sie spürten noch den letzten Menschen in der Stadt auf. Rasch hatten sie die Bevölkerung ausgelöscht. Eine Stille kehrte ein, wie es sie in dieser Stadt noch nie zuvor gegeben hatte – ganz zur Zufriedenheit des Totenflüsterers. Für die Streitmacht aber gab es weder rasten noch ruhen. Wie der am Vorabend von der Kaiserin gegebene Befehl es vorsah, verließen alle Waffenträger nach beendetem Mahl Lyon-Kenyaan, um landeinwärts weiterzuziehen. Und Gehorsam war eine der zahlreichen Tugenden der Kyaslaner. Gestärkt wie nie zuvor, durchbrachen sie mühelos die Stadtmauern, um sich dann als ein alles überwindender Strom geradewegs auf den nordöstlichen Horizont zuzubewegen – dorthin, wo sie das Land Laskun wussten. Aus der Ferne betrachtet, erinnerte ihr Anblick die Kaiserin an einen gewaltigen Schwarm von Ameisen, der sich jedoch schneller und wendiger bewegte als fernöstliche Steppenpferde.
„Nun ist die Geschichte dieser Stadt beendet. Inmitten ihrer Trümmer stehe ich zwei meiner Vertrauten gegenüber, die mich in meinen Erwartungen enttäuscht haben. Einer von euch ließ Larkyen hier an diesem Ort entkommen, der andere hat ihm in Manticora sogar geholfen und dessen Hinrichtung verhindert. Knochenmann, hast du denn wirklich geglaubt, dass deine Missetat unbemerkt bleiben würde?“
„Nein, meine Kaiserin“, antwortete der Totenflüsterer seelenruhig. „Aber es freut mich, dass dir dein Spion in Nemar noch immer so gute Dienste leistet. Dennoch wisse, dass ich niemandem je Rechenschaft schulde, da ich selbst entscheide, wann und wie ich auf die Geschicke eurer Welt einwirke.“
Plötzlich kühlte sich die Luft merklich ab. Santharias und Kalars Atem bildete feine Wölkchen, die Knochen des Totenflüsterers jedoch wurden von einer Eisschicht überzogen. Eine unsichtbare Kraft beugte das Skelett vornüber, trieb es schließlich auf die Knie. Die Sense entglitt den Fingern und fiel scheppernd auf die Steinplatten. Da raste aus den Schatten der Villa der fleischlose Gott heran, verharrte nur wenige Schritte von Santharia entfernt.
„In dieser demutsvollen Haltung gefällst du mir immer noch am besten, altes Gebein“, zischte er erzürnt. Sein Brodem flackerte tiefschwarz. „Würde ich deine Macht und deine Weisheit nicht so sehr schätzen und benötigen, würdest du die nächsten zehntausend Jahre als Eisblock verbringen.“
„Was sind schon zehntausend Jahre? Wie oft willst du mich noch einfrieren? Ganz gleich was geschieht, wir beide brauchen einander, um unsere Sehnsüchte zu erfüllen.“
„Und deine Sehnsüchte sind so bekannt wie ein zu oft gehörtes Lied: Zerstörung und Tod. Deshalb hast du ein Interesse an Larkyens schändlichem Weiterleben. Glaub mir, altes, selbstsüchtiges Gebein, dein geschätzter Zerstörer wird schon bald endgültig sterben!“
„Wenn ihr in der großen Schlacht aufeinander trefft, werde nicht einmal ich eingreifen. Licht gegen Finsternis, ein alter Gott gegen einen neuen, ein solcher Kampf ist nichts anderes als euer Schicksal.“
Kalar hatte alles mit angehört. Instinktiv war Santharias Untertan vor Schatten und Kälte zurückgewichen. Für ihn war die Welt in ihren Grundfesten erschüttert.
„Was der gefallene König im Kerker Khyr-Naans in die Dunkelheit geschrien hat“, stammelte er, „die vielen Gerüchte, die so lange Zeit erzählt wurden … die Zerstörung des Runensteins von Kyaslan durch deine Hand … Es ist alles wahr.“
„Ja, so ist es“, bestätigte Santharia. „Und dass du es nun erfahren darfst, beweist nur, dass ich dich nach wie vor allen anderen Kyaslanern vorziehe. Ich hätte dich gern in einem ruhigeren Moment eingeweiht, aber wir befinden uns schließlich im Krieg.“
„Mutter der Finsternis … Nun begreife ich auch, warum der Kriegsgott Nordar und sogar die Feuerriesen ein Bündnis mit dir so beharrlich abgelehnt haben.“ Er nickte zaghaft, holte tief Luft und sprach: “Meine Treue gilt auch weiterhin dir … Und wenn du es verlangst, sogar deinem Sohn.“
„Lüge“, mischte sich Strygar abrupt ein. „Deine Stimme bebt wie deine Knochen. Ich kann deine Angst spüren. Stets sind es die Feigen, die Verunsicherten, die Schwachen, die bei der ersten Gelegenheit vor unseren Feinden fliehen und irgendwann damit liebäugeln, zu ihnen überzulaufen. Ich werde bestimmt nicht so lange warten, bis mich erneut ein Verbündeter hintergeht.“
Nur kurz schweifte der Blick des Statthalters zu den Kaskaden hinüber. Jener Fluchtweg, über den Larkyen aus dem Garten hatte entkommen können, wurde ihm jedoch von Strygar versperrt. Der Statthalter griff in die Tasche seines Umhangs. Zitternde Finger klammerten sich um sein einziges Andenken aus Kyaslan – eines der vielen Bruchstücke des durch Santharia zerstörten Runensteins. Seitdem er damals das heilige Reich hatte verlassen müssen, um sein Amt als Statthalter anzutreten, trug er es bei sich. Und er erinnerte sich daran, welchem Zweck der Monolith einst gedient hatte. Er hielt das Bruchstück in Strygars Finsternis. Es war, als träfe eine große Menge Wasser auf Feuer – Strygar wich wie von einer unsichtbaren Kraft getroffen zurück. Der Blick, den Kalar seiner Kaiserin daraufhin zuwarf, verriet, dass er sich hier und jetzt von ihr abwandte. Sie spürte einen schmerzhaften Stich im Herzen. Und mit einer Bewegung, die sogar für Unsterbliche außergewöhnlich schnell war, entriss sie dem Statthalter das Bruchstück und zerbröselte es zwischen ihren Fingern. Danach schmetterte sie ihn mit einer Wucht zu Boden, die die Steinplatten unter ihm zerbersten ließ. Sie musste sich eingestehen, dass Strygars beständige Skepsis ihm gegenüber angebracht gewesen war. Wie lange würde es dauern, bis selbst Kalar es für seine heilige Pflicht halten würde, gegen den Herrn der Finsternis in den Krieg zu ziehen? – wie andere vor ihm. Gleich dem Volk von Kyaslan war auch er nicht fähig, in Strygar das Besondere und Einzigartige zu sehen, sondern nur das Böse und Unnatürliche, das es zu verachten und zu bekämpfen galt.
Ehe sie seine Existenz eigenhändig beenden konnte, nahm sich Strygar seiner an – Eiseskälte und Gluthitze umarmten den Statthalter gleichzeitig, ließen seine Gliedmaßen erstarren und verhinderten jeden weiteren Fluchtversuch. Der Herr der Finsternis demonstrierte einmal mehr, wer die Dunkle Allianz anführte. Es waren die üblichen Machtspielchen, die Santharia seit der Wiedervereinigung mit ihrem Sohn über sich ergehen lassen musste. Mit seiner hohen, kalten Stimme, die in diesem Moment unangenehmer nicht hätte erklingen können, stieß er einen Ruf gen Himmel aus, der nur für seine Scharen als Befehl zu verstehen war. Daraufhin setzte sich am Horizont eine dunkle Wolkenformation in Bewegung. Sie war schon am späten Nachmittag dort gewesen, und ein Fischer hätte bei ihrem Anblick wohl das Heraufziehen einer Schlechtwetterfront befürchtet. Jetzt aber bewegte sich die Wolke auf die Stadt zu – unnatürlich schnell und entgegen der Windrichtung. Kaum waren die letzten Sonnenstrahlen versiegt, löste sie sich abrupt auf und offenbarte alle zehn Schattenbringer auf einmal. Flügelschlagend umkreisten die fahlen Riesen die Stadt. Mit sich brachten sie den süßlich beißenden Gestank tausender geöffneter Gräber, der sogar die frische Seeluft verdrängte. Auch sie sollten wohlgenährt in die bevorstehende Schlacht ziehen.
„Sieh nur gut hin, elender Wurm“, sprach Strygar zu Kalar. „In meiner neuen Welt sind sie die Könige. Sie werden die großen Führer der Menschen ablösen und an ihrer statt die Reiche in meinem Sinne regieren: Lemurien, Atland, Kentar, Bolwarien und all die anderen. Eine neue Ordnung wird entstehen, so sieht es der große Plan vor. Doch das wirst du nicht mehr erleben.“
Ghal-Sar Stachelrücken, der Gewaltigste unter ihnen, ließ sich im Garten der Villa nieder, so wie es sein Herr wünschte. Denn in dieser Nacht gewährte Strygar nur ihm den Geschmack von frischem Götterfleisch. Mit seinen riesigen Händen packte er den Statthalter. Ein jeder Finger endete in langen Klauen – in Form und Beschaffenheit an schwarzstählerne Schwertklingen erinnernd –, die dessen Leib zerschnitten, Haut vom Knochen schälten.
„Kaiserin“, wimmerte Kalar. Dabei quoll Blut aus seinem Mund. „Erkenne … was … dein … Sohn … ist … was … er … anrichtet.“
Und mit einem einzigen Bissen verschlang Stachelrücken sein Opfer. Unaufhaltsam schlugen die Kiefer aufeinander, zermalmten Fleisch und Knochen und beendeten jene von der schwarzen Sonne erschaffene Existenz für immer. Kein Stern am Firmament sollte jemals an Kalar erinnern.
Die anderen Züchtungen landeten währenddessen auf den Straßen und Marktplätzen und begannen, die dort verstreut liegenden Leichen der Lyonen zu fressen. Auf ihrer Suche nach noch mehr Menschenfleisch rissen sie sogar mühelos die Dächer und Hauswände ein. Ihr Kauen und Schmatzen übertönte das Geräusch von Wind und Wellen.
„Fresst euch nur satt, meine Kinder“, rief Strygar ihnen zu. „Und seid euch gewiss, dass in Nemar noch viel köstlicheres Fleisch auf euch wartet.“
Stachelrücken aber hätte an Ort und Stelle ein weiteres Mahl bevorzugt. Er beugte sich herab, sein unförmiger Schädel näherte sich der Kaiserin, blies ihr seinen stinkenden Atem entgegen. Auch in ihren Adern floss ebenjenes Götterblut, dessen Geschmack seinesgleichen so sehr liebte. Für einen winzigen Moment musste sie sich eingestehen, dass sie nicht einschätzen konnte, was Stachelrücken als nächstes tun würde. Obgleich sie für die Schattenbringer eine Vertraute war, gehorchten die Kreaturen nur Strygar allein.
Santharia verbarg ihre Unsicherheit gut genug. Nicht einen Schritt wich sie vor dem Schattenbringer zurück, reckte stattdessen eine Hand dem fahlen Antlitz entgegen und strich mit ihren Fingern über die rissige Haut. Die Kreatur ließ die Berührung über sich ergehen. Inmitten dieses gewaltigen Leibes erfühlte Santharia keinerlei Lebenskraft. Ihre Finger glitten über den Hals hinweg und auf die massige Brust zu, fanden in eine der durch zu schnelles Wachstum verursachten Wunden hinein. Noch nie zuvor hatte sie dergleichen gewagt. Unter einer zähen Brühe aus Eiter pulsierte jene schneidend kalte Finsternis, die auch das zukünftige Weltreich Strygars beseelen sollte. Für die Kultisten war es eine heilige Essenz, die jedoch in einer derartigen Konzentration die Haut der Kaiserin verwelken und das Blut in ihren Adern zu Staub werden ließ. Das damit einhergehende Gefühl von Taubheit weitete sich über den Unterarm bis hinein in ihre Brust aus. Abrupt zog sie die Hand zurück. Forschend blickte sie auf ihr eigenes abgestorbenes Fleisch, wie es sich nur zaghaft unter dem Bann ihrer Selbstheilungskräfte erholte.
„Soeben bist du vom Tod liebkost worden“, sprach der Totenflüsterer. „Wenngleich dieser Moment dir bittere Erinnerungen an deine einstige Verwundung durch Rha-Khuns Schergen bescheren mag, so hoffe ich dennoch, dass du ihn irgendwie genießen konntest und seine ganze Herrlichkeit zu schätzen weißt.“
Ehe sie auch nur ein Wort entgegnen konnte, sprach Strygar: „Natürlich hat sie die Liebkosung durch eine solche Macht genossen, altes Gebein. Früher oder später erkennt ein jeder von uns, was notwendig ist, um den großen Plan zu verwirklichen. Wie oft habe ich den Tod verflucht, wie sehr habe ich ihn gehasst, weil er mir so viel genommen hat, dabei liegt in ihm doch auch der Funke für eine Schöpfung verborgen, für ein neues Reich ohne Sonne, Mond und Sterne, für eine neue Familie. Und nun, der Erfüllung meiner Bestimmung so nahe, kommen mir die Verluste der Vergangenheit wie ein Tribut vor, den zu entrichten ich gezwungen war. Und ja, seine Höhe war angemessen, überaus sogar.“
Als der Mond im Zenit stand, brach auch die Dunkle Allianz – getragen von leichenblassen Schwingen – gen Osten auf, wo ihr großer Plan ein noch nie da gewesenes Unheil entfachen sollte.
In derselben Nacht fegte ein außergewöhnlich starker Sturm über das Altoryagebirge und das westliche Grenzland Laskuns hinweg. Aufgewirbelter Schnee behinderte Grimms Sicht erheblich. So plötzlich wie sich das Wetter geändert hatte, vermutete der Hauptmann, dass die Macht Strygars am Werk war. Immerhin gab es genügend Gerüchte darüber, wie der Herr der Finsternis sogar aus großer Entfernung das Wetter beeinflussen konnte. Derartige Bedingungen bedeuteten für die Streitmacht der Kultisten einen strategischen Vorteil, verliehen sie ihnen in den Bergen doch eine schiere Unsichtbarkeit.
Immer hatte Castagyr von Eridu darauf bestanden, von seinen Vorposten und Spähern ausschließlich präzise Informationen über alle Truppenbewegungen im Grenzgebiet zu erhalten. Da Grimm den Anführer des Widerstands nicht enttäuschen wollte, führte er höchstpersönlich einen Spähtrupp von sieben Unsterblichen an, um die gegenwärtige Position des Heers zu bestimmen. Obgleich ein jeder von ihnen zahlreiche Schlachten in der Vergangenheit geschlagen und einige sogar den Sonnensturm überlebt hatten, konnten sie ihre Nervosität angesichts eines so scheußlichen Feindes nicht verbergen.
„Wenn ihr in Kämpfe verwickelt werdet und unterliegen solltet, stürzt euch eher in die eigene Klinge, als dass ihr euch von ihnen gefangen nehmen lasst.“ Mit diesen mahnenden Worten erinnerte Grimm seine Untergebenen abermals daran, wie begierig jener Feind nach frischem Götterblut lechzte und welches andere Grauen daraus entwachsen konnte.
„Wir sind schon die halbe Nacht hier draußen und noch immer keine Spur von ihnen“, flüsterte eine Unsterbliche zu seiner Linken. „Sie müssen einen anderen Weg genommen haben.“
„Unsere Informationen sind richtig“, bestätigte er. „Die Kultisten kommen von Westen, die Kyaslaner von Süden. Habt ihr etwa geglaubt, dass sich das Heer des Nachtreichs gleich nach dem Grenzübertritt auf Nemar stürzen würde? Auch wenn die Kultisten keine gewöhnlichen Menschen sind, brauchen sie irgendwann eine Rast. Hier oben gibt es nur noch einen einzigen Ort, an dem sich ein so großes Heer von Sterblichen vorübergehend verbergen könnte, und zwar die Ruinen von Karlysan. Und wenn wir sie nicht einmal dort entdecken, dann haben sie die Grenze noch nicht übertreten.“
„Wir sind viel zu wenige, um das gesamte Grenzland überwachen zu können“, murrte ein anderer Soldat.
Grimm ignorierte ihn, hätte einer solchen Aussage aber auch nicht widersprechen können. Ein jeder Vorposten des Widerstands war trotz der zugesicherten Verstärkung noch immer unterbesetzt. Castagyr hatte es für weitaus wichtiger befunden, die Mauern und Türme der Festung sowie des Schlosses ausreichend zu besetzen. Dennoch war Hauptmann Grimm einmal mehr dankbar, seinen Dienst im Grenzland verrichten zu dürfen, ganz gleich, ob sich die Wetterverhältnisse noch verschlechtern würden. Seitdem es vor zwei Tagen einen Anschlag auf Großmeister Amar in den Gewölben des Schlosses gegeben hatte und der Täter nur aus den Reihen des Widerstands stammen konnte, herrschte innerhalb der Festung ein größeres Misstrauen als jemals zuvor. Etwa ein Drittel der dort stationierten Soldaten zeigten sich demoralisiert. Einige sprachen bereits darüber, zu desertieren, und jener Krieger, der seinen ruchlosen Worten auch Taten folgen lassen wollte, war von Castagyr persönlich ertappt und noch an Ort und Stelle hingerichtet worden. Der Anführer des Widerstands agierte ungewohnt gnadenlos. Tag und Nacht befürchtete er, seinen Führungsanspruch zugunsten Larkyens einzubüßen. Grimm konnte alle Bedenken des obersten Kommandanten ausnahmslos nachempfinden. So schätzenswert die Kampfkraft des Kentarenkönigs und seines Totenheers auch war, fiel es nicht schwer, ihn für seine Macht zu hassen. Hier oben in den Bergen aber sollte es für derlei Zwistigkeiten keine Zeit geben.
Die Ruinen von Karlysan waren nicht mehr fern, jenseits einer schroffen Felsformation erhoben sich die Aussichtstürme. Ob sich der Feind wirklich dort verbarg, sogar Wachposten aufgestellt hatte, konnte Grimm nicht erkennen. Ein besserer Blick auf die nahe Umgebung und einige Regionen des Grenzlands würde sich nur vom Gipfel der Felsformation bieten. Vorsichtig wagte der Spähtrupp den Aufstieg. Und dann war der Moment gekommen, in dem Hauptmann Grimms Herz schneller zu schlagen begann. Der Feind aus dem Nachtreich hielt sich genau dort auf, wo er ihn vermutet hatte. Das Lager der Kultisten erstreckte sich über ganz Karlysan, auf jeder Straße und auf jedem Platz tummelten sich die Jünger Strygars. Sie trugen ihre markanten Roben und Mäntel, die fratzenhaften Gesichter waren unter Kapuzen verborgen. Längst hatten sie die Umgebung an ihre Bedürfnisse angepasst, überall ragten aus losen Steinen errichtete Altäre auf. Und es gab genügend Jünger, die sich bereitwillig und bei lebendigem Leibe zu Strygars Ehren schlachten ließen, um das eigene Fleisch und Blut ihren Nächsten als Mahl darzubieten.
Auf den Überresten der Mauern und auch auf den Türmen zeichneten sich die Silhouetten von bewaffneten Wachen ab, regungslos wie Statuen harrten sie inmitten des Schneesturms aus. Und obgleich die Augen eines jeden Blutkultisten in der Dunkelheit des Nachtreichs für immer erblindet waren, so galten ihre übrigen Sinne als umso schärfer. Grimm befürchtete, dass sie ihn und seinen Spähtrupp bereits gewittert hatten. Sofort gab er den Befehl, zum Vorposten zurückzukehren.
Rasch kletterten sie die Felsen wieder hinab und liefen über den Gebirgspass zurück. Der Sturm nahm währenddessen zu, erschuf um sie herum eine weiße Wand. Plötzlich erschien – einem Trugbild gleich – unmittelbar vor ihnen eine feuerrote Gestalt. Ehe der Spähtrupp in Verteidigungsstellung gehen konnte, fuhr ein schwarzstählerner Speer auf den Krieger an Grimms Seite zu und durchbohrte dessen Kopf mit einem dumpfen Krachen. Schädelsplitter und Gehirnmasse prasselten auf den steinigen Boden. Schon der nächste Stoß galt dem Hauptmann selbst, streifte aber nur sein Gesicht und riss ihm die linke Wange bis zum Kinn auf. Seine letzte Verwundung durch den mit Runen geweihten Stahl lag so lange zurück, dass er sich nicht mehr daran erinnern konnte. Noch während sich sein Mund mit dem eigenen Blut füllte, gab er den Befehl zum Rückzug. Da brach auch schon der nächste Angriff wie aus dem Nichts über den Spähtrupp herein, und das Blut von zwei weiteren tödlich verwundeten Opfern tränkte den Schnee.
Grimm konnte den Anblick der reglosen Leiber kaum mehr ertragen, zu viele aus seinen Reihen waren in den letzten hundert Jahren gefallen. Als Hauptmann hatte er sich geschworen, alles zu tun, um seine Untergebenen zu schützen. Trotz seiner Verletzung warf er sich mit gezogenem Schwert dem nahezu unsichtbaren Angreifer entgegen, verwickelte ihn in einen Zweikampf. Funken stoben inmitten umherwirbelnder Schneeflocken, als Schwert und Speer immer wieder aufeinandertrafen. Ungeachtet dessen brüllte er seinem Spähtrupp die nächsten Befehle zu: „Lasst mich hier … evakuiert den Vorposten … kehrt nach Nemar zurück!“ Castagyr musste über die Ankunft der Blutkultisten unterrichtet werden. Und ganz gleich, mit welcher Inbrunst seine Untergebenen ihm im Kampf beistehen wollten, sie taten schweren Herzens wie ihnen geheißen und auch die Gefallenen nahmen sie mit sich. Ihr Entkommen bescherte Grimm zumindest ein kurzes Gefühl von Zufriedenheit.
Und dann zeigte sich der Angreifer endlich vollständig. Von eisigen Winden getragen, bewegte er sich scheinbar schwerelos über den Pass, reckte in einer Geste des Triumphs seinen Speer empor. Grimm wusste längst, dass er dem berüchtigten Herzog von Eisenburg gegenüberstand. Er erkannte die Waffe in dessen Besitz sofort wieder. Seine Überraschung hielt sich in Grenzen, denn allein in den letzten Jahrzehnten hatte er zu vielen Kultisten gegenübergestanden, die den schwarzen Stahl geführt hatten. Was bedeutete da noch diese weitere Schmach, ganz gleich, wie groß sie auch war? Der Heerführer des Nachtreichs nahm den Helm ab, sein eingefallenes Antlitz mit den milchig weißen Augen ähnelte einem Leichnam.
„Hauptmann Grimm, du bist genauso kühn, wie ich erwartet habe. Zugegeben, ich dachte, wir würden uns erst bei der kommenden Belagerung gegenüberstehen.“
„Dann hättet ihr euer Lager besser verbergen müssen. Es war nicht schwer, euch zu finden.“
„Du hast nur das Lager der Nachhut entdeckt, mehr nicht.“ Er lachte. „Wir sind schon viel weiter in die Nähe von Nemar vorgedrungen, als euch lieb ist. Oder hast du ernsthaft geglaubt, dass wir gleich gewöhnlichen Menschen die Gipfel der Berge scheuen? Verborgen in Dunkelheit und Schneegestöber sind tausende Jünger nördlich eures Vorpostens an euch vorbeigeklettert, so unbemerkt wie Schatten in der Nacht. Strygars Macht verleiht uns eine Schnelligkeit und Wendigkeit, die der euren ähnlich ist, und zuweilen trägt er uns sogar durch die Lüfte. Aber wem wirst du kleiner Hauptmann schon davon erzählen können?“
Grimm verschwendete kein weiteres Wort, sondern griff den Roten an. Der Schlagabtausch dauerte lange an und endete damit, dass Grimm trotz seiner Rüstung eine Wunde am Bauch davontrug. Für den Moment geriet er ins Taumeln, konnte kaum fassen, was soeben geschehen war.
Die Augen des Herzogs vermochten Grimms Verletzung nicht zu erblicken, jedoch roch er das frische Blut umso besser. Die Gier danach beherrschte sein Antlitz, ließ ihn in Vorfreude grinsen und dabei spitzgeschliffene Zähne blecken. „Tapferer kleiner Hauptmann“, raunte er. „Du gibst dein eigenes Leben, um die Flucht der deinen zu decken. Doch sie werden ohnehin bald sterben.“
Schon sein nächster Speerstoß war zu kraftvoll für Grimms Abwehr, sandte ihn zuerst auf die Knie und dann rücklings in den Schnee. Die Gesänge der Kultisten untermalten diese Niederlage, wurden immer lauter und steigerten sich ihrem schauerlichen Höhepunkt entgegen. Schon im nächsten Moment beugte sich der Herzog über Grimm, schlug seine Zähne in dessen Hals und begann das herausströmende Blut zu trinken.
Die eigene Unterlegenheit rief in dem Sohn der schwarzen Sonne nichts als Wut hervor, er nahm all seine verbliebenen Kräfte zusammen und schleuderte den Angreifer von sich. Für die Flucht über den Pass war es zu spät. Während er am Boden gelegen hatte, war er von Kultisten umzingelt worden. Zwar gelang es ihm, mehr als ein Dutzend von ihnen niederzustrecken, doch ihr Ansturm war zu groß. Unter weiteren Verletzungen gelang Grimm der Ausbruch, er ließ sich bis an den Rand der Schlucht zurücktreiben. Abermals erschallte die Stimme des Herzogs, prophezeite dem Hauptmann ein Ende auf dem Opferaltar. Durch diesen Feind durfte es keine Gefangennahme geben. Rücklings ließ sich Grimm in den Abgrund fallen. Schneeflocken hüllten seinen geschundenen Leib in ein weißes Kleid, der kalte Wind liebkoste zahlreiche Verletzungen. Ihm blieb noch Zeit einen Gedanken zu fassen und er widmete ihn dem ermordeten Gott-Imperator. Dann schlug er auf vereiste Felsen auf.
Vierundzwanzig kleine Steine lagen vor Pandora auf dem Eichenholztisch verteilt. Ein jeder davon trug die Gravur einer Rune. Mittig, gleich einer Sonne, um die ganze Welten kreisen, befand sich Sigarya. Unablässig war ihr Blick auf den Blitz gerichtet. In solchen Momenten war die Macht des alten Nordens und seines beinahe vergessenen Imperiums wieder allgegenwärtig und erweckte für Pandora die Runen zum Leben; ließ sie für ihre Augen zu Bildnissen jener Ereignisse verschmelzen, die allen anderen sonst verborgen blieben. Seit dem Anschlag auf den Großmeister nutzte sie ihre Gabe umso häufiger, ganz gleich, wie viel Kraft sie dafür aufbringen musste. Manchmal glaubte sie sich im Anschluß einer Ohnmacht nahe. Doch sie musste frühzeitig erfahren, wann immer jene, die ihr nahestanden, großer Gefahr ausgesetzt waren. Um nichts in der Welt wollte sie Larkyen wieder verlieren. Jedoch unterlagen die Ereignisse, die sie voraussah, viel eher dem Zufall – einiges geschah im selben Moment in weiter Ferne oder ganz in der Nähe, anderes sollte erst noch geschehen. Nichtsdestotrotz hatte sie durch ihre Aufopferung die Bestätigung erlangt, dass die Schattenbringer ebenso wie Strygar durch die schützende Weihung des Monolithen von Nemar ferngehalten wurden. Doch ganz gleich, wie viel wertvolles Wissen sie verkündete, es gab noch viele Zweifler, die ihr Täuschung oder gar Lüge unterstellten. Besonders Castagyr weigerte sich nach wie vor vehement, ihre Gabe anzuerkennen.
Plötzlich verkrampften sich ihre Hände, ein Zucken durchfuhr ihren Leib, ließ ihre Augenlider flattern. Der Geschmack von Blut breitete sich auf ihrer Zunge aus, fremdes Blut. In diesem Augenblick war es, als läge Grimm unmittelbar vor ihren Füßen, blutüberströmt, mit gebrochenen Knochen. Seine rechte Hand hielt das schwarzstählerne Schwert unablässig umklammert, so als stünde er noch immer einer Übermacht von Kultisten gegenüber. Langsam rutschte er von den Felsen und glitt in die reißenden Ströme eines vorbeifließenden Baches, der ihn mit sich nahm.
Auch wenn Pandora gegenüber dem Hauptmann keine Sympathien empfand, zollte sie ihm zumindest als Krieger den gebotenen Respekt. Zweifelsohne würden seine Erfahrenheit und Tapferkeit dem Widerstand in der großen Schlacht fehlen. Sie erhob sich von ihrem Stuhl, bemerkte, wie ihre Knie vor Aufregung und Überanstrengung zitterten. Vom Fenster aus war es möglich, die Ausläufer des Altoryagebirges am Horizont zu erblicken, wo die dichten Wolkenschleier eines anhaltenden Unwetters das Grenzland völlig verschluckt hatten. Dort oben war es geschehen; dort lauerte der Feind.
Eiligen Schrittes verließ die Runenmeisterin ihr Zimmer und hetzte durch den langen Korridor des Schlosses. Dabei musste sie sich mehrfach an den Wänden abstützen. Sie riss die Tür zu einem Zimmer auf, dessen Luft mit dem Geruch der verschiedensten Heilkräuter geschwängert war. Mitten im Raum wachte Ayrus am Bett des bewusstlosen Amar und bot noch immer all sein Können auf, um ihn zu retten. In diesen Zeiten konnte der Verrat mit der Arglist einer Hyäne bereits hinter der nächsten Ecke lauern, Ayrus aber gehörte den wenigen Unsterblichen an, denen Pandora noch vertraute und der mittlerweile an ihre Gabe glaubte. Überrascht sah er sie an, den Mund bereits geöffnet, um sie für ihr plötzliches Eindringen zu rügen.
„Grimm ist im Zweikampf besiegt worden!“, rief sie. „Der Vorposten ist verloren.“
„Was?“ In einem Anfall von Fassungslosigkeit verfinsterte sich seine Miene. „Du hast es also in den Runen gelesen … wie so vieles.“
„Ja“, bestätigte sie. Ihr Blickfeld verschwamm. Sie tastete nach dem Bettpfosten, um sich Halt zu verschaffen.
„So dankbar ich dir für den Einsatz deiner Gabe bin, du solltest dich zumindest zuweilen schonen. Setz dich hin.“ Seine Stimme drang gedämpft und abklingend, wie aus weiter Ferne, an ihre Ohren.
„Es geht wieder“, log sie.
„Ich kannte Grimm schon, als Atland und Lemurien gerade erst die Seefahrt für sich entdeckt hatten und ihre Häfen noch klein waren“, hörte sie ihn sagen. „Zu viele Kinder der schwarzen Sonne sind hier im verfluchten Osten gestorben, dabei hieß es immer, dass wir, die Götter der Erde, für die Ewigkeit bestimmt wären. Oh, wie sich die Zeiten doch gewandelt haben.“
„Hör mich an“, keuchte sie benommen. „Noch ist der Hauptmann nicht tot. Aber bei seinen Verletzungen wird er ohne fremde Hilfe nicht länger als einen Tag durchhalten können.“ Sie holte mehrfach tief Luft, endlich fühlte sie sich besser. Dann berichtete sie Ayrus, was in den Bergen geschehen war.
„Genau wie andere habe ich alter Narr mir schon angewöhnt, immer vom schlimmsten auszugehen“, murmelte er daraufhin. „Eine Niederlage im Zweikampf bedeutet noch lange keinen Toten. Konntest du sehen, wohin die Strömung ihn getragen hat?“
„Ja, der Bach mündet in einen See in der Nähe der Königskuppe.“
Plötzlich durchschnitt Castagyrs Stimme die Luft mit der Schärfe einer Klinge: „Und wieder überrascht es mich zutiefst, wie ihr beide an Informationen gelangt seid, die ich selbst erst eben erhalten habe.“
Völlig unbemerkt hatte der Anführer des Widerstands den Raum betreten. Lautlosigkeit und Tarnung gehörten zu seinen besonderen Fähigkeiten, die er sich im Dienste des Imperators angeeignet hatte. Forschend blickte er erst Ayrus und dann Pandora an. Der lebensbedrohliche Zustand, in dem sich der Großmeister befand, setzte Castagyr mehr zu, als er öffentlich zugegeben hätte. Und immer häufiger versuchte er, alle im Schloss und der Festung stationierten Unsterblichen zu beobachten und zu belauschen. Er hatte es sich zur Aufgabe gemacht, den Verräter unter ihnen höchstpersönlich zu finden und seiner gerechten Strafe zuzuführen. Das anhaltende Gefühl niemals allein zu sein beherrschte die eigenen Reihen. Und niemand vermochte zu ahnen, wann und wo sich der Anführer des Widerstands plötzlich zeigen würde. Pandora verhielt sich ruhig, um ihn nicht zu reizen und wich seinem Blick bewusst aus.
„Wir müssen sofort einige Soldaten zu Grimms Rettung entsenden“, forderte Ayrus mit Nachdruck.
„Weil Pandora wieder einmal in den Runen gelesen hat? Wie leichtgläubig bist du? Wann immer sie von ihrer angeblichen Gabe Gebrauch gemacht hat, war sie alleine. Nie gab es irgendwelche Zeugen, nicht einmal Larkyen hat sie je dabei gesehen. Aber bei dir findet sie stets Gehör.“
„Ja, ich glaube ihr. Grimm lebt noch und wir müssen ihm helfen.“
„Einen solchen Befehl werde ich nicht erteilen. Wir haben diesen Vorposten verloren, jedoch konnten sich die meisten unserer Leute vor der Übermacht der Kultisten retten und alle Gefallenen außer Grimm zurück nach Nemar bringen.“
„Verstehe doch, der Hauptmann ist nicht im Kampf gefallen, sondern verwundet worden. Was ist aus unserem Gebot geworden, niemals jemanden im Feindesland zurückzulassen?“
„Das ist ein Gebot der Kriegerkaste, du aber hast dich der Kunde der Runen und der Heilung verschrieben. Deine derzeitige Aufgabe ist es, über den Großmeister zu wachen und ihm beizustehen, so gut du kannst.“
„Seitdem der Gott-Imperator ermordet wurde und wir in Nemar ausharren, gibt es zumindest unter uns keinerlei Kaste mehr. So lauteten einmal deine Worte.“
„Du solltest umso besser verstehen, dass wir unsere Kräfte hier in Nemar nicht schwächen dürfen, indem wir dort draußen nach möglichen Verwundeten suchen.“
„Ich kann kaum glauben, dass du ihn einfach so aufgibst. Wir haben alle die gleiche Vergangenheit. Denkst du manchmal noch an den Sonnensturm zurück?“
„Ayrus … genug davon.“
„Erinnerst du dich an das heilige Banner, unter dem wir beide einst mit Grimm, Logrey, Shagoraz und so vielen anderen gegen Nordars Streitmacht kämpften? Wie viele Jahrhunderte sind seitdem vergangen?“
„Es war ein anderes Zeitalter … Damals gab es noch keine Finsternis, die danach trachtet die Sonne zu verschlingen.“
„Wahrhaftig war das Zeitalter ein anderes und du warst damals auch ein anderer Krieger, denn ich erkenne dich nicht mehr wieder. Wenn Logrey hier wäre, würde er dir dasselbe sagen.“
„Im Rang eines Hauptmanns trägt Logrey die alleinige Verantwortung für den Vorposten der südlichen Landesgrenze und zwar ohne fortwährend zu klagen. Ein jeder von uns hat in diesen Zeiten seine Pflicht zu erfüllen … und gegebenenfalls schwierige Entscheidungen zu treffen.“
„Es geht also nur um die Erfüllung von Pflichten? War es denn deine Pflicht, den Soldaten, der den Widerstand letzte Nacht verlassen wollte, ohne eine ordentliche Anhörung zum Tode zu verurteilen?“
„Er wollte uns alle, und das wofür wir kämpfen, für immer im Stich lassen. Also war er ein Verräter und ein Feigling und musste bestraft werden, um all jene, die ebenso wie er denken, ausdrücklich zu warnen. Es hat hier bereits viel zu viel Verrat gegeben. Wenn Nemar fällt, wird das Nachtreich nicht länger nur auf die Grenzen des alten Ken-Tunys beschränkt sein. Ich versuche mein Möglichstes, um unsere Gemeinschaft zu bewahren.“
„Nein, mein Kommandant, du zerstörst sie. Seit vorgestern säst du Furcht in den eigenen Reihen. In Kyaslan gab es Gesetze, Rha-Khuns Gesetze, die für alle Bürger des Reiches galten, hier aber gibt es nur noch dich. Und wenn du mich nicht bei Grimms Rettung unterstützt, dann breche ich allein auf.“
„Du widersprichst mir als deinem Kommandanten?“
„Ja, Castagyr. Bin auch ich nun ein Verräter, wird auch mein Kopf rollen?“
„Nein, alter Freund.“
„Freunde vertrauen einander.“
„Freunde“, seufzte Castagyr, bevor er nach einem Moment des Schweigens fortfuhr: „Aber mehr als zwei aus unseren Reihen kann ich dir nicht mitgeben. Und sei dir darüber gewiss, dass du dort draußen in großer Gefahr schwebst. Unsere Späher berichten, dass die gesamte Gegend um die Königskuppe herum höchstwahrscheinlich das Einmarschgebiet der Kultisten markiert. Ja, Ayrus, das hat Pandora mit ihrer angeblichen Gabe, von der du so überzeugt bist, ganz offenbar nicht voraussehen können. Aber auf diesem Weg werden Strygars Scharen bald nach Nemar ziehen. Und Santharias Armee hat sich ebenfalls schon in Bewegung gesetzt und dringt durch die südlichsten Regionen Altoryas auf Laskun zu. Wen auch immer du für deine Rettungsmission auswählst, euch wird nicht viel Zeit bleiben, um Grimm zu retten und wieder hierher zurückzukehren.“
Kapitel 1 – Die Finsternis naht
An den Nemar zugewandten Ausläufern des gewaltigen Pregargebirgskammes hatte sich das Totenheer versammelt. Das erste Licht des Tages umspielte die verschwommenen Konturen von annähernd einhunderttausend schemenhaften Gestalten. In den Sümpfen hatten sie sich am Rüstzeug der Gefallenen bedient, um es einzig aus alter Gewohnheit anzulegen. Das schlammverschmierte und rostige Eisen verlieh ihnen ein umso furchteinflößenderes Erscheinungsbild. Zusätzlich hatte ihr König ein Drittel von ihnen mit den schwarzstählernen Waffen der bisher gefallenen Kultisten und Widerstandskämpfer ausgestattet. Schulter an Schulter standen sie nun da, blickten mit flammenden Augen zu ihm, der auf einem Felsvorsprung stand, empor. Fortwährend konnte Larkyen ihre Unruhe spüren, sie sehnten sich nach der letzten Schlacht, nach dem Ende des einst von ihnen geleisteten ewigen Schwurs. Dennoch misstrauten insbesondere Shagoraz und Lyra den Kentaren noch immer und wollten nicht glauben, dass Varnak Eisenzahn sich an sein gegebenes Wort hielt. All ihre Bedenken und Warnungen stießen bei Larkyen auf taube Ohren. Lange genug war er mit dem Totenheer verbunden, um zu wissen, wie bedeutsam der Sieg in einem Zweikampf für einen jeden Kentaren war und welch immenser Wert der Kriegerehre beigemessen wurde.
Varnak verharrte nur wenige Schritte von Larkyen entfernt, in der rechten Hand hielt er ein Schwert aus den alten Schmieden Eisenburgs. Ohne Weiteres hätte er ihn damit niederstrecken können, aber nichts dergleichen sollte geschehen. Zusammen mit allen anderen Kentaren lauschte er den von Larkyen verkündeten Einzelheiten der geplanten Schlachtordnung. Wie schon damals während des Feldzugs im Westen unterteilte der König das Totenheer in zwei gleichgroße Armeen:
Die Erste Armee sollte sich ringförmig um die Festung und das Schloss herum postieren.
Die Zweite Armee stand unter seiner persönlichen Führung und würde zusammen mit den Wolfsrudeln an den Hängen des Pregargebirges warten. Die erhöhte Position garantierte eine gute Aussicht auf das Schlachtfeld sowie über weite Teile der Sümpfe und die angrenzenden Gebiete. Erst wenn sich die Kultisten und die Schattenbringer zeigten, war der Zeitpunkt ihres Einschreitens gekommen.
Die vereinigten Rudel hatten sich in einem nahen Waldstück versammelt, wo sie sich vorerst verbargen. Zuweilen zeigten sich einzelne Tiere zwischen den Stämmen der Bäume, unter ihnen auch der große, weiße Wolf. Die Kentaren, insbesondere jene als Werwölfe berühmt-berüchtigten Krieger, kommunizierten mit ihnen über Bell-, Heul- und Knurrlaute, demonstrierten so ihre ewige Verbundenheit zu dem Raubtier, welches ihr Banner schmückte.
„Heil Larkyen, König von Kentar!“, rief Varnak aus. Und die Kentaren der Ersten und Zweiten Armee fielen in den Ruf ein.