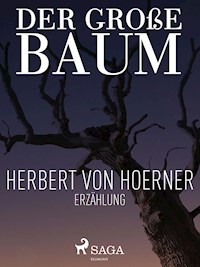Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
"Auch der Herr legt die Hand an den Stamm und schaut zur Krone hinauf. Und wie sie so dastehen, den Baum zwischen sich, ihn betrachtend und an ihn gelehnt, liegt in Blick und Haltung der beiden etwas Verbindendes, von Mensch zu Mensch ein Verstehen. Nicht wie von gleich zu gleich. Herr und Knecht, dabei bleibt es. Aber sie wissen beide, und eben darin verstehen sie sich, daß vor Gott alle Menschen gleich sind. Sie sind es auch vor diesem Baume." Begleitet wird der Majoratsherr bei seiner Fahrt durch den Wald von seinem Enkel, dem fünfjährigen Alexander. Als nun der Schneesturm an Kraft gewinnt, geschieht es, dass der übermütige kleine Junge, dem das Versteckspielen im Schneegestöber Spaß macht, sich verirrt und im Sturm verloren geht. Die Suche nach ihm bleibt erfolglos. Wie soll er nur eine ganze Nacht alleine dort draußen im Toben der Elemente überleben? Doch Alexander ist nicht völlig allein: Der große Baum und die führende Hand seiner alten Kinderfrau Mining scheinen den kleinen Jungherrn zu beschützen. Nur, dass sich Mining währenddessen noch zu einer Beerdigung auf einem Nachbargut befindet ... Das Schneesturmdrama um das im nächtlichen Wald sich verlaufende Kind wird unter Hoerners plastisch gestaltender Hand zum Monumentalgemälde eines gewaltigen Naturereignisses, in dem zugleich eine tiefe menschliche Wahrheit aufscheint.-
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 216
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Herbert von Hoerner
Der graue Reiter
Saga
Der graue ReiterCopyright © 2019 SAGA Egmont All rights reserved ISBN: 9788711593097
1. Ebook-Auflage, 2019 Format: EPUB 2.0
Dieses Buch ist urheberrechtlich geschützt. Kopieren für andere als persönliche Nutzung ist nur nach
Absprache mit SAGA Egmont gestattet.
SAGA Egmont www.saga-books.com und Lindhardt og Ringhof www.lrforlag.dk – a part of Egmont www.egmont.com
Der Wirbelwind
Es sing damit an, dass auf dem Wasser ein Wirbel entstand, der offenbar nicht von der Strömung herrührte, sondern von einer drehenden Bewegung der Luft. Es sah fast so aus, wie wenn die Bauersfrau mit einem Löffel in der Milch rumrührt. Nur hätte es freilich müssen ein riesenhafter Löffel sein und eine riesenhafte Hand, die ihn führte. Die drehende Bewegung setzte sich von der Mitte des Flusses, wo sie zuerst sichtbar geworden war, fort bis zum Ufer, an welchem der Bauer und die Bäuerin standen, das seltsame Naturspiel anstaunend. Ans Land springend; verwandelte sich die Bewegung in einen Wirbel von Staub und Stroh und was sonst noch sich vom Boden hochfegen liess. Der Wirbel fuhr gegen eine Weide an, deren hängende Zweige nach oben reissend und verdrehend, stieg, um abgerissene Blätter bereichert, als ein toller Tanz in die Höhe, zerflatterte, liess alles Mitgenommene fallen und war vershwunden.
„Ein Wirbelwind“, sagte der Mann, indem er sich mit dem Handrücken über die von Schweiss feuchte Stirn strich. Die Luft war drückend. Das Wasser, wieder beruhigt, glänzte bleiern. Von drüben leuchtete weisslich die Ruine. Hinter ihr hervor stieg in den schon getrübten Himmel eine Wolke auf, grau, von geballter, nach oben seitlich verbreiterter Form.
„Wie ein Pferdekopf“, meinte die Frau, auf die Wolke deutend.
„Unsinn“, antwortete der Mann. „Wolken haben keine Köpfe, weder die von Pferden noch andere.“
„Der graue Reiter“, sagte die Frau.
Der Mann wurde ärgerlich. „Denkst du wieder an deine Märchen? Erzählst sie wohl den Kindern?“
„Du hast es mir verboten“, sagte die Frau.
„Und daran tat ich recht“, erwiderte der Mann ernsthaft. „Es gibt im Leben Gefährlichkeiten genug, wirkliche, vor denen soll man die Kinder warnen. Übrigens“ — er lachte kurz auf — „erzähl es ihnen, wenn du Freude daran hast, dich von den Kindern auslachen zu lassen. Sie sind gross und verständig genug. Ich habe ja auch die Grossmutter dafür ausgelacht, und da war ich noch nicht so alt wie Maris. Die Grossmutter glaubte daran.“
Ich sage ja nicht, dass ich daran glaube“, antwortete die Frau. „Aber es ist eine Sage. Warum soll man sie nicht erzählen?“
Es ist eine unnütze Sage“, erwiderte der Mann, „und ich mag davon nichts hören. Aber die Wolke wächst. — Heh, Attis! Lauf, sieh dich um, wo das Vieh weidet. Mikelis und Maris sollen es in den Stall zurücktreiben. — Und Grieting die Hühner!“ rief er ihm noch nach.
Das Gewitter kam. Grieting, das zarte Gemüt, das vor allen gewalttätigen Äusserungen der Natur zitterte, verkroch sich unter das Bett der Eltern und wurde dafür von Attis verhöhnt. — „Hörst du, Gott schilt“, spottete er, während des Donners tiefe Stimme die Fenster klirren machte. Die Mutter wies ihn zurecht. — „Ich glaube“, sagte sie, „das Schelten gilt eher dir als Grieting, die immer gottesfürchtig ist.“
„Gottesfürchtig sind wir alle“, sagte der Mann.
„Freilich“, meinte die Frau, „wenn du ein Gewitter über dem Kopf hast, bist du es auch.“
Milda lachte über die Bemerkung der Mutter. Immer fand Milda etwas zum Lachen. Ansis sass schweigend da. Er blickte in das Gesicht des Vaters und las darin dieselbe Besorgnis, die auch ihn erfüllte: Wenn das Wetter nur nicht Hagel brachte! Die Wolken hatten danach ausgesehen. Das Korn stand grün und hoffnungsvoll auf dem Halm. Die Ernte war in Gefahr. Es blitzte und donnerte, ohne dass es beginnen wollte zu regnen. Als wäre eine Unentschlossenheit in dem Wetter, schien es reglos über dem Hause zu stehen. Aber die Reglosigkeit war wie eine Drohung. Die acht Menschen in der Stube fühlten sich darunter klein wie unter dem finsteren Blick eines Riesen, der mit grollender Stimme sprach und einen blitzenden Hammer schwang. Er schien aber noch irgendetwas Gefährliches unter feinem Mantel zu bergen. Sollte es Hagel sein? — Wenn es nur erst anfangen wollte zu regnen!
Der Bauer blickte zum Fenster hinaus und bemerkte, dass die Tür vom Schuppen offen stand und im Winde schlug. Er ging hinaus, sie zu schliessen. Als er zurückam, berichtete er, am Himmel drehten sich die Wolken so ähnlich, wie es vorhin im Wasser angefangen habe. — „Ein tolles Wetter“, sagte er. „Da wird man zweiundvierzig Jahre alt und hat so etwas noch nicht erlebt. Wenn’s nur nicht Hagel wird!“
Endlich begann es, gegen die Scheiben zu prasseln. Aber das waren nicht Regentropfen und auch nicht Schlossen. Sand, kleine Steine, Staub und Mist wurden wie von unsichtbarer Hand gegen die Fenster geworfen. Und dazu begann ein fürchterliches Geheul, als raste ein wildes Tier schreiend auf dem Hofe umher. Das wilde Tier sprang mit stampfenden Hufen über das Dach des Hauses. Es schlug gegen die Tür. Es hatte Mähne und Schweif und peitschte damit die Wände, dass die Stube bebte. — Brüllte nicht auch das Vieh im Stall? — Irgendetwas krachte. Dabei war in dem Lärm nicht zu unterscheiden, was Wind, was Donner, was brüllendes Vieh, was Krachen war.
„Gnädiger Gott“, stöhnte die Bäuerin. „Die Welt geht unter.“ Sie zog ihr Grieting unter dem Bett hervor und nahm es schützend in die Arme. Welche Mutter würde bei Weltuntergang nicht zuerst das schwächste ihrer Kinder zu retten suchen? Selbst Attis machte ein ängstliches Gesicht.
Aber das wilde Tier hatte sich an der Stelle ausgetobt. Man hörte es davongaloppieren. Sein Wiehern verklang in der Ferne. Gleich darauf fielen schwer die ersten Tropfen. Sie mehrten sich, überdeckten den Boden mit Nässe. Der Regen rauschte. Es war kein Hagel dabei.
„Gott sei Dank!“ sagte der Bauer. Aber da wusste er noch nicht, was ihm das Wetter gebracht oder vielmehr genommen hatte. Dem kleinen Wirbelwinde am Vormittage war ein grosser Bruder gefolgt. Er war an dem Hof nicht spurlos vorübergegangen.
Mikelis und Maris waren die ersten, die es bemerkten. Sie waren noch im Regen hinausgelaufen, um in den Pfützen zu patschen. — „Das Dach“, riefen sie, einander überschreiend, „das Dach vom Stall ist weg!“
Das ganze Dach war es nicht, doch fast das halbe. Grad über dem Abteil des Pferdes stand es noch. Aber die Seite über den Kühen, den Schafen, den Schweinen war wie mit der Faust weggeschlagen. Es musste eine grosse Faust gewesen sein. Auch von der Deckenlage, wo unter dem Dach noch ein Rest von altem Heu lag, waren Bretter herausgerissen, so dass der freie Himmel zu den verängsteten Tieren hereinsah. Die Hühner fehlten. Sie waren durch ihren Notausgang geflüchtet. Mit einer einzigen sehr traurigen Ausnahme: Die alte Gans, die schon vierzehn Bruten hinter sich hatte, lag, durch ein herabgefallenes Brett erschlagen, mit ausgebreiteten Flügeln, als habe sie zum letztenmal ihre Gössel beschützen wollen. Und es kam auch wirklich eines unversehrt unter ihr hervorgewatschelt und piepste.
Sparren, Latten und Stroh fanden sich weit auseinandergerissen und etliche hundert Schritt weit über Garten und Feld verstreut. Einer der Bienenstöcke war umgefallen. Sonst hatte der grosse Bruder Wirbelwind keinen nennenswerten Schaden angerichtet. Die Scheune stand nicht schiefer da als vorher. Das kleine Vordach der Kleete hinkte ein wenig nach der einen von seinen zwei Säulen hin, liess sich aber mit Leichtigkeit wieder grade richten. Nur noch das Strohdach des Wohnhauses sah aus, als hätte man die Katze gegen den Strich gebürstet. Die Moospolster hatten es zusammengehalten. Und sonst war nichts geschehen. Wirbelwinde sind launisch.
Aber das halbe Dach vom Stall, das war Schaden genug, und noch nicht der schlimmste. Denn der schlimmere wurde durch ihn erst aufgedeckt.
Wie sahen die Holzwände innen aus! Atem und Dampf der Tiere hatten sie Jahrzehnte lang nass erhalten. Das Holz fasste sich an wie Schwamm. Man konnte die Finger hineindrücken. — Hatte der Bauer das nicht gewusst? Jetzt, da in den sonst nur mangelhaft erhellten Raum durch das Loch in der Decke der Himmel hereinleuchtete, war es nicht möglich, zu übersehen, dass der Stall baufällig war, der ganze Stall. Ein neues Dach auf solche Wände zu setzen, erschien nutzlos.
Der Bauer murrte: „Wäre nur gleich der ganze Stall davongeflogen!“
„Aber die Tiere“, wandte die Bäuerin ein. „Welch ein Glück, dass uns kein Tier dabei umgekommen ist! Bis auf die alte Gans, nun ja, es ist schade um sie. Aber sogar das weisse Hühnchen, um welches Grieting geweint hat, weil wir es vermissten, ist wieder da.“
„Wenn man ein Bein bricht“, erwiderte darauf der Bauer, „so kann man es wohl ein Glück nennen, dass man nicht beide Beine gebrochen hat. Ich nenne es aber ein Unglück, wenn ich sehen muss, wie der ganze Stall nichts mehr taugt. Wo soll denn ein neuer herkommen? Kannst du mir das sagen?“
Das kann ich dir sagen“, antwortete die Bäuerin. Sie legte ihm den Arm tröstend um die Schultern. „Hast du nicht selber schon davon gesprochen, dass der Stall einmal neu gebaut werden müsste?“
„Aber doch nicht in diesem Jahr. Es ist zu spät, damit anzufangen.“ — Er griff sich ratlos ins Haar und kratzte sich den Kopf.
„Mann“, sagte die Frau, „du bist klug, du bist stark, du bist fleissig. Und du hast Ansis zum Gehilfen. Ich sehe euch beide schon, wie ihr zusammen den neuen Stall baut. Der wird schöner werden als der alte.“
Mit Ansis zusammen — das war ein Gedanke, dem sich Freude abgewinnen liess. — „Ich will mir’s in Ruhe überlegen“, sagte der Bauer.
Ansis als der älteste Sohn war dem Vater das wichtigste seiner Kinder. Zählte er sie an den Fingern her, so brauchte er für fünf von ihnen, mit Milda angefangen, die linke Hand. Aber für Ansis hielt er den Daumen der rechten hoch. Die anderen waren am Baum der Familie die Asttriebe. Ansis war der Stammtrieb.
Auch sollte ja Ansis einmal den Hof erben, also derjenige sein, der den Namen des Hofes wie der Familie zusammenhielt. Ob der Hof nach der Familie oder die Familie nach dem Hof, den sie besass, hiess, hätte niemand zu sagen gewusst. Die Sippe war über das Land verbreitet. Man wusste von einander nicht mehr, als sich aus nächster Verwandtschaft ergab. Mochte zu einer Zeit, da die Familiennamen verteilt wurden, ein Erzvater des Geschlechts den seinen sonstwoher bekommen oder sich nach der Scholle, auf der es sass, genannt haben, in jedem Falle gehörten sie, soweit sich zurückdenken liess, zusammen: die Wezrumbas und ihr Hof. — Wezrumba — mit einem solchen Namen konnten sie wohl zufrieden sein, und sie waren es.
Es hätten sich in ihrer Familiengeschichte, wenn jemand ihr hätte nachforschen wollen, unter Glück und Unglück, die ja beide nicht ausbleiben können, von letzterem sicherlich auch solche Fälle nachweisen lassen, die dem von dem Wirbelwinde angerichteten Schaden mehr oder weniger ähnlich gesehen hätten. Und wahrscheinlich haben sich bei solchen Gelegenheiten die davon betroffenen Männer genau in derselben Weise den Kopf gekratzt, wie es Karlis Wezrumba, Träger der Stammlinie, angesichts seines zerfledderten Stalldaches tat. Und wenn die Frauen dabei waren, haben sie ihnen Mut zugesprochen, genau wie Frau Anne. Wie denn überhaupt anzunehmen ist, dass die Wezrumbas von Urzeiten her ihre Abstammungsähnlichkeit nicht verleugnet haben.
Hinter der Stirnlocke aber des Urahns muss ein Gedanke gewohnt haben, wie ihn nicht jeder Stammvater gedacht hat: Ur-Wezrumba hat etwas im Geiste erschaut, das hat er wie einen Segen und eine Verheissung für das ganze Geschlecht vorausgesehen, gedacht und vielleicht auch ausgesprochen: Es soll einmal zu irgendeiner Zeit, in der es schon sehr viele Wezrumbas geben wird, unter ihnen einer sein, der soll in sich vereinigen alle Tugenden seiner Vorfahren unter Weglassung aller ihrer Untugenden.
Das war Ansis, wie der Vater ihn sah: Der leibhaft Wirklichkeit gewordene Gedanke Ur-Wezrumbas.
„Du verziehst ihn“, sagte zuweilen die Mutter.
„Was ist an Ansis zu erziehen?“ pflegte darauf der Vater zu erwidern.
Siebenmal schon hatte die Bäuerin dem Manne zu dem Glück verholfen, Vater zu werden. Nur leider war das Jüngste — ein Mädchen war es und sollte Welta heissen — noch im zarten Säuglingsalter gestorben. Der liebe Gott hatte das Engelchen wieder zu sich genommen. Aber wenn er wollte, so konnte er ja die Zahl sieben wieder herstellen, indem er den heranwachsenden Geschwistern noch einmal so ein Kleines zugesellte. Mit dem Heranwachsen ging es ja sonst zu schnell. Milda mit ihren achtzehn Jahren war ohne Zweifel schon heiratsfähig. Das konnte man freilich von Ansis, der erst im siebzehnten stand, noch nicht sagen. Aber wie Milda die Magd, so ersetzte er, kräftig entwickelt, vollauf schon den Knecht. Gerwiss, es war vorteilhaft, schon so grosse Kinder zu haben, die in der Wirtschaft tüchtig halfen. Auch Attis, der Vierzehnjährige, obwohl noch ein rechter Lümmel, war schon zu vielem zu gebrauchen. Tischler wollte er werden. Den Verstand und das Geschick hatte er dazu, und die Lehre würde ihm gut tun. Von Grieting, dem schmächtigen Ding, war nicht viel zu verlangen. Sie fütterte die Hühner. Man musste ja die Kinder so nehmen, wie Gott sie gab, und weniger geliebt war darum Grieting auch beim Vater nicht. Blieben als die beiden Jüngsten noch Mikelis und Maris, von Fremderen stets für Zwillinge gehalten, obwohl sie mit neun und zehn ein ordentliches Jahr auseinander waren. Auch sie assen schon ihr Brot am Tische der Eltern nicht umsonst: sie hatten das Vieh auf die Weide zu treiben und zu hüten, dass es nicht hinginge, wo es nicht sollte. Im Winter freilich schieden sie als nützliche Familienmitglieder aus, denn dann mussten sie zur Schule. Aber das alles ging dem Bauern zu schnell, und darum wünschte er, es träte noch einmal die Notwendigkeit an ihn heran, die Wiege vom Dachboden herunterzuholen, wo sie, seit das Engelchen aus ihr fortgeflogen war, in leerem Dasein verstaubte.
Und schliesslich brauchte es ja bei Sieben auch noch nicht sein Bewenden zu haben. Aber selbst wenn die Finger beider Hände zum Herzählen nicht mehr ausreichen sollten, so würde doch immer der Daumen der rechten Hand dem Ansis vorbehalten bleiben. Ansis war ja nicht nur der Daumen, er war — so sprach der Vater es einmal aus — seine ganze rechte Hand. Und darum hatte die Frau genau das Richtige damit getroffen, dass sie dem Manne, als dieser mutlos werden wollte, den Namen desjenigen vors Ohr sprach, der ihm Sohn und Gehilfe war, und mehr als beides: eine Verheissung.
So dauerte denn auch sein Überlegen nicht lange. — „In diesem Jahre wird das nicht mehr“, sagte er. „Wo nehme ich trockenes Holz her? Es muss im Winter geschlagen sein. Wir werden ein Notdach machen. Den einen Winter hält es das Vieh wohl noch in dem alten Stall aus. Aber vom nächsten Frühjahr an — — Frau, ich danke dir, dass du mir wieder Mut gemacht hast.“ — Er spuckte zum Zeichen seines wiedergewonnenen Mutes in die Hände, als wollte er gleich ein Werkzeug anpacken.
„Nun ich sehe schon“, sagte die Frau, „ein Dach hat uns der Wirbelwind zerblasen. Aber da drunter“ — sie griff dem Mann in die Stirnlocke — „hat er noch keinen Schaden angerichtet. Und darum wird auch alles wieder gut.“
„Ja, das wird es“, sagte der Mann.
Sie blickten sich vergnügt in die Gesichter, und keines von ihnen erschien dem anderen gealtert.
Der Einfall
Während der folgenden Tage sann der Bauer Wezrumba darüber nach, was alles zum Bauen nötig sein werde. Da war an vielerlei zu denken.
„Holz gibt es genug im Walde“, sagte er sich. „Der Wald ist nicht weit. Er gehört dem Staat. Zum Zwecke des Bauens kriegt man’s billiger als vom Händler. Auch sucht der Staat immer Arbeiter für seinen Wald. Man kann also Holz auch ohne bares Geld kaufen, wenn man sich dafür zu bestimmten Arbeiten verpflichtet. Notfalls aber, wenn mir das zu viel wird, weil das Schlagen und Anfahren und Bearbeiten der Stämme schon Mühe genug ist, kann ich auch bei der Bank ein Darlehen aufnehmen. Der Hof ist unverschuldet, da lässt sich das schon machen, auch ohne dass ich deshalb die Summe angreifen müsste, die ich mir zum Kauf des zweiten Pferdes zurückgelegt habe. Schade um den schwarzen Peter!“
Diesem letzteren Gedanken schickte er einen kleinen Seufzer nach, und damit verhielt es sich so: Immer, solange man denken konnte, hatten die Wezrumbas mit zwei Pferden gepflügt. Was ist das auch für eine jämmerliche Wirtschaft, in der man sich mit einem Pferde begnügt! Damit mochten die Jaunsems auskommen, aber nicht die Wezrumbas. Nun hatte aber im vergangenen Winter der vortreffliche schwarze Peter, ein uraltes Pferd, zum erstenmal in seinem Leben Fleiss und Gehorsam verweigert, indem er sich einfach hinlegte und starb. Er war gebührend betrauert worden. Für einen sofortigen Ersatz war das Geld nicht da. Seitdem hatte der noch jugendliche gute Braune, zum Kummer seines Pflegers Ansis, mehr leisten müssen, als ihm lieb war, und beim Pflügen hatte man sich mit den Nachbarn, den Jaunsems, gegenseitig ausgeholfen. Denn mit einem Pferde kam man ja mit dem Pfluge nicht tief genug in den schweren, lehmigen Boden. War aber erst die neue Ernte, die gut zu werden versprach, geborgen, so rollte auch wieder Geld ins Haus. Keinesfalls sollte wegen des Neubaus auf die Wiederanschaffung des zweiten Pferdes verzichtet werden. Nur war es vorteilhafter, es erst im nächsten Frühjahr zu kaufen, des Futters wegen.
Überhaupt sollte nach Möglichkeit, trotz Wirbelwind, nichts unterbleiben, was für den Zuwachs der Wirtschaft gedacht und beabsichtigt war: Die Rodung des Strauches, die Entwässerung des Sumpfes, nichts sollte deswegen hinausgeschoben werden. Ausführbar war alles. Die Frage war einzig die, ob man gegenüber einer stark vermehrten Arbeitslast noch einen Überschuss an Kräften in sich spürte, den man dafür einsetzen konnte. Und diesen Überschuss spürte der Bauer in sich. Darum hatte er auch die Frau so vergnügt anlachen können.
Was er bisher gedacht hatte, waren alles noch keine sehr ungewöhnlichen Gedanken. Sie ergaben sich sozusagen von selbst. Er hatte in Holz gedacht, und dass er sich dabei den neuen Stall ein wenig grösser, schöner und irgendwie besser vorstellte als den alten, das setzte wohl seinen Verstand in Bewegung und frischte ihm den Mut auf, griff aber noch nicht zutiefst in sein Gemüt. Dazu musste ihm erst ein anderer Gedanke kommen, ein völlig neuer, ungewöhnlicher, von der Art, von der man manchmal nicht weiss, wo sie herkommt, und die man darum Einfall nennt.
Der Einfall war: „Ich bane gar nicht wieder aus Holz, sondern aus Stein. Feldstein kostet nichts. Drüben liegt er bei der Ruine. Man muss ihn nur über den Fluss herüberholen.“
Wezrumba fing beim Denken nicht mit Begründungen an. Hätte er aber nachträglich welche vorbringen sollen, so wäre er darum nicht verlegen gewesen. — „Stein hält länger als Holz“, hätte er gesagt. „Zwar die Ruine drüben war ehemals eine stolze Ritterburg und nachher ein Schloss und Herrenhaus, und dann ist sie doch zerfallen. Aber wie hat man sie auch behandelt! Zerschossen hat man sie und angezündet. Die Ritter sind ausser Landes gegangen. Und nachher hat jeder, der dort in der Nähe wohnte und Steine zum Bauen brauchte, sich welche von den Trümmern der Burg geholt. Darum ist so wenig mehr von ihr übrig, nur noch der Turm und die Wand mit den drei Fensteröffnungen. Als ich ein Kind war, habe ich in ihr vier Fensteröffnungen gesehen. Also ist seitdem ein Stück von ihr weggebrochen, und bricht noch ein Stück weg, so werden es nur noch zwei Fenster sein, wie Augen in einem Kopf. Auch der Turm ist früher höher gewesen, als er heute ist. Warum hat man das nach dem Brande nicht wieder aufgebaut? Jetzt ist das weiter nichts als ein Steinbruch.
Die drüben haben zum Bauen immer den Stein gehabt. Noch heute haben sie beim Pflügen ihre Plage mit den Steinen im Acker. Wir auf unserer Seite des Flusses haben den Feldstein nicht. Das ist fürs Ackern gut. Aber zum Bauen fehlt’s. Darum hat man bei uns immer aus. Holz gebaut. Und war es gutes, gesundes, trockenes Holz, so mag der Bauende wohl über die eigene kurze Lebenszeit hinausgedacht haben, an Kind und Kindeskind. Viel weiter hat dabei keiner denken können. Das kleine Kleetchen hat der Urgrossvater gebaut. Man weiss von ihm sonst nichts. Er hat es schön hingestellt mit dem Vordach auf den zwei Säulen. Und das hat ja auch gehalten. Das kommt von seinem trockenen Inhalt. Es lagert in ihm die reine Gottesgabe, das ausgedroschene Korn. Die Frau hängt die geräucherten Schinken und Würste, das getrocknete Schaffleisch und den gedörrten Fisch hinein, so sie welchen für uns hat. Das Kleetchen ist unsere Schatzkammer, und darum braucht es auch nicht grösser zu sein. Unter der Tür ist ein Loch, dass die Katze durchschlüpfen kann, zum Mäusefang. Das Kleetchen mag noch eine gute Weile stehen.
Aber schon bei dem Wohnhause wird es bedenklich. An den Türen sieht man es, wie die Balkenwände sich verzogen haben. Der Grossvater hat es gebaut. Aber wer weiss, ob es einmal dem Ansis, wenn er der Herr darin sein wird, noch genügen wird. Man könnte wahrhaftig schon an einen Neubau des Wohnhauses denken, wenn nicht der Stall so viel wichtiger wäre. Und der ist nun hin. Bis zu mir, dem Enkel, hat’s gereicht. Bis zum Urenkel Ansis reicht es nicht mehr. So vergänglich ist das Holz als Baustoff. Und darum, wer etwas recht Dauerhaftes hinsetzen will, der soll aus Stein bauen. — Drüben bei der Ruine liegt er.“
Das waren ja nun gewiss recht gute Begründungen. Aber wo ein Gedanke wächst, da wachsen meist auch gleich ein paar Bedenken. Das erste Bedenken war: „Wie kriege ich die Steine über den Fluss herüber? Der Fluss ist breit, die Strömung lebhaft. Das Boot ist klein. Das wäre eine zu grosse Anstrengung und würde zu lange dauern. Ja, wenn es nah eine Brücke gäbe! Aber die Brücken sind weit. Eine befindet sich unterhalb, und es liegt eine Stadt an ihr, von der ist es schon nicht mehr fern bis zum Meer. Die andere Brücke, oberhalb, ist noch weiter. Auch dort liegt eine Stadt. Sie ist für die Bahn ein wichtiger Knotenpunkt. Aber was nützen Knotenpunkte, Eisenbahnstrecken, Brücken, wenn sie alle so weit sind? Die Gegend ist still. Ist sie darum so still, weil sie abseits des Verkehrs liegt, oder hat man den Verkehr darum nicht hergeleitet, weil die Gegend so still ist? Wäre eine Brücke da, dann wäre es leicht, die Steine von drüben herüberzuholen. Aber sie ist nicht da. Oder doch? — Im Winter, wenn der Fluss fest zufriert, dass man mit Pferd und Schlitten darauf fahren kann, dann ist der Fluss eine grosse Verkehrsstrasse, in seiner ganzen Länge, und wird auch als solche benutzt, und eine einzige Brücke, in seiner ganzen Breite. Dann ist Ufer zu Ufer nah.“
Also: Es musste nur erst Winter werden, damit der Fluss zufror. Vor dem nächsten Frühjahr war an Bauen doch nicht zu denken. Der gute Branne würde nicht dazu kommen, sich allein im Stall zu langweilen. Für den gab’s Arbeit! Und der Schlitten war auch noch gut und ganz.
Schwerer schien ein anderes Bedenken zu wiegen: „Das Ufer drüben gehört dem Staat. Dem Staat gehört der bewaldete Hang und nach der anderen Seite der Hügel, so weit er bewaldet ist. Also gehört dem Staat auch die Ruine, und ihm gehören die Steine, die von ihr sind. Der Staat ist genau mit seinen Sachen. Aber wozu braucht der Staat die Steine? Er baut ja dort nichts. Man hat auch nicht bemerkt, dass drüben einmal ein Wächter zu sehen gewesen wäre. Wer Steine braucht, der holt sich welche, das ist immer so gewesen. Und man hat noch nie davon gehört, dass deswegen einer Unannehmlichkeiten gehabt hätte. Was nicht bewacht wird, das ist frei, und man kann davon nehmen. Es ist wie die Luft und das Wasser, die auch nichts kosten. In alten Zeiten soll ja auch der Boden nichts gekostet haben, und auch das Holz aus dem Walde nichts, und es konnte jeder im Walde jagen und im Wasser fischen, wo es ihm gefiel. Der Staat ist ja nun nicht so wie die alte Zeit, sondern er ist genau. Und wenn man ihn fragen wollte, so würde man ihn vielleicht damit erst auf den Gedanken bringen, sich’s auszurechnen, was die Steine drüben wert sind. Darum fragt man besser nicht.“ — Also, das Bedenken, fand der Bauer, war eigentlich keins. Es liess sich ganz leicht aus dem Kopf schütteln.
Aber das eine, das grösste Bedenken, blieb bei alledem doch noch bestehen: die Kosten! Darum war ja auch an Ziegelbau, Zementguss und dergleichen nicht zu denken. Und wenn nun auch der Feldstein nichts kostete, so kostete doch der Kalk, den man für den Mörtel brauchte. Auch kam man ja bei keinem Bau ohne Holz aus. Was da allein für das Dach draufgehen würde! Eigentlich müsste man es mit Dachpfannen decken, der Schönheit wegen. Aber wer konnte das bezahlen? Stroh? — nein, Stroh sollte es nicht sein, aber Schindeln. Und es gab eine rote Farbe. Wenn man mit der die Holzschindeln strich, sah es von weitem genau so aus wie ein Ziegeldach. Auch sollte die Farbe das Holz vor Fäulnis schützen. Das war eine Lösung. Es musste sich auch für alles andere eine Lösung finden. Ein wenig Eisen, ein wenig Glas, und was sonst noch zum Bauen nötig war — nun, was wirklich nötig war, das musste eben beschafft werden! Hauptsache, dass die Steine nichts kosteten!
Wezrumba freute sich so, als hätte er die Steine schon, die er brauchte. Er trug seine Gedanken schweigend umher. Die Arbeit am Heu liess keine Zeit zu Gesprächen. Aber die anderen merken es, wenn einer im Hause seine Gedanken verbirgt. Die Frau sah zuweilen den Mann prüfend von der Seite an. Sie freute sich über sein frisches, unternehmendes Aussehen. Es kam ihr aber eine kleine Bangigkeit dabei. Sie wusste nicht, woher.
Zu den feststehenden Gewohnheiten des Bauern Wezrumba gehörte natürlicherweise auch die, dass an jedem Tage des Jahres beim Erwachen sein erster Blick und seine erste Frage dem Wetter galten. Dabei begnügte er sich nicht damit, durch die immer ein wenig trüben kleinen Scheiben eines der Fenster zu sehen, sondern er trat vors Haus, um zu spüren, wie und von woher die Luft wehe.