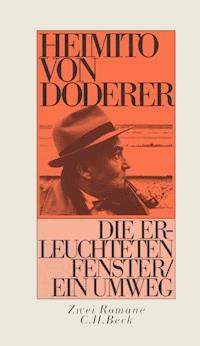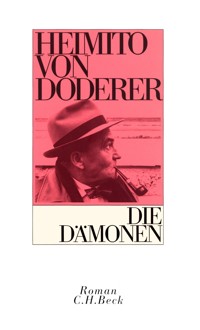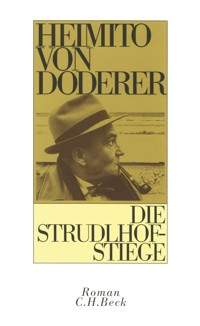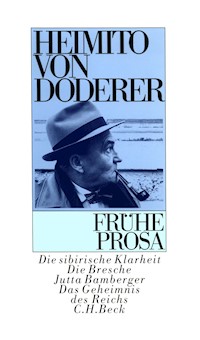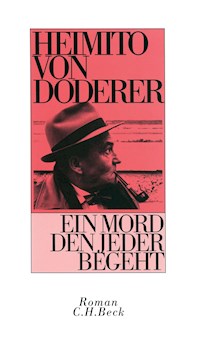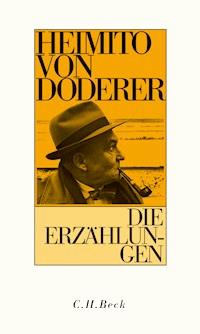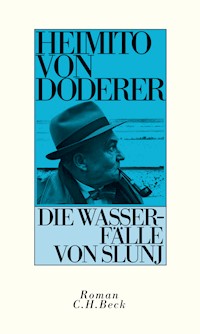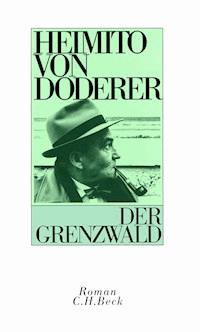
13,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: C. H. Beck
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
"Der Grenzwald" war von Heimito von Doderer als zweiter "Satz" des nach dem Vorbild einer Symphonie in vier Sätzen aufgebauten "Romans No. 7" geplant. Die Einheit dieses vierteiligen Werkes sollte nicht im Inhalt, sondern allein in seinen Formelementen liegen. Wie im ersten "Satz", den "Wasserfällen von Slunj", tritt eine Figur weitgehend in den Mittelpunkt. Es ist der Oberleutnant Zienhammer, Durchschnittsmensch mit einem Schicksal, das in allen Kriegen, so aktuell ist wie in dem, den Heimito von Doderer schildert. Neben Zienhammer steht der Arzt Dr. Alfons Halfon im Vordergrund: im Konflikt mit seinem Vater und auf der Suche nach den befremdlichen Todesumständen seiner Mutter. Obwohl "Der Grenzwald" Fragment geblieben ist, ist Doderers Technik, die Dinge als sie selbst wirken zu lassen, bereits durchschaubar; und der Raum, der durch das Motiv des "Grenzwaldes" geschaffen wird, verleiht dem Werk auch in der Gestalt die atmosphärische Dichte, die Doderers Romane stets ausgezeichnet hat.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
HEIMITO VON DODERER
Der Grenzwald
Roman
VERLAG C. H. BECK
Zum Buch
„Der Grenzwald“ war von Heimito von Doderer als zweiter „Satz“ des nach dem Vorbild einer Symphonie in vier Sätzen aufgebauten „Romans No. 7“ geplant. Die Einheit dieses vierteiligen Werkes sollte nicht im Inhalt, sondern allein in seinen Formelementen liegen. Wie im ersten „Satz“, den „Wasserfällen von Slunj“, tritt eine Figur weitgehend in den Mittelpunkt. Es ist der Oberleutnant Zienhammer, Durchschnittsmensch mit einem Schicksal, das in allen Kriegen, so aktuell ist wie in dem, den Heimito von Doderer schildert. Neben Zienhammer steht der Arzt Dr. Alfons Halfon im Vordergrund: im Konflikt mit seinem Vater und auf der Suche nach den befremdlichen Todesumständen seiner Mutter. Obwohl „Der Grenzwald“ Fragment geblieben ist, ist Doderers Technik, die Dinge als sie selbst wirken zu lassen, bereits durchschaubar; und der Raum, der durch das Motiv des „Grenzwaldes“ geschaffen wird, verleiht dem Werk auch in der unvollendeten Gestalt die atmosphärische Dichte, die Doderers Romane stets ausgezeichnet hat.
Über den Autor
Heimito von Doderer (1896–1966) gilt seit der Veröffentlichung seiner beiden großen Wiener Romane Die Strudlhofstiege (1951) und Die Dämonen (1956) als einer der bedeutendsten österreichischen Schriftsteller des 20. Jahrhunderts.
«Doderer ist ein ganz erstaunlicher Schriftsteller. Sehr berühmt und doch immer noch zu entdecken.»
Daniel Kehlmann
«Rätselhaft, daß wir es uns leisten, über diesen großen Autor hinwegzugehen.»
Walter Kempowski
Inhalt
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
ANHANG
TAGEBUCHAUFZEICHNUNGEN ZU ‚ROMAN NO 7/II‘
ZUM STAND DES FRAGMENTS
Fußnoten
1
Ventruba orientierte sich rasch mit Hilfe seines Vaters. Wenige Stunden nach der Rückkehr aus Italien am 10. August 1919 – er hatte über drei Jahre in Kriegsgefangenschaft verbracht – wußte er schon wie die Dinge standen und hatte bereits den Vater begriffen, welcher ihm jenen Punkt zeigte, wo der Profit saß. Kein Schieber- und Spekulantenprofit, sondern ein kommender industrieller.
„Ich bringe mit“, sagte er zu Ventruba senior, der ihn nach solchen Sachen eben gefragt hatte, „englisch, französisch, italienisch fast perfekt und tschechisch viel besser, als ich es früher gesprochen habe. Ferner hab’ ich alles repetiert, was man im Abiturientenkurs der Exportakademie gelernt hat; theoretisch könnte ich morgen die Prüfung noch einmal und ebenso gut wie damals machen. Die Praxis in der Fabrik vor dem Krieg und die paar Semester Jus haben mir auch nicht geschadet. Wir haben in den Kriegsgefangenenlagern ausgezeichnete Kurse gehabt, das wurde nie unterbrochen. Wenn du mich anleitest, Papa, werde ich in ein oder zwei Jahren und sobald die Lederimporte im Gang sind, das Werk hier in Mödling in deiner Vertretung führen können, so daß du für Brünn zeitweise abkömmlich wirst. Daß wir keine Kredite brauchen werden ist deiner genialen Tat zu verdanken, Papa.“
Ventruba senior hatte schon 1915 sein Gesamtvermögen in die Schweiz und deren Währung verbracht gehabt. Solche Transaktionen waren damals noch durchaus möglich gewesen. Jetzt, wie die Sachen lagen, konnte es nur kurzfristige Industriekredite geben, vom Ausland.
Morgens: das Zimmer in der kleinen Villa, ein sehr frühes Erwachen, der Blick auf die Waldberge. So fand sich Ventruba aus dem Leben in Lagern und auf Transporten mit einer kurz abbrechenden Plötzlichkeit in’s Einzeldasein versetzt. In der Wanne sitzend im warmen Wasser wurde ihm das, nur durch Augenblicke, allzu bewußt, und aus ihm antwortete eine kleine Bangnis, ob er der Lage gewachsen sei, an welcher er sich nun zu messen hatte? Die zwei Junggesellen frühstückten dann zusammen: das waren sie jetzt wirklich, Vater und Sohn. Die Mutter war im Sommer 1911 gestorben. Vincenz Ventruba hatte damals schon die Reifeprüfung hinter sich gehabt und mußte von seiner ‚Matura-Reise‘ telegraphisch nachhause gerufen werden. Er kam zurecht um die Mutter noch bei Leben zu sehen. Das war nun bald acht Jahre her. Er hatte jetzt sechsundzwanzig. Das Jus-Studium würde er beschleunigt abschließen können. Daß man den Kriegsteilnehmern ein oder das andere Studiensemester erlasse, war schon in der Gefangenschaft bekannt geworden.
Der Alte saß gemütlich auf der Veranda hinter seiner Kaffeetasse und war schon bei der Zigarre, als Vincenz an den Frühstückstisch kam. Ob er mit ihm in’s Werk würde gehen wollen („oder ruhst dich besser heut’ aus!“), soweit von einem solchen jetzt gesprochen werden könne?! Man habe zuletzt Schuhsohlen erzeugt aus wenig Lederabfällen, viel Sägespänen, Papierabfällen, und Teer als Bindemittel, gepreßt; ein Teil der Fabrik hatte auf Munitionsbetrieb umgestellt werden müssen. „Immerhin, die Gebäude sind da. Ein Teil der Maschinen ist auch noch verwendbar.“ Vincenz faßte Mut, wenn er den Alten ansah; unter dieser Leitung würde er alles leisten können. Ventruba senior war ein kleiner, grauer, trotz der schlechten Jahre verfetteter lustiger Mann. Der Sohn aber ein langes, zähes Tau, fast einen Meter und neunzig Centimeter groß. Dieser Wuchs kam von der Mutter, der geborenen Morawetz; Ella Morawetz, ebenfalls aus der lederverarbeitenden Branche.
Die Holzveranda war eine von den braunen, altmodischen. Vincenz erinnerte sich jetzt, wie er täglich morgens in’s Gymnasium nach Wien gefahren war. Sein Zimmer oben im ersten Stock war unverändert geblieben. Der Kiesweg um die Ecke der zweistöckigen Veranda bog wie einst in den Garten ab und führte an einer Tonne für Abfälle vorbei. Das Butterbrot schmeckte eigentümlich frisch hier im Freien, wie man da saß; die großen verglasten Rahmen waren zur Seite geschoben; die Luft sehr mild, schon dufteten Blüten. „Daß du nur wieder da bist“, sagte der Vater.
Das Werk war ein Saustall. Das elendige Material, mit welchem hier während des letzten Kriegsjahres gearbeitet worden war, hatte alles vermistet und verschmutzt; dies zog sich sogar bis in die Kanzlei. Durch die Aufstellung der Drehbänke zur Munitionserzeugung aber war die Einteilung der Räume für den eigentlichen Produktionszweck der Fabrik vollends gestört. Die Massen der Ersatzstoffe zur Schuhsohlenerzeugung samt dem fertigen Produkt wurden bereits weg gebracht. Man hatte sie für industrielle Heizzwecke verkauft. Auch verfrachtete man die Drehbänke. Beide letzte Posten gehörten schon in den Rahmen jener ‚Sachdemobilisierung‘ im weitesten Sinne, welche eine Lawine chaotischer Kriegsgüter noch Jahr und Tag lang auf den Markt warf.
Das Werk verlassend, den Blick wieder in den Waldbergen drüben: kein Gegensatz – der heillos geworden wäre! – wurde von Vincenz verspürt zwischen der verschmutzten und verkratzten Stätte, die er verließ, und den im mittäglichen Lichte vor dem Sommerhimmel dahinziehenden Erhebungen, deren entferntere Wälder dicht wie Moospolster schienen. Ihm, Vincenz, ging solch ein schmerzender Gegensatz wahrhaftig nicht ab, er wußte nichts davon. Erst recht genoß er die Einheit seines Daseins jetzt und hier, und dessen klare Richtung und Aufgabe als ein volles Glück.
„Wir werden’s machen, Vinci“, sagte der Vater, der neben ihm klein dahinging. Er nahm Vincenz für einen Augenblick mit leichtem Drucke bei der Hand.
„Ja, Papa“, sagte Vincenz laut und fest.
Damit begann hier jener Vorgang – und an vielen tausend anderen Stellen zugleich – welchen man nach der zweiten Weltkatastrophe unseres Jahrhunderts ebenfalls den Wiederaufbau genannt hat.
Wenn auch in Vincenz Ventruba Gegensätze nicht allzudeutlich in’s Bewußtsein zu treten pflegten: die gewandelte Lebensluft ward ja doch von ihm geatmet und gefühlt, in Wien freilich, weil er dort im Auftrage des Vaters zu tun hatte, und das fast täglich. Besonders in alten Stadtteilen und Gassen, wenn er solche betrat: hier stand’s zum Greifen, daß sie wie halb untergegangene Schiffe waren, die auf Grund geraten sind und deren Bug, nun ganz sichtbar geworden, in ungemäßer Weise in den Himmel ragt, nicht vom Wasser mehr umschlossen, sondern von Luft umgeben, und also verrottend.
Tiefe Vorstädte, jahrelang aufgescheucht durch das mißratene Lieblingskind einer unzulänglichen Staatsführung, den Krieg: aber schon sonderten sie wie eine Schutzhülle ihre Aura neuerlich ab, und man kann sagen, daß bereits in den frühen Zwanzigerjahren viel davon wieder vorhanden und dicht geworden war. Teilweis auch schien es überhaupt nicht zerrissen und gewichen. Es schien Inseln zu geben in der vergehenden Zeit, nur umspielt von deren Strom, den sie gleichsam teilten, nur umspült, nie überflutet; und so hielten sie durch viele Jahrzehnte sich unverändert: in donaunahen Bezirken, etwa in der alten Leopoldstadt mit ihren schäbigen Gassen, die seltsame Namen tragen, wie die Mohren-Gasse oder die Rotenlöwengasse, oft ganz leer und still, nicht einmal Kinder spielen auf dem Gehsteig. In der Novaragasse aber standen die Frauenzimmer am hellichten Tag in Grüppchen herum, daraus Zurufe an etwa einherkommende Passanten tönten.
Vincenz streifte hier nirgends an. Seine mit Vorsicht genossenen Freuden, auf die er ja in Wien früher oder später hatte verfallen müssen, wählten eine soigniertere Ebene mit einer garantierten Hygiene.
Mehrmals auch kam er später, schon 1920, an seinem einstmaligen Gymnasium vorbei (jetzt bereits am Steuer eines langen Wagens) und einmal gerade dann, als mittags nach Schluß des Unterrichtes die Scharen der Schüler dem Gebäude entquollen, wie eh und je. Ventruba hielt nicht an, obwohl er’s gerne hätte getan. Er glitt weiter die lange, gerade, leicht abfallende Straße hinab. Aber, als er hier die laufenden und durcheinander rufenden Schüler hinter sich ließ – einige sprangen beiseite, da er hupte – kam doch ein Bach von Erinnerungen hinterdrein, der auch durch die folgenden Tage floß. Seine Mitschüler: der kleine Baron Rottenstein mit Stupsnase und schwarzen Haaren. Der Doderer mit den Schlitzaugen. Der Hofmock mit den gesellschaftlichen Ambitionen. Einen Canadier aus Montreal hatten sie auch gehabt, Cunish hieß er, dick und lustig-listig, einer der besten Schüler.
Er wußte von keinem mehr was. Sie waren ihm fast alle gleich nach der Matura abhanden gekommen, und vergessen worden.
Der Alte hatte sich übrigens 1911, nachdem die Mutter gestorben war, gänzlich zurückgezogen. Ein Haus war eigentlich nie geführt worden, es gab ja keine Tochter. Es mußte Vincenz jetzt auffallen, daß er in Wien kaum mehr Bekannte außerhalb der geschäftlichen Bezüge hatte. Auch keine Verwandten; diese saßen in Brünn, das jetzt Brno hieß. So geriet er in Wien nur sehr allmählich sozusagen in’s Interieur der Stadt, wo das Sachliche zurücktritt und das persönliche Leben beginnt. Zunächst bekam Vincenz allermeist nur Geschäftsräume und Ämter zu sehen.
Schließlich aber doch den Fritz Hofmock, und auf lächerliche Weise. Sie stiegen vor der Devisen-Zentrale beide gleichzeitig aus ihren Wagen, mit gleichem Schwung der Türen, mit gleichem Klapp. Fritz war ein perfekter Weltmann geworden. Nach fünf Minuten wußte Ventruba bereits, daß jener sich mit einem Fräulein Harbach verlobt hatte, der Tochter eines Textilgroßindustriellen, und auch schon in der Firma seines künftigen Schwiegervaters tätig war. Ventruba’s Auftreten – Vincenz hatte seine Tätigkeit und Umstände nur kurz erwähnt – wirkte auf Hofmock offenbar vertrauenerweckend, er gab ihm seine Adresse, lud ihn ein.
„Der Cunish ist in Wien“, hieß es zuletzt. „Bei der canadischen Militärmission.“
Manches auch spielte sich schon ein um diese Zeit. Das Leder kam, das erneuerte Werk lief. Man begann wieder Schuhe mit richtigen Sohlen zu tragen.
Die alten Gassen da oder dort suchte Vincenz mitunter gerne auf, und ohne den Wagen, den er gesichert stehen ließ. Er besuchte sogar abseitig-spießerische Cafés (der Kaffee war damals sehr schlecht), Lokale, die ein Fritz Hofmock nie betreten hätte; und hier zeigt sich doch ein Unterschied zwischen den beiden, der, als sie vor der Devisenzentrale synchronisiert aus ihren Autos gestiegen waren, fast verschwunden schien, zur Beruhigung Fritzens.
Im ‚Café Kraus‘ am alten Bezirke ‚Neubau‘ aber war Ventruba keineswegs mit jenem Hofmock synchronisiert, sondern recht eigentlich entchronisiert, aus der Zeit geraten, oder vielleicht, ganz im Gegenteile, tiefer in sie hinein, in ihr untersinkend; aus der Rinne getreten, die uns von einer Obliegenheit und ihrem Zeitpunkt an die andere Obliegenheit und ihren Zeitpunkt weitergibt; von allen denkbaren Partnern oder Gegnern losgelöst; verborgen, unauffindbar; in eine Stille geraten die, wer sie nur wirklich auffaßte, niemals für eine solche des bloßen Nichtstuns hätte halten können. Hier war jene bessere Aura, die vom Nicht-Tun kommt, nicht vom Nichts-Tun, das nur die schlechte Luft der Trägheit verbreitet.
Den Gästen des Lokales, welche in schon recht schäbig gewordenen gepolsterten Logen saßen – diese gliederten den Raum beinah in einzelne Räume und außerdem lag ein Teil des Cafés um ein paar Stufen höher – hätte man mit irgendwelchen Novitäten schwerlich das Geld aus den Taschen ziehen können, auch abgesehen davon, daß in solchen Taschen fast nichts war. Hier an rauchigen Herbstabenden zu dösen, nach der Plage im Geschäft oder Bureau, das genügte ihnen (und erstaunlicherweise dem Vincenz Ventruba auch!), profund einverblödet in’s glücklich wieder Gewohnte, das man doch intensiv genoß, samt den quargelnden und raunzenden Stimmen des halblauten Disputs von der Nachbarloge her, während man mageren Hinterns auf modester Bureau-Hose in einem ebensolchen gepolsterten Viereck saß, klug und verzwickt, daheim eine erlesene Sammlung von seltsamen Meerschaumpfeifen hegend, oder eine solche von Originalbriefen berühmter Burgtheatermitglieder (von welcher mancher Historiker gern gewußt hätte, jedoch ward sie geheim gehalten), oder von außerordentlichen tropischen Schmetterlingen, kurz: hier mager und gepolstert zu sitzen, ein wenig gescheucht und vorsichtig, als ein rechter austriakischer Kaktus, viel wissend, allerlei bedacht habend, hoffnungslos aber unausrottbar: das genügte. Es klingelt die Trambahn draußen, gedämpft, denn der Ober hat schon mit Hilfe eines langen Stabes die dicken Vorhänge vor die großen Scheiben fließen lassen, das Lokal ist erhellt. Man begrüßt einen Bekannten, der vorbeikommt, aber man zieht den Kopf gleich wieder ein. Billardbälle klacksen rückwärts.
Keineswegs nur im Café Kraus war eine Aura dieser Art angereichert, es gab solche Cafés – zum Teil waren sie viel kleiner – allenthalben, Nothäfen für renitente Seelen, die hier ein wenig im stehenden Wasser sich aufhalten konnten, außerhalb der fühlbaren Strömung und Ziehung einer neuen Zeit. Seltsamerweise gehörte unser junger Ventruba zu jenen Seelen, ohne irgendwas dabei zu denken.
Seit er auch die Abende nicht selten in Wien verbrachte – sein Vater hatte ihn veranlaßt, hier eine kleine Wohnung sich zu verschaffen, für Geld konnte man ja alles kriegen, und selbstverständlich hatte der Alte da auch sein Zimmer – seit er also hier daheim war und nicht unbedingt nachts nach Mödling zurückfahren mußte, sank er allmählich etwas tiefer in die Stadt ein, gelangte auch in deren private Kreise und Interieurs, vom Vater dabei gefördert, der Verbindungen da oder dort wiederum anknüpfte und den Sohn in der Folge unmerklich vorschob, denn er selbst hatte nicht mehr viel Lust zur Geselligkeit und verbrachte seine freie Zeit lieber in Mödling auf der alten Holzveranda.
Die Stadtwohnung bot alles erforderliche, wie es Junggesellen brauchen: im Zentrum, aber hoch gelegen, mit Lift, Bad, Telephon, Zentralheizung, keine Umständlichkeiten, alles tunlichst auf Selbstbedienung eingestellt, auch die Küche. Aber außer dieser zeitgemäßen Automatik und den, für damals, ebenso zeitgemäßen neuen Möbeln (mit Geld konnte man wieder alles bekommen, nicht nur Butter, Tee oder Rotwein) hatte diese Behausung etwas wirklich bemerkenswertes zu bieten, und das war die Aussicht, welche man hier genoß wenn man an ein Fenster trat und den halb durchsichtigen Vorhang zurück gleiten ließ. Dann allerdings fiel die Ferne vom Fenster gleich durch den ganzen Raum. Man sah ungefähr nach Nordwesten, über die Donau, gegen Korneuburg. Man hätte durch ein Glas Einzelheiten auf dem Bisamberge ausnehmen können. Diese Aussicht hier war keineswegs charakteristisch, es war keine Wiener Ansicht oder Aussicht, keine Vedute; es war ein unbestimmtes Bild, weiter oder enger und verhangener, je nach der Witterung. Es schien herein. Man sah in der Ferne unverbautes Land. Das war eigentlich alles.
Vincenz kannte auch ein größeres, fast elegantes Café in der Vorstadt, welches aber immer noch im gleichen Wesen seine Wurzeln hatte, wie das ‚Café Kraus‘. Es lag in jener Gegend, wo sich jetzt wieder das Wiener Bureau der Firma befand und ein großes Lager, das licht und luftig und gut übersichtlich war. Hier roch es nach frischer Tischlerarbeit sowie nach Leder, denn auf den Regalen bauten sich Mauern von weißen Kartons mit neuen Schuhen auf, die von hier aus an die Detailgeschäfte geliefert wurden. Vincenz weilte oft tagelang in diesen sauberen Lokalitäten, aß mittags in einem nahen Wirtshaus und ging dann in jenes erwähnte größere Café um Zeitungen zu lesen: es gab auch neugegründete, die man früher nicht gekannt hatte, andere waren verschwunden, wie etwa das kleinformatige Organ des k.u.k. Außenministeriums, ‚Fremdenblatt‘ genannt.
Der Kaffee begann besser zu werden; das heißt, es gab jetzt, neben dem derzeit ganz grauslichen ‚Schwarzen‘, auch einen ‚Türkischen‘ im Kupferkännchen, und dieser war bereits recht gut. Wer den Satz nicht mochte, bestellte ihn ‚passiert‘. So auch Vincenz.
Wenn er in’s Café kam, saß stets ein älterer Herr schon dort, der hier sein Bureau etabliert zu haben schien, und vom Ober mit größter Devotion behandelt wurde. Jener Herr war sehr gut gekleidet, was damals noch ein wenig auffallend wirkte, und saß hinter zwei zusammengeschobenen Marmortischchen, deren eines mit Papieren bedeckt war. Einmal wurde Vincenz zugenickt als er kam und ein andermal geriet man schließlich in’s Gespräch, durch den Ober, der oft in Wiener Cafés die Brücke zwischen Gästen bildet. Der Ältere warf seine Personalien und Lebensumstände kurz wie Karten auf den Tisch, um zu erklären, was er tagsüber im Café mache. Er war Varieté-Direktor, den Namen seines Etablissements kannte in Wien jeder Mensch. Das Gebäude hatte man im Krieg als Reservespital belegt. Alles mußte nun renoviert werden. „Der Lärm ist unbeschreiblich. Jetzt sind eben die Bureau-Räume an der Reihe. Ich kann dort niemand empfangen. Und mein Haus ist zu weit draußen“, sagte Herr Béla Tiborski. In der Tat hielt er hier eine Art Parteienverkehr ab, dann und wann kamen Herren, an denen weiter nichts auffallendes war, setzten sich an seinen Tisch, und Tiborski kramte in den Papieren.
„Sie bereiten mir eine Enttäuschung, Herr Ventruba“, sagte er zu Vincenz, als dieser seine eigenen Lebensumstände kurz angedeutet hatte. „Dadurch nämlich, daß Sie schon in Position sind. Ich habe gehofft Sie wären vielleicht auf der Suche nach einer solchen, wie das bei vielen jungen Leuten jetzt der Fall ist. Und ich hätte eine Position zu bieten, eine sehr günstige für einen jungen Herren Ihrer Art.“
Sodann setzte er ihm auseinander worum es hier ginge. Nicht um einen Fachmann – das sei er selber. Nicht um einen gelernten Kaufmann: dazu habe er den Direktor und die Kanzlei. Sondern um einen Privatsekretär für ihn selbst, mit dem er die Chef-Korrespondenz, die in seiner Branche mitunter heikel sei, bearbeiten könne, vor allem diejenige mit den internationalen Größen und angesichts von deren nicht selten maßlosen Forderungen. Um einen jungen Mann von Distinktion ginge es hier, der auch als schweigende Stütze bei allen Verhandlungen ihn begleiten müßte. „Einen jungen Herrn wie Sie, Herr Ventruba, brauche ich. Sehen Sie sich doch um im Kreis Ihrer Freunde und Bekannten, die aus dem Krieg zurück kommen wie Sie selbst, und nicht das Glück haben, den Vater und eine Position wiederzufinden. Ich wäre Ihnen von Herzen und ernstlich dankbar, wenn Sie diese Sache im Auge behalten und mich gelegentlich verständigen würden. Sie müssen verstehen, daß ich durchaus niemand ‚aus der Branche‘ haben will, also etwa einen ehemaligen Artisten oder dergleichen. Das kommt nicht in Betracht. Ich brauche einen jungen Herren, einen Gentleman.“
Er gab ihm seine Karte mit der privaten Adresse und Telephonnummer.
‚Der Rottenstein!‘ dachte Vincenz. ‚Das wär was für den. Aber wo steckt der?‘
Wirklich hat Vincenz in der Villa der Baronin – Rottenstein-Tattenbach, verehel. Schiffmann stand im Telephonbuch! – angerufen, worauf ihm – und in einem arroganten und unangenehmen Tone – von irgendjemand, der offenbar jetzt dort wohnte, mitgeteilt wurde, die Frau Schiffmann sei voriges Jahr verstorben und von dem jungen Baron wisse man nichts. Und schon auch wurde das Gespräch in brüsker Weise durch Auflegen des Hörers beendet.
Die Sache entschwand, wenngleich Vincenz von Herrn Tiborski gelegentlich daran erinnert wurde. Aber eines Tages waren dessen Kanzleiräume wieder beziehbar und benutzbar geworden, er amtierte nicht mehr im Café, und blieb überhaupt aus.
Auch war um diese Zeit schon neues in Ventrubas Lebenskreis getreten, in Gestalt einer entfernten Cousine aus Brünn, die Edith Morawetz hieß, eine in jeder Hinsicht beachtliche Person. Sie veranlaßte ihn – zunächst nicht sogleich zu den hier angezeigten Aktionen, sondern zu tieferen Meditationen als dem Gegenstande angemessen war; und so geriet er wieder in seine kleinen Vorstadtcafés, welche ihm die rechte Folie seines profunden Nachdenkens zu bilden schienen. Doch eigentlich saß er nur erstaunt über eine ihm bis dahin unbekannte Art des Empfindens gebeugt, eine neue Zuständlichkeit.
Alles ist später gut ausgegangen. Sie war eine ‚gute Partie‘. Sie stammte aus derselben Branche. Der Vater freute sich dann sehr. An der entfernten Verwandtschaft des Paares konnte niemand Anstoß nehmen.
Aber damals, wie war’s, als er wieder in seinen alten Cafés zurückgezogen landete? Sah das nicht wie ein Abschied aus von aller Zurückgezogenheit? Er dachte an Hofmock, der ihm gleich mit seiner Verlobung gekommen war. Es widerte ihn jetzt an. Ging er nicht den gleichen Weg? Gab es nicht einen anderen? Es war im ‚Café Kraus‘, wo sich ein solcher fast zu öffnen schien aus einer Vergangenheit, die urplötzlich so nahe rückte, daß er vor Staunen den Mund öffnete. Das Gefühl oder die Zuständlichkeit, welche da wie etwas fremdes, wie ein Objekt der Außenwelt bei ihm eingedrungen war, seine Verliebtheit in Edith nämlich: dies war ihm garnicht so unbekannt gewesen, er hatte es längst gefühlt gehabt. Es stand, umgeben von einem Hof vertrauter Erinnerung, in der Gymnasiasten-Zeit lange vor der Matura. Jener zarte Hof umgab den, im Vergleiche zu seiner eigenen Länge, kleinen Freiherrn Ernst von Rottenstein mit dem blassen Gesicht und den dicken schwarzen Haaren (daß ihm dieser dann später, auf der Universität, wieder begegnet war, daran dachte Vincenz jetzt überhaupt nicht).
Er lehnte sich in der gepolsterten Loge zurück, so gewaltig überkam ihn das, nicht eigentlich als ein Gegensatz zu Edith mehr, sondern als eine Möglichkeit sein neues Gefühl für sie einzuordnen, gleichsam in eine ihm doch eben schon bekannte Skala. Auf dieser standen Ernst und Edith nah beieinander, er hätte nicht sagen können, wem da der höhere Grad gebührte. Es gab auch keinen Unterschied in der Tönung des Gefühls, welches in beiden Fällen hinüberdrängte in ein unbekanntes Terrain, das man – nur so war’s zu bezeichnen! – im Grunde eigentlich gerne selbst gewesen wäre!
Aber daß er für Edith das gleiche zu fühlen vermeinte wie damals für den kleinen Baron: das war sein Rettungsanker, hierin gerade war er doch klar unterschieden, so schien es ihm, von einem Hofmock und dessen Verlobung mit irgendeiner Harbach-Pipsi oder Papsi.
So führte denn das schöne Fräulein Morawetz mit seinen Beachtlichkeiten den Vincenz Ventruba dahin, daß er sich urplötzlich gewissermaßen neun oder zehn Jahre zurück verankerte; und sie vermochte allerdings nicht zu ahnen, an welchem Maße sein Gefühl für sie von ihm gemessen wurde und womit er es verglich, ja, man könnte sagen: wodurch er es legitimierte.
Aber mit alledem war nun einmal das Gewesene aufgebrochen und für Vincenz die Heimkehr erst richtig vollzogen. Mit seiner Liebe – soll man sagen seiner Doppel-Liebe?! – nahm er, nach dem Tumult der Kriegsjahre, nun von den älteren Schichten seines Lebens Besitz und hatte von jenem Abende im ‚Café Kraus‘ an eine Vergangenheit, so jung er war: er wunderte sich denn auch über manches darin. So über die einstmaligen Schulsorgen: denen zuvorzukommen wäre doch ein leichtes gewesen! – nämlich das ganze Zeug immer rechtzeitig zu lernen. Warum eigentlich hatten er, oder etwa Rottenstein, das niemals getan? Warum nur?! Man hätte doch zehnmal lustiger gelebt! Der Hofmock und seine Freunde, zum Beispiel, hatten solche Sorgen überhaupt nicht gekannt. Und warum tat er selbst jetzt alles erforderliche und zur rechten Zeit? War zwischen Schule und Leben ein so großer Unterschied? Garkeiner. Was er jetzt machte, waren ebenso Aufgaben, Schulaufgaben wie damals.
Solche Sachen ließen Vincenz nicht los, aber er gewann ihnen eine Erkenntnis keineswegs ab: wenngleich ihm ahnte, daß hier eine Einheit bestand, die man früher, und noch in der Schule, für eine Zweiheit gehalten hatte.
Jetzt aber trat etwas vollends anderes dazwischen – das doch hierher gehörte. Es kam aus den Zeitungen, deren ja hier im Café genug umherlagen.
‚Liebesabenteuer während der Kriegsgefangenschaft‘ (nun, er, Ventruba, hatte dergleichen nicht erlebt, man war allzusehr unter Verschluß gewesen). In Sibirien waren derartige Erlebnisse offenbar im Bereiche des Möglichen gelegen, denn einer hatte sich, wieder daheim, am Wirtstische ihrer gerühmt, und die Gattin, die ihn offenbar los werden wollte, klagte deshalb nunmehr auf Scheidung. Natürlich ward von dem Ehemann alles bestritten und als harmlose Aufschneiderei hingestellt. Aber dieser weitere Verlauf der Sache interessierte den Vincenz nicht mehr. Sondern für ihn gehörte das ganze in merkwürdiger Weise zum Kapitel ‚Schule und Leben‘, und ebenso wie er dort hintennach eine Einheit gefunden hatte, wo ursprünglich Zweiheit geherrscht, so belehrten ihn jene Dummheiten mit den sibirischen Liebesabenteuern, die dann vor einem Wiener Bezirksgerichte zur Verhandlung kamen, über die Verbindung, ja, Verbundenheit, ja, Einheit von Lebenskreisen, deren jeder in bezug auf den anderen geradezu als ein Jenseits erschien, weit mehr noch als etwa ‚Schule und Leben‘. Ja, nicht genug an dem, es tauchten für Ventruba (der wohl alles eher war als ein Denker) weiterhin noch krassere Beispiele dieser Art auf, denen er allerdings ebensowenig eine Erkenntnis abzugewinnen vermochte als den früheren.
So sahen nun einmal die kurzen und seltenen puren Denkakte (nie die sachlichen Überlegungen!) eines gut veranlagten und mittelmäßig begabten jungen Mannes aus. Daß er Schule und Kriegsgefangenschaft ungefähr gleichsetzte, erscheint verständlich, denn er hatte jene eigentlich erst im ‚campo degli prigionieri di guerra‘ recht entdeckt und durchlaufen, wie er seinem Vater gleich am Tage der Heimkehr wahrheitsgemäß berichtete. Aber es mußten doch frappantere Fälle aus den raschelnden Blättern der Zeitung hervorkommen, um Vincenz bezüglich des Geltens und des Zusammenhanges von allem und jedem zu belehren, der Giltigkeit von Sachen etwa, die sich im russischen Bürgerkrieg abgespielt hatten (also fast wie auf einem fremden Planeten) vor dem Wiener Landesgerichte I. für Strafsachen.
Damals griff die Österreichische Staatsanwaltschaft – wenn genügende und verläßliche Zeugen auftraten – mehrmals nach Personen, die im russischen Bürgerkriege durch politische Denunziation, sei’s bei Weiß oder bei Rot, die Erschießung von Mitgefangenen, also ehemaligen österreichisch-ungarischen Soldaten, verursacht hatten. Derartige Verfahren, welche ja nur eröffnet werden konnten, wenn der Tatbestand als fast erwiesen erschien, waren nun alles eher als harmlos, denn die Anklage lautete dann auf nichts geringeres als Beihilfe zum Mord.
Auch solches stand in den Zeitungen. Aber die Reaktion unseres Denkers aus der Leder- und Schuhbranche muß mindestens als befremdlich, wenn nicht als geradezu infantil erscheinen. Es ist wirklich erst bei einer solchen Gelegenheit gewesen, daß er sich seiner geographischen Kenntnisse bewußt wurde, nämlich ganz einfach des Durchlaufens der Ländermasse von hier in Österreich bis tief nach Rußland und Sibirien hinein und noch viel weiter, ohne daß sich da irgendwo ein gähnender und trennender Abgrund auftat. Nein, man kam, kilometerfressend, durchaus von Wien nach Wladiwostok.
Auch im ‚Café Kraus‘.
Solche Gedankengänge wären einem Fritz Hofmock nicht passiert.
So synchronisiert er immer mit Vincenz beim Verlassen des Wagens vor der Devisenzentrale erschienen war.
Nicht nur im ‚Café Kraus‘. Seit er wirklich angelangt und wieder heimgekehrt war, seit er hier eine Vergangenheit hatte (die Rottenstein hieß) und eine Gegenwart (die sich derzeit Edith Morawetz benannte), hatte er gleichsam Saugwurzeln angesetzt, die allenthalben in jene Zeit vor dem Kriege hingen, welche damit aufhörte eine abgetrennte und gesonderte zu sein, vielmehr überall in die jetzige überging und mit ihr zusammenfloß, was eigentlich damit begonnen hatte, daß bei den Ausführungen des Herrn Béla Tiborski von ihm gleich an seinen Schulkameraden Rottenstein gedacht worden war.
Inzwischen setzte sich so manches wieder zurecht und der kleine Alltag war 1920 schon weit normalisierter als er’s zwei Jahre nach dem zweiten und noch geistreicheren Weltkriege gewesen war. Was die zunehmende Geldentwertung anlangte, so gewöhnte man sich auch an diesen Rutsch, der den Schweizer Franken und also auch die Ventrubas – unsere zwei Junggesellen – zudem garnicht betraf. In den Cafés quengelten und raunzten die Leute vor sich hin wie eh und je, was sie nicht hinderte, eine unausrottbare Tüchtigkeit auf allen Gebieten des praktischen Lebens – und insbesondere auf dem des Schleichhandels – zu entwickeln, und so fand man sich denn wieder zurecht, nachdem einmal der obschwebende Unsinn des Krieges als oberstes Prinzip abgeräumt war. Er hinterließ nur eine Fülle von Ämtern und Amts-Stellen, dergleichen man in so üppiger Wucherung vordem nie gekannt hatte, aber auch diese Gebilde wurden mit der Zeit angenagt und zernagt und von der Korruption wieder in’s organische Dasein zurückgeführt, welche allenthalben eine reiche Darmflora des wiederkehrenden Lebens wuchern ließ.
Alles wurde rasch zunehmend wieder so, wie es einmal gewesen war. Agramer und Esseger Geschäftsleute vereinbarten bei Verträgen mit Wiener Firmen stets als Gerichtsort Wien, weil ein hiesiger Bezirksrichter immer noch verläßlicher schien als alle Stühle der Gerechtigkeit über welchen neue Fahnen flatterten.
Vincenz sank tiefer in die Zeit ein, er war nun kein frischer Kömmling mehr, kein Nowak oder Neukomm, sondern er faulte bereits gründlich an, wozu freilich auch der Umgang mit gewissen Ämtern beitrug, der Importe wegen, und mit Persönlichkeiten, welche jenen Ämtern zwar nicht angehörten, gleichwohl jedoch keine eigentlich Außenstehenden waren, sondern ihnen nahestanden, sogar durch Familienbande. Der Vater staunte. So was hatte er noch nicht erlebt, jedoch für Vinci schien es selbstverständlich zu sein.
So kehrte der Alltag wieder, und mit ihm manches was dazugehört, wie die Politiker. Gehäuftes Privatleben, völliges Fehlen auch der entferntesten Kriegsgefahr, Vermeidung aller, auch der dringendsten öffentlichen Probleme (die später ohnehin der Prälat Ignaz Seipel löste), so sahen ungefähr die Fundamentalien der Herren Ventruba, Vater und Sohn, aus, und aller anderen mehr oder weniger, die sich in ähnlicher Lage befanden.
Mit dem Frühjahr dunsteten die alten Gassen richtig auf. Man vermeinte wahrlich über tiefe Höhlungen voll längst vergangener Gerüche auf dem schmalen Stege einer Gegenwart zu schreiten, die sich hierin knapper ausdrückte, spärlicher zur Nase sprach, aber um nichts weniger unappetitlich. Es gab da eine Art – Durchsichtigkeit bis hinab in einst gewesenen Duft oder Dunst, aber man sah eben nicht sondern man roch. Man roch durch bis in die Tiefe der Zeiten, und man sah’s unmittelbar ein, daß es dort so hatte riechen müssen, und daß man dazugehörte. Das waren die letzten Schübe von Ventrubas Heimkunft. Es höhlte sich die Zeit, auch die jüngst gewesene, und auch was er in Italien in bezug auf die Nase und durch die Nase erlebt hatte, sammelte sich dort rückwärts in einem weiten Becken und nahm mit seiner Tiefe schon Abstand vom heutigen Tage. Zuletzt war es fast, als sei überhaupt nichts geschehen inzwischen. Das Wasser der Zeit stand klar, Schicht über Schicht, ja, Jahrzehnt über Jahrzehnt, und beinahe hätte man vermeinen können, daß man bis auf den Grund hinunter zu sehen vermöge.
2
Der Blick über die Rotensterngasse gehörte für den dreißigjährigen Doktor Halfon nicht auf die Gutseite seiner inneren Buchführung. Eine wenig freundliche Gasse des tiefgelegenen Stadtteiles nahe der Donau. Wenn die Ordinationsgehilfin, das alte Fräulein Elli Ellis, nicht viel später als der letzte Patient gegangen war und der Arzt allein zurückblieb, war der Blick aus den Fenstern kaum zu vermeiden, weil längst zur Gewohnheit geworden. Keineswegs immer trat das Bild der toten Mutter belebend zwischen ihn und das, was er hier, über die Gasse blickend, sah. Eine schmierige Front. Es wirkte niederschlagend. Er schlug die Augen nieder. Ein paar Häuser weiter, nahe der Straßenecke, war das Geschäftsschild der Waschanstalt. Dieses konnte man auch auf dem lebensgroßen Porträt der Verstorbenen sehen, das beim Vater in der Rotenlöwengasse zwischen zwei mächtigen Bücherschränken hing. Sonst befand sich nichts an dieser Rückwand des Zimmers. Das Bild zeigte die Mutter in ganzer Figur, aber nicht etwa in großer Toilette und die Hand auf ein Tischchen gestützt, sondern im einfachen Jackenkleid und auf der Straße gehend, hier am Bezirke, man konnte sogar genau erkennen wo: an dem Geschäftsschild der Waschanstalt nämlich und an der Straßenecke. Der Blick über die Gasse war meisterhaft dargestellt als Hintergrund für die Gestalt der jungen Frau. Sie war offenbar blond gewesen und hatte die Perücke, wie sie von jüdischen Frauen über dem damals noch öfter nach alter Sitte geschorenen Haupt getragen wurde, wohl in ihrer eigenen Haarfarbe gewählt: gewissermaßen sandig-blond, auch im Gesicht, vielleicht zart beflaumt, und die Augen schienen violett und zeigten einen erschrockenen Ausdruck, als werde sie ganz plötzlich und überraschend auf der Straße gemalt, was doch unmöglich so gewesen sein konnte. Doch hatte es der Meister des Bildes eben nicht anders gewollt. Das Bild zeigte die Mutter im Jahr nach der Hochzeit, also 1879. Das klar lesbare Signet des Malers – Johann Eggenbrecher hieß er – wies jene Jahreszahl. Sie war 1884 gestorben, mit dreiundzwanzig, ein Jahr etwa nach der Geburt des Sohnes, ihres einzigen Kindes.
Es hieß zum Vater gehen. Doktor Halfon besuchte ihn zweimal wöchentlich, seit langem schon. Es war wie eine Regel.
Nicht immer, ja, nicht einmal oft, berührte ihn der Gedanke an seine Mutter: in Form von zarten Attacken nur. Sogar wenn er zum Vater ging, blieben sie meistens aus, trotz des Porträts dort, trotz der Straßenecke mit der Waschanstalt. Das Sich-Ankündigen der Mutter – wie ein vorbrechender Schein hinter der Straßenecke – war an eine bestimmte und nicht geringe Reihe von einzelnen Umständen geknüpft, Umstände des eigenen Befindens – sogar solche der Verdauung, dachte Doktor Halfon einmal! – Umstände der Beleuchtung und Tageszeit, der Sammlung oder Zerstreutheit. Auch mußte der Himmel über der Straße bewölkt sein und tief herabhängen, fast wie ein Plafond. Sie war ihm jedoch auch bei ganz anderem Wetter und weit von der Straßenecke und der Waschanstalt schon begegnet, im Prater etwa, in den Auen, die sich dem stark beschäftigten praktischen Arzte ja als nächste Gelegenheit boten um Luft zu schöpfen und Bewegung zu machen, im Auwald, auf den Wiesen. Es gab auch einen jungen Wald, der nicht groß war, zwischen den Wiesen gelegen, eher ein Wäldchen zu nennen, ein Hain. Beschritt er den schmalen Pfad zwischen den Ahornstämmchen- und Stämmen, dann fehlte nie ein gewisses Befremden. Jenseits des Haines war ein lichterer Schein zu vermuten; doch wurde nicht deutlich und erkennbar, wovon dieser ausging, nur der Himmel blickte heller zwischen die Bäumchen herein. Es hieß jetzt zum Vater gehen. Doktor Halfon kam an der Waschanstalt vorbei. Das Haus in der Rotenlöwengasse war außen schmierig und schäbig, innen gewölbt und weit mit breiten flach ansteigenden Treppen, die in ein Palais gepaßt hätten. Im ersten Stock eine blitzend blanke Klingel, ebenso in Messing das Schild: Ephraim Halfon.
Er, der Doktor, aber hieß Alfons, und außerdem David, aber diesen Namen führte er nicht.
Doktor Alfons wurde von der Haushälterin empfangen, die er nicht leiden konnte. Betont geschlechtslose Weiber waren ihm zuwider. Eine Ausnahme machte da nur seine Ordinationsdame, das Fräulein Elli Ellis (deren Namenzusammenstellung besser klang als seine eigene, er wußte es wohl). Aber Fräulein Ellis war gewissermaßen entschuldigt: sie hatte 63 Jahre, war also mehr als doppelt so alt wie der Arzt; eine kleine grauhaarige Dame mit vorstehenden oberen Schneidezähnen: gelernte und ausgediente Krankenschwester, die auf Kliniken aller Art gearbeitet hatte, unschätzbar für den jungen Mediziner, besonders in der ersten Zeit.
Er hatte damals den Gedanken aufgegeben, Spezialarzt zu werden, obwohl er die Voraussetzungen dazu besaß, vor allem eine genügende klinische Praxis, um sich als Internist niederlassen zu können. Doch war in dieser Stadtgegend hier eine Art ärztliches Vacuum entstanden, weil sich zwei alte praktische Ärzte fast gleichzeitig zur Ruhe setzten; den einen von ihnen hatte Doktor Alfons schon mehrmals vertreten; und da dieser Herr sich nun auf’s Land zurückzog, übernahm er seine Praxis samt Wohnung, Instrumentarium und Ordinationsdame Fräulein Ellis, und vor allem – ein stets volles Wartezimmer. In der ersten Zeit war’s ein Plackerei gewesen. Aber alles spielt sich nach und nach ein.
Die Haushälterin ging vor ihm durch das sehr große und dunkle Vorzimmer und klopfte ganz rückwärts an einer niederen schwarzen, mit stark erhabenen Schnitzereien verzierten Tür. Doktor Alfons sah die gekreuzten weißen Schürzenträger und empfand diese ganz ebenso als Demonstration wie das gestärkte Häubchen oder die Vorderseite der Dame mit einer sich dem Absoluten nähernden Flachheit der Brust. Dabei war Fräulein Breitschwanz nicht viel über vierzig: kein Anlaß zu solchem Gehaben, dachte Doktor Alfons, kein Anlaß zu einer derart auf die Spitze getriebenen Hochanständigkeit, auch im Ausdrucke des mageren Gesichtchens. Unter der weißen Haube war ein wenig strohblondes Haar zu sehen: das einzig menschliche an dieser Person, dachte Doktor Alfons.
Der Vater wurde bald vierundachtzig. Hier war der Hausherr doppelt so alt wie die Empfangsdame.
Nun trat er ein.
Der Raum war fast ein Saal. Rechts entlang die mächtigen, aber nicht hohen, sondern gedrungenen schwarzen Bücherschränke; dazwischen das Porträt, die Bibliothek teilend und weit überragend. Unter dem Bilde ein ebenfalls schwarzer niederer Schrank mit Türen; auf dessen Platte lagen ein Damen-Réticule und darüber ein Paar langer heller Glacéhandschuhe. Diese Dinge hatte die Mutter zuletzt getragen, vor mehr als achtundzwanzig Jahren. Doktor Alfons warf einen kurzen Blick zum Bilde hinauf, einen dringlichen, wie eine Anrufung. Dann schritt er zum Vater, um ihn zu begrüßen.
Der alte Herr saß an der rückwärtigen Schmalseite des Raumes beim hohen Fenster, durch welches das Licht schon dämmrig einfiel, an einem schweren eichenen Pult, ohne noch die elektrische Lampe zum Lesen eingeschaltet zu haben, obwohl auf dem Pulte ein geöffneter Foliant lag. Vater Halfon hatte den Kopf auf die linke Hand gestützt, regte sich nicht, ja, es sah aus als beachte er garnicht den Eintritt des Sohnes: so tief in Gedanken schien er zu sein. Der mächtige lange und breite weiße Bart leuchtete in all dem Braun und Schwarz als ein großer heller Fleck.
„Guten Abend, Herr Vater“, sagte Doktor Alfons und verbeugte sich.
Der Alte wies ihm einen Stuhl, den Doktor Alfons herbeizog. Die gegenseitigen Fragen nach Befinden und Ergehen waren bald getan; auch die sehr eingehenden Fragen nach der Praxis des Sohnes, welche dieser ausführlich beantwortete und besprach. Neuestens etwa gab es da den Herrn Zienhammer von der Steueradministration und seine Psoriasis. Herr Zienhammer war auch Ephraim Halfon bekannt, dem Namen nach. Manche Dekrete des Steueramtes trugen seine gut leserliche Unterschrift.