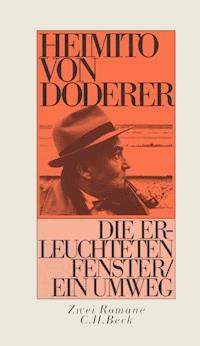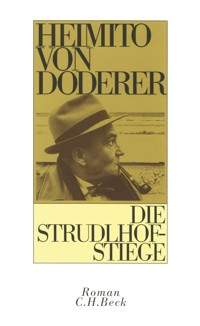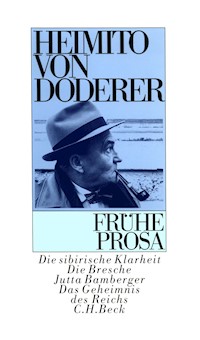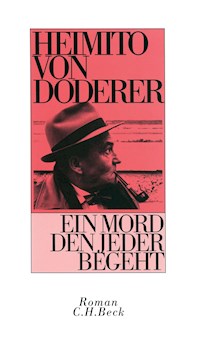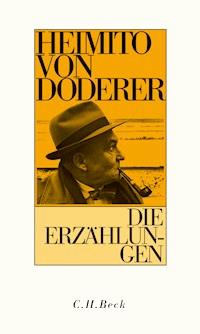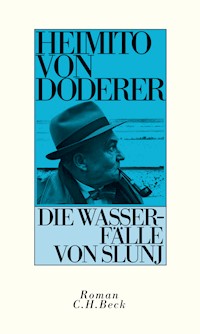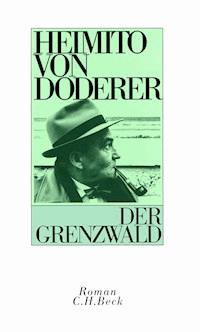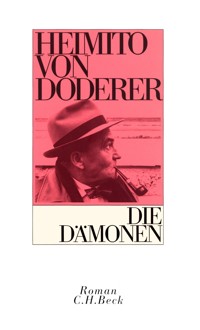
18,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: C. H. Beck
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
"Die Dämonen" ist einer der bedeutendsten Großstadtromane dieses Jahrhunderts. Gestalten des Wiener Großbürgertums und des Adels, Arbeiter und Intellektuelle, aber auch Typen der Halb- und Unterwelt sind zu einem schillernden gesellschaftlichen Gewebe verflochten. Hinter dem eleganten Charme der Fünfuhrtees und Tennisturniere werden Unsicherheit, politische Fragwürdigkeiten und sexuelle Ausschweifung sichtbar. Die Handlung läuft von Anfang an auf den Brand des Wiener Justizpalastes am 15. Juli 1927 zu, den Doderer als "Cannae der österreichischen Freiheit" begreift: Im Verlauf der Auseinandersetzungen zwischen "Frontkämpfern" und Republikanischem Schutzbund waren mehrere Arbeiter umgebracht worden. Nach dem Freispruch der Mörder durch die Justiz brachen Arbeiterunruhen aus, die von der Polizei blutig niedergeschlagen wurden. Obwohl die Schicksale der Figuren meist nur indirekt mit diesem historischen Ereignis verknüpft sind, gehört es zu Doderers kunstvoller Komposition, daß sich zahlreiche ihrer Lebensprobleme an diesem Tag klären.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
HEIMITO VON DODERER
Die Dämonen
Nach der Chronik des Sektionsrates Geyrenhoff
Roman
VERLAG C. H. BECK
Zum Buch
„Die Dämonen“ ist einer der bedeutendsten Großstadtromane dieses Jahrhunderts. Gestalten des Wiener Großbürgertums und des Adels, Arbeiter und Intellektuelle, aber auch Typen der Halb- und Unterwelt sind zu einem schillernden gesellschaftlichen Gewebe verflochten. Hinter dem eleganten Charme der Fünfuhrtees und Tennisturniere werden Unsicherheit, politische Fragwürdigkeiten und sexuelle Ausschweifung sichtbar. Die Handlung läuft von Anfang an auf den Brand des Wiener Justizpalastes am 15. Juli 1927 zu, den Doderer als „Cannae der österreichischen Freiheit“ begreift: Im Verlauf der Auseinandersetzungen zwischen „Frontkämpfern“ und Republikanischem Schutzbund waren mehrere Arbeiter umgebracht worden. Nach dem Freispruch der Mörder durch die Justiz brachen Arbeiterunruhen aus, die von der Polizei blutig niedergeschlagen wurden. Obwohl die Schicksale der Figuren meist nur indirekt mit diesem historischen Ereignis verknüpft sind, gehört es zu Doderers kunstvoller Komposition, daß sich zahlreiche ihrer Lebensprobleme an diesem Tag klären.
Über den Autor
Heimito von Doderer (1896–1966) gilt seit der Veröffentlichung seiner beiden großen Wiener Romane Die Strudlhofstiege (1951) und Die Dämonen (1956) als einer der bedeutendsten österreichischen Schriftsteller des 20. Jahrhunderts.
«Doderer ist ein ganz erstaunlicher Schriftsteller. Sehr berühmt und doch immer noch zu entdecken.»
Daniel Kehlmann
«Rätselhaft, daß wir es uns leisten, über diesen großen Autor hinwegzugehen.»
Walter Kempowski
Inhalt
OUVERTÜRE
ERSTER TEIL
1: DRAUSSEN AM RANDE
2: DIE ENTSTEHUNG EINER KOLONIE I
3: TOPFENKUCHEN
4: FRIEDERIKE RUTHMAYR
5: DER GROSSE NEBELFLECKODERVORBEI AN FRIEDERIKE RUTHMAYR
6: EIN WINTER MIT QUAPP
7: STREITEREIEN
8: DIE ENTSTEHUNG EINER KOLONIE II
9: EIN ENTZÜCKENDES KONZIL
10: DIE UNSRIGEN I
11: DIE ALLIANZ
12: DIE UNSRIGEN II
13: DER EINTOPF
ZWEITER TEIL
1: AUF OFFENER STRECKE
2: AM ANDEREN UFER
3: IM OSTEN
4: TRIUMPH DER RAHEL
5: DIE FALLTÜR
6: DIE KAVERNEN VON NEUDEGG
7: DORT UNTEN
8: AM STROM
9: DER STURZ VOM STECKENPFERD
DRITTER TEIL
1: DICKE DAMEN
2: ÜBERM BERG
3: IM HAUS ‚ZUM BLAUEN EINHORN‘
4: DIE ANABASIS
5: NACHTBUCH DER KAPS I
6: VOR VERSCHLOSSENEN TÜREN
7: KURZE KURVEN I
8: AUF DER SCHANZE
8: KURZE KURVEN II
10: NACHTBUCH DER KAPS II
11: DAS FEUER
12: SCHLAGGENBERG’S WIEDERKEHR
Fußnoten
Malignitati falsa species
libertatis inest.
Tacitus, Hist. I, 1
OUVERTÜRE
Seit Jahr und Tag wohne ich nun in Schlaggenbergs einstmaligem Zimmer.
Es ist eine Mansarde, jedoch darf man dabei an kein ärmliches Quartier denken. Er pflegte in der letzten Zeit, die er noch in Wien und in unserer Gartenvorstadt hier verlebte, seltsamerweise stets in Malerateliers zu hausen, und bewies in der Auffindung von reizenden Wohnungen dieser Art großes Geschick – erstmalig, als er, knapp bevor sein Lehrer Kyrill Scolander aus Südfrankreich wieder hierher kam, für jenen ein geeignetes Zimmer suchen mußte: das Ergebnis war das erste und vielleicht schönste von ‚Schlaggenbergs Ateliers‘ (wie wir’s später nannten) – welche im übrigen seine einzige Beziehung zur Malerei darstellten, denn von dieser selbst hat er, wie mir schien, nie viel verstanden, oder sich darum ebensowenig bekümmert als etwa um das Theater. Bei Scolander indessen, dem damals zu Wien eine Professur angeboten worden war, gewann der Raum für die Berufsarbeit Bedeutung, wenngleich ihm ja auch der Staat nunmehr eine geeignete Werkstatt zur Verfügung stellen mußte. Las man übrigens Schlaggenbergs schon vordem in den Buchhandel gekommene Biographie seines Lehrers, so mußte man den falschen Eindruck gewinnen, daß jener sozusagen nur nebenher male: denn verglichen mit den Schriften Scolanders, welche mit einiger Ausführlichkeit dort betrachtet werden, erscheinen die malerischen Arbeiten fast nachlässig behandelt.
Es ist also das letzte von ‚Schlaggenbergs Ateliers‘, womit ich ihn gewissermaßen beerbt habe, das zuletzt von ihm bewohnte; der Raum ist kleiner als jener, den Scolander einst innehatte, jedoch scheint mir dafür diesem kleineren Raume mehr Behagen zu eignen.
Man sieht weit aus durch die schrägen Fenster. Das doppelt verglaste Oberlicht läßt einen Katarakt von Helligkeit herabstürzen. Man sitzt hoch wie auf dem Gefechtsstande eines Artilleriebeobachters oder in einem Leuchtturme. Man sitzt hoch über der Stadt und gerade gegenüber den Bergen der Landschaft, welche den Gesichtskreis wellig begrenzen. Nach rechts unten hin ist alles unbestimmt; hinter geschachtelten, oft in der Sonne einzelweis vorleuchtenden Häuserblocks liegt eine bunte und dunstige Tiefe: dort flieht die Ebene, nach Ungarn zu. Linker Hand endet das Gebirg’, setzt steil ab, blickt gehöht ins Land.
Unter mir liegt unsere Gartenvorstadt: flach oder gieblig gedächert, hier ins Grüne verstreut und zerflattert, dort wieder geschart um die Wucht einer romanischen Kirche, die mit ihren breiten Türmen zwei Torpfeiler vor die wolkengebauschte Himmelsweite stellt.
Hier also, in diesen unter meinem Aug’ gebreiteten neuen und daneben wieder hundertjährigen Gassen hat sich ein wesentlicher Teil jener Begebenheiten vollzogen, deren Zeuge ich vielfach war, deren Chronist ich geworden bin, und das letztere oft fast gleichzeitig mit den Ereignissen. Denn sehr bald hatte ich den Entschluß gefaßt, meine gelegentlichen Aufzeichnungen mit größerer Genauigkeit zu machen und meine Notizen zu verarbeiten. An diesem Punkte hielt ich bereits im Frühling des Jahres 1927 (da ich’s denn nicht liebe, daß Dinge und Menschen eines Berichts gleichsam in der Luft hängen, setze ich die Jahreszahl hierher).
Nicht lange danach widerfuhr mir übrigens in der Stadt dort drinnen eine in ihrer Art seltsame Begegnung, deren ich noch Erwähnung tun werde: diese beiden Punkte – der Beginn meiner Arbeit hier und das zufällige Zusammentreffen mit dem Kammerrat Levielle auf dem ‚Graben‘ – liegen so nahe beieinander, daß mir mit dem einen rückblickend auch das andere gleich in den Sinn kommt.
Ich begann also meine Aufzeichnungen mit Eifer zu betreiben. An Zeit gebrach es mir nicht. Ich war nicht lange vor dem früher angezogenen Jahre aus dem Staatsdienst geschieden, als Sektionsrat, und die hier naheliegende Frage, warum ich bei noch immerhin jüngeren Jahren die Laufbahn verließ, mich mit einer verhältnismäßig niederen Staffel begnügend, wo mir doch, aller Wahrscheinlichkeit nach, eine höhere noch wäre zugänglich gewesen – diese Frage beantworte ich geradeaus damit, daß in der nach dem Kriege entstandenen Republik mir das Leben und die Arbeit eines Staatsbeamten manches von ihrem Sinn verloren zu haben schienen, während im alten Reiche, in gewissen Arbeitsgebieten zumindest, der österreichische Verwaltungsbeamte vielfach etwas wie eine wirkliche Mission trug. Hinzu kam, daß während des Jahres 1926 meine Vermögensverhältnisse sich von Grund auf verändert hatten. Diese Änderung hing mit der Freigabe der im Kriege beschlagnahmten oder, wie man auch sagte, ‚sequestrierten‘ Wertpapiere und Bankguthaben österreichischer Staatsbürger in England zusammen. Ich hatte drüben Anteilscheine an pennsylvanischen Stahlwerken liegen gehabt. Der Sequester verwandelte diese Papiere 1914 in englische Kriegsanleihe. Früher hatte der so in vorläufigen Verlust gekommene Teil meines väterlichen Erbes innerhalb desselben eine überragende Stellung nicht eben eingenommen. Nun aber, freigeworden, und nach einem langwierigen Verfahren und großen, durch die Art der Manipulation eingetretenen Kursverlusten wieder für mich verfügbar, erwies dieses einzig wertbeständige Bruchstück meines einstmaligen Vermögens sich doch als gar sehr ins Gewicht fallend. Denn alles übrige war mit den alten Währungen zerronnen.
So mochte ich denn nicht mehr in einem Amte bleiben, das an Arbeit und Wirkungsmöglichkeit wenig mehr bot, sondern eben nur die platte Versorgung, die mir in einer nachgerade drückenden Weise auf Kosten meiner werkenden Mitbürger zu erfolgen schien. Der gar nicht absehbaren Vorteile einer Menschenklasse, welche, bei zwar vielfach kleinen, jedoch im ganzen gleichbleibenden und gesicherten ‚Bezügen‘ die schlimmsten Jahre und deren Not besser überdauerte als selbst der Tüchtigste – dieser Vorteile wollte ich mich eines Teiles begeben. Denn das mir verbleibende Ruhegehalt war bescheiden.
An Zeit gebrach es mir demnach nicht mehr, und ich war auch frei von allem, was man so gemeinhin Sorgen nennt; zudem Junggeselle. In Ermangelung von Sorgen schuf ich mir indessen welche, wie dies eben alle Menschen tun. Nur waren diese neuen Sorgen leichterer, ja fast möchte ich sagen, tändelnder Art, zumindest für den Anfang.
Ich begann also nicht weniger und nicht mehr als für eine ganze Gruppe von Menschen (und das sind vornehmlich jene, die ich späterhin kurz ‚die Unsrigen‘ nennen werde) ein Tagebuch zu führen. Jedoch nicht nur das Tagebuch einer Gemeinschaft – also ein Ding etwa wie ein Schiffstagebuch oder wie die Aufzeichnungen einer Expedition unter wilde Völker – sondern ich tat’s gewissermaßen für jeden von diesen einzelnen und behielt ihn unter den Augen. Darum entstanden meine Berichte hier vielfach gleichzeitig mit den Ereignissen, und schon damals pflegte mich Schlaggenberg zu ärgern, der, nachdem er mir bald hinter meine Schreibereien gekommen war, zu dem Wort ‚Berichte‘ stets das Adjektiv ‚romanhaft‘ setzte: ‚Ihre romanhaften Berichte, Herr G-ff.‘ Nicht lange danach gewann ich ihn schon zur Mitarbeit. Ganz ebenso auch den René von Stangeler, welchen wir den ‚Fähnrich‘ nannten (er war’s im Krieg bei den Dragonern gewesen). Diese zwei beflissen sich ja damals des Schreibens berufsmäßig. Ich übertrug ihnen ganze Abschnitte und bezahlte sie anfänglich auch dafür (Schlaggenberg tat’s später aus Liebe zur Sache umsonst). Damit nicht genug, breitete ich meine Pläne und Arbeiten zum Beispiel vor einer Frau Selma Steuermann aus, der die Sache Spaß bereitete und die mich nun gleichfalls unterstützte, mit der genauen Schilderung von Vorgängen, deren Zeuge ich nie hätte sein können, und welche ich so trotzdem in meine Aufzeichnungen hereinbekam. Die gute Selma hat für mich geradezu spioniert und vornehmlich eben in ihren, mir ja gar nicht ohne weiteres und auf vertrauliche Art zugänglichen Kreisen. Einige gab es auch, die mitarbeiteten, ohne es zu wissen, indem sie nämlich von mir ausgehorcht wurden, zum Beispiel das Fräulein Grete Siebenschein; aber derlei versteht sich ja fast von selbst, und das tun bekanntlich die Berufsschreiber auch.
Ich hatte noch andere Mitarbeiter – Frau Friederike Ruthmayr und Herr von Eulenfeld bleiben unvergessen! – aber es sei genug an den schon genannten. Schlaggenberg hatte ja gar einmal die Unverschämtheit, mich zu fragen, ob ich nicht den Kammerrat Levielle gleichfalls engagieren wollte?! Trotz all dieser reichen Kenntnisse – Schlaggenberg sagte ‚Tratschereien‘ – und der weitgehenden Zuträgerei, die sich bald aus meinem ganzen Betrieb entwickelte, blieb ich natürlicherweise bei währendem Geschehen in vielen, ja in den entscheidenden Punkten teilweise oder auch völlig unwissend, und wenn ich nun jetzt, hier und hintennach, in Schlaggenbergs ‚letztem Atelier‘ die Zusammenfassung und Überarbeitung des Ganzen vornehme, so würde es mir schwindelhaft erscheinen, wollte ich etwa davor zurückschrecken, mich zumindest in denjenigen Abschnitten, wo ich als Augenzeuge selbst erzähle und somit auch vorkomme, wollte ich also davor zurückschrecken, mich dort etwa als weniger dumm und unwissend darzustellen, als ich’s eben war, wie wir’s ja alle dem Leben gegenüber sind, das sich gerade vor uns abspielt und dessen Verlängerung und Fluchtlinie wir unmöglich noch erkennen können. Zwar in die Vorgänge nirgends eigentlich selbst verstrickt (das hätte mir gerade noch gefehlt!) stand ich doch vor der Notwendigkeit, mich da oder dort in einer Ecke gleichsam mit abzubilden, wie es manche von den alten Meistern der Malerei getan haben, da eben hier zum Ganzen auch der Chronist gehört: nur darf sein Gesichtsausdruck nicht gescheiter gemalt werden, als er im gegebenen Zeitpunkte wirklich war.
Heute freilich, ‚in Kenntnis des Ganzen‘ – bin ich auch einer von den nach rückwärts gekehrten Propheten!
Und dennoch, in der Tat gälte es nur, den Faden an einer beliebigen Stelle aus dem Geweb’ des Lebens zu ziehen, und er liefe durchs Ganze, und in der nun breiteren offenen Bahn würden auch die anderen, sich ablösend, einzelweis sichtbar. Denn im kleinsten Ausschnitte jeder Lebensgeschichte ist deren Ganzes enthalten, ja man möchte sagen dürfen: in jedem einzelnen Augenblicke steckt es, sei’s nun, daß Wollust, Verzweiflung, Langeweile oder Triumph den, gleichwie bei einem Bagger, herankommenden und vorübergleitenden Eimer der tickenden Sekunde füllen.
Solches trat mir neulich wiederum nahe, in der Stadt dort drinnen, nachdem ich den stillen weiten Raum hier verlassen hatte, vorher noch einmal durch meine schrägen Mansardenfenster einen geradezu erstaunten Blick in den weißglühenden Widerglanz des Abends werfend, der sich doch bei klarem Wetter alltäglich dort drüben in den verglasten Veranden des Hotels am Kahlengebirge fängt und lange darin liegt: es sieht aus wie ein Brand, besonders später, bei schon rötlichem Scheine. Eine Dreiviertelstunde danach ging ich über den belebten ‚Graben‘, und als um die bekannte Ecke gegenüber dem sogenannten ‚Stock im Eisen‘ der Turm von St. Stephan gleichsam mit einem einzigen Riesenschritte hervortrat, machte meine Erinnerung einen Sprung um achtundzwanzig Jahre zurück und eben in jene Zeit, da ich diese Aufzeichnungen recht eigentlich begonnen hatte.
Gerade an dieser Stelle hier war mir der Kammerrat Levielle begegnet, 1927 im Vorfrühling.
Als wär’s gestern gewesen: der Abend spiegelte noch grünlich hinter dem Turme, und in das ermattete Tageslicht traten die ersten leuchtenden Kugeln, vor den Läden und über der Straße schwebend. Ein weit und langsam ausgeschwenkter Hut, der weiße Kopf darunter, das weiße Schnurrbartbürstchen – ich verhielt, nicht etwa weil ich ihn schon erkannte, sondern da mich die Tatsache seines Grüßens plötzlich aus meinen Gedanken riß – und so verloren wir beide den Schwung des Gehens, mit welchem wir ja ansonst unter zeremoniösem Salut aneinander vorbeizukommen pflegten, und standen nunmehr beisammen. Indessen war ich’s bald zufrieden, ersah mir eine Unterhaltung dabei und begleitete den Alten sogar über den Graben zurück, an der schönen Pestsäule vorbei und weiter.
„Als Pensionist geht man bekanntlich gern und viel spazieren“, sagte ich nach den ersten gegenseitigen Erkundigungen ums werte Befinden. Er wußte es aber schon, daß ich nicht mehr im Amte saß. Und die Art, wie er jetzt über meinen vorzeitigen Abschied sich äußerte, und zwar von zwei ganz verschiedenen Gesichtspunkten aus, wie man gleich sehen wird, diese Art brachte mich auf den Gedanken, daß es eigentlich mit den Verstellungskünsten des Herrn Levielle, die man ihm ja gelegentlich nachsagte, unmöglich so sehr weit her sein könne; oder es war ihm nur mir gegenüber nicht der Mühe wert, sie anzuwenden. „Aber Herr G-ff“, sagte er, „Sie standen doch nicht mehr gar weit vom Ministerialrat?!“ Der Ton war jedoch nicht der eines Bedauerns für mich und in meinem Interesse etwa, vielmehr schien mir Levielle geradezu ärgerlich, und als hätte ich mit meinem Abschiede von der Beamtenlaufbahn ihm eine Ungelegenheit bereitet oder ihn eines noch möglichen Vorteiles beraubt.
„Neulich erst hatte ich wieder in Ihrem Ministerium beruflich vorzusprechen, wegen einer Einfuhrbewilligung, und habe an höherer Stelle das lebhafteste Bedauern über Ihren Schritt gefunden, man stand nicht an, Sie für einen der aussichtsreichsten unter den Beamten Ihrer Rangsklasse zu halten.“ Es fehlte nur noch, daß er gesagt hätte: „Das sind mir Sachen! Ja, wo käme man denn hin, wenn alle im Staatsdienste stehenden Bekannten sich pensionieren ließen? Bis zum Ministerialrat hätten Sie schon noch aushalten können, mein Lieber!“ Er sprach nämlich das, was er wirklich laut sagte, so sehr ohne jeden Bezug zum Hörer vor sich hin, daß es beinah wie ein ärgerliches Selbstgespräch herauskam. Bald danach meldete sich auch ein Ton von bereits eintretender leichter Geringschätzung, aber das dauerte nicht lange, denn jetzt kam der zweite Gesichtspunkt an die Reihe. „Du reste – c’est étonnant“, sagte Levielle (denn er war ja Pariser, zumindest ein halber!), „mais passons. Das Vermögen, in dessen Wiederbesitz Sie vor etwa einem Jahr gelangt sind, ist immerhin ein für heutige Verhältnisse sehr bedeutendes“ (er sprach die genaue Ziffer aus), „und es hätte um einiges mehr sein können, nämlich gerade um jenen Betrag, den Sie durch die Art der Behandlung dieser Fälle von seiten der zuständigen Abteilung in der österreichischen Handelskammer verloren haben, oder, anders ausgedrückt, den außerordentlich hohen Kursverlust. Sie verloren im ganzen pro Pfund … und somit …“ (auch hier folgte wieder die Bezifferung).
„Sie sind erstaunlich gut unterrichtet, Herr Kammerrat“, sagte ich, jedoch ohne jede Gereiztheit.
„Nachdem ich innerhalb der Handelskammer selbst eine ehrenamtliche Funktion versehe – wobei ich nicht unterlassen möchte, zu sagen, daß der von mir im allgemeinen geführte Titel sich keineswegs von diesem Ämtchen her, sondern von Paris herschreibt, wo ich eine etwas bedeutendere Stellung solcher Art bekleide – nachdem ich also in der Handelskammer sozusagen daheim bin, wie eben da oder dort, wohin man gerade berufen oder gewählt wird, so darf meine Kenntnis Ihres Falles Sie nicht wundernehmen. Dasjenige aber, was mich meinerseits dabei verwundert, ist, wie ein solcher Verlust von Ihnen hingenommen werden konnte, ohne jeden rechtzeitigen Versuch einer Abwehr.“
„Ich wußte nicht, daß eine Abwehr im Bereiche des Möglichen war“, sagte ich.
„Sie ist es fast immer in solchen Fällen.“
„Was hätte ich also tun sollen?“
„Sie hätten sich an mich wenden müssen“, sagte er, „nämlich rechtzeitig. Ich hatte eine ganz ähnliche Sache zu ordnen, nur handelte es sich dabei um ungleich höhere Summen. Der Verlust, den ich naturgemäß auch erlitt, ist aber verhältnismäßig mit dem von Ihnen getragenen gar nicht zu vergleichen. Nun, immerhin, ein beträchtliches Vermögen ist jetzt in Ihrer Hand, und bei Ihnen steht es, damit etwas anzufangen, um so eher, als Sie jetzt des unfruchtbaren Zeitversitzens im Amte ledig geworden sind. Haben Sie schon Pläne gefaßt?“
Er begann mir unangenehm zu werden und ich brachte die Worte: „Es tut mir sehr leid, um Ihre Hilfe nicht rechtzeitig nachgesucht zu haben, Herr Kammerrat“ mit einiger Mühe heraus. Auf seine letzte Frage antwortete ich nicht. Ich wußte im übrigen genau, was es für ‚ungleich höhere Summen‘ waren, von denen er vorher gesprochen hatte.
Indem wandte ich plötzlich und mit einer beinahe erschrockenen Gebärde den Kopf nach einer jungen Frau, die eben an uns vorbeigekommen war.
„Nun? Eine Bekannte?“ fragte Levielle.
„Nein“, sagte ich. „Es schien mir nur einen Augenblick lang so …, ’s ist auch merkwürdig.“
„Was ist denn merkwürdig, Herr Sektionsrat?“
„Verzeihen Sie“, sagte ich (unbefangen, wie ich’s damals noch war), „Sie sprachen doch eben vor ein paar Augenblicken von einem großen in England seinerzeit beschlagnahmten Vermögen, das nun vor Jahr und Tag frei geworden ist, wobei es Ihnen dann gelang, diese Angelegenheit günstig zu ordnen …“
„Ja, und?!“
„Nun, welches Vermögen das war, ist ja leicht zu erraten, da Sie schon 1914 Testamentsvollstrecker des gefallenen Rittmeisters Ruthmayr wurden, der ja einen gewaltigen Effektenbesitz drüben hatte. Er hat mir das sogar selbst kurz vor dem Ausbruch des Krieges einmal gesagt. Wir sprachen also mittelbar von Ruthmayr.“
„Gut, wir sprachen mittelbar von Ruthmayr – obwohl ich andere Angelegenheiten dieser Art auch noch führte und führe. Aber – was hat das mit jener Dame zu tun, die eben vorbeikam und in welcher Sie eine Bekannte zu erkennen glaubten?“
„Ich glaubte nämlich, es sei – Charlotte von Schlaggenberg, die Schwester meines alten Bekannten Kajetan von Schlaggenberg …“
„Wie? Was?!“
Er schrie mich geradezu an. Sein Gesicht kam mir durch einen Augenblick nahe, es war gerötet, und seit diesem Augenblicke weiß ich, daß Levielle niederer Abkunft gewesen sein muß und in Wirklichkeit sehr gewöhnlich aussah, sobald nämlich der sorgsam zurechtgelegte Faltenwurf dieses Antlitzes ‚à la englischer Lord‘ über dem weißen Schnurrbartbürstchen in Unordnung geriet.
„Ja, was hat denn diese kleine Schlaggenberg, diese ‚Quappe‘ oder ‚Quapp‘, oder wie sie schon genannt wird, damit zu tun?!“ setzte er beinahe unwirsch hinzu.
„Sehen Sie, Herr Kammerrat“, sagte ich, „es gibt bekanntlich seltsame Ähnlichkeiten zwischen im Leben ganz weit auseinanderstehenden Menschen, ja diese Menschen brauchen nicht einmal gleichzeitig zu leben – und doch wird einem zumute, als seien ihre Gesichter, ich möchte sagen, nach derselben Model geformt oder vom Schöpfer aus der gleichen Schachtel genommen, wenn dieses Bild erlaubt ist; oder als würde mit solchen Antlitzen ganz die gleiche Grundidee zum Ausdruck gebracht, sozusagen eine physiognomische Grundidee. Hierher gehören für mich unter anderem der selige Rittmeister Ruthmayr und das Fräulein von Schlaggenberg, die einander niemals gekannt haben. Ich kam erst vor einigen Wochen zufällig auf diesen Sachverhalt, an einem Sonntagmorgen, und noch beinahe im Halbschlafe. Zwischen Schlaf und Wachsein fallen dem Menschen oft die merkwürdigsten Dinge ein, und mitunter ist wohl auch Wesentliches dabei. Seither nun ist mir diese seltsame Ähnlichkeit klar geworden. Übrigens sieht das Fräulein von Schlaggenberg nicht immer so aus, einmal mehr, einmal weniger und mitunter auch ganz anders.“
„Ich habe von dieser Ähnlichkeit wahrhaft nie etwas bemerkt“, sagte er und ging jetzt aufgeblasen neben mir her wie ein gereizter Truthahn. Ich mußte ihn offenbar geärgert haben, und zwar bedeutend, nur konnte ich nicht begreifen wodurch.
„Übrigens wird sie uns bald begegnen, die gute Quapp“, sagte ich, „denn ich habe es oft beobachtet: man sieht eine Person auf der Straße, die einem Bekannten ähnelt, dann kommt nach einer Weile jemand, den man, zumindest auf ein paar Schritte Entfernung noch, wirklich für den Betreffenden halten könnte – und richtig, zwei Gassen weiter stolziert dieser dann selbst ganz vergnügt auf uns zu, so daß man am liebsten sagen würde: na also! da sind Sie ja endlich; ich erwarte Sie bereits die ganze Zeit hindurch … da ist sie!“
Levielle erschrak, ich bemerkte es deutlich. „Nein, sie ist’s doch nicht“, sagte ich. Er war ersichtlich nervös und geärgert, sagte aber lachend:
„Na – Sie haben auch seltsame Grillen, jetzt als ‚Pensionist‘! Übrigens, seit wann ist denn diese kleine Person wieder in Wien?“
„Sie kam nicht lange nach Neujahr.“
„Und haust wieder mit dem Bruder auf einem gemeinsamen Zimmer?“
„Nein“, sagte ich, etwas befremdet.
„Nun, das gab’s nämlich auch schon. Mais laissons cela.“
Wir waren indessen bei fortwährendem Weiterschreiten in das Viertel gekommen, wo die Bankpaläste liegen. Ich hatte ihn ein gutes Stück Weges begleitet. Die Dunkelheit war hereingebrochen, und die Straßen lagen schon in ihren schreienden Lichtern. Das Pflaster glänzte feucht. Beim Seiteneingang eines großen Gebäudes blieb Levielle stehen.
„So spät noch in Geschäften?“ sagte ich.
Ein weit und langsam ausgeschwenkter Hut, der weiße Kopf darunter, das weiße Schnurrbartbürstchen – ich sah noch durch die Scheibe, wie ein betreßter Torwart aus seinem matt erleuchteten Raume vortrat und die Flügel einer Glastür vor einem Stiegenhause öffnete, wo alle großen Lichter schon ausgeschaltet waren: denn der öffentliche Arbeitstag dieser Bank und ihre allgemeinen Besuchsstunden hatten längst geendet.
Ja, in der Tat gälte es nur den Faden an einer beliebigen Stelle aus dem Geweb’ des Lebens zu ziehen, und er liefe durchs Ganze: wie Wolken tritt das Vergangene gleichsam links und rechts der Stirne vor, und der Erinnerung scharfer und süßer Zahn setzt sich in die Herzgrube. Aus jenem Vergangenen aber schwankt wie aus Nebeln zusammen, was aus Wahrheit zusammen gehört, wir wußten’s oft kaum, aber jetzt reicht das verwandte Gebild dem verwandten die Hand, und sie schlagen eine Brücke durch die Zeit, mögen sie auch sonst im Leben ganz weit auseinandergestanden haben, in verschiedenen Jahren, an verschiedenen Orten, zwischen denen eine recht eigentlich gangbare Verbindung der Umstände fehlt. Und so weiß ich freilich, daß jenes dunkelblonde Mädchen, welches im tief verschneiten Wald unterhalb des Kahlenbergs, rasch auf den Skiern dahinhuschend, schräg unsere Spur geschnitten hatte, daß dieses Mädchen die gleiche war, welche später im Haus ‚Zum blauen Einhorn‘ durch mehrere seltsame Tage gewohnt hat: denn dieser ihr Aufenthalt wurde mir von ihr selbst sehr genau geschildert; und hier taucht auch, rasch wieder an ihren naturgegebenen Ort zurücksinkend, jene verlumpte Didi auf, die als Ausschenkerin in Freuds Branntweinschank (in diesem Falle räumlich gar nicht weit vom Haus ‚Zum blauen Einhorn‘) so sehr über die Herren vom ‚Allianz‘-Zeitungskonzern gelacht hat, welche dorthin gekommen waren, um die ‚Verbrecherwelt zu studieren‘ (für eine ‚Reportage‘, wie das genannt zu werden pflegt).
Nun aber, was jene dunkelblonde Renata angeht: es gibt Träume, die sozusagen auch im Leben gelten, also eigentlich keine Träume mehr sind, sondern schon eher Kenntnisse; Kenntnisse, die ganz schüchtern und doch seltsam durchdringend mit einer blassen und gleichwohl starken Anwesenheit hinter die geordneten und mit dem Lichte der Gewißheit ausstaffierten sogenannten Tatsachen treten; steigend und sinkend wie der farbige Fleck im Innern des geschlossenen Augenlides; ein unordentliches Gewirr – aber wir begreifen immer, was gemeint ist, selbst wenn wir’s nicht wollen. Wenn wir in einem hübschen Laden für süße Sachen stehen und wir sehen plötzlich ein Kindergesicht, das draußen an der Scheibe sich ein wenig das Näschen platt drückt: nicht näher tretend und nicht deutlicher ist der Anruf solches unseres geheimsten Wissens, von dem und von jenem.
Es verlangt auch keine Nachprüfung. Man fragt und erkundet hier nicht. Ich habe Renata, die ich doch, viel später, ein wenig näher kennenlernte, niemals gefragt, ob sie etwa jene Person gewesen sei, die man im Frühjahre 1927 am Beginn eines gemeinsamen Ausfluges der ‚Unsrigen‘ neben Schlaggenberg auf dem Hügelkamm gesehen hatte, so daß wir alle, die wir hinaufstiegen, glaubten, sie gehöre zu ihm und er hätte sie mitgebracht (Kajetan erwartete uns dort oben). Aber das war nur ein Zufall und eine Täuschung, sie war im Begriffe, an ihm vorbeizugehen, stand auch nicht eigentlich neben Schlaggenberg, sondern gute zwei Schritte hinter ihm – nur von ferne hatte das so ausgesehen – und jetzt ging sie schon weiter, den Weg herab, den unsere Gesellschaft hinaufstieg, und mitten durch uns hindurch, wobei sie uns sozusagen in zwei Gruppen schied. …
Erst eine spätere Zeit hat’s bewiesen, wie zutreffend für damals diese Scheidung auf dem Spaziergange von Renata (denn für mich war sie’s und bleibt sie’s) vollzogen worden ist, und daß hier für vergehende Augenblicke getrennt ward, was aus Wahrheit nicht zusammengehörte, in dieser wenig glücklich und doch nach dem Willen des Lebens gemischten Gesellschaft.
Aber da und dort glaub’ ich es auch noch zu sehen, das Mädchen, in manchem verschwimmenden Gebild’ glaub’ ich Renata wiederzuerkennen, das sich an jener Wand aus Glas niederschlägt, die uns vom Vergangenen trennt und die Täuschung möglich werden läßt, es sei schier gegenwärtig; nur drücken sich die Konturen mit der Zeit ein wenig platt daran, wie das Näschen in dem Kindergesicht, von dem ich früher sprach.
Hier aber halten wir an dem Punkte, der den Chronisten Lügen straft, wenn dieser sagte, er sei in die Vorgänge nirgends eigentlich selbst verstrickt gewesen: in einem war er’s gleichwohl, wenn auch in aller Verborgenheit; doch der Erinnerung scharfer und süßer Zahn trifft jetzt die wunde Stelle.
Sie wurde sichtbar an jenem Abende, da Schlaggenberg bei dem großen Empfang im Palais Ruthmayr neben mir aus der übermäßig erleuchteten Halle zu den oberen Räumen hinaufstieg über die breite Treppe, an deren Ausmündung Frau Friederike ihre Gäste empfing (links hinter ihr stand der Kammerrat). Kajetan sagte später, er habe, als er der Frau Ruthmayr ansichtig wurde, sofort den Wunsch empfunden, sich auf den Teppich vor ihren Füßen hinzusetzen und – so drückte er sich aus – sein ganzes bisheriges Leben in ihren Schoß zu legen und es ihr gewissermaßen vertrauensvoll zu übergeben. Er blieb damals etwas länger, als hierzulande gerade üblich ist, beim Kusse über ihre Hand gebeugt, so daß ich, der ich nach ihm an die Reihe kam, die Empfindung hatte, eine ganze Weile gewartet zu haben. Ich sah während des Wartens nicht zu Levielle hinüber. Jener gewisse Faden, von dem ich immer sage, man müsse ihn aus dem Geweb’ des Lebens ziehen und dann liefe er schon von alleine durchs Ganze – ach, der stand damals sehr sichtbarlich daraus hervor, und die Geschichte glich bereits eher einer fallenden Masche in einem Strumpf.
Indessen ertappe ich mich dabei, warum ich hier gerade an einen Strumpf denke.
Ich habe nämlich während Schlaggenbergs etwas ausgedehntem Handkusse auf Frau Ruthmayrs Füße hinabgesehen, lieber als zu dem Kammerrat hinüber, auf zwei kleine feste, unendlich liebenswürdige Füße mit sehr schlank eingezogenen Fesseln unter dem Ansatz eines kräftigen Beines, das schon eher zu Friederikes imposanter Erscheinung passen wollte als diese unschuldsvollen und wie aus einer Mädchenzeit übriggebliebenen Pedale.
Und letzten Endes steht das wirkliche Leben auf sehr zarten Füßen, und seine letzten Stütz- und Haltepunkte – räumt man nur allen angeschwemmten und angeschwätzten Schutt hinweg – seine Saugwurzeln, die es tief in den Boden einer uns im einzelnen unbegreiflichen Wirklichkeit senkt, hätten, wollten wir sie ehrlich benennen – soweit wir das überhaupt könnten – recht seltsame, ja beinah einfältige, in gar keiner Weise aber hochtrabende oder feierliche Namen: der Nachklang einer Farbe im dunklen inneren Augenlid, der Geruch des einstmals frischlackierten Spieltischchens in unserer einstmaligen Kinderstube, die fallende Masche an einem Strumpf, der sich um eine sehr schlank eingezogene Fessel spannt.
Hier aber lehnt sich an jene unsichtbare Mauer, an jene gläserne Wand, die uns vom Vergangenen trennt und hinter der die Bilder erscheinen, vielfach einander überschneidend und eines durch das andere durchschlagend und durchtretend – hier lehnt sich hinter der etwas zu grell erleuchteten Halle des Palais Ruthmayr ein anderes Bild an die jetzt wellig erzitternde Fläche, und es ist, als erzitterte zugleich der weit gespannte Bogen der Jahre und als sollte das Heute noch ins Einst stürzen: ein rotes Licht erscheint zunächst hinter den vielen sich hin und her bewegenden Gästen in Frau Friederikes schönem Hause, ein rot und einsam und trüb weit draußen erglühendes Licht, jedoch durch die hellen Räume und die vielfältige Gesellschaft allmählich deutlicher hindurchtretend. Die gläserne Mauer beschlägt sich jetzt kalt und rauchig, und nun erkenne ich die riesige Halle des Fernbahnhofes und weiß, daß dieses Licht zu einem Signalmast gehört und draußen von der beginnenden gedehnten Strecke her durch den hohen grauen Bogen hereinscheint, in die Ferne hinausweisend, in den Nachthimmel, vor welchem es tief sitzt. Daneben erscheinen bald andere, ferner und schwächer, aber auch nahe, weiß und blau, in stillen Figuren, in leuchtender Ausgespanntheit. Aber die Halle ist voll Lärm, voll Bergen von trägen Koffern, welche die Eile der Menschen ungern teilen, jedenn-noch eifrig vorwärts geschoben werden auf den Wägelchen, mit ‚Achtung!‘, so daß man beiseite hüpft, denn die Koffer müssen ja mit: es wird Zeit, die große Uhr rückt ihre Zeiger. Und wieder ist es nur ein kleiner und unerheblicher Stützpunkt, dessen die Wirklichkeit hier bedarf, um mich mit diesem Winterabende auf dem Bahnhof lebhaft zu verbinden, es ist ein klein wenig blondes Haar an der Schläfe der Frau Camy von Schlaggenberg, Kajetans Gattin, und die Art, wie das kleine Reisehütchen in ihre Stirn drückte, worunter sie etwas spitznäsig und augenscheinlich doch nicht ganz im seelischen Gleichgewichte hervorsah.
Sie stand klein und schlank auf dem Trittbrett des Wagens und reichte mir eine wohlbehandschuhte Hand, an welche ich mich seltsamerweise als an etwas sehr Trockenes erinnere.
Solches aber sind jene Kleinigkeiten, die jedermann bei sich herumträgt, die allein aber – Hand aufs Herz! – das Große des Lebens ganz enthalten, wenngleich ungestalt noch und keines Namens würdig. Solches sind die Besitztümer vieler einsamer Menschen, und wenn einer aus der Stadt dort drinnen entronnen ist und in sein stilles leeres Zimmer kommt, das sich, so lange allein gelassen, nach allen Seiten gestreckt und gleichsam erweitert hat – dann tritt sein Eigentum näher zu ihm, aber nicht anders wie das Kind draußen vor der Glasscheibe, von dem ich früher sprach. Oft stellt sich einer, wenn er das Licht eingeschaltet hat, für Augenblicke ans Fenster – ‚nachdenklich‘, wie man zu sagen pflegt (aber er denkt in Wahrheit nicht das geringste). Sei der Ausblick nun eng oder weit: es sind immer die gleichen Lichter, die hier allabendlich erscheinen, in stillen Figuren, trüb oder scharf, oder in leuchtender Ausgespanntheit. Es ist jedermanns irdischer Sternhimmel voll kranker Erdensterne, die ebenso blinzeln und zucken wie die himmlischen; und verschieden für Tausende einsamer Augenpaare aus Tausenden von Fenstern und sicherlich jedermann genauestens angemessen. Wer an das Fenster tritt, der tritt hier unter sein Gestirn; und gewiß wäre auch diese ferne und glimmende Ansprache aus dem Dunkel zu deuten, wenn wir’s nur vermöchten. Da habe ich die Lichter der Landstraße, die zwischen die Hügel hinausläuft: sie sind das ‚Sternbild des Stabes‘. Dieses überstrahlend, gibt es noch mehrere nahe Sterne erster Größe. Dahinter rechts, fast unterm Horizonte, einen dichten Sternhaufen. Gerade gegenüber aber steht, in der Richtung, wo bei Tag ein großes Gebäude mit Turm zu sehen ist, meine ‚Cassiopeia‘, das ‚W‘ des Himmels; nein, hier das ‚W‘ der Erde.
Furchtbares hat sich begeben in meinem Vaterlande und in dieser Stadt, meiner Heimat, zu einer Zeit, da die Geschichten, ernst und heiter, die ich hier erzählen will, längst geendet hatten. Und eines Namens wurde würdig, wahrhaft eines schrecklichen, was bei währenden Begebenheiten hier noch ungestalt lag und wie keimweis gefaltet beisammen: aber es trat hervor, und bluttriefend, und jetzt auch dem Auge, das vor so viel Geschehen nahezu blöde geworden, in seinen Anfängen kenntlich, gräßlich bescheiden und doch so sehr kenntlich.
Ja, bei Nacht oder bei Tage: man sieht weit aus durch die schrägen Fenster dieser Mansarde. Man sitzt hoch, wie auf dem Gefechtsstande eines Artilleriebeobachters oder auf einem Leuchtturme. Man sitzt hoch über der Stadt.
Mir aber erhebt sich, hinter dem Horizonte eines engen Lebens, welches beschränkt an den immer wiederkehrenden gleichen Dingen, Nöten, Fragen klebt – mir erhebt sich hinter dem Vordergrunde dieser Kram- und Trödelmasse und hinter dem anschließenden Ausblicke auf Dächer und Gärten des Stadtteiles, ja noch ein gewaltiges Stück weiter hinter den schweren Türmen der romanischen Kirche, welche bereits den leeren Himmel in Anspruch nehmen wollen, als einen ihrer würdigen Hintergrund – und dann erst, eine machtvoll aufgerissene, vor Ferne schon dünne und glitzernde Strecke hinter diesem Gotteshause mit dem ‚zum Himmel weisenden Finger‘ – nein! erst vor dem Randblau rückwärtiger Himmel erscheint mir dort eine riesenhafte Hand, eine Menschenhand, fern und doch ganz fleischhaft gerundet, scharf und deutlich, daß jedes einzelne Äderchen wohl sichtbar wird: eine Menschenhand von Turm- oder Bergesgröße vor dem Blau, über den Zwergtürmchen der Kirche und dem Geschächtel und Spielzeug der Häuser und Gärten: und erst sie ist’s, die über das lächerliche Gefäß eines einzelnen Lebens und über all diese Hülsen und Gefäße mich hinausweist mit einem gereckten Zeiger, dessen Ausgestrecktsein wie ein Schuss ist und wie ein Kanonenschlag durch alle meine Kammern rollt.
ERSTER TEIL
1
DRAUSSEN AM RANDE
Immerfort sprudelt der breite Bach, Schleier von Wasser fallen über glattgewaschene Steine. Herr Williams und Fräulein Drobil saßen mitten im Bachbett, jedoch durchaus im Trockenen, auf einer Art Insel, die von mehreren Blöcken gebildet war – man konnte hier bequem wie in einem Fauteuil lehnen – und vergrößert durch hinzugeschwemmten Sand, der sich rundum festgesetzt hatte. Williams lebte schon länger in Wien als die Emma, die erst vor sechs Wochen hier angekommen war; jedoch blieb die Stadt beiden noch fremd, wenn auch freundlichfremd; sie streckten die Hand nach ihr aus, wie nach einem unbekannten Gericht, das jedoch Vertrauen erweckt und Appetit macht. Die Lage hier war eine gute, für ihn, der aus Buffalo hierher geraten, für sie, die aus Prag zugereist war. Jetzt wurde dies von einander weit Entfernte hier auf einem und demselben Punkt zusammengezogen, am Bache im sogenannten Haltertal oberhalb Hütteldorf, das ein Vorort von Wien ist. Immerzu sprudelte und brodelte das Wasser ihnen in breiter Front entgegen, als wär’s die unaufhörlich gehende und vergehende Zeit ihres Lebens, darin sie selbst aber jetzt paradoxer Weise ruhten. Der Blick konnte von hier durch das gerade Bachbett weit aufwärts gehen; dort bog es endlich, verschwand im Grün.
Wie ein Stab von kühlem Metall, die Wärme des Tages teilend, lag das lang gestreckte Bett des Bachs hier im Talgrund, in tiefster Ruhe bei munterer Bewegung. Was Williams und die Emma redeten, bleibe hier beiseite, wegen völliger Belanglosigkeit. Immerhin, selbst das flachste Zeug dringt mindestens in den, der es sagt, tief genug ein – und sei’s nur durch den Schall in seiner Mundhöhle – daß es seinen eigentlichen Zustand dabei und die gerade diesem wesentlichen Vorstellungen hinabdrückt, gleichsam unter das Reden hinab, wie ein Kissen, das man irgendwo hineinstopft.
Wirklich waren zwei Lebensgeschichten in springenden Bildern unter allem anwesend.
Im Elternhause zu Buffalo mochte der kleine Dwight am meisten den Keller. Jede Flasche hatte in einer Wand von Beton ein waagrechtes, ihrem Querschnitt angemessenes Loch, darin sie gesondert lag. Man konnte sie am Halse packen und ein wenig herausziehen. Dann stand sie vor und ließ sich ebenso leicht wieder hineinschieben. Als höherer Schüler nannte er das dann ‚die assyrische Bibliothek‘ und stellte sich vor, daß die auf Tonzylinder geschriebenen Bücher vielleicht ähnlich waren aufbewahrt worden. Die Keller, es waren ja mehrere, bildeten ein sehr geordnetes, gut gelüftetes und beleuchtetes System; es gab hier auch so etwas wie eine Klima-Anlage. Auch die Obstkammer zeichnete sich durch systematische Fächer aus, vom Dufte ganz zu schweigen. Die Konserven ihrerseits bildeten mehrere, im ganzen bunte und schöne pyramidenförmige Aufbauten. Dwight lief hinter der Mutter mit zwei Körben durch die Keller und trug hinauf, was sie ausgewählt hatte. Er trachtete, diese Amtshandlung nie zu versäumen und dafür stets bereit zu sein. Die Mama hatte sich daran gewöhnt. Sie pfiff durch den Garten und schon holte Dwight seine Körbe.
Das war also der Keller. Das ganze Haus hätte so sein müssen wie der Keller. Dies traf ja nun in Dwights Elternhause eigentlich zu; jedoch die Ordnung und Übersichtlichkeit des Kellers wurde nie erreicht. Der Keller war eine Sammlung. Die Zu- und Abgänge in der ‚assyrischen Bibliothek‘ wurden stets vermerkt. Als Dwight sich durch eine saubere Handschrift auszuzeichnen begann – es war das erste, was an dem Knaben besonders auffiel – erlaubte ihm der Vater, das Kellerbuch zu führen.
Ein anderes waren die Schmetterlinge. Dwight lernte sie erst auf der Universität näher kennen; als Knabe hatte er sich nicht viel um sie gekümmert. Nach mehreren schon abgelegten Prüfungen in seinem Fache, der Zoologie, verfiel Dwight am Ende des zweiten Studienjahres auf die Schmetterlinge. Aus der Kindheit brachte er hiefür weder besondere Erlebnisse noch Vorkenntnisse mit. Die Schmetterlinge waren daim ganzen für ihn das ungefähre Gegenteil des Kellers gewesen. Sie flatterten dann und wann in ungeordneter Weise über den Büschen und Beeten des Gartens.
Aber es gab Schmetterlingsbücher, ganz ebenso, wie es einst ein Kellerbuch gegeben hatte. Das Studium einer Fachwissenschaft ist einer Brautschau ähnlich. Die gesamte Heilkunde oder die gesamte Zoologie oder die gesamte Altertumswissenschaft führen an sehr viele und verschiedene Objekte der Liebe heran, bis endlich ein aus fast unerforschlichen Wurzeln der Biographie heraufsteigender Eros sich auf eines oder einige derselben stürzt: die Karzinome, die Lepidoptera oder die Brakteaten. Es gehört dazu auch, daß normale Mitbürger nicht einmal wissen können, was das nun eigentlich sei. Wann der Sprung des spezialen Eros in Dwight sich vollzogen hatte, wußte er selbst nicht ganz genau, aber doch annähernd: es war entweder beim Nachschlagen in einem älteren Werk gewesen, und zwar in Scudder’s ‚The Butterflies of the Eastern United States‘ (3 Bände), oder aber vor den Schaukästen der Sammlungen. Auch dies Leichte, Flatternde dort oben im Garten konnte also geordnet werden, ebenso fundamental wie der Keller. Dwight promovierte drei Jahre später auf Grund einer Abhandlung über den Saison-Dimorphismus; in unserer bürgerlichen Sprache bedeutet das den einigermaßen erstaunlichen Umstand, daß manche Schmetterlinge im Frühjahr, nachdem sie aus der Puppe gekrochen sind, gänzlich anders aussehen als im Sommer, so sehr, daß man sie einst für verschiedene Arten gehalten hat.
Den jungen Insektenforscher hatte sein Weg nach Brasilien geführt und auch auf ein gewisses Hochplateau im Urwald, das später einmal durch einen Roman des Sir Conan Doyle berühmt geworden ist. Aber eine persönliche Form nahm sein Leben erst während eines längeren Aufenthaltes in London an, wo er im Hause einer Madame Libesny wohnte, keine Engländerin, wie schon der böhmische Name zeigt; sie stammte denn auch aus Wien.
Der Bach kommt immerfort breit entgegen. Da und dort trommelt das Wasser in dumpfem Basse, hell rinnende und plätschernde Diskante liegen darüber. Der Wald greift links und rechts mit Baumkronen über den Bach, aber dieser selbst ist breit, er hält den Wald auseinander und über sich den Streifen Himmels offen, der die Kronen blau grundiert, und bis in’s letzte einzelne Blatt. Der Bach geht in diesem Waldtal dahin seit vielen hunderten und vielleicht tausenden Jahren. Tal und Bach sind alt. Die Bäume vergleichsweise jung; das Haar der Erde; es fällt aus, es wächst nach. Rechts oben läuft die Straße. Von Zeit zu Zeit kommt eine Art rauschender Guss auf ihr, wenn ein Auto vorbeifährt.
Emma Drobils Vater war Redakteur im tschechoslowakischen Korrespondenzbüro gewesen; früher, zu den k.u.k. Zeiten, hatte er auch durch mehrere Jahre dem ‚Prager Tagblatt‘ angehört. Die Biographie der Emma, in ihrem Freundeskreise ‚La Drobile‘ genannt, war an dem Punkte, wo wir jetzt mit ihr halten – am Bach im Haltertale, Sommer 1926 –noch nicht sehr weit gediehen, denn ihr lächerliches Lebensalter war wenig über zwanzig. Da sie englisch, tschechisch und deutsch gleichermaßen zu stenographieren vermochte, die Handelskorrespondenz beherrschte und obendrein eine gescheite und sogar gebildete Person war (beispielsweise: passables Latein !), so zog das Auftauchen ihres hübschen Gesichtes bei einer sehr bekannten Transportfirma unweigerlich bald das Angebot einer vorteilhaften Stellung nach sich, ganz zu schweigen davon, daß die Drobila groß und gut gewachsen war und ihr hoher Busen in beträchtlicher Prozession wie ein Herold vor ihr herzog. Die Mama in Prag fand sich damit ab, daß dies tüchtige Kind sich in die Fremde und die Selbständigkeit und gerade nach Wien begab, denn das hatte die Emma immer schon wollen. Jetzt wohnte sie in der Hietzinger Hadikgasse, nicht übel, elegant und hell. Mit der Mutter wurden viele und zärtliche Briefe gewechselt.
Am Bache hatte sich – übrigens, wie gesagt, seit sehr langer Zeit schon – nichts geändert, über ihn ist kaum mehr etwas auszusagen. Williams aber dachte jetzt an die schon erwähnte Frau Libesny. War alles bisher bei ihm sozusagen plan gegangen – ‚kellermäßig‘ könnte man sagen – so erhielt hier diese Lebensgeschichte eine neue und dritte Dimension, geriet also aus der Planimetrie in die Stereometrie; allerdings blieb’s doch immer noch euklidisch; wohl, aber für Dwight Williams war die Sache kompliziert genug. Es gibt nun zwar nicht nur Kellerbücher und Schmetterlingsbücher, sondern auch Psychologiebücher. Und wirklich versuchte Williams sich ihrer zu bedienen. Aber das führte zu nichts, zu keinem Ausgang, es führte aus der Sache nicht heraus.
Madame Libesny wohnte in Battersea nicht weit von der Albert-Brücke am Park, in welchen man über die Straße hinüber von ihren Fenstern blicken konnte; auch Dwights Zimmer sah dort hinaus. Es lag in günstiger Weise separiert von der übrigen Wohnung. Madame Libesny hatte diese allein inne; sie war Witwe oder geschieden, oder was es schon sein mochte; sie schien wohlhabend und ging keinem Erwerb nach. Einmal erwähnte sie ihren erwachsenen Sohn. Es gab hier auch da oder dort Bilder von ihm; ein hübscher, dunkelhaariger Mensch. Madame Libesny hatte auch zwei in Amerika verheiratete Töchter; zudem noch immer viele Verbindungen nach Wien. Darunter gab es eine Frau Mary (‚meine Freundin Mary‘). Dwight sah ihr Bild. Sie erschien ihm sehr schön. Seine Hausfrau bemerkte dazu, daß diese Dame vor etwa einem Monat durch einen Straßen-Unfall das rechte Bein verloren habe. Ein entsetzliches Unglück. In Williams erzeugte diese Mitteilung einen kurzen und beinahe stechenden Schmerz.
Er war schmetterlingshalber in London. Nicht etwa, um hier Schmetterlinge zu fangen. Sondern Dwight war auf seine erste Spezialarbeit nach Jahren wieder zurückgekommen und zugleich auf einen englischen Gelehrten, der diesbezüglich einschlägige Sammlungen in seinem Privatbesitz hatte. Mit ihm arbeitete Dwight. Die Herren hatten sich für eine Publikation, die ihnen aufgetragen worden war, zusammengetan. Der Professor wohnte jenseits der Themse, in Chelsea. Dwight ging gern hin. Er liebte den Stadtteil mit den kleinen niederen Häusern und den Vortreppen.
Ein oder das andere Mal nahm Dr. Williams den Tee bei Madame Libesny in deren Wohnzimmer. Auch hier, wie überall bei ihr, schienen Grün und Weiß und eine gewisse atlasglänzende Blässe vorzuwiegen, wenn sich das auch gar nicht in allen Einzelheiten feststellen ließ; so etwa hatte sie mehrere dunkle Empire- und Biedermeier-Stücke unter ihren Möbeln. Das Stubenmädchen, welches den Tee brachte, hieß Anna und stammte gleichfalls aus Wien. Ihren Familiennamen wußte Dwight freilich nicht, und er hätte ihn zudem kaum aussprechen können. Anna Kakabsa unterhielt ebenfalls Briefwechsel und Beziehungen zur Heimat, wo ihre Mutter noch lebte und ihre Schwester Ludmilla in einem vornehmen Hause bedienstet war. Mit ihrem Bruder Leonhard jedoch, Arbeiter in einer Gurtweberei zu Wien, unterhielt sie keine Korrespondenz. Sie bekam nur von Ludmilla dann und wann Nachricht, daß es ihm gut gehe.
Das grün-weiße Licht in der Wohnung konnte schließlich durch die Weite des Himmels über den Wipfeln des Parks erklärt werden, der sich jenseits der Prince-Albert-Bridge-Road erstreckte. Vor solchem Hintergrunde nun zeigte sich ein von Dwight bald beobachteter Dimorphismus, der sich jedoch nicht über ganze Jahreszeiten erstreckte, sondern innerhalb eines Tages, ja, weniger Stunden erlebt werden konnte (Horadimorphismus). Erlebt – so dachte Dwight, der als Gelehrter freilich dazu neigte, die Erscheinung zunächst als eine subjektive, also nur in seiner Vorstellung vorhandene, anzusehen, sie also nicht eigentlich als Wahrnehmung eines äußeren Phänomens zu werten.
Nun gut, aber es hatte Macht über ihn. Wenn Madame Libesny zu ihrem Stubenmädchen Anna sprach, sah sie gänzlich anders aus, als gleich danach, nun wieder in den blaßgrün bespannten Fauteuil zurückgelehnt. Madame Libesny redete in deutscher Sprache mit ihrem Mädchen, aber es war ein Deutsch, das Dwight schwer verstehen konnte, es hatte eine ihm neue Tonart und eine Wortstellung, die den Faden seines Verstehens immer wieder zerriß: ebenso auch, wenn Anna ihrer Herrin antwortete, was meist in längeren Sätzen und mit zahlreichen Wiederholungen geschah; dennoch vermochte Dwight ihr nicht zu folgen. Wenn das Mädchen im Zimmer war, wurde Madame Libesny’s Gesicht schmäler, und es erschien gewissermaßen dachförmig um den Nasenrücken und die Mittelachse geknickt, so daß diese etwa wie ein Messer-Rücken vortrat. War das Mädchen gegangen und hatte Madame Libesny sich zurückgelehnt, dann sah sie augenblicksweise jener Frau Mary ähnlich, die kürzlich ein Bein verloren hatte. Das Porträt der Frau Mary, welches Dwight kannte, war von halbrechts aufgenommen, so, daß man dreiviertel des Antlitzes sehen konnte; dieses war weich, in der Art einer aufgebrochenen Frucht, dabei aber auch in irgendeiner Weise von einer feinen, klugen Schärfe durchzogen. Übrigens stand das Bild in einem glatten braunen Holzrahmen auf einem Wandtischchen neben dem großen und bis auf den letzten Winkel gefüllten Bücherschrank. Wenn Dwight bei diesem stehen blieb und das Bild der Frau Mary ansah, kehrte jedesmal etwas von dem stechenden Schmerz wieder, den er zuerst empfunden hatte, als er von dem Unfall dieser Dame erfahren. …
Aber jetzt, bei dem was eben jetzt – unter der Decke des immer fortgesetzten Geplauders mit der Drobila – heraufkam in Dwights Erinnerung, heraufschoss, wie ein Holz, das am Grunde eines Weihers irgendwie verklemmt war und freigekommen ist, und nun ein Stück noch über die Oberfläche emporspringt: bei diesem Heraufschießen jetzt zerlegte der Bach sein verworrenes Gemisch von Stimmen, und plötzlich hörte Dwight nur mehr einen dumpf trommelnden Baß, und einen einzigen schrillen, klingelnden Diskant darüber.
In den Armen Madame Libesnys hatte er Mary gesucht: das Gelöste war Mary, die aufgebrochene Frucht, das zurückgesunkene Haupt, das dunkle Haar auf dem Kissen. Aber, auch die Schärfe kam aus Marys Bild, sie biß mit süßem Zahne; und sie war in manchen Augenblicken von einer trockenen, heißen Gewalt, von der ihre Eignerin offenbar wußte: dies obendrein noch: ein wild zuckender Körper – und dabei voll Verständigkeit, voll wissender Unterordnung dem eigenen Zustande gegenüber. So etwa. Dwight hätte es nicht ausdrücken können. Während er mit der Drobila über ein Revuetheater sprach, nahm sein Ohr nur mehr die schrillsten Diskante aus dem Wasser auf. Alle Bässe hatten gänzlich ausgesetzt.
Freilich, die Drobila merkte nichts; und doch war sie nicht von gestern; das muß endlich nachgetragen werden. Sie hatte das Obligatorische übrigens schon erledigt, kurz nach ihrem Abitur; kein Wunder, wenn man hinter der Gallionsfigur eines solchen Busens, wie ihn die Emma hatte, in See sticht. Da kann’s nicht fehlen. Aber die Drobila hielt ihren Kurs. Sie stellte ganz bestimmte, sehr konkrete Anforderungen an Mannsbilder. So zum Beispiel wünschte sie, wenn sie schon einen Mann haben sollte – die Nachteile dieses Zustandes waren ganz klar vor ihren Augen – sich um nichts mehr kümmern zu müssen und geborgen zu sein. Aber einen Mann haben, und erst recht für’s tägliche Brot arbeiten, das erschien ihr als widersinnig und sie lehnte es ab. Gar nicht dumm.
Sie hatten jetzt den Bach verlassen. Sein Rauschen verschwand hinter den Uferbäumen und dem dichten Gebüsch wie hinter einer zugeschlagenen Tür, als sie die Fahrstraße querten.
Dr. Williams und die Drobila erstiegen den Hang jenseits der Straße und hielten sich im ganzen in der Richtung gegen jenen Höhenzug, welchen man den ‚Kordon‘ nennt. Die Flanke war steil. Oben ging es wellig hin und fast eben. Es war Wald, Laubwald, richtiger, freier, ungezähmter Wald, hügel-auf, hügel-ab; und das kaum fünfzig Minuten vom Zentrum der Großstadt, wenn man die Stadtbahn bis Hütteldorf nahm.
Was die beiden eigentlich von einander, mit einander, für einander wollten, erscheint zunächst noch als undurchsichtig, als neutral und blaß, als kaum feststellbar. Sie gingen eben miteinander spazieren, punctum. Aber jedes wie immer geartete Faktum, wenn es zwei Personen verschiedenen Geschlechts zusammenbringt, wird tendenziös. Dwight kümmerte sich jedoch nicht darum. Er dachte jetzt an sein Zimmer in London, Albert-Straße. In der Ecke hatte es einen alten Schrank mit Einlege-Arbeit gegeben, Bilder aus der englischen Geschichte darstellend: unter anderem sah man den König Heinrich VIII., umgeben von seinen umgebrachten Frauen, jede in einem Medaillon. Das Ganze sah aus wie ein schlechter Witz, insbesondere die Physiognomie des Königs. Dwight mochte das Ding nicht. Es erschien ihm wie ein Knoten der eigenen inneren Verstrickung.
Dwight hatte die Drobil auf die denkbar simpelste Art kennen gelernt: dadurch, daß von ihrer Firma seine Bücherkiste aus London hierher spediert worden war.
Nun, hier gingen sie. Es gibt dort oben auf der Höhe, auf dem flachen Bergrücken, einen Aussichtsturm und daneben ein Wirtshaus.
Der Wienerwald ist eine nicht unbedenkliche Landschaft. Alles leichtgeschwungen und duftig enteilend. Aber dahinter lauert eine gewisse Schwere, die Schwere der Wehmut, eine Gefahr auch für sehr gesunde Menschen; ja, für die erst recht. Es ist eigentlich schon der Abschied von Berg und Hügel, von villenbesetzten Lehnen, die sich in die Waldtäler schieben; es ist der Abschied von all’ dieser freundlich anheimelnden westlichen Detailliertheit und den kleineren Landmaßen; ja, es ist wie der Abschied von der Kleinheit Griechenlands, hart vor dem Eintritt in den Osten, den unmäßig hingedehnten: nicht weit von hier beginnt die Tiefebene und flieht dahin und enteilt; gegen Ungarn zu. Alles wird größer und weniger in’s einzelne gehend, und mit dem wachsenden Landmaße wächst auch das Zeitmaß. Nicht jedes Leben hat da ein, wenn auch unsichtbares, so doch besonderes Gärtlein. Hier zogen einst nur Wandervölker. Heut’ noch sieht man, in Rußland etwa, die Menschen ständig wandern: mit Bündeln, die getragen werden, mit hölzernen Koffern, die man auf Wägelchen oder Schlitten nachzieht. Sie wandern. Ja, sie müssen wandern. Man hetzt sie. Das Einzel-Leben lehnt sich nicht auf: es ist zu wenig davon vorhanden für eine Auflehnung. Eine Seele mischt sich mit der anderen wie Rauch. Daher sind die Menschen dort brüderlich. Hier noch, so weit der Westen geht, so weit Rom und Griechenland reichen (kurz gesagt), steht einer allein zwischen den gepflegten Beeten und dem kleinen Porticus des Hauses, daraus ihn nach Recht und Gesetz niemand soll vertreiben können. Er steht für sich allein, um ihn ist die blaue linde Luft, er steht allseitig frei, wie ein Standbild. Nur so kann er’s machen, nur so kann er groß oder klein, krumm oder grad, gut oder schlecht sein. Nicht aber, wenn er sich demutsvoll fügt, sich hineinjagen und einreihen läßt in irgendeine wandernde Herde, und Leidenspille nach Leidenspille schluckt, und noch eine dazu und noch eine obendrauf, und dabei denkt, es müsse eben so sein.
Dwight und die Drobil hätten alle diese Sachen wissen können, und wußten sie vielleicht auch irgendwie und schulbildungsgemäß. Aber es war ihnen solcher Hintergrund, vor welchem sie lebten und privatim agierten, durchaus nicht gegenwärtig und bewußt: anders wär’s ja ein Vordergrund geworden. Ihre Beziehung dazu war eine weit konkretere; denn sie wurden ja durch die angedeuteten Sachverhalte in ihrer privaten Existenz erst ermöglicht, in ihrer Lebensform als schwankende Nadeln, die sich da und dort hin wenden können, oft zuckend, statt zeigend, oft wirbelnd, statt weisend: jedenfalls aber am Ende voll haftbar für den eingeschlagenen Weg: als Figuren, um die man allerseits herumgehen kann, und um welche rundum denn auch schlichthin alle Möglichkeiten offen stehen, die Windrichtungen des Lebens: um endlich ihren letzten Streit und Widersatz, ihr Saugen und Ziehen da oder dort hin, in einem sozusagen freien Wettbewerbe drinnen im Kern der Figur auszutragen.
Ohne freie Dialektik gibt’s kein Griechenland.
Nun, dies nur nebenbei. An jeder Lage ist am meisten bezeichnend dasjenige, was dabei als selbstverständlich gilt. Zugleich ist es am schwersten zu erfahren. Ethnologen in fernen Ländern und auf urtümlichen Inseln bekamen oft von gastfreundlichen und zutraulichen Wilden die größten Merkwürdigkeiten gezeigt: nur, was diesen Völkern als selbstverständlich galt in Brauch und Anschauung, dies ward freilich niemals auch nur gestreift. Und es hätte eben das, der Kern der Nation und ihre Absetzung von anderen, die Professoren sicherlich am meisten interessiert. Sie mußten es aber stets auf Umwegen und durch vorsichtiges Fragen allmählich herauskriegen.
Bei Dwight und der Drobil wär’s uns ähnlich gegangen. Sie haben sich inzwischen unten beim Aussichtsturm niedergelassen, um Bier zu trinken; die Drobila war ja eine Böhmin, und die Amerikaner trinken ein gutes Bier auch recht gern. Freilich wär’ unserer Emma ein echtes Pilsner noch willkommener gewesen; aber das gab es nur in der Stadt drinnen; und dies hier schmeckte auch nicht übel. Beiden war einigermaßen warm geworden, schon beim Anstiege zum Kamm. Der Himmel wölbte sich jetzt wolkenlos. Neben dem Aussichtsturm, in einem umzäumten Gärtchen, hüpfte ein junges Lämmlein herum. Es trug ein blaues Band um den Hals mit einer kleinen Schelle daran, die dann und wann leise klingelte. Ein Kind erschien an einem der Fenster des Hauses und rief „Tschapei! Tschapei!“ herüber. Das war offenbar des Lämmleins Name. Es antwortete auch und sagte: bäh!
Dwight war schmetterlingshalber in Wien. Nicht etwa, um hier Schmetterlinge zu fangen; sondern er war interessiert daran, bei der Neuordnung der lepidopterologischen Sammlungen des naturhistorischen Museums mitzuwirken, weil ihm dabei ein für seine Arbeiten erforderliches Material vollständig unter die Augen kommen mußte; und so hatte er sich denn hierher schicken oder eigentlich rufen lassen. Das Museum aber bildete nur den einen Pol seiner Anwesenheit in Wien, einen festen, der so schwer dalag, wie drüben, wenn man aus dem hohen Bogenfenster des Arbeitszimmers sah, das kunsthistorische Museum sich erstreckte, dem Gebäude, worin man sich befand, äußerlich vollends gleichartig: ein auf der anderen Seite grüner Anlagen stehendes Spiegelbild. Darüber viel Himmel. Darunter das hohe Standbild oder eigentlich Sitzbild der Kaiserin, mit ihren berittenen Paladinen am Sockel. Es markierte einen Bezugspunkt, es nabelte, was man hier sah, in ein Zentrum zusammen.
Den anderen Pol bildete Frau Mary.
Sie war jedoch nicht lokalisierbar, daher in diffuser Weise fast überall anwesend.
Es war in der Albert-Straße zuletzt einfach unmöglich geworden, Madame Libesny noch um Frau Mary’s Familiennamen und Wiener Anschrift zu bitten. Wenn Dwight etwas länger neben dem Bücherkasten stehen blieb und auf das Bild sah, trat Dimorphismus ein.
Dabei hatte Madame Libesny zwei außerordentlich schöne Beine.
Frau Mary K. lebte im Sommer 1926 nicht in Wien. Sie hielt sich in München auf, Monat für Monat, schließlich weit über ein halbes Jahr. Zu München wirkte damals ein berühmter Orthopäde, der Professor Habermann. Außer seiner Klinik umgab ihn ein kleiner Kreis sozusagen eisern entschlossener Patienten, die es fertig brachten, sich von dem Umstande, daß sie irgendwann und irgendwie zwischen die Mechanik des Lebens geraten waren, nicht niederdrücken zu lassen; ja, bei einigen von ihnen sind ihre besten Kräfte erst recht provoziert worden dadurch, daß ihnen ein Schicksal, ähnlich dem der Frau Mary K., zuteil geworden war. Solche Mobilmachungen des kämpfenden Ich aber wurden von dem Professor Habermann nicht nur nach neuesten orthopädischen Methoden, sondern auch psychologisch auf’s trefflichste gefördert.
Frau Mary wohnte in einem bekannten Münchener Hotel, nicht weit vom Hauptbahnhof, und war gut aufgehoben. Ihr geräumiges Zimmer lag an der Ecke des Hauses und hatte daher Fenster nach zwei Seiten, in zwei verschiedene Straßen.
Hier oblag sie durch viele Monate dem ihr aufgetragenen Werk mit Überwindung und Festigkeit. Um von Stelzfuß und Krücken wegzukommen, verlangte Habermann bald tägliche Übungen im Gehen mit der neuen Prothese; er verlangte, daß der Patient nicht ablasse, daß er die Zähne zusammenbeiße und übe, als hinge das Leben daran (und es hing ja daran!); er verlangte, daß die immer wieder neu erscheinenden Druckstellen und Empfindlichkeiten da und dort – der Stumpf, bei Mary also nur der Oberschenkel, stak in einer Art Hülse oder Düte – für den Patienten kein Grund sein sollten, vom Üben abzulassen: dieses war freilich im einzelnen geregelt und in seiner Abfolge vorgeschrieben. Häufig geschieht es in solchen Fällen, daß kleine Wunden entstehen, daß die verheilten Teile da oder dort ein wenig aufbrechen; derartiges mußte behandelt werden, im Üben aber sollte es, wenn irgend möglich, dabei zu keiner Unterbrechung kommen. Der ganze Vorgang ließe sich, allerdings sehr entfernt und im bis zur Harmlosigkeit verkleinerten Maßstabe, subjektiv mit jenem vergleichen, der statthat, wenn einer sich an das Tragen einer Zahnprothese gewöhnen muß: auch hier gibt es anfangs oft empfindlich gewordene Stellen, wodurch der Aufbiß gehindert wird, so wie dort der Auftritt mit dem Ersatzgliede unerträglich erscheint, das übrigens, einem echten täuschend nachgebildet, auch dessen Strumpf und Schuhwerk trägt.
Hier also, in diesem Eckzimmer des ‚Hotel Feldhütter‘ zu München, bestand Frau Mary ihre ‚Aristeia‘, wie Homer in der Ilias die großartigsten und preiswürdigsten Kämpfe seiner Helden nennt. Denn sehr bald ordnete der Professor Habermann an, daß, nach hinreichender Unterweisung, auch allein und daheim täglich regelmäßig geübt und mit den Gehversuchen nicht nachgelassen werde. So trug Frau Mary ihre Aufgabe und die Last des so unbehilflich gewordenen Körpers mit leicht verzogenem Munde, und auf einen Spazierstock aus Ebenholz gestützt, von der einen Fensterseite des Zimmers zur anderen, schräg durch den Raum. Ein dumpfer Druck rumorte. Schon wieder stach ein kleiner Schmerz. Die Prothese hing so tot am Körper, wie sie ja wirklich war. Jedoch, sie sollte gleichsam einbezogen werden in den Leib, und an ihn angegliedert.
Mary hielt im Humpeln inne und sah auf.
Sie muß sehr schön gewesen sein in diesen Augenblicken. Das Licht, wenn auch ohne Sonnenschein, fiel durch’s hohe breite Fenster direkt auf sie. Ein kluges, wahrhaft wohlgeratenes Weib, die jetzt fast ehrwürdig wirkenden Züge uralter Rasse, das kupfrig leuchtende Haar um die Schläfen, deren Haut schimmerte wie das Innere einer Perlmuschel: und dies alles schwer getroffen mitten im Anstiege zur wahren fraulichen Pracht der vierzig und fünfzig; ihr war jetzt so, als hätt’ ihr das Unglück nicht nur ein Bein über dem Knie, sondern alle beide weggerissen, und die Arme dazu, einen sinnlosen, unbeweglichen Klumpen übrig lassend.
Ihre weißen Zähnchen gruben sich in die Unterlippe. Das Netz zarter Striche, welches eine lange Leidenszeit über dieses Antlitz geworfen – darin seit jeher eine feine Schärfe nicht gefehlt hatte – zog sich enger zusammen. Sie senkte den Kopf tief herab. Um die Augen erglühte ein Ring, jetzt schlossen sie sich, die zurückgepreßten Tränen fielen zu Boden: eine, noch eine.
Und doch, während sie ganz kurz auf einem Tiefpunkt verweilte, der dem Verzweifeln so nahe zu liegen schien, war, wie ein zweiter Boden darunter, die Gewißheit in ihr anwesend, das Schwerste schon hinter sich zu haben: das Schwerste nicht in bezug auf ihre gegenwärtige Aufgabe bei Professor Habermann und hier in diesem Zimmer. Vielmehr das überhaupt Schwerste, das sich auf sie gleichsam herabgesenkt hatte, während sie noch im Unfallkrankenhaus zu Wien gelegen war: diese Katastrophe nämlich in die Dauer aufzulösen, aus einem Ereignis von Sekunden nunmehr eine Einrichtung von Jahren zu machen; nicht zurückzutasten in die Zeit vor dem Unglück, in die letzten, ahnungslosen Stunden etwa knapp vorher; nicht sich zu fragen ‚wie war denn das möglich?‘, sondern sich zu sagen, daß es nun eben bereits so sei. Das Schreckliche galt es, in die Dauer gestreckt und in kleinen Portionen zu konsumieren, es sich zu assimilieren, um es schließlich schon zu praktizieren – wie eben hier und jetzt.
Aber, bis sie so weit gelangte!
Als sie ausgefahren war in dem Rollstuhl, den man hatte anschaffen müssen – welch ein Umstand im Lift! die beiden erwachsenen Kinder oder der Portier halfen jedesmal der treuen Marie – hatte sie, am Schaufenster eines Schuhgeschäftes vorbeigleitend, gleichsam ihre eigenen beiden heilen Füße vervielfacht hinter der Glasscheibe stehen sehn. Vervielfacht. Ja, es war zu viel gewesen. Umwenden, nach Hause.
An diesem Abend trat die Krise ein. Sie hatte Marie hinausgeschickt und saß im Nachthemd auf dem Bettrand. Sie lüftete das Hemd und sah jetzt den Stumpf, narbig, braun verfärbt. Im Augenblicke wurde sie selbst zu einem klumpigen, stumpigen Klotz, einem Knollengewächs, einem Gnomen.
Ihr Auge blieb trocken. Es war kein Elend mehr. Sie erfaßte plötzlich die Größe ihrer Lage, und damit ihre Stunde: und so wurde sie fähig, deren Befehl zu empfangen. Ihre Augen blitzten auf. „Mary!“ sagte sie laut. Sie sprach sich selbst an. Das Mädchen erschien. Sie vermeinte, gerufen worden zu sein. Aber die Gnädige hatte nur hier und jetzt und im voraus einen kleinen Tigersprung nach München gemacht zu Professor Habermann.