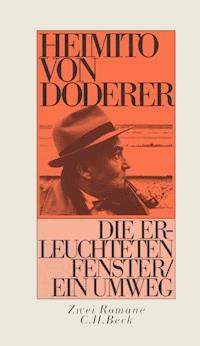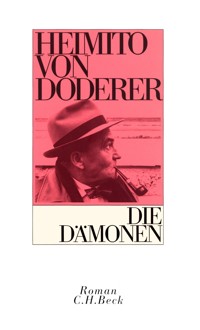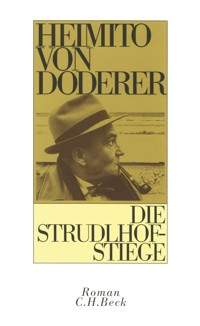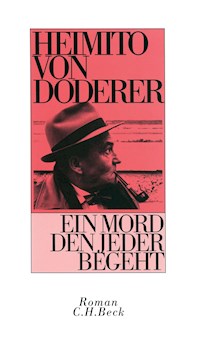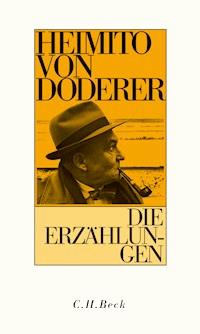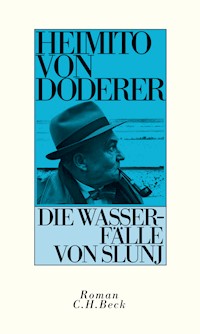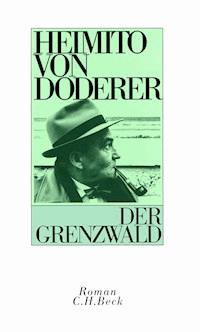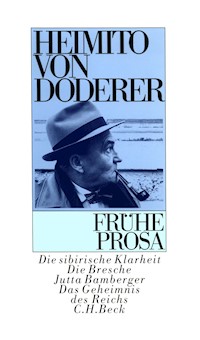
13,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: C. H. Beck
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
In diesem Band sind Heimito von Doderers Texte aus der Zeit der Kriegsgefangenschaft 1916 bis 1920 und seine Werke aus den zwanziger Jahren zusammengefasst. In den frühen Skizzen und Erzählungen, die das Lagerleben reflektieren, aber auch das ferne Wien poetisch vergegenwärtigen, finden bereits Themenstränge, die sich, Jahrzehnte später, in der "Strudlhofstiege", den "Dämonen" und noch im "Grenzwald" romanhaft auffächern. Auch die Arbeiten aus den zwanziger Jahren deuten alle schon auf Charaktere und Situationen der großen Romane hin. Doderers eigentümliche Beschreibungsart und "dodereske" Stilmittel, aber auch für Doderer zentrale Motive, etwa das der Befreiung und Verstrickung durch die Landschaft und das der Menschwerdung, sind bereits erkennbar.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
HEIMITO VON DODERER
Frühe Prosa
Die sibirische Klarheit Die Bresche/Jutta Bamberger Das Geheimnis des Reichs
VERLAG C. H. BECK
Zum Buch
In diesem Band sind Heimito von Doderers Texte aus der Zeit der Kriegsgefangenschaft 1916 bis 1920 und seine Werke aus den zwanziger Jahren zusammengefaßt. In den frühen Skizzen und Erzählungen, die das Lagerleben reflektieren, aber auch das ferne Wien poetisch vergegenwärtigen, finden sich bereits Themenstränge, die sich, Jahrzehnte später, in der „Strudlhofstiege“, den „Dämonen“ und noch im „Grenzwald“ romanhaft auffächern. Auch die Arbeiten aus den zwanziger Jahren deuten alle schon auf Charaktere und Situationen der großen Romane hin. Doderers eigentümliche Beschreibungsart und „dodereske“ Stilmittel, aber auch für Doderer zentrale Motive, etwa das der Befreiung und Verstrickung durch die Landschaft und das der Menschwerdung, sind bereits erkennbar.
Über den Autor
Heimito von Doderer (1896–1966) gilt seit der Veröffentlichung seiner beiden großen Wiener Romane Die Strudlhofstiege (1951) und Die Dämonen (1956) als einer der bedeutendsten österreichischen Schriftsteller des 20. Jahrhunderts.
«Doderer ist ein ganz erstaunlicher Schriftsteller. Sehr berühmt und doch immer noch zu entdecken.»
Daniel Kehlmann
«Rätselhaft, daß wir es uns leisten, über diesen großen Autor hinwegzugehen.»
Walter Kempowski
Inhalt
DIE SIBIRISCHE KLARHEIT – Texte aus der Gefangenschaft
Die Singvögel.
DER CENTAUR UND DIE SPRINGSCHNUR.
Der Tod und der Starke.
Schneeschmelze im Hof.
Das Treibhaus.
KAULQUAPPEN. – (Wassergraben im Hof.)
Der Abschied.
SLOBEDEFF.
DER BRANDSTUHL.
Holzschnittexte.
Das Caféhaus.
Dilettanten der Armut.
Katharina.
FORTUNATINA UND DIE LÖWIN. – Ein Märchen
Falsche Erwartungen.
Finale.
DIE BRESCHE – Ein Vorgang in vierundzwanzig Stunden
I
II
Intermezzo
III
IV
Nachspiel
JUTTA BAMBERGER – Ein Fragment aus dem Nachlaß
1. – (bis 12. Jahr)
2. – (ab 12. Jahr)
3. – (ab 16. Jahr)
4. – (ab 17. Jahr)
Episode f
DAS GEHEIMNIS DES REICHS – Roman
I
II
III
IV
ANHANG
ZUR DOKUMENTATION
VORSTUFEN UND VARIANTEN ZU „JUTTA BAMBERGER“
Fußnoten
DIE SIBIRISCHE KLARHEIT
Texte aus der Gefangenschaft
Die Singvögel.
Auf dem Gartenweg ging langsam ein Mann. Hinter ihm kam die große, gefleckte Katze mit verführerischer Freundlichkeit daher. Sie dehnte sich bei jedem Pfötchenschritt, ihr Gang war weich wie Butter.
Der Mann auf dem Gartenweg sah sich um und bemerkte die Katze. Er ging wieder ein paar Schritte und freute sich, als die Katze ihm folgte. Es tat ihm leid, daß er nichts für sie hatte, kein Schüsselchen mit Milch oder ein Stückchen weißes Brot –
Hinter der Katze kam das Hündchen; es sah töricht drein. Die Katze beachtete es kaum, obwohl es sich näher an sie heranmachte und endlich an ihrer Seite daherzottelte. Die Katze hatte wichtigere und höhere Zwecke im Auge, als einem Spaziergänger nachzulaufen oder mit dem Hündchen zu spielen.
Denn auf einem Baum, gleich hier am Wege, gab es ein Vogelhäuschen mit Nestlingen. Und in der Krone des Baumes hüpften und pfiffen die Goldammern.
Der Mann bemerkte, als er sich wieder umsah, den Hund, und daß sich jener an die Katze heranmachte. Da hielt er im Gehen inne und sah zu, denn es gingen ihm die Worte ‚Hund und Katz‘ durch den Kopf, und er erwartete ein kleines Schauspiel.
Aber die Katze hatte, wie gesagt, Wichtigeres zu tun. Ihr Pfötchenschritt dehnte und streckte sich, sie schlich auf den Fuß des Baumes zu. Das Hündchen versuchte noch immer, mit ihr zu spielen, aber sie beachtete es nicht. Mit einem Male richtete sie sich auf – spak, spak –, die Krallen schlugen in die Rinde des Baumes. Das Hündchen sah nun wohl deutlich, daß die Wege der Katze über seine Kräfte gingen und daß sein Spielkamerad ihm zu sehr überlegen war. Aber es richtete sich auch auf an dem Baum, so gut es konnte, und legte der Katze ein Pfötchen auf den Rücken, wie um sie doch noch zurückzuhalten. Dabei sah es so traurig und töricht drein!
In diesem Augenblick freute sich der Mann, der auf dem Weg stand und zusah, über die Katze und ihre Gewandtheit und Überlegenheit dem dummen Hündchen gegenüber. Doch jetzt, als die Katze mit einem Satz an dem Stamm emporschoß – spak, spak, klangen die scharfen Krallen, und die Katzenaugen waren starr auf die Vögel gerichtet, die oben ängstlich herumhüpften –, da wußte der Spaziergänger recht gut, daß jenes arme Hündchen, das nun unter dem Baume stand und traurig nach oben sah, doch besser war als die schnelle Katze. Und wenn er auch einen Augenblick lang die Absicht gehabt haben mochte, der Katze bei der Jagd zuzusehen – nun faßte ihn ein Abscheu vor ihr, er schlug sich auf die Seite der Singvögel und jagte die Katze mit Steinwürfen vom Baum herab und davon.
DER CENTAUR UND DIE SPRINGSCHNUR.
(A. Kunft)
Zwei Männer gingen von Abdera weg, in’s Bergland, um einen Centauren zu fangen.
Sie hatten zu diesem Zweck nichts Anderes mitgenommen als einen langen Strick. Denn sie wußten recht wohl, wie man es anstellt, einen von den Busch und Halde durchstreifenden, plumpen und zottigen Roßmenschen festzukriegen. „Die dummen Halbtiere werden nicht schwer zu überlisten sein“, dachten sie. „Und wenn wir einen in die Stadt und auf den Markt bringen und er dort seine Sprünge macht, wird uns das ein schönes Stück Geld einbringen, die ganze Stadt wird davon reden, und Jeder läuft uns gewiß zu, um das Ungetüm nur auch gesehn zu haben. Und wir haben einen schönen Verdienst, einen Spaß obendrein und werden berühmte und vielgenannte Leute. Man muß nur etwas Mut haben und einen findigen Kopf …“
In währendem Gehen vertrieben sie sich die Zeit, indem sie den Strick ausgespannt über die Straße hielten und damit Wellen, Kreise und Spiralen schlugen; oder es versuchte Einer den Anderen durch plötzliches Anziehen zu Fall zu bringen. Als sie das letzte kleine Bergdorf durchschritten, warfen sie gar einmal den Strick wie eine Schlinge um den Ast eines Birnbaumes, schüttelten, und bestahlen so den Bauer um seine Früchte, die jener ganz sicher geglaubt hatte, da sie ja so hoch hingen.
So kamen sie, birnenkauend und allerlei Unfug treibend, am frühen Nachmittage in ein einsames Bergtal. Linker Hand stieg niederer Wald an, und zur Rechten zogen die Matten hin, noch grün und mit den Farbflecken der Herbstzeitlosen weithin betupft. Sie gingen noch immer wie früher, der Eine diesseits, der Andere jenseits des Weges; den Strick hielten sie an seinen Enden und schlenkerten damit. Als der Eine gerade die letzte Birne aus der Gürteltasche nahm und hineinbiß, daß ihm der süße Saft aus den Mundwinkeln und über das Kinn rann, wollte ihm sein Gefährte den Genuß verderben; denn dieser war mit seinen Birnen schon zu Ende, und die Sonne stach, trotz der späten Jahreszeit. Darum ärgerte ihn das saftfreudige Kauen des Anderen, und er zog plötzlich und heftig am Strick. In dem unnützen Bestreben, das Ende des Strickes festzuhalten, taumelte nun der zweite Centaurenjäger einen Schritt einwärts des Weges und streckte die freie Hand aus, um in’s Gleichgewicht zu kommen. Dabei hielt er die Birne mit den Zähnen fest, und so kam es, daß ihm gerade das eine Stück im Mund blieb und der andere Teil angebissen und saftfeucht in den Wegstaub fiel.
Er wollte schlucken und fluchen, doch grad’ im Augenblicke hörten sie Hufschlag.
Sie sahen beide gespannt vor sich hin, nach der nahen Wegbiegung. Das Hufgestampf kam näher, es klang wie scharfer Gallopp; und gleich kam es um die Biegung – ein junger Centaur, ein wahrhaft prächtiger Bursche, mit breiten Schultern und stämmigen Leibes. In der Lust des Dahinjagens hatte er den Kopf weit in’s Genick zurückgeworfen und die Arme ausgebreitet. Die langzottigen Brusthaare umflatterten ihm wie eine Mähne die Seiten, unter seinen Hufen flogen die Steine, und weglang stand hinter ihm eine Staubwolke.
Den Zweien fiel im Augenblick nichts Anderes ein, als rasch den Strick zu spannen und ihn in Mannshöhe emporzuhalten. Da war der Centaur auch schon heran und setzte in kraftvollem Sprung über den Strick weg; Staub und Steine flogen hoch auf.
Erst standen die beiden Jäger ein wenig verdutzt, dann aber besannen sie sich ihrer List. Sie hatten davon gehört, welches maßlose Vergnügen die Roßmenschen am Springen finden. Drum blieben sie ruhig, wo sie waren, und hielten den Strick nach wie vor ausgespannt über den Weg. Der Centaur machte auch richtig nur mehr etliche langsamere Galloppsprünge, blieb stehen und lugte über die haarige Achsel zurück. Endlich wandte er sich um und kam im langsamen Trabe heran. Dann warf er plötzlich den Kopf in den Nacken, prellte vor und setzte in hohem Bogen zum zweiten Male über den Strick.
Die Beiden behielten ihre Stellung unverändert.
Und das Spiel wiederholte sich.
Der Centaur flog hin und her, Sprung folgte auf Sprung. Der Staub stand in Wolken, und den beiden Jägern begannen die Arme zu ermüden, wenngleich sie abwechselten und den Strick bald mit der Linken, bald mit der Rechten hochhielten. Eine Raserei schien den Roßmenschen überkommen zu haben. Er schoß hin und her, mit einem Riesensatze jedesmal den Strick überspringend; und dann wandte er sich gleich auf den Hinterhufen, zu neuem Anlauf. Der Schaum begann ihm auf die Lippen zu treten, er hielt den Mund offen, und sein Atem ging keuchend und rasselnd durch die Kehle. Die beiden Jäger sahen das mit Befriedigung. Denn sie hofften, den gänzlich Erschöpften dann leicht zu fangen und zu binden.
Aber es dauerte noch eine Weile. Indes, den Jägern fiel etwas ein. Sie begannen nämlich, den Strick zu drehen, in der Art, wie die kleinen Mädchen ihre Springschnur schwingen. Der Centaur wurde da völlig toll. Er blieb gleich an Ort und Stelle stehen und sprang mit seinen vier Rosseshufen immer wieder über den rasch unter ihm durchsausenden Strick. Die Sprünge folgten schneller und schneller aufeinander, denn die Beiden drehten aus Leibeskräften; und die Bewegungen des Centauren glichen schon denen eines heftig bokkenden Pferdes. Der Strick schnitt blitzschnell und pfeifend durch die Luft, er hielt den Roßmenschen gleichsam in seinem Bann: denn immer wieder mußte er springen, und kaum war er auf seinen vier Hufen gelandet, so pfiff auch schon die Springschnur von Neuem heran, und es blieb ihm nichts Anderes übrig, als darüber hinwegzusetzen. Er tat es denn auch bald in müderen und plumperen Sätzen, seine breiten Hufe streiften da und da den Strick. Die Zunge lag ihm heiß und rot zwischen den offenen, beschäumten Lippen, die Brust hob sich heftig im fliegenden Atem, und die schweißdunklen Flanken zitterten und bebten. Da verfing er sich denn bald, gänzlich erschöpft, mit den Hufen im Seil, brach in die Hinterbeine, versuchte hufscharrend aufzukommen, fiel aber endlich ermattet zur Seite in den Wegstaub – und da lag er und zuckte mit den Beinen wie ein verendendes Pferd. Die beiden Jäger waren alsbald über ihm her, sie fesselten seine Vorderbeine und schnürten ihm die starken, haarigen Arme auf dem Rücken zusammen.
Nun hatten sie ihn und lachten.
Der Centaur lag mit geschlossenen Augen und atmete heftig.
Aber nach einer Weile schlug er die dunklen Augensterne auf und suchte sich zu regen und auf die Beine zu kommen. Da fühlte er denn die Fesseln und sah sich gefangen. Er schloß die Lider auf’s Neue. Dann aber wandte er das Haupt, hob den Blick zu den beiden Jägern, die lachend vor ihm standen, und begann zu sprechen:
„Wohlan! – ihr glaubt jetzt, die Klügeren zu sein, und seid es ja in meinem Falle wirklich! Denn eure Springschnur hat mir zu viel Vergnügen gemacht, ich konnt’ nicht mehr los, ich mußte springen und springen bis – nun, jetzt liege ich hier, halb verreckt im Wegstaub. Ihr habt mich gefangen und gebunden. Wohlan! – ihr habt mich überlistet. Es sei euch zugestanden!
Nun aber hört mich.
Meine Dummheit war groß, ich will das nicht läugnen. Und doch liegt sie euren klugen Köpfen nicht so fern, wie ihr vielleicht glaubt.
Seht – ihr seid Bürger der großen Stadt Abdera, vermutlich; wenigstens seht ihr mir so aus. Nun, ihr habt da euer Gewerbe – welches ist es denn, wenn es erlaubt ist zu fragen …? So. Nun gut, Du bist Gewürzkrämer, und Dein Gefährte flickt Schuhe. Ihr habt da also eure Arbeit, euer Geschäft, eine Frau vielleicht und am Ende noch Kinder. Du verkaufst Deine Rettiche und Deinen Knoblauch, und Du besserst Deinen Kunden den zerrissenen Sandalenriemen aus. Dann geht ihr auf den Markt; ihr seht, was es Neues in den Staats- und Stadtangelegenheiten giebt. Ihr hört zu und gebt eure Meinung ab und nennt den oder jenen Feldherren einen großen Mann und etwa den neugewählten Bürgermeister einen Tropf. Dann kommt ihr nach Hause, die Frau setzt das Essen auf den Tisch, ihr seid zufrieden oder auch gar unzufrieden damit. Ihr prügelt euren Jungen und gebt dem Sklaven, den ihr vielleicht habt, eine Maulschelle, wenn euch die Laune durch das Essen verdorben ist, oder ihr sonstwie schiefgewickelt seid. Abends geht ihr dann in die Schenke, oder ihr bleibt auch hübsch daheim und helft der Frau Wollsträhne haspeln.
Seht ihr, das geht so Tag für Tag.
Und nun frage ich euch: sind eure Tage mit den tausend kleinen Anlässen zu irgend was, zu Ärger, Freude, Sorge – sind diese Tage nicht auch so eine Art Springschnur, in deren Wirbel ihr hineingeraten seid? Und nun müßt ihr eben hüpfen, immer wieder, und wenn euch auch mitunter – schon zehnmal alle Knochen weh tun. Ihr müßt eben – das rollt so fort, und ihr könnt nicht anders.
Nun glaubt ihr vielleicht manchmal im Ernste, selbst die Schnur zu drehen, über die ihr alltäglich springt. Doch nein – ihr wißt ja recht gut, daß dem nicht so ist. Und so hat eigentlich die Schnur samt ihrer Drehung mit euch selbst gar nichts zu tun – sie gehört gleichsam garnicht euch – ihr müßt nur springen, springen.
Und das noch dazu euer ganzes Leben lang.
Bis ihr so daliegt wie ich jetzt.
Ich könnte noch anmerken, daß es außerdem etwas in diesem euren Leben giebt, das noch viel größere Ähnlichkeit mit einer Springschnur aufweist. Und das hätte vielleicht einen besseren Vergleich abgegeben. Aber ich kann euch doch nicht gut eure Leidenschaften vorhalten; namentlich, da ich selbst durch etwas Ähnliches zu Fall gekommen bin. Überdies ziemt Höflichkeit dem Unterlegenen.“
So sprach der Centaur. Die beiden Abderiten sahen sich betroffen an. „Wenn er nun solche Geschichten unten auf dem Markt erzählt – wie würden wir dastehen?“ So dachten sie; da lösten sie, ohne ein Wort zu sprechen, die Bande des Roßmenschen und zogen stillschweigend mit ihrem Strick zu Tal. Der Centaur aber stürmte aufjauchzend in seine Berge.
Der Tod und der Starke.
Oben, an der Ausladerampe des Lebens, ging der Tod langsam auf und ab.
Die ganze Breite der steilen Rampe unter ihm war von eifrig emporstrebenden Menschen eingenommen. Im Gewimmel mühten sie sich hinauf: einige versuchten es noch aufrechtgehend, andere hatten sich schon auf die Knie und Handflächen gestützt, um nicht zurückzugleiten. Keuchend und eifrig strebte jeder vorwärts und empor auf dem überaus glatten Holz.
Der Tod ging oben auf und ab und wartete, bis es jeweils Einen abzufertigen gab. Er hatte das Gehaben eines Beamten, der gleichgültig und gewohnheitsmäßig seine Arbeit macht, ein wenig gelangweilt und mit einer leisen Note von Verachtung gegen das andrängende Publicum. Man sieht solche Mienen an öffentlichen Schaltern. Denn der Beamte hat die Interessen aller zu bedienen, und während er mit dem einen verhandelt, hat er des eben erledigten Vorgängers längst vergessen, und wenn die Angelegenheit noch so einschneidend für diesen war. Daher denn bei dem Schaltermann eine gewisse Erhabenheit über das heftig drängende Einzelinteresse.
Ab und zu blieb der Tod stehen, trat an die Rampe und sah hinab. Meistens gab es dann für ihn Ärger. „Aha“, sagte er, „sind wieder ein paar schon vor der Mitte zu Ende.“ Unten waren auf halbem Wege ein paar Menschen zusammengebrochen. Sie lagen kraftlos und zuckend auf den überaus glatten Planken und kamen durchaus nicht weiter. Denen mußte der Tod entgegengehen, klappernd und ächzend; dann tat er sie mit einem ruhigen, gleichmütigen Sensenstriche ab; und dann kehrte er wieder zurück auf seinen Platz, langsam und gemach, die Sense auf der Schulter, wie ein Bauer etwa, der eine steile Wiese hinaufgeht. „Dutzendware, lauter Dutzendware“, brummte der Tod mißvergnügt und verächtlich. Er mußte sich oft wundern über die Menschen. War das ein verzweifeltes Drängen und Hasten da herauf! Nun, was gab es da heroben schon zu holen, oder was gab es Besonderes zu sehen!? Er fertigte doch alle in gleicher Weise ab. Also, was drängten sie sich da zu ihm herauf? Warum bestürmte man ihn dermaßen? – Der Tod war sehr eingebildet. Die Meisten von unten hatten ihre Augen durchaus nicht auf ihn gerichtet. Sie wollten etwas ganz Anderes. Ab und zu einmal sah ihn Einer. Und dann verdoppelte der seine Bemühungen. Die Bemühungen galten aber nicht dem Tod, sondern gerade dem Gegenteil. Das mochte der Alte oben falsch aufgefaßt haben.
Nun, er ging auf und ab, tat seine Arbeit und war über das ganze Gedränge unten erhaben. Mit einem Male aber fühlte er sich in seinem Amtsgleichmaß gestört. Die Rampe nämlich zitterte. Der Tod wußte, was es war. Dies geschah immer, wenn ein Starker heraufkam. Der Tod trat an den Abhang und sah hinab.
Er erblickte den Starken sogleich; er hatte das erste Drittel der Rampe bereits überschritten. Der Starke ging bald aufrecht, bald brach er wieder in die Knie. Wenn er aber in die Knie gebrochen war, warf der Starke die Arme weit auseinander und schlug die gekrallten Hände mit den Nägeln in die überaus glatten Planken. Er zerrte, bis es ihm gelang, ein paar Späne loszureißen. Wenn er dann die glatte Oberfläche überwunden hatte, grub der Starke weiter, mit den Nägeln Stückchen auf Stückchen vom Holze losreißend. Sein Blut floß. Aber er gewann eine Vertiefung und einen Halt und richtete sich wieder auf.
Der Tod sah zu; er vergaß alle Anderen über dem Anblick, und er vergaß seine überlegene Amtsmiene. Er fühlte sich nicht wohl. Der Starke arbeitete sich empor, die Vertiefungen mit dem klebenden Blut bezeichneten seinen Weg auf der Rampe. „Ist auch Einer – wird eben auch erledigt“, dachte der Tod. Er dachte es sich gleichsam vor und hätte sich’s am liebsten vorgesagt: er fühlte sich nicht sicher.
Indessen hatten auf der Rampe Einige die Vertiefungen entdeckt, welche der Starke hinterlassen hatte. Sie benützten diese nun für ihr eigenes Weiterkommen als Halt und drängten hinter dem Starken her.
Dieser war schon im letzten Drittel des Weges. Er ging aufrecht, langsam und sicher auf den überaus glatten Planken. Doch schien er müde und wurde es immer mehr. Die breiten Schultern waren vorgeschoben und der Kopf gesenkt über dem tragenden Genick. So kam er auf den Tod zu. Der Tod stand und wußte nicht, wie er sich halten sollte. Konnte er ihn „abtun“?
Mit einem Male aber hörten alle Sterne am weiten Himmel zu blinzeln auf und sahen mit ernsten Augen herab auf den scheidenden Starken und die blutigen Zeichen, die jener hinterlassen hatte. Als der Starke mit wankenden Knien das Ende erreichte, stand der alte Tod demütig und in Achtungstellung wie ein Soldat. Und er bot der müden, ruhesuchenden Hand des Starken seine Schulter zur Stütze.
Schneeschmelze im Hof.
(3. März)
Mit den Jahreszeiten geht es Dir etwa so, wie mit dem Anhören bekannter Musik: da weißt Du zum Beispiel, daß nun gleich eine Melodie auftauchen wird, die Dir besonders nahe steht. Du merkst scharf auf, damit Du den Anfang gleich erfaßt und nicht dann erst erkennst: das ist sie ja!, wenn Deiner Unaufmerksamkeit kostbare Töne schon entgangen sind. Und dann kommt es doch jedesmal so rasch daher und über Dich, gleich bist Du mitten darin und hast den Beginn garnicht recht wahrnehmen können. Und wie rasch geht es nun vorbei! Daß Du’s doch halten, gleich zwei- und dreimal hören könntest!
So ist es mit den Jahreszeiten, mit ihrem Wechsel und Dahingehen, besonders aber mit dem Frühjahr. Wie schwer läßt sich der Anfang erfassen! Nun lauere ich seit Weihnacht auf den Frühlingsbeginn. Und nun ist er da, hat schon eingesetzt, ich war garnicht recht dabei, bei diesem Ereignis. Auch konnte ich es nicht glauben und fragte Jemand, ob es wahr sei. „Ja selbstverständlich – woher soll denn sonst auf ein Mal die Wärme kommen? Merkwürdig! Wie Sie da fragen! Wir haben doch schließlich und endlich schon Anfang März! Da kann es doch schon einmal warm werden!?“
„Gewiß, gewiß“, beeilte ich mich zu sagen, „wir haben schon im höchsten Grade begründeten Anspruch auf Wärme, eigentlich ist es beinahe ein Scandal, daß es nicht schon viel wärmer ist …“
Nun also, heute, am zweiten März, war es offenkundig der nahende Frühling, welcher der Sonne größere Kraft gab, ja dem Winter seinen unerbittlichen Ernst nahm und ihn fast in eine Art Scheinherrschaft verwies. Ich trat zu Mittag aus der Glasveranda und wußte sofort, daß jenes große Geschehniß, auf das ich wartete, nun schon vollendet in der Luft lag. Von heute ab würde kein Mensch mehr den Winter völlig ernst nehmen, und schneite es gleich und fröre es auch jeden Abend. Dies zeigte sich auch deutlich in dem gleichsam harmlosen Benehmen der Menschen, welche sich auf dem Hofraum ergingen. Auf den Turnbarren, welche über den Winter ganz trostlos dagestanden hatten, saß eine Gruppe von lachenden jungen Männern, ja sogar eine schneefreie Bank war besetzt. Ich will nicht von den nässedunklen Wegen reden und von Lachen Wassers da und dort: allzuviel sichtbare und fühlbare Kraft hatte die Sonne noch nicht, es war alles mehr ein Versprechen. Aber in diesem deutlichen Versprechen lag eben jene Kraft, welche dem Winter seine Alleinherrschaft über die Gemüter raubte.
Doch manches war auch wirklich schon getan. Die mächtigen Eiskaskaden an den Dachtraufen schienen erheblich gemindert, es tropfte eben doch schon an allen Ecken und Enden. „Was glauben Sie?“ sagte man mir, „weht bei uns zu Hause schon dieser gewisse warme Wind in den Straßen?“ Ich antwortete zuversichtlich mit „ja“. Ich sagte, daß ich die Überzeugung hege, daß jener „warme Wind“ bei uns zu Hause schon ganz gehörig, ja im höchsten Grade vorhanden sei. Sollte meine freundliche Heimat hinter diesem Deportiertenland zurückstehen? (Hier ist es nämlich mit dem „warmen Wind“ noch recht armselig bestellt. Der Wind ist, gerade heraus gesagt, kalt.)
Eines muß hier noch erwähnt werden. Ich sprach von einem harmlosen Benehmen der Menschen auf dem Hofraum: und dachte dabei an die winterlichen Gestalten der „Spaziergänger aus Gesundheitsrücksichten“. Welche Energie lag in ihren Schritten (sie gingen mit gänzlich überflüssigem Kraftaufwand, der Kälte wegen), wenn sie ihre festgesetzten fünf Runden um das Haus machten! Und welche Vermummungen! Heute zerstreuten sich die Spaziergänger ganz langsam hierhin und dorthin, man sah welche, die stehen blieben, und, wie gesagt, sogar Sitzende gab es. Durchaus nicht mehr das entschlossene Schreiten des winterlichen Hygienikers mit dem von der geradezu heftigen, unanständigen Kälte gespannten Gesicht. (Soweit dieses überhaupt sichtbar getragen werden konnte.) Denn hier giebt es einen Winter! Einen heftigen, bösartigen Winter, ohne die geringste Unterbrechung durch einigermaßen wärmere Tage; nein, hier ist es den ganzen Winter hindurch gleichmäßig und beispiellos kalt. Und ebenso gleichmäßig herrscht dabei eine bedrückende Abundanz an Schnee, Eis und Sturm.
Wieviel bedeutet darum hier das Frühjahr!
(4. März)
Heute morgen – ich lag noch im Halbschlaf – sagte Jemand draußen auf der Veranda: „Wie warm es ist!“ „Ja, das ist schon das Frühjahr“, wurde ihm geantwortet.
Dabei ist heute ein trüber Tag – und doch steht er nicht mehr unter der Knute des Winters. Zwar sind die Wege noch hart gefroren, aber mit der winterlichen Genauigkeit scheint es nun vorbei zu sein. Diese „winterliche Genauigkeit“ herrschte bis jetzt ganz unangetastet. Sie besteht darin, daß der Schnee überall ist und alle Formen makellos nachbildet. Auf jeder Bank im Freien, auf jedem Tisch und auf jedem Fensterbrett lag bis jetzt eine Art Polster mit ganz unnatürlicher Korrektheit aufgebreitet. Jeder Pflock hatte die größtmögliche Haube. Dies alles ist jetzt verwischt, wird ungenau oder verschwindet gar ganz. Um jede Bank, um jeden Tisch entsteht eine Unmenge von kleinen, runden Löchern im Schnee, Tropfen fällt auf Tropfen. Die Eiskaskaden an den Dachtraufen sind nun fast ganz dahin, und unter dem Dachvorsprung ist der Schnee gelöchert wie ein Sieb.
(Abends.)
Es schneit. Der Schnee fällt langsam.
(5. März)
Als ich heute morgen ausging, erkannte ich den neuen Schneemantel gleich an seiner echten Wesenheit: er soll eine Niederlage verhüllen. Unter ihm sieht es ruppig genug aus. Aber es herrscht Kälte, und die Spaziergänger schreiten wieder eifrig rundum.
(22. März)
Die Nässe im Freien nimmt zu, das Wasser steht in großen Pfützen. Am Schnee kann man etwas Eigentümliches beobachten: jede glatte Schneefläche löst sich unter dem Einfluß von Sonne, Wind und Schmelzwasser in eine Unmenge von Zacken auf, die immer flächenweise in einer Richtung stehen.
Im übrigen sieht es auf dem Hofe recht mäßig aus. Der Schnee ist schmutzig, an den Rändern zerfressen und unordentlich. Altes Gerümpel in den Ecken, früher sauber eingeschneit, wird nun sichtbar. Wo aber ein Stückchen trockener Erde bloßliegt, erhält man einen fast – sommerlichen Eindruck. Denn während des eigentlichen Winters gab es hier keine Fußbreite Boden’s, die der Schnee unverhüllt gelassen hätte; daher diese sonderbare Empfindung.
Nun – man bekommt nasse Füße, wenn man spazierengeht, und überdies ein wenig Unrast.
Die Schneeschmelze hier wird noch lange genug dauern. Berge von Eisblöcken, eng gepreßt und ineinander geschmolzen, liegen allenthalben um das Haus. Man hat ja im Winter von Zeit zu Zeit das Dach von Schnee und Eis befreien müssen, um es zu entlasten. Auch rotes Eis giebt es hier in großen Blöcken. Der Grund dieser Rotfärbung ist mir bisher unbekannt geblieben; nur ein geringer Teil des Eises hatte übrigens diese Eigenschaft.
(28. März)
Der Winter ist in voller Auflösung. Jeder Schrittbreit Boden’s im Hof trügt den Fuß und giebt nach. Der Schlitten des Wasserfahrers gleitet im Kot. Man kann kaum mehr gehen, mühsam ist es, einen Weg zu finden. Wohl beherrscht der Schnee noch das Bild; aber er weicht mehr und mehr dem um sich greifenden Chaos von Schmelzwasser und Kot. Alle winterliche Ordnung löst sich mit zunehmender Schnelligkeit auf. Die Wege, ehemals im Schnee ausgeschaufelt, sind keine Wege mehr, sie sind zu Wassergräben geworden. Große Tümpel breiten sich da und dort immer mehr aus, und der Wind spielt mit ihrer Oberfläche und kräuselt sie, während anderwärts noch der weiße Schnee in Flächen liegt. Aber der Schnee ist triefnaß und altersmüde, er fährt nicht mehr stäubend auf vor dem Wind. Und wenn man ihn betritt, giebt er gleich nach, und das Schmelzwasser quillt von allen Seiten durch Schuh und Strumpf. So macht der Schnee aus dem eigenen Nässetod noch eine schwächliche Tücke.
Ja, es ist das Chaos, fortwährend weht der Wind, die Luft ist voll von Tönen. Denn der Wind pfeift nicht mehr herrisch und immer streng und gleichmäßig wie im Winter. Jetzt weht ein anderer Wind: er seufzt und stöhnt, er bittet gleichsam noch. Aber in seiner ganzen Unbeständigkeit und zeitweiligen Zaghaftigkeit ist er doch irgendwie siegesgewiß.
Der Winter bricht in Stücke. Und jetzt wird eine Weile das Nichts herrschen, das Chaos: Kot und Wasser, und beides wird immer ärger werden. Bis eines Tages –
Ja, man hat sich allerdings um die Knospen an den Sträuchern bekümmert; man hat nachgesehen, ob sie nicht schon sichtbar würden an den Astknoten, zu einer Zeit, als noch der Wind scharf pfiff und den stäubenden Schnee längs der Plankenwände trieb –
Und doch wird man eines Tages überrascht gegen die grauen Planken starren; denn da wird ein ganz zartes Grün vor dem Grau liegen, nur ein paar grüne Striche: das wird fast wie eine Friedensbotschaft sein und wird als ein sichtbares Zeichen des beendigten Überganges freundlich im leichteren Luftzug schwanken.
(29. März)
Es sieht hier wahrhaftig aus wie auf einem Schlachtfeld. Der Boden zerrissen, jeder Einheitlichkeit beraubt; nur selten ist ein trockenes Plätzchen zu finden. Alles, was der Schnee unter sich begraben und erdrückt hat, kommt nun wieder an die Sonne: totes Gras, und die gelben Skelette der Sonnenblumen vom vorigen Sommer, die jetzt nackt und dürr im kräftigeren Sonnenschein stehen. Überall liegt Unrat herum, Gerümpel, das man im Winter in den allesverbergenden Schooß des Schnee’s geworfen hat, und das jetzt zu Tage tritt, wie alte Stiefel oder Eisenteile, die am Grunde eines entwässerten Teiches sichtbar werden. Und die unter der Schneelast zerbrochenen Lauben und Spaliere stehen klapprig gegen den blauen, windigen Himmel.
(1. April)
Schritt für Schritt weicht der Schnee; doch ist sein Weiß noch immer die Hauptfarbe. Nur an den Rändern der Schneefläche, von wo aus die Auflösung kommt, ist das Weiß beschmutzt, zerstampft und besudelt. Dort steht der Schnee im Kampf, zieht sich langsam zurück, und in dem Maaße, wie sich seine makellose Einheit und Ordnung aufgelöst hat, läßt er Kot und Wasser hinter sich.
Die Wege, die zwischen den noch erhaltenen Schneeflächen über den Hof führen, werden fast stündlich breiter. Denn Jedermann tritt am Rande eine neue kleine Wegspur in den Schnee, um nicht in der Mitte durch den Kot waten zu müssen.
(2. April)
Spazierengehen im Freien.
Heute hatte ich Gelegenheit, einen Spaziergang außerhalb des Lagers zu machen. Da das Besuchen der Ortschaften verboten ist, so nahm ich meinen Weg gleich in der entgegengesetzten Richtung, gegen die großen Wälder zu. Ich verließ das Lager mit einer erwartungsvollen und freudigen Empfindung, als ginge ich nun einer ganz besonderen und neuen Begebenheit entgegen. Es war das reine Abenteurergefühl; im Grunde glaubte ich bei alledem, mich auf verbotenen Wegen zu befinden. Beim Tor erwartete ich mit Bestimmtheit, angehalten zu werden, und war fast verwundert, als nichts dergleichen geschah, und als ich endlich draußen war, hatte ich das Gefühl, glücklich entwischt zu sein.
Nun schritt ich rasch vorwärts, ich mußte mich von dem Gefangenenlager gleichsam losreißen. Doch nach hundert und zweihundert Schritten wandte ich mich um, mit dem Gefühl, schon zu weit gelaufen zu sein; ja, es schien mir der Gedanke sehr kühn, so weit zu gehen, daß man das Lager nicht mehr erblicken konnte. Unterdessen aber schritt ich immer in bester Laune vorwärts und schwang meinen Stock. Als ich ein gutes Stück vor mir Leute von uns gehen sah, wußte ich, daß dies der richtige und übliche Spazierweg sei, auf dem ich mich befand. Später sagten mir auch Heimkehrende, daß man über die nächsten Höhen und bis zur Bahnlinie gehen könne.
Nun machte ich lange Beine, denn an der Lehne des bewaldeten Hügels gegenüber sah ich wahrhaftig die Spaziergänger hinaufwandern. Während des Gehens hielt ich mir vor, daß dies ja für mich eine völlig neue Gegend sei, daß ich mich zum ersten Male hier auf diesem Wege befände, daß ich meine Augen wohl offen halten müsse – ich hatte vollständig vergessen, daß ich genau diesen selben Weg vor sechzehn Monaten gegangen war, nur in umgekehrter Richtung und unter Eskorte von Kosaken, als wir von Chabarowsk hierhertransportiert worden waren.
So ging ich über das offene Feld und dann hügelab und hügelan durch den lichten Wald, der beiderseits des Weges stand. Überall das Weiß des Schnees als Hintergrund aller Dinge; und überall das helle, mattgelbe Birkengeäst, schon Kätzchen tragend, aber noch kahl. Ich fragte mich, welches Weiß heller sei: das des Schnees oder das der Birkenstämme, die als helle Striche überall leuchteten. Und ich fand, daß die Stämme heller gefärbt waren als der Schnee, wenngleich dessen Farbe reicher und mannigfaltiger, gleichsam lebendiger schien, verglichen mit dem glanzlosen und zarten Birkenbast. Hin und wieder stand eine junge Eiche, die noch ihr ganzes trockenes Laub vom vorigen Herbst trug, zwischen den kahlen Stämmen. Ich kann nicht verstehen, wie jene toten Blätter die Winterstürme überdauern konnten.
Der Schnee ist an der Oberfläche getaut und wieder leicht gefroren. Dünne Eisplatten, wie Marienglas, überdecken ihn. Wo die Sonne scharf auftrifft, giebt es einen Glanz weithin, wie blankes getriebenes Silber. Und im Schatten und Halbschatten liegen die Mulden und Hügel mit mattem, seidigem Glanz, wie gebauschte Atlaspfühle. Denn hier im Freien ist der Winter noch mehr in Kraft als bei uns auf dem Hofe, wo der Schnee täglich von vielen Füßen immer mehr zu Brei getreten wird. Doch scheint die Sonne warm, mein Pelz beschwert mich, ich schlüpfe aus den Ärmeln und hänge ihn über. Ich gehe noch ein paar Schritte und komme auf eine Anhöhe mit weitem Ausblick: dort werfe ich den Pelz auf einen Baumstamm und lasse mich in der Sonne nieder.
Die Landschaft hier hat einen großzügigen und heroischen Charackter. Rechter Hand Hügel und Berge mit fernen dunklen Nadelwäldern und dahinter noch höhere Berge, die schon blau sind vor Ferne, eine blaue Wand, die den Ausblick endet. Es sind jene Höhen, die man auch von unserem Hof aus über die hohe Plankenwand sehen kann. Aber jetzt liegen sie unverdeckt, und ihre Kette erscheint langgestreckter, als man geahnt hat.
Die Wälder wallen gegen die Hügel und Berge zu. An den Flanken der Hügel steigen die zarten Schaaren der Birken empor.
Unten im Tal führt die Bahnlinie, an dem kleinen, roten Stationsgebäude vorbei; sie verschwindet irgendwo im ansteigenden, waldigen Land.
Und linker Hand liegen Ebene, Fluß und Stadt. Alle Entfernungen sind groß, die gelassenen Wellen des Landes ohne Ende.
Ich sitze hier auf dem Baumstamm, unter dem lichtblauen Himmel und zwischen den hellen Birken, während die Sonne mich warm durchdringt. Bauern gehen vorbei, ein Holzschlitten kommt, Buben betteln mir meine Cigarre ab. Bauernburschen versuchen, mit mir zu sprechen; ich schäme mich, nicht auf gut russisch antworten zu können. Die Buben werfen sich mit Schneeballen und ich sehe zu –
Das Beste von alledem aber ist: heute habe ich im Wald, während meine Füße im Schnee standen, einen Schmetterling gesehen: es war ein schöner Admiral.
(7. April)
Das Ende der Schneeschmelze ging mit großer Schnelligkeit vor sich.
Eines Tages stritt schon der graubraune Boden mit dem Schnee um die Beherrschung des Bildes. Dann begann der Schnee im Hofe allenthalben zurückzufliehen, er verlor sein Weiß, wurde grau, schmutzig und unansehnlich. Die aufgetürmtesten Schneewälle verschwanden; sie sanken unglaublich rasch in den Boden: der Hof ist jetzt gleichsam eben geworden. Nur an der Schattenseite des Hauses und da und dort im Schutz und Schatten des hohen Plankenzaunes halten sich noch hartnäckig schmutzigweiße Streifen.
Auch draußen, im freien Land, wird der weiße Hintergrund aller Dinge rasch fortgenommen, und die Schneedecke löst sich in kleine Flecken auf, die von weitem alle ein elliptisches Ansehn haben und den Wald zieren, als erster Schmuck des Vorfrühlings, der noch ohne Blumen ist.
Das Treibhaus.
In den großen Sälen schliefen die Kriegsgefangenen, vierzig und fünfzig in jedem Saale. Durch die hohen, kahlen Fenster fiel das Licht in die Kabinen und auf die Schläfer, die darin lagen. Die Stoff- und Mattenwände standen bleich im Dunkel; und da so viele hier atmeten – leichter und schwerer –, so war es fast, als ob dann und wann ein leises Zittern und welliges Mitschwingen durch die leichten Scheidewände liefe, welche den Schläfer vom Schläfer trennten. Doch ging nicht jenes tiefe und hingegebene Atmen durch die Säle, welches sonst ein Haus mit schlafenden Menschen zur Nachtzeit erfüllt, das Atmen derer, die nach einem wahrhaften Tage einer wahrhaften Nacht in den Armen liegen, ein Atmen, das so brusttief kommt und geht, daß dem einsamen Nachtwandler auf der Straße Wände und Dach des schlafenden Hauses sich mit zu heben und zu senken scheinen. Das Atmen der vielen Schläfer hier war unruhig und oftmals abgesetzt, es klang fast verdrossen.
Im Dunklen, unter der hohen Decke des Saales, hingen still, in nächtlicher Erstarrung, die Gedanken der Gefangenen: alles das, was ihnen am grauen Morgen, während des langen Tages und am traurigen Abend in den Sinn zu kommen pflegte. Diese Gedanken standen nun zur Nachtzeit still über jedem Schläfer, so, wie im Wasser treibende Dinge beim Gefrieren an ihrem jeweiligen Ort festgebannt bleiben. Und wenn einmal Einer erwachte und mit offenen Augen lag, so taute seine erstarrte Gedankenwolke über ihm allmählich auf, und er begann wieder, in seinem Geist dies und jenes hin- und herzuschieben, bis sich seine Augen von Neuem schlossen.
Ein freieres Leben aber führten sie alle im Schlaf mit den Träumen. Denn wenn sie auch gleichsam unter dem Betthimmel ihrer Tagesgedanken träumten, so gaben sich doch hier die Bilder in kräftigeren Farben und folgten einander ganz mutig und entschlossen.
Die meisten der Gefangenen hatten schon zwei Jahre zwischen den Plankenwänden des Lagers verbracht, manche saßen auch schon drei und vier Jahre hier. Und in dieser ganzen Zeit hatte Jeder immer dieselben Erinnerungen mit sich herumgetragen und immer dieselbe Sehnsucht vergebens an dem Plankenzaun des Hofes wundgestoßen; bei Vielen war sie auch schon flügellahm geworden. Es verging kaum ein Tag für einen der Gefangenen, an dem er nicht die Erinnerungstafeln seines früheren Lebens aus dem Gedächtnis hervorgeholt und neu zu bemalen versucht hätte. Keiner ließ im Grunde ganz davon ab, und alle Arbeit und Beschäftigung, die sich Einer etwa machte, ließen immer noch ein paar Augenblicke frei, in denen ein plötzlich erwachtes Bild von ehemals heraufkam und ihm vor Augen trat. Denn zutiefst hielten sie alle die früheren, besseren Zeiten, die sie durchlebt hatten, für die Gewähr einer schöneren Zukunft. So floß ihnen die vor- und rückschauende Sehnsucht in eins zusammen und bildete das Farbenkästchen, mit dem sie ihre graue Gegenwart bemalten. Denn alle glaubten in einem Ausnahmezustand, in der Verbannung zu sein; und sie waren im Grunde der festen Überzeugung, daß sie ein unbestreitbares Anrecht hätten, auch wieder einmal ein schöneres Dasein beschert zu bekommen. So ertrugen sie die Gegenwart. Keiner von ihnen betrachtete sein früheres, schöneres Leben einfach als vergangen und versunken. Vielmehr sah es Jeder als ein Gut an, das er wohl in dieser wilden Zeit nicht genießen konnte, das ihm aber später rechtens wieder zukam. Sie hatten es gleichsam in Verwahrung gegeben, hielten sich aber für vollauf berechtigt, es später (vor dem Richterstuhl des Lebens gleichsam) zurückzufordern. Keiner hätte sich mit dem Gedanken abgefunden, daß das Leben eben nur den ersten Teil ihres Daseins bunt koloriert habe, um dann die farbigen Pinsel zu verwerfen und jetzt und in Hinkunft nur mehr den grauen zu führen.
Indes, am fleißigsten gebrauchten die Gefangenen ihr Farbenkästchen mit den Zukunfts- und Vergangenheitsfarben im Traume; und im Schlaf gelang es ihnen noch immer am besten, ihre Erinnerungstafeln zu bemalen. Denn bei Jenen, die am längsten gesessen hatten, trat dann und wann schon eine Art Farbenmangel ein, wenn sie wachten; ja, es mochte sogar vorkommen, daß die vorhandenen Farben kaum ausreichten, um das Bild der Mutter lebendig genug und befriedigend im Geiste auszumalen; und daß den Gefangenen eine fremde Furcht ankam, gleichsam als hätte er ein Stück seiner selbst irgendwo verloren und an Stelle dessen gähne nun ein schwarzes Loch. Doch im Schlaf ging es noch immer leidlich; und wenn auch die Gestalten der Träume sich mitunter in absonderlicher Weise mit den jetzigen, schon gewohnten Verhältnissen vermischten, so hatten sie doch hinlänglich Leben und Frische.
Bis einmal, als ein böses Anzeichen und als Folge dieses flächenhaften und unwirklichen Lebens, ein Traum zur Nachtzeit durch die schlafenden Säle wandelte; und wen von den Schläfern er berührte:
Dem war es, als stünde er am Krankenbett einer jungen, schönen Frau. Die aber konnte nichts Anderes retten und wieder gesund machen, als der Frühling. Es war aber Winter.
Da beschloß man, ihr einen künstlichen Frühling vorzutäuschen, um ihr Leben zu retten. Während sie schlief, nachts, ward alles vorbereitet.
Und dann war es dem Träumenden, als ginge er aus dem Zimmer, in dem die Kranke lag; er trat hinaus vor das Haus in die Dunkelheit, und da war es mit einem Male sein eigenes Haus, daheim; und sein Nachbar kam im Dunklen auf ihn zu. Da gingen sie beide an die Morgenseite des Hauses, um das Aufgehen der Sonne zu erwarten. Denn bei Sonnenaufgang sollte dann jenes Wunder, dessen die Kranke bedurfte, sichtbar werden und die winterliche Gegend im Schmuck des künstlichen Frühlings prangen. Die Luft war seltsam lau, fast schwül, und ihre Wärme erschien fremdartig für diese Tages- und Jahreszeit – wie in einem geschlossenen und geheitzten Raum. Indessen wurde es grau, und der Träumende sah mit Staunen die dunklen Schattenbilder der Bäume vor dem Hause belaubt. Eine rasche Morgenröte erglomm im Osten. Und nun zeigte sich die Fläche des Gartens allenthalben mit Gras bewachsen. Das Gras war von heftiger, gelbgrüner Farbe, ebenso die ganze Landschaft, die – fast sommerlich begrünt und mit blättergeschmückten Bäumen – nunmehr sich allmählich erhellte. Der Nachbar wies in den Garten: dort tanzten Schmetterlinge über dem Rasen. „Es sind künstliche“, sagte er. Der Träumende wußte es wohl, aber es schmerzte ihn sehr, es eigens noch zu hören. Er wurde traurig und hätte den Nachbar am liebsten gebeten, ihm seine schwache Freude doch zu lassen. Aber er vermochte nicht zu sprechen.
Jetzt ging mit einem Male die Sonne auf über den gewohnten Bergen. Sie war klein und heftig leuchtend, wie ein Stück glühender Holzkohle. Und nun lag das erste morgendliche Rotgold auf dem Rasen – aber es hatte einen düsterroten Schein, wie von Fackeln. Es war nicht das helle, freundliche Gold der wahren Morgensonne. „Es ist eben doch unnatürlich“, sagten die Beiden, der Träumende und sein Nachbar.
Dann wurde es Tag, ein grauer Tag, und sie saßen in einer großen Theaterdecoration. Denn nicht anders sah es um sie aus: das künstliche Gras war trocken und schien wie altes Moos auf dem Boden; und die Blätter an den Bäumen raschelten wie Papier. Die Blumen aber waren richtige, trockene Kunstblumen.
Einen Falter fing der Träumende; der war aus Schreibpapier ausgeschnitten und noch dazu nur an der Oberseite bemalt, mit ein paar farbigen Punkten und Strichen. Ihn legte er der kranken Frau auf die Bettdecke.
So weit träumte der Gefangene; dann verließ ihn der Schlaf, er erwachte und sah in das Dunkel, das über ihm stand, und in den bleichen Schein, der von seitwärts durch die Fenster kam.
KAULQUAPPEN.
(Wassergraben im Hof.)
Neben dem Weg war ein Wassergraben.
In diesem lebte eine Unmenge Kaulquappen. Sie huschten munter herum in dem sonnigen Wasser. Unter ihnen waren kleine, mit runden Bäuchlein und einem lustigen Schwippschwänzlein hinten. Manche waren größer, und es begannen ihnen schon die Hinterbeine zu wachsen.
Alle wollten Frösche werden.
Neben dem Wassergraben lag ein Sportplatz. Auf diesem spielte eine Menge lustiger Leute Faustball und Lawn-Tennis. Sie sprangen und liefen munter herum in der Sonne. Alle wollten aus der Gefangenschaft gesund nach Hause kommen; darum betrieben sie Sport.
Die Sonne trocknete den Wassergraben aus. Schließlich blieben nur ganz kleine Pfützen. In diesen zuckten die Massen aneinandergedrängter Kaulquappen. Die kleinen Pfützen trockneten auch aus. Dann kamen die Fliegen, und von den Kaulquappen blieben nur schwarze Flecke, hier und dort auf dem immer dürrer werdenden Boden, der schon Risse bekam.
Nach zwei Tagen regnete es heftig. Der Graben war wieder voll Wasser. Das Wasser war aber tot und leer.
Früher, bevor die Sonne den Graben ausgetrocknet hatte, war einmal jemand vorbeigegangen, stehengeblieben, hatte sich ein großes Glas geholt und von den lustigen Kaulquappen, die ihm sehr gefielen, ein Dutzend gefangen. Jetzt war er ihrer müde, und da er den Graben wieder voll sah, goß er das Glas mit den Kaulquappen hinein. Sie schwammen munter und mit den Schwänzlein wedelnd durch das Wasser, das ihnen sehr groß vorkam. Sie waren die letzten Überlebenden eines ungeheuren Geschlechtes.
Auf dem Sportplatz neben dem Weg liefen und sprangen die Leute, alte und junge. Es waren die Überlebenden eines Riesenheeres, das tot lag.
Der Abschied.
Es wird der Tag kommen, an dem wir diesen Ort verlassen werden. Zum letzten Male über den Hof schreitend, dem Ausgang zu, wird unser Blick ausgreifen mit dem angstvollen Bestreben, noch ein Mal dieses ganze Stück Leben, das uns hier zwischen den Plankenwänden liegt, zu umfassen. Und angesichts der Unwiederbringlichkeit alles dessen – die uns hier, als an einem sichtbaren Abschnitt, bewußt wird –, angesichts dieser Unwiederbringlichkeit wird unser Gewissen dem Geist zu dieser Stunde jede Vorschau verbieten. Und wir werden uns zurückwenden müssen, wie gerne auch unser Sinn in der Spielstube der Zukunft tändeln möchte.
Wir werden Abreisende sein, die sich zum letzten Male umsehen, ob sie nichts vergessen haben. Wir werden gehen und wissen, daß wir Vieles vergessen haben. Unser Gewissen und das Bewußtsein unserer Fahrlässigkeit wird uns auf immer mit diesen Jahren und mit diesem Ort verknüpfen. Nur die Lumpen, die ihrer selbst und Gottes nicht achten, werden beides leichthin hinter sich werfen, weil es einen unschönen Titel hat: Kriegsgefangenschaft.
(Zwei Grotesken.)
SLOBEDEFF.
Der dritte Sommermonat, den er hier im Hotel verbrachte, fand ihn noch immer ohne jedwede Ansprache oder Bekanntschaft. Denn einerseits war die hauptsächlichste und vorwiegendste Empfindung, die Slobedeff seinen Mitmenschen gegenüber immer hatte, jene: daß er sich behelligt fühlte. Anderseits war sein Äußeres finster und unschön, zog niemanden an und schien das geeignetste Kleid für eine Seele, die allein zu bleiben wünscht: Slobedeff verbrachte seine Zeit abseits der Gesellschaftsräume und der begangenen Spazierwege – wenn er arbeiten konnte. Slobedeff war glücklich, denn er konnte es diesmal fast den ganzen Sommer hindurch. Je mehr er besaß, desto weniger bedurfte er. Notenheft und Zigarren genügten, der Stoß fertiger Partituren wuchs, ihm zur Freude, im Koffer.
Dies alles ging aber nicht kampflos ab; und wie hätte es anders sein können. Slobedeff hatte sich selbst gleichsam dauernd beim Genick gepackt und schüttelte sich haßerfüllt, wenn er gewisse Dinge bemerkte, die sich dann und wann hervorwagten: Flüchtigkeiten bei der Arbeit oder Grillen bei der Rast, die ihn untüchtig hätten machen können. Solche Gefechte nun lärmten dann und wann in seinem Innern. Sie wirbelten gleichsam Staubwolken auf, aus denen er sich wieder zum klaren Blick herausarbeiten mußte. Diese Inanspruchnahme seiner selbst nun hatte eines zur Folge (was Slobedeff indessen kaum beachtete): er verlor das übliche Verhältnis zur Umgebung völlig, umsomehr, da er ja seit seinem Aufenthalte hier im Hotel kaum eine Verbindung mit seinen Nebenmenschen gehabt hatte. Slobedeff aber war seine Umgebung nun noch fremder geworden, als am Tage seiner Ankunft – was die Menschen betraf. Wenn er im Speisesaal mit ihnen zusammenkam und sich unter ihnen bewegen mußte, fühlte sich Slobedeff gleichsam abgerückt von allen. Er konnte nicht teilhaben an ihren Reden, ihren Bewegungen und ihrem Lachen, dies alles schien ihm fremd, und er fühlte mit Keinem eine Gemeinsamkeit, die ihn angeschlossen und verbunden hätte. Er war getrennt von ihnen. Alles, was über das Essen hinausging, störte ihn, und er empfand es als aufgezwungen. Das Anstandsgespräch mit den Tischnachbarn führte Slobedeff, was Redewendung, Geste und Meinung betraf, gleichsam mit erborgtem, fremdem Werkzeug, und am Beginn desselben mußte er immer zwischen sich und dem Nachbar eine Brücke aus den vermutlichen Interessen des Anderen bauen. Er fühlte deutlich, daß garnicht Slobedeff da lachte und sprach oder dieser und jener Meinung war: vielmehr Slobedeff selbst war ganz still, hatte sich dies alles nur irgendwo zum Gebrauch ausgeliehen und ließ es jetzt spielen. Aber es war ihm doch nicht ganz wohl dabei, und er empfand etwas wie Scham darüber, etwa die Scham über einen Zwang, den er sich auferlegen ließ. So lebte Slobedeff hier nicht in einer Umgebung, sondern vielmehr neben derselben her. Und da er eben in keiner Weise in seiner Umgebung enthalten war, so war kein Leben zwischen Slobedeff selbst und ihr, sondern ein toter Raum. Bewegung und Leben der Umwelt gewannen solchermaßen für Slobedeff eigentümlich bildhaften Charackter und, abgerückt, wie er von alledem war, sah er es auch als Bild. Doch die rein äußerliche Wechselwirkung, die eben immer noch da war, störte dabei, denn sie bestand seitens der Umgebung in nichts Anderem als in den conventionellen Ansprüchen, die jene an Slobedeff stellte, seinerseits wieder nur darin, daß er diesen Ansprüchen in üblicher Weise Genüge tat; dies alles aber hatte mit ihm selbst nichts zu tun, konnte also nicht beleben, noch erfreuen.
Aus alledem erwuchs Slobedeff dann und wann eine Empfindung: die der Einsamkeit und des im Grunde völlig Verlassenseins. Dies brachte ihm sein in der eigenen Brust verschlossenes Leben, das abends beim Einschlafen voll Angst, oder in der Dämmerstunde voll Wehmut danach verlangen konnte, hervorzubrechen, um ein Widerspiel zu finden: in den bewegteren Zügen eines Anderen, oder nur in einem Zucken der Hand und im schnelleren Gehen des Atems. Aber da war Niemand, der ihm einen Menschen entgegengebracht hätte. Sie konnten es wohl alle nicht mehr, und sie waren untereinander auf das Kleingeldgeben und Kleingeldnehmen des täglichen Verkehres eingestellt.
Indessen befiel Slobedeff solche Beklemmung nicht allzuoft; nur bei den Abschnitten seiner Arbeit, nach der Vollendung, wenn eine leicht verwundbare Wehmut ihn erfüllte, in der Vieles noch nachklingen konnte, aber gemäßigt und ausgeglichen, sanft wie das Abendrot über dem pflugverlassenen Acker: in solcher Stimmung hätte er eines zweiten Menschen bedurft.
In den letzten Tagen hatte Slobedeff an einem Streichquartett gearbeitet. Er pflegte im Wald zu schreiben, an einer Stelle, die, etwa eine halbe Stunde vom Hotel entfernt, abseits der Wege und einsam lag. Nun, da seine Arbeit vollendet war, ging Slobedeff auf der kleinen Waldlichtung hin und wider und überlas die vierstimmige Partitur. Indes klang die Glocke zum Abendessen vom Hotel her. Zwischen den Bäumen lag Dämmerung; sie schob sich an den Stämmen empor gegen die Wipfel, die noch licht vorm lichteren Himmel standen. Slobedeff ging durch den Wald, achtete auf nichts, hörte vielmehr noch immer Harpeggien des Violoncellos, mit denen es, von den Geigenstimmen gleichsam selbst angeregt, diese begleitete. Dies alles schwoll nun wieder in ihm an und drängte sich gleichsam. Mittlerweile erreichte er den Waldrand und die noch stark belebte Kurpromenade. Auf der anderen Seite des breiten Weges lag sein Hotel. Während Slobedeff die Promenade überschritt, erfüllt wie er war, empfand er im Gehen zwischen den vielen Menschen etwas wie mangelndes Gleichgewicht und befürchtete fast, an Jemand anzurennen. Er gelangte endlich mit Hast auf sein Zimmer und zog sich für das Abendessen um. –
Als Slobedeff im Gesellschaftsanzug den Saal betrat, hatte das Essen schon eine Weile gedauert; eben kamen die Kellner mit neuen Platten herein, während ein Piccolo mit gebrauchten Tellern und Bestecken an Slobedeff vorbeieilte. Slobedeff ging, an der langen Tafel entlang, auf seinen Platz zu, vorbei an den Rücken der Essenden. Von der anderen Seite des Tisches sahen einige der ihm zugekehrten Gesichter auf, um augenblicks den enttäuschten Blick wieder zu senken. Slobedeff erreichte seinen Platz. Er grüßte zerstreut seinen Nachbarn zur Linken und eine junge Hannöveranerin, die rechts von ihm saß. Der Kellner kam, eben mit der Platte, Slobedeff bediente sich und begann ohne sonderlichen Appetitt zu essen. Das viele Licht im Saal belästigte und verwirrte ihn. „Sie waren weit spazieren – was?“ fragte der junge Mann rechts. Er sprach mit Slobedeff immer französisch, obwohl dieser gut deutsch konnte und ihm anfangs auch deutsch geantwortet hatte. Die französische Sprache aber galt hier mehr der jungen Hannöveranerin, welche daraus die Weltgewandtheit des Sprechers im Verkehr mit dem „Russen“ ersehen sollte. „Ja“, sagte Slobedeff, „ich habe mich verlaufen. Ich bin sehr ermüdet.“ Gleichzeitig servierte ihm ein Kellner die Vorspeise nach; Slobedeff saß zerstreut vor den beiden Gerichten. Die Bestecke klapperten in das summende Redegetön der langen Tafel. Slobedeff hatte mit einem Male den Wunsch, allein zu sein, um essen zu können. „Warum setzen sich die Leute bei Tisch zusammen?“ ging es ihm durch den Kopf. „Immer vom Teller zum Mund, vom Teller zum Mund. Jeder führt in das Loch im Gesicht ein, soviel er braucht. Eigentlich unschön – aber man setzt sich eigens dabei zusammen. Das ist ja doch – tierisch.“ Ihm gegenüber gebrauchte jemand das Messer als Löffel. Es ging ihm augenblicks scharf durch den Kopf, daß alle diese Leute nur durch die Convention zusammengehalten und gebändigt seien. „Wenn sie wegfällt –?“ dachte Slobedeff. Mit einem Male erinnerte er sich an seine Knabenzeit – und dabei an irgendwelche Augen von Tieren. „Ja – im Teich, dort in dem Teich, wo ich immer am Rand gespielt habe – der Frosch und der Krebs, die einmal ganz einträchtiglich nebeneinander gesessen sind. Ja – ich habe mich gewundert damals, daß sie sich nicht ekeln und fürchten, Einer vor dem Anderen. Den Krebs, ja, den habe ich gefangen damals; und die Augen – so starr und eng, eben von einem Tier.“ Er sah auf. Ihm gegenüber ging es vom Teller zum Mund, vom Teller zum Mund. Und dann sah er die Augen der Menschen. Da erkannte Slobedeff, daß er völlig allein sei: unerbittlich allein.
In diesem Augenblick, als er die aufsteigende Angst schon nicht mehr eindämmen konnte, schoben zwei Kellner die gläsernen Türen zur Terasse zurück. Mit der lauwarmen Luftwelle, die hereinschlug, sank das summende Redegetön an der langen Tafel herab, einen Augenblick herrschte verhältnismäßige Stille. Die Essenden gegenüber von Slobedeff wandten die Köpfe der wohltuenden Luftwelle zu. Mit dieser eingetretenen Stille aber brach über Slobedeff das Entsetzen herein. Denn ohne daß er es wußte, hatte das fortgesetzte Reden der Anderen noch beruhigend auf ihn gewirkt. Nun schwiegen sie, nun war es mit einem Male still. „Um Gottes Willen, um Gottes Willen“, dachte Slobedeff immer wieder, „wenn Einer jetzt zu mir hersieht und – sich bewegt dabei – nein, nein – das war der Tod – nicht weiter –“
Er schrie gellend auf, fuhr herum und packte seinen Nachbar am Rockaufschlag. Und während Slobedeff zerrte und rüttelte, kreischte er in einem fort: „Reden Sie – sagen Sie – bitte, bitte – um Gottes Willen – reden –“, er fühlte, wie er fiel. Während Slobedeff, der sich halb erhoben hatte, samt dem Stuhl hintenüber schlug, sah er die Kellner mit den weißen Hemdausschnitten von allen Seiten auf sich zu kommen. –
Man brachte Slobedeff auf sein Zimmer. Er erholte sich, packte, verließ fluchtartig das Hotel und nahm den Nachtzug.
DER BRANDSTUHL.
(A. Kunft)
(I.)
Es muß zugegeben werden, daß sowohl Franziska als ich an diesem Abend betrunken waren.
Als dem Klavierspieler die Hände von der Tastatur herunterfielen und er mit herabhängenden Armen vor dem Piano saß, während die Schweißtropfen ganz still über seine Stirn kullerten, mußten wir mit dem Tanzen aufhören. Wir blieben aber noch in der Mitte des kleinen Raumes stehen und machten einige sehr unentschlossene Bewegungen, die aber schon nichts mehr von Tanz an sich hatten und sich infolge des plötzlichen Aussetzens der Musik eher matt und dösig ausnahmen. Um es aufrichtiger zu sagen: wir standen uns gegenüber, hielten uns bei den Armen und schwankten ein wenig hin und her, und das war eigentlich alles. Denn nach ein paar Augenblicken gab mir Franziska einen mäßigen Rippenstoß, drehte mich in der Richtung der Bar und erteilte mir in energischer Weise den Befehl, mich auf einen der hohen Hocker zu setzen. Ich erkannte augenblicks die Gefährlichkeit dieses Unternehmens und blieb in hilfloser Unentschlossenheit am Fuß des Gestelles stehn. Dabei fühlte ich, daß die ganze Welt um mich etwas sozusagen Schwebendes angenommen hatte, und ich befand mich dabei tatsächlich in einer so unsicheren Verfassung, daß ich beispielsweise gewiß nicht im Stande gewesen wäre, mich selbst beim Kopf zu packen. Ich sah aber jetzt plötzlich, daß Franziska schon oben auf einem der Hocker saß in ihrem grünen Kleid, mitten drin in der Weißflut der elektrischen Glühbirnen. Dieser Anblick wirkte zwingend auf mich, und ich begann jetzt, ohne Besinnen das vor mir stehende Gestell zu erklettern und gelangte in wunderbarer Weise und ohne Unfall hinauf und saß jetzt neben Franziska. Zugleich fand ich einen herrlichen Halt an der breiten Brüstung des Schanktisches; und dadurch ermutigt ergriff ich ein Glas, das vor mir stand und eine rötliche Flüssigkeit enthielt. Ich trank alles aus. Die Eiseskälte in Kehle und Magen empfand ich sehr angenehm, und sie schien mir sonderbarer Weise einen wohltuenden Gegensatz zu der grellen Lichtflut rings um mich zu bilden; diese ermüdete mich schrecklich. Auch waren meine Füße heiß vom Tanzen in den Lackschuhen und schmertzten mich. Jetzt, während ich saß, schien die Hitze immer mehr gegen die Fußspitzen hinabzusinken und sich dort förmlich zu verdichten. Ich glaubte einen Augenblick lang, daß man unter meinem Sitzgestell ein Feuer entzündet habe, und sah tatsächlich hinunter. „Was suchst Du denn? Trinke doch“, sagte Franziska, und ich nahm das Glas, das sich inzwischen wieder gefüllt hatte, und trank alles aus. Meine ganze Umgebung kam dabei in’s Schwanken. Franziska’s Sitzgestell schien seine Höhe fortgesetzt zu verändern, zog sich in die Länge und schrumpfte wieder ein, als ob es von Kautschuk wäre. Bald saß sie hoch über mir, bald in gleicher Höhe mit mir, und dann wuchs der Hocker wieder empor, und ich konnte sie kaum mehr sehen. Jetzt, mit einem Male, fiel mir ein, warum meine Füße so sehr heiß waren, und daß dies nicht allein vom Tanzen herrührte. Ich hatte es ja vorhin gesehen, daß der Heizkörper der Warmwasserleitung unten am Schanktische entlanglief, ich hatte also meine Fußsohlen gerade darüber. Während ich mich noch herzlich über meine Klugheit freute, sagte Franziska wieder: „Trinke. Wenn die Anderen wissen würden, daß ich mich hier allein mit Dir herumtreibe, würden sie mich wahrscheinlich am liebsten aufhängen.“ „Aufhängen –?“ sagte ich und wurde plötzlich sehr ernst und zugleich von wirklicher Angst erfüllt. Denn Franziska saß jetzt wieder ganz hoch oben über mir, und es wäre entsetzlich gewesen, wenn man sie dort oben aufgehängt hätte. Man hätte die Schlinge nur am Kronleuchter festmachen und das hohe Sitzgestell umstürzen müssen, und sie wäre dann dort oben gependelt, jedenfalls rettungslos und ganz hilflos. Oder, wenn der Strick gerissen wäre – beispielsweise, mit den Füßen gerade auf die heiße Röhre unten zu fallen, das wäre auch fürchterlich genug gewesen …
„Trinke“, sagte Franziska noch einmal, und ich griff jetzt nach dem Glas und trank alles aus, während ich die grellweiße Lichtflut der elektrischen Lampen geradezu drückend auf meiner Schädeldecke spürte.
(II.)
Ich gelangte nach Hause, da es mir glückte, in eine Automobildroschke zu steigen. Ich kam schließlich auch in mein Zimmer und stand dort in der Mitte unter der Lampe, während meine Möbel mich nüchtern anblickten. Mein Gesichtsausdruck muß dabei ein äußerst ungläubiger gewesen sein. Heute erscheint es mir als ein sehr glücklicher Zufall, daß ich damals unter der Türe im Vorbeigehen den Schalter des elektrischen Lichtes gleich gefunden habe. So befand ich mich wenigstens in einem erleuchteten Raum.
Dadurch nämlich konnte ich gleich mein Bett sehen, wie es breit dort stand, und ich wurde von Weiterem abgehalten und meine Einrichtung vor Schaden bewahrt. Denn ich ging sofort geradewegs auf das Bett zu und ließ mich fallen. Ich lag also und klappte mit den Augendeckeln und dachte daran, daß ich das Licht abdrehen müsse, um zu schlafen. Es fielen mir aber die Augen zu, und ich ließ sie geschlossen und tröstete mich damit, daß man ja dem grellen Licht auch durch ein kaltes Getränk abhelfen könne. Während ich aber durch den Garderobegang der Bar und an den vielen dort hängenden Mänteln vorbei lief, um ein solches Getränk zu holen, merkte ich, daß ich ja noch immer im Bett lag, und zwar mit geschlossenen Augen, und daß das Licht brannte. Ich konnte aber die Augen nicht öffnen. Irgend jemand sagte mir jetzt, daß diese Mäntel hier den Henkern gehörten und daß man es der Franziska schon zeigen würde, was es hieße, sich so allein mit mir herumzutreiben. Ich erschrack fürchterlich, denn ich dachte daran, wie sehr mein kaltes Getränk dem Kronleuchter schaden könnte, so daß er am Ende abbrechen würde; und Franziska würde herunterstürzen und vielleicht gerade auf den glühend heißen Heizkörper. Ich eilte also, von der Angst getrieben, so schnell ich eben konnte durch die langen Gänge, an deren Wänden endlose Reihen von Mänteln hingen. Wie viele Henker mußten da an der Arbeit sein!
Endlich stürtzte ich auf den Balkon hinaus und mußte mich an der Brüstung anklammern, um nicht zusammenzubrechen. Denn was ich sah, erregte mir das grausamste Entsetzen, und ich hätte mich nicht lebend in die Lage hineindenken können, in der sich Franziska (ich erkannte sie deutlich) hier befand:
In der Mitte des von greller Sonne überfluteten Marktplatzes hatte man einen Sessel aufgestellt. Aber was für einen Sessel! Einen Sessel von wahnwitziger Höhe, so hoch wie ein Fabricksschornstein oder noch höher. Und dabei hatte dieser Sessel vier nadeldünne Beine, die noch dazu ganz nahe bei einander standen, so daß ich nicht begreifen konnte, wie sich dieses riesenhaft hohe, dünne Gestell überhaupt im Gleichgewicht hielt. Und ganz oben, hoch in der Luft, auf dem Sitz, der ohne Lehne war und nur aus einer kleinen runden Platte bestand, war Franziska angebunden, splitternackt; sie krümmte und wand sich dort oben wie eine weiße Raupe an der Spitze einer langen, dunklen Nadel.
Wäre nun mein Blick in der Erstarrung und an Franziska hängen geblieben, so wäre es besser gewesen. So aber löste sich nach einer Weile die Steifheit meines ganzen Körpers, und während ich ein wenig zu zittern begann, senkte ich meine Augen, und mein Blick fiel hinunter auf den Marktplatz.
Dabei wäre ich um ein Haar durch das völlige Aussetzen meines Herzschlages um’s Leben gekommen; wenigstens scheint es mir heute so.