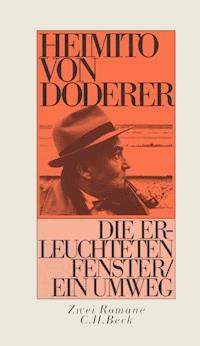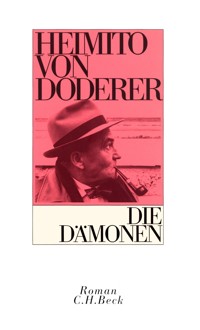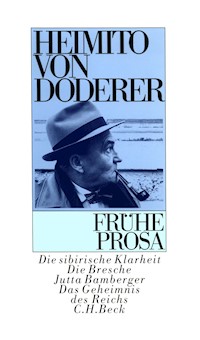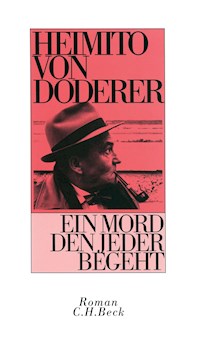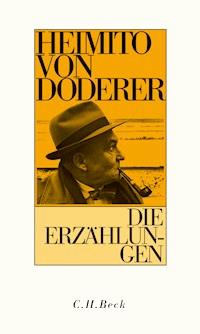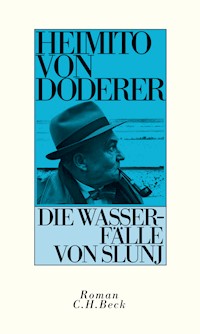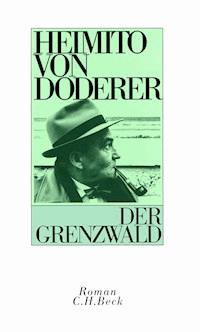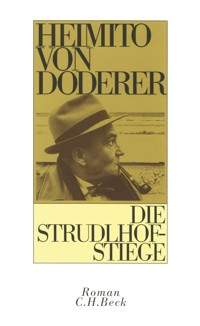
18,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: C. H. Beck
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Wien in den Jahren 1910/11 und 1923 bis 1925. Im Mittelpunkt des Geschehens steht der Amtsrat und Major a. D. Melzer, dessen Leben irgendwie immer an ihm vorbeiläuft, bis er endlich doch zu sich selbst findet. "Die Strudlhofstiege" ist Heimito von Doderers bekanntestes und beliebtestes Werk. Mit diesem vielschichtigen, von souveränem Humor erfüllten "Roman einer Epoche" hat sich Doderer einen unbestrittenen Platz in der deutschen Literatur geschaffen. Doderers wahrhaftig phänomenaler Roman ist mehr als eine minutiös echte, bezaubernde und sublim-amüsante Schilderung der vielschichtigen Wiener Gesellschaft jener Jahre. "Die Strudlhofstiege" ist ein raffinierter, psychologischer, durch und durch moderner Roman. Doderer erweist sich als geradezu virtuoser Regisseur seiner so zahlreichen Akteure; wie er sie immer wieder zur symbolisch-schicksalhaften Strudlhofstiege zu lotsen weiß, ist eine kompositionelle Meisterleistung. Dazu kommt Doderers köstliche Sprache.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
HEIMITO VON DODERER
Die Strudlhofstiege
oder Melzer und die Tiefe der Jahre
Roman
VERLAG C. H. BECK
ZUM BUCH
Wien in den Jahren 1910/11 und 1923 bis 1925. Im Mittelpunkt des Geschehens steht der Amtsrat und Major a. D. Melzer, dessen Leben irgendwie immer an ihm vorbeiläuft, bis er endlich doch zu sich selbst findet. Die Strudlhofstiege ist Heimito von Doderers bekanntestes und beliebtestes Werk. Mit diesem vielschichtigen, von souveränem Humor erfüllten „Roman einer Epoche“ hat sich Doderer einen unbestrittenen Platz in der deutschen Literatur geschaffen. Doderers wahrhaftig phänomenaler Roman ist mehr als eine minutiös echte, bezaubernde und sublim-amüsante Schilderung der vielschichtigen Wiener Gesellschaft jener Jahre. Die Strudlhofstiege ist ein raffinierter, psychologischer, durch und durch moderner Roman. Doderer erweist sich als geradezu virtuoser Regisseur seiner so zahlreichen Akteure; wie er sie immer wieder zur symbolisch-schicksalhaften Strudlhofstiege zu lotsen weiß, ist eine kompositionelle Meisterleistung.
ÜBER DEN AUTOR
Heimito von Doderer (1896–1966) gilt seit der Veröffentlichung seiner beiden großen Wiener Romane Die Strudlhofstiege (1951) und Die Dämonen (1956) als einer der bedeutendsten österreichischen Schriftsteller des 20. Jahrhunderts.
«Doderer ist ein ganz erstaunlicher Schriftsteller. Sehr berühmt und doch immer noch zu entdecken.»
Daniel Kehlmann
«Rätselhaft, daß wir es uns leisten, über diesen großen Autor hinwegzugehen.»
Walter Kempowski
INHALT
AUF DIE STRUDLHOFSTIEGE ZU WIEN
ERSTER TEIL
ZWEITER TEIL
DRITTER TEIL
VIERTER TEIL
Fußnoten
IN MEMORIAM
JOHANNIS TH. JÆGER
SENATORIS VIENNENSIS
QUI SCALAM CONSTRUXIT
CUIUS NOMEN LIBELLO
INSCRIBITUR
AUF DIE STRUDLHOFSTIEGE ZU WIEN
Wenn die Blätter auf den Stufen liegen
herbstlich atmet aus den alten Stiegen
was vor Zeiten über sie gegangen.
Mond darin sich zweie dicht umfangen
hielten, leichte Schuh und schwere Tritte,
die bemooste Vase in der Mitte
überdauert Jahre zwischen Kriegen.
Viel ist hingesunken uns zur Trauer
und das Schöne zeigt die kleinste Dauer.
ERSTER TEIL
Als Mary K.s Gatte noch lebte, Oskar hieß er, und sie selbst noch auf zwei sehr schönen Beinen ging (das rechte hat ihr, unweit ihrer Wohnung, am 21. September 1925 die Straßenbahn über dem Knie abgefahren), tauchte ein gewisser Doktor Negria auf, ein junger rumänischer Arzt, der hier zu Wien an der berühmten Fakultät sich fortbildete und im Allgemeinen Krankenhaus seine Jahre machte. Solche Rumänen und Bulgaren hat es zu Wien immer gegeben, meist im Umkreise der Universität oder der Musik-Akademie. Man war sie gewohnt: ihre Art zu sprechen, die immer mehr mit dem Österreichischen sich durchsetzte, ihre dicken Haarwirbel über der Stirn, ihre Gewohnheit, stets in den besten Villenvierteln zu wohnen, denn alle diese jungen Herren aus Bukarest oder Sofia waren wohlhabend oder hatten wohlhabende Väter. Sie blieben durchaus Fremde (denen aus der Heimat andauernd ungeheure Pakete mit ihren nationalen Leckerbissen zugingen), nicht so konsolidiert fremd wie die Norddeutschen zwar, sondern mehr eine sozusagen hiesige Einrichtung, dennoch eben ‚Balkaneser‘, weil auch bei ihnen sich das Spezifische ihres Sprechtones nie ganz verlor. Damen in Wien, welche ein oder zwei Zimmer ihrer Wohnung oder ihrer Villa zu vermieten gedachten, suchten sich dazu einen ‚bulgarischen oder rumänischen Studenten‘ und wurden dann von diesen untereinander weiterempfohlen. Denn in den zahlreichen Cafés um die Universität oder um die Kliniken herum bestand ein connationaler Zusammenhang.
Der Doktor Negria nahm Anstoß an Marys Ehe. Er konnte nicht glauben, er vermochte es einfach nicht zu glauben, daß Marys Gattinnentreue zulängliche Grundlagen habe, er ärgerte sich maßlos über diese Treue, und dieser Ärger war mindestens gleichzeitig da mit dem ersten Affekte der Begehrlichkeit. (Der Schriftsteller Kajetan von S. hätte hier zweifellos geschrieben „er begehrte sie aus abgründiger Bosheit“ – und bei Leuten seiner Art mag es ja solche im Grunde harmlose, auf groteske Manier zurechtfrisierte Dummheiten wirklich geben.) Das Verflixte bei dem Angelhaken, den der Doktor Negria verschluckt hatte, war jedoch, daß jene untadelige Frau keineswegs unbewußt eine treue Frau war. Sie war zu wenig einfältig, ihrem Herzen waren schon in der Mädchenzeit – während welcher sie durchaus als Frau fühlte, schon mit vierzehn – verschiedene Falten bewußt geworden, und so hatte sie sich denn später auf jener Ebene entfaltet und reifend geglättet, welche zuständig wird für alle, die ihre Lebensbahn nicht zwischen fugenlosen Mauern der Unschuld wandeln, eine Straße ohne Ausblick wie die vom alten Athen zum Piräus. Mary ist aber unberührt in die Ehe mit ihrem Oskar getreten. Andererseits, wenn sie hier treu war, so blieb es auch nicht deshalb dabei, weil ein stabiler Gleichgewichtszustand bei ihr entstanden wäre aus einer Art von unwiderruflicher Entscheidung und gewissermaßen Bekehrung zu ihren Aufgaben als Gattin und Mutter, als Mutter eines hübschen Kinderpaares, Mädel und Bub, jenes rötlichblond nach dem Vater, dieser dunkel-tizianrot wie sie selbst.
Zwischen den angedeuteten Grundlinien stellte sich die Sache dem Doktor Negria (nicht der Frau Mary) dar, und die Konstruktion, welche er da einem sich darbietenden Sachverhalt unterschob, stimmte im großen und ganzen. Auf diesem untergezogenen Rost – der aber am unentschiedenen Dahinleben des Gegenstandes durchaus nichts zu ändern vermochte – briet er seinen Ärger.
Es gibt eine Treue, die nichts anderes ist als Habsucht in Bezug auf Qualitäten, Qualitäts-Geiz, der, was er an Besitz-Titeln hat, an sich halten will. Eine solche Treue von gewissermaßen nur meritorischer Natur – aber meritum heißt auch das Verdienst – bildet ein bequemes Stieglein zur Hoffart und man gewöhnt sich daran, gerne da hinauf zu treten wie an einen Fensterplatz im Erker, von wo aus man auf die gewöhnlichen Straßenpassanten herabblicken kann. Eine solche Treue ist nicht stabil im Gleichgewicht und verdient eigentlich nicht ihren Namen, sie meritiert ihn nicht, eben weil sie nur meritorisch ist, aber sie wird unter Umständen sehr schwer aufgegeben, und wenn diese Umstände als unsichtbare Mauern, die aber gleichwohl den Ausblick verengen, als lange Mauern durch die Jahre den Weg begleiten, dann bleibt es beim gedachten meritum.
Das brachte den Doktor Negria auf, und hier zum Durchbruche zu gelangen – er war durchaus immer ein Durch-Brecher – wurde ihm zum Vorsatz, den er ohne jede kritische Erwägung fest in sich einbaute. Eine fordernde, eine postulierende, eine fuchtelnde Natur, ein Interventionist, Einer, der kurz beiseite zu schieben versuchte, was ihn störte und empört als unerhört empfand, was ihn bremsen wollte.
Mit jenem ‚Interventionismus‘ hängt es zusammen, daß der Name des Doktors später in einem nah benachbarten Kreise sozusagen sprichwörtlich oder schlagwörtlich wurde – und so ist es zu jener ‚Organisation Negria‘ gekommen, welche ihre Taten am Ende mit der Aktion gegen den Berliner Auto-Vertreter Helmut Biese gekrönt hat (aber das gehört nun wirklich nicht hierher!), letzteres unter der Leitung Höpfners, eines Reklame-Dichters oder Versifikators, der Mary K.s rumänischen Adorateur übrigens noch persönlich gekannt hat. Und wen hat Höpfner nicht gekannt? Er war ein Adreßbuch, eine komplette geschäftlich-gesellschaftliche Topographie von Wien (eine seiner mit dem Rittmeister von Eulenfeld gemeinsamen Eigenschaften). Zur kritischen Zeit hat der Doktor Negria einmal bei Höpfner oben – mit kurzem Zugriff von Zeit zu Zeit ein Glas Sliwowitz leerend (dazwischen lief er aufgeregt im Zimmer herum) – geäußert: „Daß diese Spinne sie eingefangen hat, ist eine für mich unerträgliche Vorstellung.“ Die ‚Spinne‘ war Oskar, Marys Gatte. Manchmal nannte er ihn auch ‚Die Zecke Oskar‘.
Seine Verbindung mit der Familie K. war auf einem der Tennisplätze im josephinisch-blassen Augarten entstanden und weiterhin durch die Kinderkrankheiten des Mäderls und des Buben eine häuslichere geworden; Negria befand sich am Allgemeinen Krankenhause in einer solchen Abteilung und wollte selbst merkwürdigerweise durchaus nur Kinderarzt werden. Bei seinem berühmten Chef stand der Rumäne in Ansehen und Schätzung, so daß jener sogar einmal zu Frau Mary hinaufkam, um die Kleinen in ihrem Krankenzimmer zu besichtigen. Von da ab erschien Negria dann besuchsweise. Sein Klingeln klang kurz und scharf, als schlüge man eine Scheibe ein oder als würde man aus dem Elf-Meter-Raum einen Fußball hart ins Tor schießen.
Mary war beim Teetisch gesessen, den Blick draußen in der kaum beginnenden Dämmerung eines Nachsommer-Abends. Man sah hier eine Gasse entlang und dann über den Donau-Kanal (der kein Kanal ist, sondern ein erheblicher, breiter und tiefer, rasch fließender Teil des Stromes) hinüber ans andere Ufer. Von der Straße kam das Rufen der Buben beim Spiel bis hier herauf in den dritten Stock, ein allabendliches Geräusch, das durch den ganzen Sommer geleitete, soweit man ihn nicht in Pörtschach oder Millstatt verbracht hatte, ein Geräusch, das am Abend nach der Rückkehr vom Lande einen begrüßte als ein verläßlich dagebliebenes, zur Jahreszeit gehöriges, und das jetzt noch durch Wochen anhielt, denn es blieb warm, wenn auch gemäßigter: das beste Tenniswetter, wie Oskar sagte, der ‚Indianersommer‘. Oskar wird in einer halben Stunde kommen. Sie denkt plötzlich an den Leutnant Melzer. Daß er recht dumm war, wußte sie damals als ganz junges Mädchen genau. Es war in Ischl gewesen, muß der Sommer 1908 oder 1909 gewesen sein, um diese Zeit war irgendeine politische Spannung mit Serbien. Daß der Leutnant Melzer sich aber, mitsamt seiner Dummheit, ihr am Ende entzog, hatte gewissermaßen diese Dummheit und damit ihre eigene Überlegenheit wieder aufgehoben, wenngleich sie gar nicht ahnungslos war in bezug auf die Hintergründe seines Rückzuges und seines Verschwindens in irgendeine Garnison dort in Bosnien unten, wo es noch Bären gab, wie er wiederholt erzählt hatte; er wollte selbst auch auf die Bärenjagd gehen. „Bringen Sie mir dann das Fell, Herr Melzer, von dem Bären, den Sie mir aufgebunden haben.“ Es waren seitdem nun beiläufig vierzehn Jahre vergangen. Ihr Vater hatte in Ischl gelegentlich geäußert, daß Melzer den Dienst quittieren müsse, wenn er sie heiraten wolle. Aber: er hätte sie doch haben können, damals, ohne Zweifel. Er ist ein sehr, sehr herziger Bursch gewesen, immer ganz gleichmäßig fröhlich und korrekt. Sorgen hat er ja keine gehabt. Später hätte sie ihn betrogen, auch das wußte sie heute. Wegen seiner Gleichmäßigkeit.
Es gab am Ende der Gasse, welche Mary von ihrem Fauteuil aus entlang blicken konnte, einen fixen Autostandplatz. Diese Mietautos pflegten in einer langen Reihe in der Quergasse postiert zu sein, links und rechts hinter der Ecke, so daß linker Hand der vordere, rechter Hand noch der rückwärtige Teil je eines Wagens stets zu sehen waren. Die Polizeivorschrift verlangte damals, daß bei Bedarf immer der erste Wagen in der ganzen Reihe genommen werde; und da sowohl Anfang wie Ende der Kolonne an gewisse Grenzen gebunden blieben, so rückte jene nach, wenn einer abgefahren war; die Wiederkehrenden schlossen dann am Ende an. Das ergab ein von Zeit zu Zeit erfolgendes langsames Überrollen des Fahrdammes durch einen oder mehrere Wagen und zuletzt blieb rechts immer einer stehen, von dem man nicht viel mehr als die Hinterräder noch sehen konnte, während linker Hand ebenfalls ein Wagen um die Ecke hervorkam, aber nur mit dem vorderen Fahrgestell.
Es gehörte dieses gleichmäßige Abfädeln der Wagen dort am Ende der Gasse für Mary zu den Selbstverständlichkeiten und Unbegreiflichkeiten dieser Wohnung hier durch all die Jahre. Es war eine Erscheinung zutiefst verwandt den Tropfen einer Wasserleitung oder den fallenden Perlen eines Rosenkranzes. Und weil die Gasse bis zu dem Standplatz der Wagen und zum ‚Kanal‘ hinunter eine beträchtliche Länge hatte, so blieb das Knurren der Motoren bei geschlossenen Fenstern völlig unhörbar. Die Erscheinung war lautlos und das machte ihr Wesen aus; sie war lautlos, völlig gleichmäßig, ruhig; sie war von monumentaler Langweiligkeit und Monotonie; und das machte jetzt auch, in Marys gleitenden Vorstellungen, die Beziehung dieses Bildes zu den Erinnerungen an den Leutnant Melzer aus. Der hatte allerdings doch sehr, sehr lieb lachen können. Das Klingeln des Doktor Negria riß ein paar sprühende Sternchen ins Bild, nicht so ganz unverwandt jenen, die einer sieht, den man aufs Aug’ haut. Negria schien heute besonders energisch zu klingeln.
Das Mädchen öffnete vor ihm die Türe, aber er trat nicht ein, sondern er drang ins Zimmer, verbeugte sich tief, küßte die Hand, war dabei schon in Vormarsch und Offensive, und das blieb penetrant, auch angesichts seiner zeremoniösen Gemessenheit der Bewegungen, Handküsse, Kratzfüße. Er sah sich im Zimmer um, musterte alles etwas aufgebracht und hatte lautlos sogleich viele Worte gesprochen oder in fluidischer Art ausgestoßen: Nun also. Alles beim Alten, noch immer. Bei der alten Zecke. Bin neugierig, wie lang Sie so noch werden weiterleben wollen. Sinnlose Existenz das, versäumtes Leben. Vorurteile sind Trägheit, weiter nichts, Trägheit ist eine Sünde gegen das Leben. Ein Gegenstand mit Eigenbeweglichkeit, also ein lebendes Wesen zum Unterschied von einem Ding, darf sich der Trägheit nicht überlassen. Die Zecke glaube ich Ihnen auf gar keinen Fall. Gibt’s nicht! Laut hatte er nur, schon die Teetasse in der Hand, mitgeteilt, daß die Zerkowitz-Kinder jetzt die Schafblattern hätten und daß es ihm heute zum ersten Mal gelungen sei, den polnischen Legationsrat dort im Tennisklub (ein Herr von Semski) im Single, allerdings ganz knapp, zu schlagen. Im übrigen sah er aus, der Doktor Negria, wie Homer vom unzuverlässigen Lümmel Ares sagt: prangend von Kraft und Gesundheit.
Es ist natürlich ganz unmöglich, daß die Entflammung, welche sie da hervorgerufen hatte, auf Mary selbst ohne jede Rückwirkung blieb: mindestens mußte sie ihrer eigenen weiblichen Potenzen noch deutlicher inne werden, und das bedeutete schon die Einladung zu einem Spiel, zur Betätigung frei spielender Kraft. Vor Negria fürchtete sie sich nicht im mindesten, denn sie hielt ihn für im Grunde noch viel dümmer als den Leutnant Melzer der Jugendzeit.
Und sie dachte nicht im entferntesten daran, von diesem schön geebneten oberen Wege abzubiegen, von wo aus man den Blick allezeit hinuntersenken konnte in die Klamm drangvoller Umstände und in des Lebens ungleichmäßig sich durchzwängende Wasser, bald zwischen Blöcken gepreßt hervorschießend, bald wieder einmal in einem tiefen blaugrünen Forellenbecken gesammelt und an dessen Rund in geheimnisvollen Höhlen die überhangende und unterwaschene Wand bespülend. Der Blick dort hinab tat sehr wohl und der Umgang mit einem gleichsam hier herauf gelangten und domestizierten Stückchen solcher Wildheit erhöhte das Behagen, vertrieb zugleich des Behagens Gift, die Langeweile.
Als Negria hörte, daß Oskar in einer halben Stunde kommen werde, klappten seine Augenlider in mißmutiger Zustimmung und damit drückte er ungefähr aus, daß er dies ohnehin angenommen und gar nicht besser erwartet habe. Was sei von ihr schon zu erwarten, eine ganz banale Person!
Aber die Banalität einer Frau hatte den Doktor Negria noch nie ernstlich behindert; und so ging er bald zu neuem Vorstoß über. Er besaß seit einiger Zeit ein Ruderboot, nicht für sportliche Zwecke gebaut, also hinlänglich breit, aber doch ein elegantes hübsches Fahrzeug. Es lag bei der Abzweigung des sogenannten Donaukanales oberhalb der Stadt in Nußdorf. Wenn ein rumänischer oder serbischer Dampfer mit Schleppzügen stromauf kam, dann wußte es Negria, in seiner Sprache oder serbisch redend, leicht zu erreichen, daß ihm ein Tau zugeworfen ward, und so kam er bis Greifenstein und Tulln und noch viel weiter und gondelte sodann wohlgelaunt stromab, nicht ohne vor dem Losmachen des Taus noch ein Päckchen österreichischer Zigaretten mit vielem Dank auf den hohen Bord des Schleppkahns hinaufzuwerfen. Mit der Zeit kam es auf solche Art zu Bekanntschaften mit Schiffsleuten und ein oder dem anderen Dampferkapitän, auch auf dem ‚Kanal‘, den Negria ebenfalls befahren hatte, durchs Herz der Stadt hindurch und bis zum sogenannten ‚Praterspitz‘, wo der Arm unterhalb der Stadt wieder in den Hauptstrom mündet.
Dabei mußte er nun freilich in nächster Nähe von Marys Wohnung vorbeikommen, und so entstand bei ihm der Vorsatz, Frau Mary zu einer Kahnfahrt einzuladen, wobei man vorher in Nußdorf zum Wein gehen konnte, bei einem der verschwiegenen ‚Heurigen‘, die Negria so ziemlich alle schon kannte. Er war sich klar darüber, daß es um einen Titel für ein Rendezvous mit ihr außer Hause ging, welches er ja vor allem anstrebte, zugleich den Boden weiter hinaus vorbereitend durch gelegentliche Bemerkungen bezüglich kleiner Mißstände in seiner schönen Junggesellenwohnung, die eines sachverständigen Auges bedürftig waren (auch ließ er beiläufig einiges fallen über rumänische Bauernstickereien und andere nationale Altertümer, die er besaß, und brachte eine herrliche Arbeit dieser Art Frau Mary zum Geschenke).
Im Vorbeigleiten auf dem ‚Kanal‘ hatte Negria einen bequemen Landungsplatz entdeckt und, das Boot zum Ufer treibend, sogar einen Ring, der ihm erlaubte, sein Schiff mit Kette und Schloß festzumachen. Das war nun in allernächster Nähe jenes Standplatzes der Autotaxis, die dort gleichmäßig den Fahrdamm überrollend durch die Jahre fädelten.
Oskar K. war nach einer halben Stunde gekommen und erfreute sich des anwesenden Gastes in einer stillen und nicht eben durchsichtigen Art. Er gehörte zu jenen Leuten, deren Sein etwas Konkaves, Hohlspiegelartiges an sich hat. Man ist da immer geneigt, Brennpunkte des Geistes zu vermuten, bis nicht das Gegenteil evident wird. Wer viel schweigt, hört und sieht viel, ohne Zweifel. Aber daß solche Zurückhaltung einfach einem erstaunlichen Mangel an Feuer entspringen könne, nimmt zunächst niemand an. Daß stille Wasser tief sind, ist eine Grundüberzeugung, die jeder hat; und mindestens sind diese Wasser unheimlich. Aber man hat sich auch schon aufmerksam über welche gebeugt, die in kaum Handtiefe nur gewöhnliche Kiesel am Grunde sehen ließen. Das Gesicht des Mannes, der sich eben hier am Teetisch niedergelassen hat, gehört einer seltenen Art an, die aber bei jüdischen Männern eher noch gefunden werden kann als bei anderen, wenngleich solch ein Antlitz eine ganz allgemeine physiognomische Möglichkeit verwirklicht. Es ist ein nicht ganz zustande gekommenes Gesicht, oder wenn man so lieber will, der Schau- und Bauplatz höchst unverträglicher Materialien, die sich schon in den Ahnen nicht haben einigen lassen, jetzt aber in Zerknall und Zerfall geraten sind, wie nach einer Explosion. Hiedurch entsteht eine außerordentliche Häßlichkeit, die um so profunder ist als sie nicht an einem Nasenerker, einer Kinnlade, einem verkniffenen Aug’ oder sonst an einzelnen Bauteilen sich verhaftet zeigt, sondern demgegenüber sozusagen in zwischendinglicher Schwebe bleibt, ein in der Luft hängendes Band (denn das ist es eben doch!), welches das Disparate nicht bindet und die Dissonanz immerfort stehen läßt. Solch ein Gesicht sieht aus, als trüge dieser Mensch an einer auferlegten Buße für ihm unbekannte Schuld.
Kein Zweifel, daß er hier die Stärke und die Schwäche seiner Position genau erkannte, soweit von Genauigkeit die Rede sein kann, bei den schwebenden und wie Nebel veränderlichen Empfindungen, die man in solchen Sachen hat. Aber seine Frau glaubte Oskar zumindest besser zu verstehen als sie sich selbst verstand. In dieser Ehe waren jetzt noch, bei heranwachsenden Kindern und einer Dauer des Zusammenlebens von bald vierzehn Jahren, die Nächte eine Angel, welche im Dunkel eingepflanzt, jeden hellen Tag um sich schwingen ließ und seinen Kreislauf von sich abhängig hielt. Hier, im Kerngehäuse seiner Lebensumstände, hatte Oskar ein Beben beobachtet, dessen Nachschwingen in helleren, dem Tage angehörenden kleinen Umständen ihm als notwendig und selbstverständlich erschien. Die seit einiger Zeit gesteigerte Hingabe seiner Gattin und die unausbleibliche Wechselwirkung davon auf ihn selbst und auf sie selbst wieder zurück – so daß dem Gott Eros schon von beiden Seiten her gesteigert gespendet ward – legte um die Frau eine knisternde Aura, welche nur einem völlig Stumpfen hätte entgehen können, nie aber demjenigen, dessen Begehrlichkeit ohnehin schon aus ihren Handgelenken, aus den Schläfen, Schultern und dem Rocksaume lange Funken zog, kaum zu verbergende. Freilich, sie wußte das, sie dämpfte es zugleich durch das völlige Fehlenlassen jeder Koketterie und benebelte hundertfach stärker nur durch das Fluidische, das von ihr ausging, und peitschte zugleich eine offene Wunde durch ihre Ehrbarkeit. Eine Wunde, vor welcher sie profund, aus einem ganz gewissen Wissen, jede Achtung weigerte.
Aber sie betonte sonst nichts. Sie schärfte nicht etwa in Negrias Gegenwart die Züge eines besonders guten ehelichen Einvernehmens heraus. Die kleine Gesellschaft am Teetisch wurde durch keinerlei Demonstrationen in Unruhe versetzt. Diese blieben so weit ab, daß man es sogar fertig brachte, sich gut zu unterhalten – Negria unterhielt sich meistens gut mit Oskar, dem ‚Spinnerich‘, der ‚Zecke‘, ohne daß ihm dabei so was wie eine Gesinnungslumperei zum Bewußtsein gekommen wäre. Man kann sagen, daß er diesen Mann verhältnismäßig leicht ertrug, zwar bei Höpfner oben schimpfend, jedoch ohne die wesentlichen Qualen der Eifersucht, womit für uns Marys geringschätzende Anschauungsweise über die Natur der gewissen Wunde nahezu bestätigt erscheint.
Alle diese feinen Spinnenfäden – feiner noch als der Altweibersommer, welcher nun bald die Wangen wieder geisterhaft berühren würde – waren für den Spinnerich manifest und evident, eben weil er ein Spinnerich war. Im Augarten aber, bei den Tennisplätzen, in einer Sonne, die zusammen mit den Wasserdünsten der Donau die Luft milde und milchig erfüllte – so daß man, den Obstgeschmack des Herbstes im Munde, die vergehende Zeit fast sinnlich spüren konnte, weil sie langsamer wurde und nahezu stand – im Augarten gelangte Oskar, am Ende sogar durch wiederholtes Experiment, zu einem Ergebnis am hellichten Tag und in der äußeren Welt, das ihn nahezu so befremdend anrührte wie das Beben der Angel im innersten Kerngehäus seines Lebenskreises. Dabei bezog sich jenes Ergebnis nur auf eine scherzhafte Gepflogenheit zwischen seiner Frau und ihm – hier eigentlich auf das Ausbleiben dieser Gepflogenheit, ja, wie es schien, die Unmöglichkeit, sie wieder zu beleben, obwohl es ein gewohnter Spaß war, den sie schon in ihrer Brautzeit gekannt hatten. Sie pflegten nämlich – und besonders gern nach dem Tennisspiel – zum Scheine miteinander Streit anzufangen, alle Anwesenden dabei irgendwie beteiligend (sei es, daß diese sich einmischten oder in Bestürzung gerieten), um dann unvermittelt Arm in Arm und ganz zärtlich-vergnügt zu entschreiten. Es zeigte sich nun, daß Mary auf dieses Spiel schon seit längerer Zeit durchaus nicht mehr einging.
Freilich, man könnte zu solchen Spielen schon was bemerken. Mindestens dieses: daß sie die Exhibition von etwas Selbstverständlichem darstellten, nämlich der Eintracht zwischen einem Paare.
Die Kinder waren zur Schule gegangen, der Mann ins Geschäft, Mary ins Badezimmer. Während sie unter dem heißen Wasserspiegel in der Wanne lag und gleichgültig ihren Körper betrachtete, dessen Wirkung hier ausblieb, zwischen gekachelten Wänden und vernickelten Hähnen unter dem bläulichen Wasser, wie ein Schuß, den man wohl abfeuern sieht, aber dessen Knall man nicht hört, klopfte es. Mary nahm sich zurück aus dem Gerinnsel ihrer Vorstellungen und viertel oder halben Gedanken und sagte ihrer treuen, stets um sie sorgenden Marie, daß sie nicht hier frühstücken wolle, sondern drinnen am Teetisch.
Gemütlicher war das Wohnzimmer wohl im Winter, wenn der in Form eines Kamines gebaute große Koksofen seine Glut gleichmäßig durch die Glimmerscheiben leuchten ließ. Jetzt blieb eine gewisse Leere fühlbar; der Teetisch stand aber winters und sommers an der selben Stelle. Indessen fühlte man sich jetzt sozusagen weniger eingeschlossen. Marie hatte das Fenster gegen die lange Gasse zum Kanal hinunter zwar zugemacht, damit kein Staub hereinfliege und sich auf die Polituren der Möbel lege; aber draußen lehnte ein warmer Spätsommermorgen an den Scheiben, ein freundliches und gelindes Geöffnetsein allen Umkreises, leicht wasserdunstig und milchig neblig noch von der Morgenfrühe am Kanal her, ein Wetter mit viel Raum, offenem Hohlraum der Erwartung; und in der Mitte solchen Umkreises, der gedämpft die Geräusche städtischen Lebens ausbreitete, saß nun Frau Mary hinter ihrer Teetasse; das war die Hauptsache, denn das übrige Frühstück wurde mit großer Mäßigung dosiert. Nein, sie gehörte nicht zu jenen mit schlechtem Gewissen viel Schlagobers einnehmenden Gestalten in dem großen Café weiter unten am Donaukanal, das den wenigen Lesern einer späterhin noch zu erwähnenden sektionsrätlich Geyrenhoff’schen handschriftlichen Chronik genauer bekannt geworden ist.
Ohne weiteres ist klar, daß die K.’sche Wohnung denselben Grundriß haben mußte, wie die darunter liegende Siebenschein’sche: alle Räume lagen in einer Achse – vier große und ein kleiner Raum, was keinen üblen Prospekt ergab – bis auf das besonders ausgedehnte Schlafzimmer (bei Siebenscheins Gesellschaftsraum) und ein Kabinett von bescheidenen Maßen (unten des Doktors Arbeitszimmer). Die K.’sche Wohnung war also sehr groß („ist als sehr groß anzusehen“ – so hätte der Amtsrat Julius Zihal des Zentral-Tax- und Gebührenbemessungsamtes in dienstpragmatischer Sprache gesagt), denn unten hatte der Doktor Siebenschein ja auch sein Rechtsanwaltsbüro samt Wartezimmer untergebracht; und hier bei K.s gab es dafür nur um eine Person mehr (seit der Heirat Titi Siebenscheins – bis dahin war man im unteren Stockwerke ja auch zu viert gewesen).
Das möbelhafte polierte Schweigen wurde nur von dem kleinen Geklapper Marys unterbrochen. Was sie wie am Grunde eines flachen Beckens, wie in einer Muschel und gleichsam präsentiert hier sitzen ließ, das war der Umstand, daß sie heute rein gar nichts vor hatte, ein seltener Fall. Der Tag hatte zudem, in beinah tendenziöser Weise vor ihr zurückweichend, noch obendrein Platz gemacht: Oskar sollte mit Geschäftsfreunden in der Stadt zu Mittag essen, und die Kinder waren von Verwandten zum Essen gleich nach der Schule und für den Nachmittag gebeten worden, in eine Villa in Döbling, ein Haus mit hervorragend schönem Park. Es gehörte dem Besitzer einer großen Bierbrauerei. Die K.-Kinder galten als gebildeter Umgang, welchen man den eigenen Buben und Mädeln gern zuführte; und wirklich waren diese beiden Kinder einigermaßen über dem Durchschnitt.
Es blieb nur die Kahnfahrt mit Negria. Mary war für den frühen Nachmittag in Nußdorf mit ihm so gut wie verabredet. Dann würde es allerdings zu spät für das Tennis werden. Oskar seinerseits pflegte jetzt höchstens bis sechs Uhr auf dem Platze zu bleiben, wohin er an Tennistagen im Spätsommer gleich vom Büro aus nach kurzer Nachmittagsruhe sich begab.
Sie hielt sich heute frei. Sie lehnte es lächelnd ab, die Vereinbarung mit Negria für bindend zu halten. Er konnte ebensogut allein fahren: und dann würde er wohl unweigerlich hier am Kanal anlegen oder, ganz seemännisch, ‚festmachen‘, und heraufkommen, um zu sehen, wo sie denn geblieben sei. Er würde an Marie vorbei ins Zimmer eindringen.
Mary lachte.
Eben kamen die Taxis in Bewegung, fädelten nacheinander quer über den Fahrdamm. Der letzte Wagen, der mit den Hinterrädern sichtbar blieb, erzitterte noch ein wenig, und ebenso der erste, von welchem man nur die Vorderräder und die Haube des Kühlers sehen konnte. Damit war die lautlose Bewegung wieder zur Ruhe erstarrt.
Aber all diese glaszart und gespannt wartende Dämonie der ruhenden Umgebung kam Frau Mary unter solchem Namen freilich nicht zum Bewußtsein. Jedoch als Frau besaß sie genug Tiefe, wenn schon nicht des Geistes, so doch des Geweids, um ihr Exponiertsein zu fühlen in dieser von allen Seiten heranstehenden Gegenwart, gleichsam auf diesem Präsentierteller sitzend, der als hell angestrahltes Scheibchen zwischen den Dunkelheiten des Vergangenen und des Zukünftigen dahin wandelte. Ein Blick auf ihr kleines goldnes Uhrarmband sagte ihr, daß sie schon eine ganz ungewöhnlich lange Zeit hier vor dem fast geleerten Teegeschirr sitze. Marie war wohl noch einmal dies oder jenes einzukaufen gegangen. Es rührte sich nichts, auch sie selbst blieb still. Und nun war eine gute Stunde vergangen, seit sie hier am Frühstückstisch sich niedergelassen und unter anderem an den Leutnant Melzer gedacht hatte.
Etwas von der Sprödigkeit des Lebens war heute in ihr, als ein Wissen und eine Eigenschaft zugleich: wie doch alles so leicht springt, sie wußte es jetzt, das heißt sie hatte es in den Gliedern, dies Heikle, diese Bologneser-Fläschchen-Natur jeder guten Stunde, die da fällt und zu Staub wird. Sie wollte heute nichts anrühren. Ein ihr ganz fremdes Verhalten, sie rührte sonst immer was an oder rückte irgend etwas zurecht.
Und eben jetzt hätte sie das tun sollen. Als die gespannte Stille platzte und mit Geklirr und Geklapper eine neue Situation aus ihr hervorsprang, da erkannte sie es. Ganz gleichzeitig erkannte sie es mit ihrem Aufstehen, das nicht vom Kopfe beschlossen worden war, sondern als eine unvermutete Eigenmächtigkeit ihrer Knie und Beine wie eine Welle von unten her durch ihren Körper lief, welche auf halbem Wege es fertig brachte, die Teekanne aus rotem Ton mitzunehmen, weil sich die Fransen eines Seidentuches, das Mary um die Schultern trug, in dem aus Bambusstäbchen geflochtenen Henkel verhängt hatten, wodurch aber auch die Tasse fiel und das ganze Tablett samt der silbernen Zuckerdose an den Rand der gleichen Möglichkeit geriet. Und, zum Resultat beruhigt, ergab der Tumult: auf dem Teppich lag die Tasse mit der Untertasse, anscheinend unzerbrochen, der Löffel hatte einen weiten Satz seitab getan; auf Marys Kleid war kein Tröpfchen des Teerestes in der Kanne geraten und der dunkel gezogene Tee hatte also keine Gelegenheit gefunden, hier eine nachhaltige Wirkung zu tun: aber er strebte danach, denn an den Fransen von Marys Seidentuch hing jetzt das Gefäß so sehr geneigt, daß die dunkle Flüssigkeit beinah den Rand erreichte. Mary sah das alles. Sie hörte zugleich von draußen, vom Vorzimmer her, den Schlüssel in der Wohnungstüre umdrehen, und so rief sie denn, ohne sich zu rühren und vorgebeugt so gut sie konnte, um ihren seltsamen Umhang von sich abzuhalten: Marie! Marie! Das Herbeieilen erfolgte, ein Erschrecken, ein Lachen, ein vorsichtiges Zugreifen und am Ende ein immerhin merkwürdiges Ergebnis: nichts war zerbrochen, nichts war befleckt, nichts war beschädigt.
Aber die Substanz des Lebens gehorchte diesmal in Mary keineswegs einer scherzhaften Deklaration, unter welcher sie untergebracht werden sollte, sie weigerte sich dessen. Allein das ist der wahre Grund gewesen, warum Mary an diesem Vormittag nicht im schönen Liechtensteinpark spazieren ging, obwohl sie gerade das noch am Frühstückstisch sich gewünscht hatte, angesichts der vielen freien und verfügbaren Zeit. Jetzt indessen – wollte sie das gar nicht mehr riskieren. Hätte sie dies nun so bewußt und in Worten gedacht, sie wäre wahrscheinlich aus vernünftigem Widerspruch doch gegangen. Aber so weit kam es nicht. Sie blieb daheim, nicht aus einer Unlust oder Furchtsamkeit des Geistes, sondern aus einer Hemmung in den Gliedern.
Es war auch schön hier daheim. Ihr gepflegter Haushalt umgab sie und durchdrang sie von allen Seiten. Es war ein vernünftig geleitetes Haus, wo nichts verschwendet und nicht an der falschen Stelle gespart wurde, dort, wo mit geringen Mitteln ein starker Effekt des Behagens erzielt werden kann: der Fünf-Uhr-Teetisch etwa zeigte immer zweierlei Getränk auf dem hübschen gläsernen Wagen, Kaffee oder Tee, je nachdem, wie eines grad gelaunt war, und ebenso Butter, wie Jam, weißes und schwarzes Gebäck; auf die Sorgfalt der Kinder konnte sich Frau Mary bereits verlassen und so blieb ein schönes Service im Gebrauche. Kam jemand unvermutet, dann stand er unter dem Eindrucke, gastlich erwartet worden zu sein. Man erwäge, ob sich der geringe Aufwand solchermaßen nicht in dem oder jenem Fall reichlich bezahlt machte. (Oskar erwog solche Sachen.)
Es waren kluge Menschen, sie lebten offenen Sinnes nach allen Seiten, darum hörten und sahen sie was, und sie sperrten sich auch nicht gegen Gesehenes und Gehörtes, und es gab nicht (wie in gewissen ganz anderen Familien) verworrene Knäuel der Verstrickung in gehüteten finsteren Ecken. Und Grete Siebenschein kam gerne auf einen Sprung herauf und vertraute sich Mary in vielem an und war für deren Meinung und Rat sehr geöffnet und hörte aufmerksam zu.
Es lag nach alledem nahe, sich an diesem freien Vormittage einmal ruhig ans Klavier zu setzen. Mary hatte unter Gretes Leitung im Laufe des letzten Jahres drei Chopin’sche Etuden und einiges von Schumann studiert.
Da sitzt sie also am Klavier, diese seit heute Morgen eigentlich recht einsame Frau und läßt die silbernen Meditationen erklingen; die Umgebung ordnet sich, es kommt ein System in diese Einsamkeit, von welchem man beinahe glauben könnte, daß es sogar in die chaotische Stadtmasse ringsum auszustrahlen vermöchte, mindestens aber die nahen Dämonen zu bändigen durch die orphische Macht der Töne.
Es ist möglich, jemandem fundamental zu raten. Niemals fast kann ein solcher Rat angenommen werden. Denn einmal so weit gekommen, daß die Lage eines Rates bedarf, ist meistens auch schon das eine oder andere Rad oder Rädchen im Getriebe locker, und der in ihm befangene Mensch starrt gebannt in diese nun ganz bewußt herausgeleuchtete gestörte Apparatur des Lebens, das ihm jetzt von ihr abzuhängen scheint, statt umgekehrt, was eigentlich normal wäre. Daher kann der Rat lediglich mehr in bezug auf den Apparat gegeben werden – nur ein unbefangenes Neu-Herantreten an diesen vermöchte seine bloß relative Wichtigkeit zu enthüllen – und so muß es bei einem kleinen Rat bleiben, einem Rätlein, einem Rätchen in bezug auf die Rädchen, welche sich wie toll drehen, weil sie nun einmal aus dem Ganzen zu sehr herausgelockert worden sind. Ein kleiner Rat, ein Kniff. Dilatorische oder palliative Mittelchen. Mit allerlei Abwechslung, je nach der Situation: als deren Produkte, und nicht als nur eine von den kleinen Wellen aus gleichbleibenden fundamentalen Quellen. Auch der Ratende hat die Richtung verloren; und das Steuer schon gar und längst.
Seit dem Sommer des Jahres 1921 hatte Frau Mary der Grete Siebenschein im Grunde anderes kaum mehr zu bieten. Das heißt also, seit dem Ende von Gretes halber Verlobung mit dem kleinen E. P. und dem Beginne ihres engen Verhältnisses zu René Stangeler. Den ersten kannte Mary, denn Grete hatte ihn ein oder das andere Mal heraufgebracht; den zweiten hatte sie auch schon gesehen, aber eben nur dies, auf der Stiege, auf der Straße neben Grete; zusammengenommen mit dem, was sie von dieser über ihn sonst noch erfuhr und was ihr Gretes nicht selten fast verzweifelte Verfassung sagte, schien er ihr durchaus der geeignete Mann zu sein, um die junge Freundin mit Sicherheit vollkommen unglücklich zu machen.
Immerhin, Grete Siebenschein hatte an dem Punkte, wo wir jetzt halten, nämlich im Nachsommer 1923, das achtundzwanzigste Lebensjahr schon überschritten.
Nein, er gefiel Frau Mary nicht, der ungefähr gleichaltrige René, und sie wünschte auch nicht, ihn kennenzulernen: als hoffte sie hintergründig noch immer, daß diese Verbindung in absehbarer Zeit sich wieder lösen würde, als wollte sie da nicht durch ihre eigene Person eine Klammer mehr noch bilden: genug, daß Stangeler schon unten bei Siebenscheins zeitweise ein und aus ging und daß sich allmählich bereits das Gewicht des Familiären auf Grete und ihren Liebhaber zu legen begann, die beiden gleichsam noch enger aneinander pressend. Nein, er gefiel ihr wirklich nicht! Seine Augen standen etwas schräg und die Backenknochen waren irgendwie magyarisch oder zigeunerisch. Einmal hatte sie ihn unten auf dem Platze vor dem Bahnhof gesehen, offenbar auf Grete wartend: er lümmelte mit dem Rücken gegen den Sockel des Uhrtürmchens, die Beine gekreuzt, die Hände in den Taschen, den Hut im Genicke. So auf offener Straße. Es lag Herausforderung in seiner Haltung. Sie erschien Mary keineswegs nachlässig und natürlich, sondern betont. Und dies war lächerlich, unsolid, wenig Vertrauen erweckend. Ihr eigener Bub, damals ein kleiner Untergymnasiast, hätte sich nicht so hingestellt: jener aber näherte sich den Dreißig. Ein Bursch aus gutem Hause obendrein, wie es hieß. Ein erwachsener Mensch. Ihr Mann war mit achtundzwanzig längst in einer selbständigen Lebensstellung gewesen. Von Stangeler hieß es, daß er noch studiere – allerdings erklärte sich das auch aus dem Militärdienst im Kriege und einer vierjährigen Kriegsgefangenschaft. Danach aber wäre es auch naheliegender gewesen, sogleich etwas Vernünftiges und Brauchbares anzufangen. Nun: Jeder wie er kann (beschränkt im gewöhnlichen Sinne war sie gar nicht, die Frau Mary!), aber sein Verhalten Grete gegenüber hätte von vornherein ein ganz anderes zu sein gehabt: über alles übrige ließe sich ja noch reden – ob jetzt heiraten oder nicht heiraten, oder erst später, ob einen praktischen Beruf ergreifen oder weiterstudieren, und dergleichen.
An allem war der kleine E. P. eigentlich selbst schuld.
Er war es, der Grete mit René Stangeler zusammengeführt hatte, wenigstens von Frau Mary her sah das so aus. Denn was von ihr bei allen diese Sache betreffenden Überlegungen und Vorstellungen nie in Anschlag gebracht worden war und gebracht wurde, etwas, das sie gleichsam nicht mitdachte oder kaum mit dem gehörigen Nachdruck: das war die doch ganz unleugbare Tatsache, daß Grete Siebenschein den kleinen E. P. nie geliebt hatte. Und doch lag gerade dies wie auf der flachen Hand. Ein blinder Fleck für Mary. Hatte sie ihren Oskar geliebt? Ja – nein. Jetzt liebte sie ihn. Es erschien ihr als etwas, das sich ergeben hatte, nicht als eine Grund- und Vorbedingung. In ihrem tiefsten Innern sah sie darin nichts Entscheidendes, worauf man geradezu losgehen konnte, was man direkt ins Auge zu fassen hatte. Kein Bedingnis, sondern ein Bedingtes. Etwas Unselbständiges, das dann wohl hinzukommen würde und überhaupt nur hinzugegeben werden konnte; nie also konnte es den Ausgangspunkt von Handeln und Raison bilden. (So etwa käm’s heraus, wenn man ausspräche, was Mary diesbezüglich mit sich führte als ein so sehr Selbstverständliches, daß sie es als ihr eigentümlich nicht mehr erkannte.)
Aber, daß hier von seiten der ganz anders gearteten Grete Siebenschein jene Neigung nicht bestand, die man schlechthin Liebe nennt – Primzahl des Lebens, keiner Analyse bedürftig oder zugänglich – das lag ebenso klar wie der von dem kleinen E. P. gemachte Fehler, welcher damit als gar keiner mehr sich darstellt. Sonst wäre Grete nach dem Kriege nicht von ihm weg über Jahr und Tag ins Ausland gefahren, mochte es auch so geboten wie immer erscheinen. Denn ihr Vater, der Doktor Ferry Siebenschein, gehörte zu jenen Leuten, deren Anständigkeit so weit zu gehen vermag, daß die Familie dabei verhungert. In der ersten Zeit nach dem Kriege, ja, vor 1918 schon, wär’s bald an dem gewesen. Es dürfte dieser Fall unter den Inhabern gutgehender Rechtsanwaltskanzleien zu Wien während jener Zeit beinahe einzig dastehend sein. Denn gerade dieser Berufsgruppe vermochten die mit ihrer Tätigkeit unweigerlich verbundenen zahlreichen Beziehungen zu anderen Menschen, ein maßvoller Austausch von Gefälligkeiten, ein an sich harmloser Handel unter der Hand, das Allernötigste immer wieder zu verschaffen, wenn nicht von Monat zu Monat, so doch von Woche zu Woche. In alledem erwies sich unser Doktor, Gretes Vater, als fast monströses Untalent, ja beinah als ein Bock mit unabänderlicher Vorliebe für die Richtung des größten Widerstandes. Grete liebte ihren Vater unter anderem auch deshalb sehr. Die Mutter Siebenschein aber geriet aus allen Zuständen in alle Zustände, nämlich in immer anders geartete, wozu es nicht einmal solcher Zeitverhältnisse bedurft hätte, denn die kleine, bewegliche Dame war von dämonischer Erfindungskraft auf dem Gebiete der Krankheiten, und wenn schon ihre Produktivität hier einmal nachließ, dann wurde die Lücke durch die ungewöhnlichsten Zwischenfälle geschlossen: sie brach oder verrenkte sich irgend ein kleines Glied, eine Zehe am linken Fuß oder den Ringfinger der rechten Hand und verstand es damit, auch in den Pausen ihrer eigentlichen Hervorbringungen – Schlaflosigkeit, Schüttelfröste, Geschwülste, oder einfach, um mit Johann Nestroy zu reden, ‚Beklemmung mit Entzündung‘ – die Aufmerksamkeit der Familie bei ihrer Person zu halten. Daß der Doktor Ferry Siebenschein kein Arzt war, wirkte hier förderlich und ließ jedes neue pathologische Ereignis in voller Frische auftreten. Ärzte verhalten sich solchem Unwesen gegenüber bekanntlich kalt wie die Eiszapfen; und der Obermedizinalrat Schedik, dessen Patientin Frau Siebenschein allerdings viel später, nämlich 1927 geworden ist, pflegte, wenn er ein Mitglied der Familie traf, nicht zu fragen, „wie geht’s der Mama?“, sondern ganz nebenbei „und was fehlt der Mama jetzt?“. Denn freilich, seit deren vorgestriger und letzter Anwesenheit in seinem Ordinationszimmer konnte immer noch ein ganz neues Krankheitsbild aufgetreten sein. Schedik, der nicht wenige Patienten von solcher Art um sich hatte, behandelte diese mit dem besten Erfolge rein psychologisch fast unter gänzlicher Beiseitelassung jeder Kur und Rezeptur, ohne daß von diesen Herrschaften jemals sich jemand die Frage vorgelegt hätte, wodurch sie eigentlich immer so rasch und so viele Male im Jahr bei dem Obermedizinalrat Schedik von oft ganz verschiedenen hintereinander auftretenden Leiden genasen. Sie hielten ihn für einen außerordentlichen Arzt. Und das war er auch. Zudem ein hervorragender Schwiegervater: leider des schon genannten Herrn Kajetan von S. Einer von seinen Hochschullehrern, der den Doktor Schedik kannte, hat Kajetan gegenüber nach dessen Ehescheidung beiläufig und nachdenklich bemerkt: „Wissen Sie, Herr von S., auf die Frau ist allenfalls noch zu verzichten; aber der Schwiegervater bedeutet einen unersetzlichen Verlust.“
Vom Vater Siebenschein aber, von jener Mutter, von der jüngeren Schwester Titi (welches Häkchen damals schon die Krümmung künftiger Bahn zeigte) trennte sich nicht lange nach dem ersten Weltkriege unsere Grete (ebenholzschwarzen Haars und klassisch geordneter Züge): nicht zuletzt auch, um den Ernährer der Familie zu entlasten, was er gar nicht wollte. Jedoch bildete sicher auch der periodische und pathologische mütterliche Festkalender ein treibendes Motiv: dem als retardierendes ein E. P. mit zu geringem Gewicht entgegenwirkte.
So kam Grete nach Norwegen. Die im Kriege neutral gebliebenen Staaten nahmen junge Österreicherinnen auf.
Sie hat sich redlich durchgebissen dort, und dabei trat zum ersten Mal ihre Persönlichkeit plastischer hervor, zeigte sich das Eigentümliche und Differenzierte ihres Wesens, da es an einer ganz anderen, an einer fremden und verhältnismäßig graden Umwelt sich maß. Sie blieb ihr gewachsen: was umsomehr heißen will, als sie aus einem zerrütteten und verarmten in ein geordnetes und vergleichsweise wohlhabendes Land gekommen war. Eine Deklassiertheit ganz allgemeiner Art drohte dort in der Fremde sozusagen täglich in eine spezielle, persönliche auszuarten; und das um so mehr, als Grete nicht durchgehends und immer so ganz in dem Berufe, dem Stande und Charakter zu bleiben vermochte, unter welchem sie da zunächst aufgetreten oder angetreten war: als Musik-Akademikerin (sie hatte in Wien absolviert). Aber es konnte beim rein Pädagogischen nicht bleiben, die Möglichkeiten hiezu waren so dicht nicht geboten und die Ruhe von Warten und Wahl noch weniger. Grete spielte auch in einem Sporthotel zum Tanzen auf. Freie Station, geringer Lohn. Sie saß hinter dem Klaviere, die Damen und Herren (oder was sie schon gewesen sein mögen) unterhielten sich und tanzten. In nördlichen Ländern, solang’ man nicht trinkt, ist die Oberfläche des Benehmens und der Erscheinung gleichmäßig gepflegter, die Rillen und Runzeln, welche die Stände trennen, liegen für den Fremden aus dem Süden nicht sogleich zu Tage, und wenn dazu die Sprache noch nicht oder erst mangelhaft beherrscht wird, so fehlen auch die Orientierungs-Marken des Bildungsmäßigen, das ja sonst, wenn auch kaum greifbar, doch ein international ergossenes Fluidum darstellt, nicht unverwandt der Bratensauce in den Speisewagen der großen Expreß-Züge, die vorlängst zwischen Biarritz und Paris, Bregenz und Wien, Mandschuria und Wladiwostok verdächtige Analogien zeigte, so daß man auf die unsinnige Vorstellung verfallen konnte, sie werde in Röhrensystemen entlang der Strecken geleitet. So auch die Bildung. Spricht man jedoch nur wenige Worte norwegisch, so kann man auf dem Holmenkollen davon keine Probe nehmen. Aber Grete wurde in die Geselligkeit bald hineingezogen; man setzte irgendwen auf ihren Platz am Klavier, der da irgendwas irgendwie spielte (ein weniger heikler Punkt dort, zu jener Zeit jedenfalls noch). Es zeigte sich, daß Grete als Person und unmittelbar mehr zur Wirkung gelangen konnte als durch ihre pianistischen Mittel, die vielleicht bei einem Wiener Walzer zwischendurch einmal zogen, sonst aber in den damals allen Tanz beherrschenden Trotts und Steps verhämmert wurden. Freilich, sie war gut gekleidet. Und auf eine Art, die sich hier doch so ganz noch nicht durchgesetzt hatte, zudem in Einzelheiten wie auch in der Gesamt-Linie vielleicht überhaupt ihrer Vaterstadt verhaftet blieb. Es ist überdies für das ganze Leben eines Menschen ein entscheidender Ton im Eröffnungs-Akkord, wenn er aus einem berühmten Orte stammt, den jeder auf der weiten Welt kennt. Für hübsche Frauen sind da Paris oder Wien von besonderer Bedeutung und müheloser Folien-Wirkung; aber auch für ein Mannsbild kann es nicht gleichgültig sein, ob Paris oder Landes-de-Bussac, Wien oder Groß-Gerungs, Moskau oder Kansk-Jenisseisk.
Grete Siebenschein wurde in die Geselligkeit hineingezogen, aber nicht ganz ohne ihr Zutun. Zu Oslo (das damals noch nicht lange so genannt wurde), in der Familie eines Zahnarztes, wo sie eine Zeit lang Musikstunden gegeben hatte, war ihr abgeraten worden, sich auf das Engagement in dem Sporthotel einzulassen: es verkehrten dort, so hieß es, nur Jobber, oder Schieber, wie man bei uns zu sagen pflegt. Aber ein Patient des Dentisten stellte ihr die Sache als gewissermaßen aufpulvernde Abwechslung dar. Und Grete hat sich als junge Person eigentlich vor nichts und vor niemand gefürchtet. Sie war mutig und bieder und von allzuviel Phantasie nicht geplagt, die bei den mutigen Menschen meistens schwach ist. Zudem lebte in ihr etwas, das man den Forschungstrieb nennen könnte. Wann immer sie im Auslande war, auch späterhin, hat sie stets viel gesehen, ohne mit ihren eigenen Sympathien und Antipathien dabei Federlesens zu machen. Vielleicht waren diese ebenfalls schwach. Sie paßte sich sogleich an. Sie trug sehr bald kein Körnchen mehr von der Erde des Vaterlandes an den Sohlen. Geringe Vorstellungskraft befördert das Aussetzen des Gedächtnisses. Man hat nicht dahinten im Vergangenen leuchtende und kaum berührte Örter, Altärchen einer sozusagen privaten Religion, kleine Haken im Herzen mit weit zurückreichenden Fäden daran, so daß irgendeine Vorstellungs-Verbindung oder etwas, was man gerade sieht, empfindlichen Zug ausüben kann. Das ist der Objektivität nicht förderlich. Grete war sehr objektiv und nur gelegentlich sentimental: das letztere wußte sie dann und hielt zugleich schützend eine kleine Randkluft von Ironie zwischen sich und ihren Gefühlen offen. Ihre Verfassung war derjenigen einer Dame aus dem achtzehnten Jahrhunderte verwandt – nichts liebte sie mehr als den Esprit und etwas davon eignete ihr selbst – und darum hat sie denn oft auch wirklich so ausgesehen. Ein klares, mitunter fast scharf dreinblickendes Aug’, der lange Hals, die fragile Schlankheit einer keineswegs Mageren – fausse maigre nennen das die Franzosen – man wurde nicht selten bei solchem Anblick an jene Gräfin Lieven erinnert, die Frau des russischen Botschafters in London, ‚la maigre Lieven‘ genannt, durch zwei Jahrzehnte die Geliebte des Staatskanzlers Clemens von Metternich; nur war die Gräfin eine Blondine gewesen. René Stangeler, der innerhalb des ganzen Galimathias, den er auf der Universität, von Gier geritten, in sich hineinstudierte, auch der österreichischen Geschichte beflissen war, hat die Lieven selbstverständlich gekannt, ja über sie sogar ein größeres Referat halten müssen. Jedoch er vermied es sorgfältig, Grete jemals von dieser Persönlichkeit etwas zu erzählen, obwohl jene sich gewiß dafür lebhaft interessiert hätte. „Ich wollte sie“ (so hat er sich später einmal dem Kajetan gegenüber geäußert) „auf diesen ihren Archetypus nicht noch geradezu hinweisen.“ Man kann’s verstehen. Er hatt’ es auch so nicht eben leicht.
Nun, wir sagten früher, „man setzte irgendwen auf ihren Platz am Klavier“, und „sie wurde in die Geselligkeit bald hineingezogen“. Am Anfang aber – setzte sie selbst (nämlich jemand anderen ans Klavier) und sie wurde in jene Gesellschaft nicht so sehr hineingezogen, als daß sie selbst in diese eintrat. Damit setzte sie zugleich auch einen sehr bezeichnenden Akt, ganz bewußt, und vollführte eine der vielen Gegenbewegungen vom Deklassiertwerden weg, welche ihre norwegischen Jahre stets begleiteten (ja, zum guten Teil ausfüllten), so wie das Wassertreten unaufhörlich ausgeführt werden muß, wenn man sich stehend und aufrecht oben halten will. Grete ist eigentlich ihr ganzes Leben hindurch mit Wassertreten in diesem Sinne beschäftigt gewesen und auch ihre hochgespannte Empfindlichkeit den Familien-Angehörigen jenes Herrn von und zu René gegenüber erklärt sich zum Teil von daher. Hier im Sporthotel aber ging es zunächst nur darum, das Gesicht zu wahren, mit zu dieser Gesellschaft (oder was es schon gewesen sein mag) zu gehören, nicht aber als Bar-Pianistin und Tappeuse gänzlich hinters Klavier verbannt zu sein. Da man sie alsbald zum Tanzen aufforderte und sie dieses vollendet beherrschte, konnte sie eine zweite gleich anschließende Aufforderung annehmen, eine dritte schon mit dem Hinweis auf das unzulänglich besetzte Klavier ablehnen und sich befriedigt und wirklich leichteren Herzens wieder hinter das Instrument zurückziehen.
Aber, solche dosierte und vernünftige Mittel und Anstalten (unsereiner hätte vielleicht fünf Stunden hinter dem Stutzflügel vor sich hin geblödet und seine Trotts gepaukt ohne sich um wen oder was zu scheren) wurden, wie so oft bei Grete, von Eruptionen ganz anderer Art durchkreuzt. Denn plötzlich, innerhalb weniger Minuten, hatte sie sich bis über beide Ohren verliebt.
Das konnte bei ihr leicht und schnell geschehen, und das erste Eigenschaftswort ist auch im Sinne einer Gewichtsbezeichnung zu verstehen: es fiel nicht schwer auf sie, es fiel sie nur heftig an. Aber die Randkluft blieb offen. Eine gewisse Reserve gesichert. Dieser hintergründige Umstand – man möchte fast sagen: als hätte sie vermöge ihres langen Hálses sich immer noch fähig gefühlt, die Lage zu überblicken – ließ Grete sehr weit gehen, bei ungeminderter elementarer Echtheit der Sensationen, welche sie empfand. Es ist derartiges auch während der ersten zwei oder drei Jahre ihrer Verbindung mit dem René Stangeler noch wiederholt vorgekommen, welch letzterer, durch Gretes Anderssein eingeschüchtert und in maßlose Bewunderung versponnen, darüber in theatralisch großzügiger Weise vermeint hat, hinweggehen zu müssen. Aber die Steine, welche er da mühelos zu schlucken vorgab, lagen dann doch unverdaulich im sozusagen psychologischen Magen und am Ende lief seine heroische Geste recht trivial darauf hinaus, daß er Gleiches mit Gleichem vergalt. Zum Unglück für Grete Siebenschein gerade dann, als die bewährte Randkluft sich bei ihr, wenn auch nicht ganz, so doch beinahe schließen wollte.
Jetzt also, wieder hinter dem Klavier, erblickte sie Einen erst recht, den sie schon flüchtig gesehen hatte und von dem sie auch bereits wußte, wer er sei: ein Mann der damals in Norwegen eine Art kleiner Berühmtheit genoß. Die Norweger sind ein mitunter beinahe hellenisch anmutendes Volk; und wenn auch aus tiefen, alten Schächten nicht selten das auftaucht, was man die nordische Häßlichkeit genannt hat, so erreichen doch Wuchs und Antlitz des Menschen in jenem Lande vielfach und so ganz nebenhin ein bedeutendes und für den Ausländer stupendes Maß der Vollkommenheit. Dieser da war einer von den ganz Kühnen, eine Größe der verschiedensten Sports, obendrein reich, und so hatte er in Paris und London die letzten provinziellen Hilflosigkeiten eines kleinen Landes vollends abgeschliffen. Dies witterte Grete sogleich, und es verengte die Randkluft merklich, besonders als sie nach einer halben Stunde wieder hinter ihrem Klavier hervorkam und nun mit jenem tanzte: der als ein bereister Mann (sogar im Himalaya) und als anerkannte Mitte des Zirkels sich der Ausländerin anzunehmen offenbar für seine Standespflicht hielt. Zudem, sie wirkte wohl exotisch, südlich, mit ihrem blauschwarzen Haar, aber nicht befremdend. Der strenge Bau des Gesichts bei makellos weißer Haut war, über alle Gegensätze der Rassen hinweg, sehr nahe benachbart einer hier vielfach anzutreffenden physiognomischen Artung.
Was nun kam, ist eine Obligat-Stimme, die wir nicht von allen ihren kleinen Anfängen an herunterraspeln wollen. Der Halbgott, welcher sich mit Grete in einem von beiden Teilen recht flüssig gesprochenen Französisch unterhielt, nahm diesen Fall neben anderen kurzerhand auch noch mit, und als die Gesellschaft sich verlaufen hatte, gingen sie zu zweit des nachts spazieren. Der Schnee lag hoch. Ohne weiteres trug unser Fliegerkapitän – das war er im Weltkrieg in englischen Diensten mit Bravour und Auszeichnung gewesen – die Grete Siebenschein streckenweise, entlang der Bahntrasse, welche unmittelbar hinter dem Hotel lief und zum Schutze gegen Schneeverwehungen mit einer Art hölzerner Tunnels eingedeckt war. Wir dürfen annehmen, daß sie sich gerne tragen ließ. Die Unterhaltung wurde bald so lebhaft, daß ihr bißchen Schmuck, welches sie an sich hatte, unvermerkt in den Schnee fiel. Aber weil er einen ganz entschiedenen und harten Widerstand bei ihr fand, ließ er wie abgeschnitten von seinen Deutlichkeiten und bemerkte ihr kurz, daß für solchen Widerstand nur zwei Gründe bestehen könnten: entweder die Unberührtheit (was sie verneinte) oder ein zur Zeit bei ihr herrschender körperlicher Zustand (was sie bejahte). Diese seine Äußerung gefiel der Grete Siebenschein jedoch so gut, daß volle Einigung damit erzielt wurde, bei geringem zeitlichem Aufschub. Plötzlich, als er sie auf den hier tragenden Schnee stellte, bei dem Eingang eines der Tunnels oder Schutzdächer – der schwarze Mund stand wie Samt in dem Weiß und Sternklar der Nacht und verschluckte die schwach glänzenden Bänder der Schienen wie abgeschnitten – vermißte sie ihren Schmuck. Er half ihr suchen, obwohl das im Schnee recht aussichtslos erschien. Aber sie fanden, ganz unnatürlicher Weise, keine dreißig Schritt von Ort und Stelle und schon nach wenigen Minuten alles beieinander schwach glänzend auf der Schneedecke liegen. Dieses Opfer war also nicht angenommen worden, und der Ring des Polykrates kehrte gewissermaßen zurück.
Rauchzimmer und Billardsaal des Hotels hatten eine seitliche Tapeten-Türe, welche auf den Gang beinah genau gegenüber Grete Siebenscheins Zimmer sich öffnete. In jenen Lokalitäten nun, die beinah ausschließlich von Mannsbildern frequentiert wurden, konnte sich Gretes Halbgott auch nachts zu jeder Zeit aufhalten, da hier immer irgendwo ein Gelage oder eine Kartenpartie im Gange war und der reichlich in Erscheinung tretende Pjolter (wir würden das einen Punsch nennen, aber einen für Bären) allem gewissermaßen die Deutlichkeit nahm und jede Vigilanz vernebelte. Durch die Tapetentür, über den Gang und zu ihr hinein. Es mag sein, daß der Kapitän außer diesem der Grete auch sonst noch einiges zugemutet hat. In der dritten Nacht solcher Praktik fand er sie auf und am Tische. Sie wies ihm einen Stuhl. „Wir werden jetzt deutsch reden“, sagte sie (auch diese Sprache beherrschte er). „Wir werden jetzt deutsch reden“, sagte sie also, und der zwischen ihnen neue Klang veränderte mit einer wahren Übermacht alles, mochte auch der Kapitän das eigentlich Tendenziöse der Redensart gar nicht auffassen, wobei ja deutsch nur so viel wie deutlich heißt; vielleicht verstand er’s bloß so, daß sie jetzt dieser Sprache sich bedienen wolle. Er sagte nichts und setzte sich auf den Stuhl. Im Zimmer war es etwas kühl, die Heizung ausgeschaltet, Grete noch vollständig angekleidet, das breite Bett von hellem Birkenholz geschlossen.
„Sie werden“, setzte die Siebenschein fort, während ihr Hals sich über die Situation hinaus verlängerte und die Glaskörper ihrer Augen durchsichtiger erschienen, „morgen abend sowohl mit mir tanzen, in der Bar, als auch Konversation machen. Im übrigen aber hier Schluß. Meine Türe gedenke ich versperrt zu halten. Der Stil, in welchem Sie da mit dem Klavierfräulein sich was angefangen haben, ist mir aus Wien nicht bekannt und konveniert keinesfalls. Sollten Sie mich indessen später in Oslo besuchen wollen – ich fahre übermorgen zurück – so habe ich nichts dagegen.“
Sie hat ihm dann die Telephon-Nummer jenes früher erwähnten Zahnarztes gegeben. Er ist schweigend gegangen, obwohl’s doch immerhin ein starkes Stück war, was sie da gespielt hatte; und er wäre vielleicht berechtigt gewesen ihr etwas zu sagen, im Rückblick etwa auf die Art der Einigung mit ihr bei den Schneetunnels vor ein paar Tagen, wo die glitzernde Nacht und die schwach schimmernden Schienen vom Samte verschluckt worden waren, während unweit davon der Schnee die bescheidentlichen Schmucksachen an seiner Oberfläche gegen den Himmel gehalten hatte – ein Bracelet von Gold und ein Anhänger mit gerissener Kette und ein Ohrgehänge mit Schräubchen, denn Gretes Ohrläppchen waren nicht durchbohrt. Aber der Kapitän sagte nichts, er ging und tat weiterhin, wie ihm geheißen worden war. Nur telephonisch angerufen hat er die Siebenschein in Oslo niemals. Sie hielt für möglich, daß es ihm nicht geglückt sein könnte, denn sie hatte auf dem Zettelchen eine Art Index-Zahl zu notieren vergessen, die damals in Oslo erfordert wurde, um eine Nummer zu erreichen. Jedoch war Grete auch ohne weiteres bereit anzunehmen, der Halbgott habe sich um sie einfach nicht mehr gekümmert; so hat sie selbst gesagt, als sie dem Kajetan von S. (die richtige Adresse!) ihre Geschichte erzählte. Das war acht Jahre später. Stangeler, der diesen Teil von Gretes Biographie genau kannte und überaus hochhielt (!), hat wegen ihrer Schonungslosigkeit sich selbst gegenüber jenen Schmerz empfunden, den sie zu empfinden nicht vermochte. Und Eifersucht dazu (aber in bezug auf Kajetan, den er damals eben kennen gelernt hatte und nur deshalb, weil ihm solches erzählt worden war).
Von einer so beschaffenen Helligkeit des Bewußtseins also waren auch die passioniertesten Affären unserer Siebenschein beschienen, und es wirkt erheiternd, daß sie eben eine derartige innere Haltung späterhin oft ihrem René vorwarf, der sie gar nie fertig gebracht hätte (mangels eines genügend langen Halses), sondern sie nur gelegentlich posierte, um rasch und heroisch irgendeine fallweise Eifersucht hinabzuwürgen, was eine Art Kulthandlung vor den Altären der Grete Siebenschein’schen Eigenpersönlichkeit darstellen wollte. Aber wer immer eine Pose zu lange heraus steckt und vorstreckt, der wird früher oder später einmal an ihr wie an einem Henkel ergriffen und so gleichsam bei einem Wort genommen, das er zwar immerwährend ausgesprochen, nie aber eigentlich gemeint hat. Nützt nichts: er bekommt das Übergewicht nach außen und fällt hinter seinem Worte her in den Tumult der Dinge. Und nach innen kann ihm obendrein gerade das gleiche passieren. Denn solche neue prothetische Gliedmaßen, die sich einer da zulegt, wachsen nach beiden Richtungen: hinaus und herein.
Was aber die Grete angeht, so muß man ihr mindestens dies eine vindicieren: daß sie ein genaues Gegenteil dessen war, was man eine dumme Gans nennt. Gerade dies aber scheint dem Herrn von und zu René, über dessen Haupt man im weiteren Verlaufe der Begebenheiten (um mit Johann Nestroy zu reden) schon bedenklich lange Ohren sich erheben sehen wird, maßlos imponiert zu haben. Es erhielten von da her die übrigen Siebenschein’schen Bestandstücke, Attraktionen, Waffen, gewissermaßen eine Art von höherer Weihe.
Unter solchen stets erneuerten Gegenbewegungen also, von denen ein Pröbchen wir hier dargeboten haben, verlief Gretes Aufenthalt in Norwegen durch Jahr und Tag. Sie erlebte nicht nur kurze und abrupte, sondern auch länger sich hinziehende Affären. Sie erreichte nicht nur amüsante und fragwürdige Stellungen (wie man gesehen hat), sondern auch bessere und langweilige.
Dann und wann schrieb sie dem kleinen E. P. Seine Antworten waren sogenannte Viertelkilo-Briefe. Sie hat ihm späterhin sogar norwegische Kronen geschickt, welche sich in der damals schon rapide verfallenden österreichischen Währung imposant ausdrückten. Von Haus aus hätt’ er’s wahrlich nicht nötig gehabt. Aber der Kleine war mit seiner Familie zerfallen, wenngleich er noch bei seinen Eltern wohnte (jene Zerfallenheit mißfiel der Frau Mary K., wie alle Querköpfigkeiten überhaupt). Das Haus Numero vierundvierzig in der Wiener Porzellangasse ist (es steht noch) die eine Hälfte eines Doppelgebäudes, aus zwei ganz gleichen Häusern, die zusammen ein symmetrisches Gebilde ergeben, eine beängstigende Bau-Art. Der Architekt hat denn auch Miserowsky geheißen, oder waren es zwei Brüder Miserowsky? Vielleicht sind sie Zwillinge gewesen, das möchte am passendsten sein. Der Vater E. P.s – man erinnert sich nur unklar des kleinen, böhmisch aussehenden glatzköpfigen Herrn – war ein Industrieller und besaß Spinnereien zu Smidary. (E. P. hat übrigens beide Eltern noch vor seiner Verehelichung, die anfangs 1924 erfolgte, verloren, die Wohnung in der Porzellangasse aber beibehalten.) Es gab auch einen Bruder, den man aber zu Wien kaum gekannt hat, er war im väterlichen Werk tätig. Eben das wollte E. P. nicht sein. Er war mit beiden innerlich verfeindet, mit dem Vater und mit dem Bruder. Es gehörte diese Feindschaft und dieses Familien-Problem zu ihm wie seine blauen Augen, seine tief-bräunliche Haut, seine ebensolchen Haare oder etwa seine extreme Kaisertreue mitten in der Republik.
Als René Stangeler im Sommer des Jahres 1920 endlich aus der Kriegsgefangenschaft heimgekehrt war, hat ihn E. P. mit einem Telegramm von vierzehn Zeilen Länge begrüßt, welches auf dem Landhause von Stangelers Eltern, wohin sich der Heimgekehrte unverzüglich begeben hatte, einigen Eindruck hervorrief. Es begann mit den Worten: „Wie herrlich ist das, Deine Rückkehr …“ Ab diesem Tage erzählten die Viertelkilo-Briefe nach Norwegen immer teilweise von René So ward der Boden vorbereitet.
Und so ging denn alles rasch, als sie wiederkam, im Frühjahr einundzwanzig. Zwischen ihrer Ankunft in Wien und der Vereinigung mit René Stangeler – welche nach der Artung des kleinen E. P. freilich dessen Bruch mit dem neuen Paare sehr bald nach sich gezogen hat – vergingen eigentlich nur wenige Wochen. Sie haben indessen der Grete Siebenschein genügt, den Kleinen in jeder Hinsicht zu versorgen. Sie hat ihm eine Stellung in einer Großbank verschafft (es war jene, die zehn Jahre später, aber nicht durch die Operationen eines gewissen Levielle umgefallen ist), und das wurde ihr möglich, weil einer der Direktoren mit der Familie Siebenschein befreundet war (der Direktor Altschul, dem Levielle am übelsten von allen mitgespielt hat; seine Frau, eine Gute, Dicke, Blonde, verkehrte, ebenso wie Frau Irma Siebenschein, übrigens in dem gleichen Café, in welches viel später Kajetan von S. den Sektionsrat Geyrenhoff ein oder das andere mal verschleppte, um dort gewisse wohlbeleibte Ehepaare in zensurbedürftiger Weise zu besingen, bei auch sonst unartiger Aufführung). Gleichzeitig mit dieser Stellung – welche den E. P. endlich von seiner Familie ganz unabhängig machte, weshalb er nun ohne Beschwer in der Porzellangasse wohnen blieb – verhalf Grete dem Kleinen indirekt auch zu einer Frau. Die lernte er in einem Büro der Bodencreditanstalt kennen, wo sie stenotypierte. Sie hieß Rosa mit dem Vornamen und wurde später, als sie schon mit E. P. verheiratet war, also ab 1924, Frau Roserl genannt. Beide blieben in der Bank tätig, was sie nicht unbedingt nötig gehabt hätten. Aber freilich, das Werk zu Smidary hatte der Bruder erhalten, und auch sonst war E. P. bei der Erbschaft nach seinen Eltern nicht eben vorteilhaft weggekommen, ganz abgesehen von der teilweisen Entwertung des Vermögens durch die Kriegsfolgen. In der Hauptsache blieb ihm nur die große eingerichtete Wohnung.
Zu Frau Mary K. ist E. P. nach dem Bruch mit Grete nie mehr gekommen, was verständlich erscheint.
Z