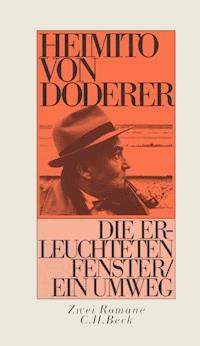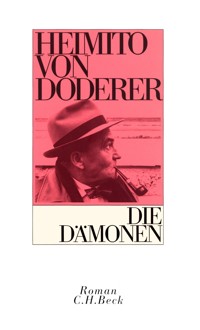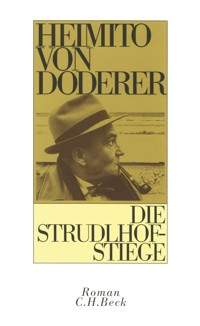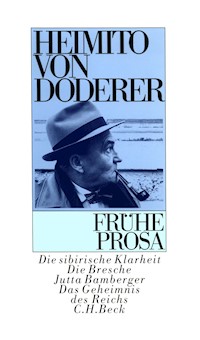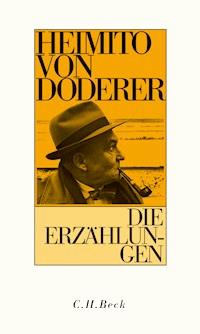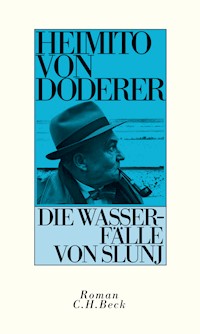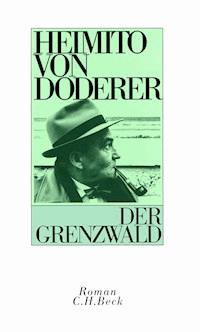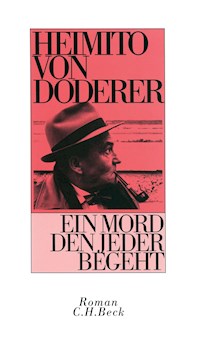
14,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: C. H. Beck
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Louison Veik, die jüngste Tochter des Landgerichtspräsidenten Veik, wird ermordet und ihres kostbaren Schmuckes beraubt. Die Such nach dem Mörder bleibt ergebnislos, der Fall muß zu den Akten gelegt werden. Sie ruhen sieben Jahre lang bis zu jenem Tag, da Conrad Castiletz die Schwester der Ermordeten heiratet. Er sieht zum ersten Mal das Bild der Toten, und eine tiefe und unerklärliche Zuneigung zu ihr überkommt ihn. Er versucht nun, von einem seltsamen Zwang getrieben, das Verbrechen aufzuklären, vernachlässigt dabei seine Frau und gefährdet seine Existenz. Aber er ist bereits so tief in den Bann der Toten geraten, dass der Sinn seines Daseins sich nur erfüllen kann, wenn er den Mörder findet. Die Entdeckung schließlich ist furchtbar ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
HEIMITO VON DODERER
Ein Mord den jeder begeht
Roman
VERLAG C. H. BECK
Zum Buch
Louison Veik, die jüngste Tochter des Landgerichtspräsidenten Veik, wird ermordet und ihres kostbaren Schmuckes beraubt. Die Suche nach dem Mörder bleibt ergebnislos, der Fall muß zu den Akten gelegt werden. Sie ruhen sieben Jahre lang bis zu jenem Tag, da Conrad Castiletz die Schwester der Ermordeten heiratet. Er sieht zum ersten Mal das Bild der Toten, und eine tiefe und unerklärliche Zuneigung zu ihr überkommt ihn. Er versucht nun, von einem seltsamen Zwang getrieben, das Verbrechen aufzuklären, vernachlässigt dabei seine Frau und gefährdet seine Existenz. Aber er ist bereits so tief in den Bann der Toten geraten, dass der Sinn seines Daseins sich nur erfüllen kann, wenn er den Mörder findet. Die Entdeckung schließlich ist furchtbar...
Über den Autor
Heimito von Doderer (1896–1966) gilt seit der Veröffentlichung seiner beiden großen Wiener Romane Die Strudlhofstiege (1951) und Die Dämonen (1956) als einer der bedeutendsten österreichischen Schriftsteller des 20. Jahrhunderts.
«Doderer ist ein ganz erstaunlicher Schriftsteller. Sehr berühmt und doch immer noch zu entdecken.»
Daniel Kehlmann
«Rätselhaft, daß wir es uns leisten, über diesen großen Autor hinwegzugehen.»
Walter Kempowski
Inhalt
Erster Teil
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Zweiter Teil
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
Dritter Teil
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
Vierter Teil
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
Erster Teil
1
Jeder bekommt seine Kindheit über den Kopf gestülpt wie einen Eimer. Später erst zeigt sich, was darin war. Aber ein ganzes Leben lang rinnt das an uns herunter, da mag einer die Kleider oder auch Kostüme wechseln wie er will.
Der Mann, dessen Leben hier erzählt werden soll – sein Fall hat innerhalb der deutschen Grenzen und noch darüber hinaus einige Neugier erregt, als hintennach die Sachen genauer bekannt wurden – dürfte fast einen Beleg dafür abgeben, daß man des bewußten Eimers Inhalt nimmer abzuwaschen vermag.
Als Kind rief man ihn „Kokosch“, seiner eigenen ersten und stammelnden Aussprache des Namens Conrad folgend. Was er schon als Knabe „sein Reich“ nannte – und später, in gehobener und angelesener Ausdrucksweise, „mein Knabenreich“ oder „mein Kinderland“ – das war der eine auslaufende Flügel einer Großstadt, welcher seine Häusermasse jenseits eines breiten und von Schiffen befahrenen Kanales unter dem Dunst bis an den Himmelsrand hinstreute. In der Tat war diese Häusermasse nicht in allen ihren Teilen zu geschlossenen Zeilen und Gassen gestockt, sondern vielfach aufgespalten, von unverbauten Feldern und Wiesenplänen unterbrochen, auf denen alte Bäume des Auwalds, Gebüsch und Jungholz standen. Manche Straße hatte nur auf der einen Seite Häuser, die schon in einer geschlossenen Reihe hinliefen, die andere Seite war jedoch leer. Hier sah man über Schotterhaufen, Holzstapel und das Geländer welches sich rückwärts vor der absinkenden Böschung des Kanals hinzog, über diesen selbst weit hinüber zu der vielgeteilten Stadtmasse jenseits des Wassers, und auch entlang, wo dieses langsam und glitzernd zwischen seinen zurückgelehnten Uferböschungen sich in einem Bogen nach links wandte. Dort stand der graugrüne Schaum der Baumkronen und dort traten die Wiesen heran. In der Ferne gab es Fabrikschornsteine, gereiht wie Pfeile in einem Köcher, und daneben noch die breiten und stumpfen Erhebungen der Gasometer, hinter deren von Gitterwerk überhöhtem metallischen Glänzen winters der Nebel, sommers das aufgekrauste Gewölk eines dampfigen Himmelsrandes lag.
In dem letzten Hause jener einseitigen Häuserzeile am Kanal wohnten Conrads Eltern im dritten Stockwerk, das sie allein als recht geräumige Behausung innehatten. Der Vater, Lorenz Castiletz, stellte zwar keinen reichen Mann vor, immerhin aber das, was man vermöglich zu nennen pflegt. Sein Arbeitsgebiet war der Tuchhandel, und er hatte zudem seit langem die Vertretung zweier holländischer Firmen, um welche man ihn nicht wenig beneidete, denn sie allein machten eine starke Stellung aus. Mit diesem Umstande und ferner damit, daß man unweit der Stadt eine an Grund und Boden, Haus und Hof, in ländlicher Weise begüterte Tante besaß, hing es zusammen, daß „Kokosch“, noch dazu als das einzige Kind, welches er war, auch während der Kriegszeit und der schlimmen ersten Jahre nach dieser, niemals nennenswerten oder gar seine Gesundheit bedrohenden Mangel litt. Jene Ereignisse gingen überhaupt am Hause Castiletz mehr auswärts vorüber. Der Vater, welcher sich auf eine merkwürdige Art – nämlich durch ein in längst vergangenen Jugendjahren allzu hingebungsvoll ausgeübtes Säbelfechten – einen Herzfehler zugezogen hatte, stand bei Kriegsanbruch nicht mehr im unmittelbar waffenpflichtigen Alter, und zudem wäre er aus dem erwähnten Grunde allein zum Felddienst untauglich gewesen. Zwischen Lorenz Castiletz und seinem Söhnchen klaffte ein Altersunterschied von siebenundvierzig Jahren.
Der Vater war ein großer und schöner Mann, mit langem, schwarzem Lockenhaar und einem kräftigen Schnurrbart, beides in anmutiger, ja beinahe koketter Weise von silbernen Fäden und Strähnen durchsetzt. Gutartig, freundlich und außerhalb seiner Geschäfte sehr zerstreut und unordentlich, konnte es jedoch bei ihm unversehens geschehen, daß er, von einem brutalen und wie nach innen gekehrtem Zorne plötzlich erfaßt, sozusagen schwarz wie Ebenholz wurde vor Wut und die unheimlichsten Beschimpfungen von sich gab. Die Wohnung verwandelt sich in solchen Fällen geradezu in einen Hohlraum des Schreckens, bis plötzlich der Vater bei irgendeiner Türe freundlich lächelnd ins Zimmer trat, bereit, sich bei jedermann zu entschuldigen, sei es bei der Mutter, die er küßte, sei es bei Kokosch, den er auf die Knie nahm. Aber das Erlebnis des plötzlich so tief verfinsterten Vaters wirkte bei dem Knaben nachhaltiger als die folgenden Tröstungen.
Einst war er in dem weißlackierten Vorzimmer von seinem tobenden Erzeuger betroffen worden, in einem ungelegenen, aber von seiten Kokoschs völlig schuldlosen Augenblicke: denn eben war jener im Begriffe, sich rechtzeitig zum Nachmittagsunterricht in die Schule zu begeben. Er hielt die Tasche mit den Büchern unterm Arme. Der Vater, dessen Stimme drinnen bei der Mutter urplötzlich laut geworden war, um alsbald in einen schreienden, ja brüllenden Ton überzugehen, kam durch die verglaste Doppeltüre des Empfangszimmers herausgeschossen und sah Kokosch da stehen, den er schon außer Hause geglaubt. „Du parierst, scheint es, auch nicht mehr Ordre, wie du solltest, du Kanaille!“ pfauchte er den Knaben an, mit verhältnismäßig leiser Stimme, was auf Kokosch den tiefsten Eindruck machte. „Marsch, marsch!“ rief jetzt der Vater, packte den Kleinen – der augenblicklich vor Schreck zu weinen begonnen hatte – hart am Genick und stieß ihn zur Türe hinaus. Nach dem Unterricht wurde Kokosch diesmal von seinem Vater abgeholt – was den Knaben beim Heraustritt aus dem Schulhaus erschreckte, denn sonst pflegte solches nie der Fall zu sein – aber Lorenz Castiletz überschüttete sein Söhnchen mit Zärtlichkeiten, stopfte den Buben beim Zuckerbäcker mit Kuchen und Schlagsahne voll und widmete sich ihm den Abend hindurch bei den Schulaufgaben – die solchermaßen im Handumdrehen fertig wurden – und beim Spielen. Er legte sich in seiner ganzen Größe auf den Bauch, um die Weichen der Uhrwerkseisenbahn genau und richtig stellen zu können, und die eintretende Mutter schlug bei diesem Anblick die Hände zusammen. Auch Kokosch war erfreut. Darunter ging das im Vorzimmer Erlebte doch in seine Träume ein, es waren stets schreckhafte Träume, in welchen er merkwürdigerweise die Matte aus braunem Rips, welche da draußen von der Eingangstüre bis zu der verglasten Tür des Empfangszimmers lief, mit einer außerordentlichen Deutlichkeit sah und jede Faser wie aus nächster Nähe, als ragte er selbst kaum zwei Spannen hoch über den Boden. Solches fehlte nie beim Traum vom zornigen Vater.
Jene plötzlichen Stürze ins Schwarz aber hatten bei Lorenz Castiletz durchaus und ausnahmslos die lächerlichsten Ursachen, und es war noch nie vorgekommen, daß er in dieser Weise bei irgendwelchen wichtigen oder auch nur einigermaßen erheblichen Angelegenheiten den Kopf verloren hätte. Sondern verrollte Kragenknöpfe und verknüllte Schlipse, verlegte Zettel, auf welchen nicht erledigte Besorgungen vermerkt waren: solches Gelichter lockte ihn in den Abgrund. Dieser letztere war zudem nicht immer ein nur vergleichsweiser, sondern wurde äußerlich sozusagen vorgeformt durch das Dunkel unter Schreibtisch und Sofa, wo etwa gesucht werden mußte, in tiefgebückter Stellung, welche für den entschieden zum Schlagfluß neigenden Mann mit dem geschwächten Herzen beklemmend war und ihn endlich – meistens unverrichteter Sachen – mit rotem Kopf wieder auftauchen ließ.
Wie viele schlampige Leute – deren Geheimnis wesentlich darin besteht, daß sie ein Ding hernehmen und gebrauchen, nie aber an seinen Platz zurücksetzen – behauptete er, man habe ihm etwas genommen oder verräumt, sobald es nicht an seinem Platze sich befand, was aber in dem stets neu ausbrechenden Chaos des Schreibzimmers geradezu übernatürlich gewesen wäre: bis auf die ersten zwei Stunden etwa, nachdem Frau Castiletz in Abwesenheit des Gatten wieder einmal Ordnung gemacht hatte. Hier aber lag vielleicht die größte Gefahr: denn ein solcher rationalistischer Eingriff zerstörte wieder alle jene im Leben gewordenen Pfade und Bahnungen des Gebrauchs, auf welchen dann die Dinge zwar einfach dahinten liegen blieben – woran sich aber ein im Halbschatten des Bewußtseins schnell und geschickt arbeitendes Gedächtnis des Suchenden wieder zurücktasten konnte; es gehört diese Fähigkeit zu den bedeutendsten und erstaunlichsten Seelenkräften der unordentlichen Leute: gerade sie aber wurden durch den Eingriff gelähmt, so daß nunmehr mit dem hellen Verstand gesucht werden mußte, welches Organ an sich ja ein kritisches ist; wehe, wenn den von ihm in solchen Fällen mit peinlichster Strenge geforderten Ordnungsörtern dann die äußere Entsprechung fehlte! Der Sturz in den Abgrund wurde möglich, ja mitunter unvermeidlich.
Man war also in Conrads elterlicher Wohnung nie ganz sicher, da es ja des Eintrittes äußerer Katastrophen oder Hiobsposten nicht bedurfte, um die Lage unhaltbar zu gestalten: vielmehr wurden jene im Hause selbst erzeugt. Man wird, auch ohne Frau Castiletz noch zu kennen, begreifen, daß sie solchem Wesen machtlos gegenüberstand. Es blieb ihr nichts anderes übrig, als sich’s unter den Gegebenheiten so bequem wie möglich zu machen, und ihren Gatten Lorenz einschlagendenfalls nicht durch Widersprüche zu reizen. Hierin hielt sie sich wacker, und es ist auch völlig unvorstellbar, was sonst geschehen wäre. Denn ihre bloße sanfte Hinnahme bedeutete in gewissem Sinne ja auch schon eine Steigerung der zur Entladung gelangenden Gewalten – insoferne nämlich, als Lorenz Castiletz dahinter stets eine besserwisserische Duldung witterte, die ihn bereits gewohnheitsmäßig nicht mehr ganz ernst nahm: und gerade das Letzte wollte er – wenn ebenholzschwarz – einmal gänzlich außer Zweifel gesetzt wissen.
Wer Frau Leontine Castiletz etwa persönlich gekannt hätte, der müßte dann auch wissen, daß es ein Wort gibt, welches ihr ganzes Wesen zulänglich umschreibt; es ist ja nicht eben ein Ausdruck von klassischer Haltung, jedoch hier vom Gehalte der Wahrheit erfüllt. Jenes Wort oder Wörtchen heißt: „blümerant“. Sie war eine blümerante Person, und seit das einmal von irgend jemand ausgesprochen worden, griff es hinter Frau Leontinens Rücken in ihrem Bekanntenkreise um sich, ja, es drang am Ende in die Verwandtschaft ein, wo man sich schon gar nicht stören ließ, sondern gleich ein Hauptwort schuf: „Die Blümerante“. Von da ab verschwand die Bezeichnung „Leontine“ gänzlich, es sei denn, daß die Trägerin dieses Namens gerade zugegen gewesen wäre.
Sie war eine hübsche Frau. Manche sagten, sie sähe so aus wie ihre Tante als Mädchen – das war jene, welche das Landgut besaß – aber Leontine war viel zarter, so daß die Gutsbesitzerin, eine schöne und recht üppige Dame, jetzt neben ihr beinahe mächtig wirkte. Vielleicht lag das am Alter. Frau Castiletz war um volle dreiundzwanzig Jahre jünger als ihr Gatte.
Sie war dunkelblond, und ihre Augen schwammen in einem seltenen Veilchenblau. Diese etwas schräg gestellten Augen – die äußeren Winkel schienen höher zu liegen – schwammen tatsächlich mehr, als daß sie blickten. Trotz der beinahe geschlitzten Form waren sie groß. Aber jeder Mensch, der vor sich hinsieht, entsendet einen Blickstrahl wie einen fliegenden Pfeil, kraftvoller oder schwächer vorgeschnellt. Bei Frau Castiletz fehlte ein solcher Strahl. Ihr Schauen breitete sich gleichsam seitwärts aus, wie die Ringe um einen ins Wasser geworfenen Stein.
Ja, es stand um ihre Augen, wie der Hof um einen trüben Mond, ein ständiger Schleier einer gewissen Unaufmerksamkeit, ein ringweis nach außen zerstreutes Sehen weit mehr als ein Suchen und Halten des Mittelpunktes in dem, was sie ansah.
Kokosch liebte seine Mutter sehr. Er konnte stundenlang zufrieden und völlig schweigsam auf dem Boden spielen, wenn sie im Zimmer saß mit ihrem Stickrahmen, den sie immer hatte und an welchem sie bei der Arbeit vorbeizusehen schien. Mitunter mochte man den Eindruck haben, daß Frau Leontine ein klein wenig schiele, aber das war nicht richtig.
An solchen einsamen Nachmittagen früher Kindheit, in welche nur dann und wann das Klingeln der Straßenbahn, das Tuten eines Dampfers vom Kanale klang, war der Knabe zweifellos glücklich und in sich selbst ruhend (und viel später erinnerte er sich mitunter daran und auch an die fernen Geräusche). Von Zeit zu Zeit pflegte er die Spielsachen – eine Festung mit Soldaten, Schiffe, die große Eisenbahn und noch anderes und Schönes – sein zu lassen und zur Mutter zu kommen. Er hockte vor ihr auf dem Teppich und rieb seinen Kopf und auch das Gesicht an ihrem Bein in dem glatten Seidenstrumpf. Dann machte er sich schweigend wieder an das Spiel, wobei Kokosch sehr erfinderisch war, einzelnen Einfällen durch Tage und wie verrannt nachging und Störungen aufs äußerste nicht leiden mochte. Sein Vater, der kein schlechter Beobachter war, kam einmal – die auf den ersten Augenschein hin stets gleiche und doch allmählich gegenüber der Festung sich von Tag zu Tag verändernde Aufstellung der Armee bemerkend – durch vorsichtiges Fragen dahinter, daß des Söhnchens Spiele Zusammenhänge bis über acht Tage aufwiesen, die man eigentlich als durchaus logische bezeichnen konnte. Kokosch erklärte dem Vater damals auch eingehend und vertraulich, welche große Rolle die Eisenbahn bei alledem spiele, und zeigte ihm die entsprechende Veränderung der Gleisanlage.
Frau Castiletz gehörte nicht zu den erzählenden Müttern. Sonst hätte sie mitteilen können, daß der Kleine, ohne eine Uhr (die er wohl schon kannte) im Zimmer zu sehen, und ohne daß man hier von einem Kirchturme hätte schlagen gehört, mit auffallender Regelmäßigkeit alle halben Stunden sein Spiel unterbrach und zu ihr kam – wie sie in der Stille über ihrer Armbanduhr festgestellt hatte.
Es hätte auch nicht zu ihr gepaßt, solche Mütteranekdoten zu erzählen. Sie beanspruchte nicht die Aufmerksamkeit ihrer Mitmenschen, sie drang nicht vor. Sie saß nur irgendwo dabei, mehr nicht. Ihre Haare waren gekraust und sehr locker, und sie hatte überhaupt etwas Aufgekraustes, Zerfließendes oder Zerfahrenes an sich, wie weiße Windwolken an Sommertagen. Ihre Kleidung war ebenso, und bei bunten Kleidern bevorzugte sie mit stiller Hartnäckigkeit ganz groß geblumte Muster, was sie stärker erscheinen ließ als sie war und zudem nicht immer und in allen Fällen sonderlich geschmackvoll wirkte. Es gab da mitunter stilisierte Blumen, von denen eine allein über den Rücken und noch tiefer reichte. Es mußte angenommen werden, daß sie derlei sich eigens beschaffte und auswählte. Aber mit Worten hörte man sie gar niemals irgendeinen Standpunkt vertreten, irgendeine greifbare Meinung äußern. Sie war oft freundlich verwundert. Wenn sie sprach, zerfielen ihre Sätze, kaum entstanden, so wie ihr Blick in Ringe zerfiel, kaum entsandt. Sie schien immer wie ein fernes Segel am Rand des Lebens draußen zu treiben. Es fanden sich Leute, welche ihr bei alledem Affigkeit nachsagten: das war ebenso unrichtig wie die Beobachtung, daß sie schiele. Sie war nicht affig. Sie war blümerant.
Ihrer Herkunft nach stammte sie aus der „Branche“, wie man vorlängst meistens noch statt „Zweig“ oder „Erwerbszweig“ zu sagen pflegte. Ihr Vater war seinerzeit Tuchfabrikant gewesen, die Mitgift achtbar, wenn auch nicht bedeutend. Immerhin, auch wenn man von der damals noch zu erwartenden Erbschaft absah, hatte Lorenz Castiletz „gut geheiratet“ – so nennt man das häufig in bürgerlichen Kreisen – als er mit fünfundvierzig Jahren das zweiundzwanzigjährige Mädchen bekam.
2
Conrads Elternhaus bildete, samt der einseitigen Straßenzeile, an deren vorläufigem Ende es stand, einen der letzten und neuesten Ausläufer des großen Stadtviertels jenseits vom Kanal, das aber in seinem Kerne ein trübes, ja selbst düsteres Gewinkel alter und zum Teil sogar uralter Gassen umschloß: sie blieben als Hintergrund den späteren Abschnitten und Zuständlichkeiten von Kokoschs Knabengeschichte vorbehalten. Diese spielte sich zunächst der Hauptsache nach in einem von drei Punkten begrenzten Gebiete ab. Der erste Punkt war die elterliche Wohnung und darin im besonderen Conrads Knabenzimmer, ein großer, heller Raum, mit weiter und bedeutender Aussicht, wie sich nach der Lage von selbst versteht. Der zweite Punkt lag jenseits des Wassers: das Schulhaus. Der Weg dahin war keineswegs weit, man mußte nur die Zeile zurück bis zu einer großen Brücke gehen, und dann lag’s linker Hand, geradeaus am oberen Ende einer langen Straße, die etwas anstieg. Lief man nach der Schule bergab, dann konnte man auf dem Bürgersteig große Geschwindigkeiten erreichen, was natürlich rudelweis geübt ward und nicht eben zur Freude der Erwachsenen. Der Vater Castiletz hatte Wert darauf gelegt, daß Conrad gerade diese Schule besuchte, und den Jungen dort rechtzeitig einschreiben lassen. Denn es waren jene fünf Klassen das Anhängsel einer großen Anstalt, worin junge Lehrer für ihren Beruf vorbereitet und gebildet wurden. Diesen dienten die Schüler gleich als pädagogische Versuchskaninchen; und das hatte zur Folge, daß hier immer auf die neueste und beste Art, welche man jeweils gerade zu haben glaubte, gelehrt ward, weshalb die Schule im Geruche besonderer Neuzeitlichkeit und Fortgeschrittenheit stand. In dem gleichen und beinahe riesenhaft zu nennenden Gebäude befand sich obendrein auch eine Mittelschule, so daß die Kinder, aufsteigend, am selben Orte und beim schon gewohnten Schulwege verbleiben konnten.
Der dritte Punkt in dem Dreiecke, das von ungefähr Conrads Knabenzeit umschloß und damit auch sein „Reich“ („Kinderland“, „Knabenreich“), lag so recht in dessen Schwerpunkte und zugleich an dessen äußerster Grenze: nämlich gerade gegenüber jenen Fabrikschloten, die wie gereihte Pfeile auf der anderen Seite des Kanales aufsprangen. Bis hierher pflegte er durch Wiesenpläne, Gebüsch und Auwald meist vorzudringen und im allgemeinen nicht weiter. Denn rückwärts standen wieder Häuser und Fabriken, lief die Eisenbahn, und vor allem das so gut wie endlose hohe Gitter eines Rennplatzes.
Conrad gehörte nicht zu jenen Knaben, die noch bis weit in die Mittelschule hinein mit einer Erzieherin gesegnet sind. Man ließ ihn bald frei herumlaufen als richtigen Straßenjungen, wenn er nur zur Zeit wieder heimkam. Die Eltern erwiesen sich hier als sorglos, ja bei Lorenz Castiletz schien die Zulassung solcher Freiheit aus einer Art von Überzeugung zu kommen. Kokosch war im Besitze jener großen Begabung, ja beinahe Kunst, welche jedes Schülerleben erleichtert ebenso wie das eines Rekruten: die Kunst, nicht aufzufallen. Er fiel weder durch Kenntnis noch durch Unkenntnis auf, seine Leistungen hielten sich sozusagen in einem schlichten Grau, ebenso wie sein Betragen, und so kam er durch eine Klasse nach der anderen als ein Mitläufer, an welchen sich die Lehrer schon gewöhnt hatten. Seinen Eltern bereitete er in diesen Sachen niemals Sorge. Lorenz Castiletz fand das selbstverständlich, und er hätte andernfalls den Jungen wahrscheinlich geprügelt.
Nein, die Bedenklichkeiten kamen hier aus anderen Ecken, und Conrads Knabenzeit war das ausgemachte Gegenteil von dem, was man damals eine „Schülertragödie“ zu nennen pflegte.
Unmittelbar vor dem Haustore begann eigentlich schon das „Reich“, wenn man so über die Straße blickte, zu den Holzstapeln, dem dazwischen wieder stückweis sichtbaren Geländer, über den Kanal und auf die Häusermasse an dessen anderem Ufer. Neben dem Hause lagen zunächst einige künftige Bauplätze, jedoch nicht umplankt, sondern offen und noch uneben, mit vielen Hüglein und Berglein, über welche spielende Kinder zahllose glattgetrampelte Pfade und Weglein getreten hatten und in die überall Löcher gegraben waren wie Tunnels und Straßen: es sah stellenweise aus wie der Bau irgendwelcher Nagetiere. Eine große Tafel auf zwei Pfosten kündete den Besitzer und daß diese Gründe käuflich zu erwerben seien. Die Tafel stand schon lange da, ihre Bretter waren fast grau von Wind und Regen.
Dieser etwas öde Platz war von den richtigen „Steppen“ oder „Pampas“ getrennt durch einen breiten Weg, der senkrecht gegen den Kanal und dessen Uferstraße herauslief.
Von da ab zogen sich die Wiesen weithin. Jüngere Laubbäume in Gruppen und Strichen standen an ihren Rändern, teilten sie da oder dort. In der Mitte aber, ganz frei auf solch einer graugrünen Fläche, erhob sich mitunter ein Riesenbaum, dessen höchste Zweige schon fern dort oben waren vor dem blauen Himmel und mit den Sonnenstrahlen verschmolzen. Unten pflegte der umfängliche Stamm fast immer glatt geschabt zu sein und ohne Borke: denn viele Kindergeschlechter hatten rundum Haschen gespielt. War der Baum hohl, dann hatte man überdies noch tiefe Grabungen im umgebenden Erdreich unternommen – die mit der Zeit zu rechten Fallgruben geworden waren – um das Versteck zu vergrößern. Oder überhaupt zu keinem Zwecke, sondern um des Grabens willen. Immer fand sich dann wer, der tiefer scharrte. Zwei, drei kleine Jungen etwa und ein Mädchen, alle mit ernsten Gesichtern, schmutzigen Nasen und Händen.
Weite Flächen waren mit dichtem und auf den ersten Blick undurchdringlichem Gebüsche bedeckt. Aber es gab darin Weglein, und zwar ganz zahllose. Nicht breiter als ein sehr schmaler Mensch. Das Gebüsch stand dann links und rechts in übermannshohen Wänden. Man entdeckte mit Freude und Überraschung Hohlräume, ja ganze Zimmer in diesen Dickungen, mit Wänden und Decken, die aus den zähen und langen Ranken der Schlingpflanzen fest geflochten waren. Jedoch, bevor man noch in der grünen Verborgenheit eines solchen Zeltes sich niedergelassen hatte, war man meist schon in einen Unrat getreten, wovon hier alles voll lag, wie sich bald zeigte. Die nächtigenden Stromer hatten sich keinen Zwang angetan.
Von all den vielen Jungen aus der Nachbarschaft, welche sich ständig hier herumzutreiben pflegten, war es eine bestimmte Gattung, die alsbald Conrads begierige Anteilnahme fesselte: jene nämlich, welche an Sommerabenden bei Einbruch der Dämmerung aus den Auen zurückkehrten mit großen Einmachgläsern, die sie an einem geschickt um den oberen Vorsprung gelegten Gehenk aus Bindfaden trugen. In den Gläsern war Wasser, und darin schwammen vierbeinige geschwänzte Geschöpfe herum, teils in prächtigen Farben, andere wieder sahen bleich und durchscheinend aus: allerlei Lurche, Kaulquappen und ähnliches Getier, aus stehenden toten Wasserarmen des großen Stroms erbeutet, der da weit rückwärts irgendwo lief, wohin man aber selten kam. Solcher Tümpel indessen gab es auch zwei in Conrads Jagdgründen; und gerade sie wurden von den Jungen bevorzugt, ihrer besonderen Ergiebigkeit wegen.
Denn jene erhielten vom Tierhändler für jedes unversehrte größere Stück einen Zehner, weil man solcher Wasserbewohner mitunter bedurfte, sei’s zur Abgabe an Aquarienfreunde oder als Versuchstiere für gelehrte Anstalten. Es erscheint bemerkenswert, daß Conrad von diesem geldlichen Hintergrunde der Forschung in den Tümpeln und des vielen Herumsteigens und Herumfischens darin erst viel später zufällige Kenntnis erhielt, als er beinahe schon erwachsen war. Hier hatte ein sicherer Zusammenhalt jeden unerwünschten Wettbewerb ausgeschlossen.
Conrads Verhalten diesen Jungen gegenüber, mit denen er alsbald bekannt wurde, war aber eigentlich ein solches, das ihn hätte beliebt machen müssen. Am ersten Nachmittage, da er sie begleitete, gebrauchte er zum Beispiel gleich – und mit einer gewissen Feinhörigkeit und Eilfertigkeit – ihre für ihn mitunter recht fremde Ausdrucksweise, einschließlich der eigentümlichen Namen, die sie den Tieren gaben, welche dem kleinen Castiletz freilich aus der Naturgeschichte unter ganz anderen geläufig waren. Aber er bediente sich der ihren. Einen sprach er auch mehrmals vollkommen verdreht aus, die Jungen sahen sich an und lachten, verbesserten ihn aber nicht. Beim Fangen erwies sich Conrad als geschickt. Seine Beute kam auch in die großen Einmachgläser. Abends streunte er dann mit den Jungen durch die Wiesen und Buschwälder heimwärts und in die ersten Gassen hinein. Hinter den Bäumen lag ein langer rötlicher Streif am Himmel, in der herabsinkenden Dunkelheit lärmten die Wagen, klingelten die erleuchteten Straßenbahnzüge: es schien ihm fast ungewohnt, nach so vielem Entlangschlüpfen durch das Uferdickicht, Waten mit bloßen Füßen, wo sich eine sandige, schlammfreie Stelle fand, nach so stundenlangem versunkenen Hineinstarren in das Wasser, immer wieder den Bewegungen eines kleineren oder gar größeren höchst anziehenden Geschöpfes gespannt folgend, bis es in Reichweite der Hand kam, mit einem ruhigen, sehr aufmerksamen Griffe von rückwärts genommen werden konnte, jetzt als greifbarer Erfolg in des Wortes genauester Bedeutung in der Hand zappelnd sich regte: herausgehoben sah es dann, samt dem Schlamm, der immer dabei war, jedesmal kleiner aus, als Conrad erwartet hatte.
Einzelne von den Jungen fielen am Heimwege da und dort in seitliche Gassen ab, sie gaben den anderen kaum einen Gruß, als sie sich entfernten, und Kokosch beachteten sie überhaupt nicht. Dieser ging am Ende mit dem Letzten, welcher mit ihm noch ein Stück des Heimweges gemeinsam zu haben schien, weiter. Conrad begann zu sprechen, fragte, in welche Schule jener gehe, und ob es noch größere Molche dort in dem Wasser gebe als die heute gefangenen. Die Antworten des anderen Knaben hatten sozusagen einen sehr kurzen Atem. Bei seinem Haustore grüßte er mit einer merkwürdigen Förmlichkeit in einer fühlbar für diesen Anlaß gereinigten Sprache und verschwand hinein.
Daheim in seinem Zimmer suchte Conrad, gleich nachdem er das Licht angedreht hatte, einen kleinen roten Eimer hervor, den er aus früheren Zeiten, vom Graben am Sandhaufen her, noch besaß, ging in die Küche, wo schon das Abendbrot vorbereitet wurde, und ließ das Gefäß voll Wasser laufen, um es so auf sein Dichthalten zu prüfen.
Nach dem Abendessen überblickte Conrad die Sachlage bei den Schularbeiten und vertiefte sich auf das heftigste ins Latein und in die Geographie. Um halb zwölf Uhr nachts kam sein Vater vor dem Schlafengehen noch herein, verwundert über das späte Licht.
„Nun, mein Armer“, sagte er, „noch so viel zu lernen für morgen?“
„Nein, Vater“, sagte Conrad wahrheitsgemäß, „ich war schon heute nachmittag um fünf Uhr fertig. Aber ich will morgen etwas länger in die Auen gehen, und so arbeite ich im voraus für übermorgen.“
„Ja, das sind so die Geschäftsdispositionen“, sagte Lorenz Castilez beiläufig, lachte, streckte die Arme über den Kopf empor und gähnte dann. „Na, geh nur bald zur Ruhe, mein Junge.“
Auch die Mutter kam noch. Conrad drückte mit einer gewissen kaum merklichen Heftigkeit seinen Kopf an ihre Schulter. –
In der Au, am folgenden Nachmittage mit seinem roten Eimerchen anlangend, fand er den Platz noch leer, die Ufergebüsche noch nicht bewegt von hindurchschlüpfenden Knaben, das Wasser noch nicht rauschend und plätschernd vom Waten darin. Er setzte den trockenen Eimer ins Gras, bei einem alten Baume, der, flach gekrümmt, ein Stück noch fast waagrecht über den Boden hinlief; dann erst schwang sich der Stamm empor. Es sah aus wie eine Ruhebank. Conrad setzte sich. Am anderen Ufer drüben, wo das Wasser tief war, hingen die Wipfel von Baum und Strauch über, stellenweise bis in den Spiegel hinein. Der Himmel war von blassem und doch heißem Blau, darin ferne hohe Baumkronen standen wie Wolken.
Die herrschende Stille beklemmte Kokosch ein wenig, nicht aber mit der Empfindung eines schweigenden Druckes von allen Seiten, wie dies gewöhnlich ist, sondern durch ihre Weiträumigkeit, in welche er sich gleichsam verteilt fühlte, ohne solchem Gefühl doch Folge geben zu können. Dort drüben schwammen die fernen Baumkronen in der Höhe. Hinter ihm lief der Tümpel, teils zwischen Stämmen und Gebüsch, dann wieder von den sich leicht absenkenden Wiesenflächen begleitet, ein Stück nach rückwärts und endete vor einer hohen Böschung, die zu dem Rennplatze an den Grenzen des „Reichs“ gehörte. Linker Hand von der natürlichen Ruhebank, auf der Conrad saß, floh freie „Steppe“ weit hinaus. Dorthin wäre er jetzt am liebsten gelaufen, wenn es schon nach allen Seiten zugleich nicht möglich war. Indessen er blieb sitzen, fast bewegungslos, und blickte auf das rote Eimerchen zu seinen Füßen im Grase. Plötzlich dachte er sehr lebhaft an die Mutter, wie sie gestern abends noch in seinem Zimmer gestanden hatte. Er fühlte einen feinen, jedoch scharfen Zug in der Nähe des Herzens, sprang zu Boden und nahm den Eimer auf.
Es gelang ihm bald, zwei schwarze Wassersalamander von beträchtlicher Größe zu erbeuten, da die Tiere, von niemandem noch aufgescheucht, nahe beim grasigen Ufer an einer ganz flachen Stelle gesessen hatten. Als er den zweiten in dem nun halbgefüllten Eimer barg, raschelte das Gebüsch, plantschte da und dort schon das Wasser, tauchten am Ufer entlang überall die Knaben auf. Sie mußten Conrad zuerst gesehen haben, hatten ihn jedoch nicht angerufen. Der zuletzt gestern mit ihm gegangen war, fragte nun, ob Conrad schon etwas habe. Dieser zeigte die zwei Tiere im Eimerchen und stellte das rote Gefäß zu der Gruppe von Einmachgläsern, die in hohem Gras bei dem Baume niedergesetzt worden war.
Das Wasser entlang tönten schon einzelne erregte Rufe derjenigen Jungen, die gleichfalls jetzt Beute gemacht hatten.
Conrad verfolgte sein Ziel, noch einen dritten großen Molch zu bekommen. Er ließ zwei oder drei kleinere Stücke ungefangen und erreichte, was er wollte, erst nach einiger Zeit, und zwar auf der anderen, tiefen Seite des Tümpels, abseits von den lärmenden Knaben. Ein großer, wohl über spannenlanger Bursche saß dort am Rande, den breiten Kopf fast aus dem Wasser erhoben. Die geringste unvorsichtige Bewegung allerdings konnte ihn zurück in die Tiefe scheuchen. Zudem war das Ufer hier steil und nicht anders zugänglich, als daß man sich an einem Stamme hielt. Ein vorhängender Ast wäre hiezu wohl besser geeignet gewesen, mußte jedoch durch sein Schwingen und Rauschen den ganzen Plan vereiteln. Conrad überlegte genau jeden Griff, behielt das Tierchen dabei im Auge, und der Feldzug gelang. Nun mußte er mit seiner zwischen den hohlen Händen sorglich und doch fest gehaltenen Beute um den Tümpel wieder herumgehen, bis dorthin, wo sein roter Eimer mit den beiden anderen Molchen stand. Beim Baume hockte einer von den Knaben. Als Conrad das Gefäß aufnahm, fand er es leicht und leer, ohne Wasser und ohne Tiere. „Wir haben sie gleich rübergetan“, fand nun der Andere doch für nötig zu erklären und wies auf die großen Gläser, worin jetzt Conrads frühere Beute schon zusammen mit anderer schwamm. „Gut“, sagte Conrad ohne weiteres, „da werde ich mir neue fangen, denn ich will heute auch welche mitnehmen“. „Sie fressen Fliegen“, sagte der Junge und blinzelte listig. „Nein, sie fressen keine Fliegen, sondern Regenwürmer und ähnliches, leben aber mitunter sehr lange auch ohne Nahrung“, antwortete Kokosch, und, zu seiner Verwunderung, ohne Angleichung an die Sprechweise seines Gegenüber: es klang ihm selbst, als hätte er aus einem Schulbuch vorgelesen, und er lachte. Der Eimer wurde wieder halb gefüllt, der Neuling hineingesetzt. Nun behielt jedoch Conrad sein Gefäß bei sich, was auch wegen der zu erhoffenden Beute besser war, denn er ging wieder weit um den ganzen Tümpel auf die andere, tiefe Seite.
Es dauerte lange genug, bis Ersatz für die entwendeten Tiere gefunden war, jedoch befand sich darunter das größte Stück, welches Conrad bisher überhaupt gesehen hatte. Als wieder drei Molche im Eimerchen herumschwänzelten, fing Conrad dennoch weiter, aber was er nun erbeutete, brachte er den Jungen und setzte es in ihre Gläser. Jene zeigten sich zum ersten Male einigermaßen freundlich gegen ihn – und vornehmlich der eine, dem er sozusagen den Text aus dem Lehrbuch gelesen hatte – sie dankten für die Stücke, die er ihnen gebracht, liefen alle um den roten Eimer zusammen und bewunderten den „Riesen“.
Als Kokosch jedoch gesprächig wurde und sich, sonderlich auf dem Heimwege, mit Gewandtheit der Ausdrucksweise seiner neuen Freunde befliß, versanken diese wieder in ihre frühere Einsilbigkeit.
Zu Hause angelangt, weihte Conrad sogleich nach dem Aufschließen der Türe das Stubenmädchen in seinen neuen Schatz ein. Sie war eine ganz junge und noch recht kindische Person, die dem Knaben stets wohl wollte. In seinem Zimmer betrachteten beide angelegentlich die Tiere im Eimer und beschlossen dann, diesen auf den Kasten hinaufzustellen, welches der sicherste Platz war, und die Beschaffung eines größeren und standfesteren Gefäßes.
Es gab einen Glasermeister beim Schulgebäude – sein Geschäft sollte übrigens in Kokoschs näherer Zukunft noch eine bedeutende Rolle spielen – der auch allerhand Waren seines Zweiges führte, Spiegel, Krüge, Flaschen, mancherlei Gefäße für besondere Zwecke, und obendrein kleinere und größere Wasserbehälter oder Aquarien. Sie waren völlig aus Glas gegossen, in flacheren oder höheren Formen zu haben, und Conrad hatte sie oft in dem kleinen Schaufenster stehen gesehen, ohne ihnen weitere Beachtung zu schenken: jetzt aber entsann er sich ihrer. Als am nächsten Tage die Schularbeiten überblickt und nach zwei Stunden auch beendet waren – Geschäftsdispositionen und ihre Durchführung, um mit Lorenz Castiletz zu reden, und eigentlich paßte das gut auf die Haltung des Söhnchens in diesen Sachen! – danach also machte sich Conrad, unter Mitnahme seiner gesamten Barschaft, auf den Weg zum Glaser. Hier zeigte sich erfreulicherweise, daß die Preise weit niedriger waren als Kokoschs Voranschlag, und so konnte ein Gefäß von ziemlicher Größe als Palast für die Molche angeschafft werden. Es war länglich und mehr breit als hoch. Halb mit Wasser gefüllt – dieses wurde eigens in einem großen alten Kruge aus dem Tümpel geholt, samt den schwimmenden Linsen und anderen Pflanzen – entsprach es seinem Zwecke vollkommen, und die schwarzen Tiere schwänzelten eilfertig darin herum, mit Bewegungen, die manchmal ein wenig an die der Forellen erinnerten.
Es war eine seltsame Zeit. Es war die Molchzeit! Kokosch erwachte des nachts in seinem Bette, das so stand, daß er von den Kissen durch das zweite Fenster gerade gegenüber hinaussehen konnte. Einzelne Dachkanten des ansteigenden Stadtteiles jenseits vom Kanale setzten sich fern und von irgendeinem unbestimmten Lichtschimmer bestrahlt vor dem dunklen Himmel ab. Ein Scheinwerfer wanderte mit seinem Widerglanz über die Zimmerdecke. Ein ferner Eisenbahnpfiff ertönte von der Gegend des Rennplatzes her, wo der Bahnkörper lief. Unweit davon lag in der Dunkelheit auch der Molchtümpel. Ob die Tiere wohl Heimweh hätten, fragte Conrad sich plötzlich. Ein leises Glucksen ließ sich hören; sie erzeugten oft solche kleinen nächtlichen Geräusche, die in Kokosch ein beinahe zärtliches Gefühl erweckten. Er glitt aus dem Bett, nahm seine elektrische Taschenlampe und, auf einem Sessel stehend, beleuchtete er das Aquarium oben am Kasten. Da stieg schon einer auf und ab hinter der Glaswand, durch sachte Ruderschläge des platten Schwanzes sich hebend, beim Sinken die Vorderbeine ausgebreitet, die wie kurze Arme mit kleinen Händchen aussahen. Der breite Kopf war Kokosch zugewandt, und die winzigen dunklen Perlen der Augen sahen ihn geruhig an.
3
Um diese Zeit gewann Kokosch, eigentlich erstmalig, einen Freund in der Schule, denn bisher war sein Umgang mit den Kameraden ein nur oberflächlicher und gelegentlicher gewesen, im Schulhause selbst und an den verschiedenen Stätten und Plätzen körperlicher Übung und Erziehung.
Jener Junge hieß Günther Ligharts, stammte aus dem Norden und war vornehmer Leute Kind. Als Lorenz Castiletz aus dem Munde seines Söhnchens in zufälliger Weise den Namen hörte, wußte er über die Familie gleich Bescheid. Sie bewohnte ein großes Haus, das im Villenviertel der Stadt lag. Der kleine Günther hatte zum erstenmal auf dem Heimwege von der Schule mit Kokosch etwas länger gesprochen und war dabei mit ihm gegangen, obwohl die Straßenbahn, welche jener benutzen mußte, in einer anderen Richtung zu erreichen gewesen wäre. Nun, als Mittelschüler, pflegte man allerdings die lange gerade Straße bis zur Brücke über den Kanal nicht mehr aus Leibeskräften bergabrennend zurückzulegen, sondern man schlenderte gemächlich und hatte daher Zeit zu Gesprächen. Ja, man ging sogar eben wegen dieser Gespräche recht langsam und blieb an den Ecken stehen. Kokosch erzählte, wie es ihm gelungen sei, die Molche zu füttern. Er hatte Regenwürmer ausgegraben, aber eigentlich wenig Hoffnung gehabt, daß die Salamander in der Gefangenschaft fressen würden, und deshalb schon beschlossen, die Tiere von Zeit zu Zeit auszutauschen, das heißt, andere zu fangen und die bisherigen Bewohner des Aquariums an dem Orte ihrer Herkunft wieder in Freiheit zu setzen. Jedoch als er zum ersten Male einen Wurm in das Wasser des Behälters hineinhängen ließ, dauerte es gar nicht lange, bis ein Molch herbeischoß und anbiß, den Wurm mit seltsam schaukelnden Bewegungen Stückchen um Stückchen in sich hineinbeutelnd, bis er ganz verschwunden war. Ja, Kokosch bemerkte bald, daß er dabei das andere Ende des Regenwurmes nicht loszulassen, sondern nur ein wenig nachzugeben brauchte: den Salamander störte das wenig, er fraß sozusagen aus der Hand. Ließ jedoch Conrad loß, dann geschah es häufig, daß ein anderer von den drei schwarzen Brüdern das freie Ende verschluckte, worauf es am Grunde des Wassers nun zwischen beiden Fressern zu einer Art Tauziehen kam – die Kämpfer stemmten dabei ihre Beinchen höchst niedlich gegen den Boden – oder aber die Schlingenden schließlich mit den Köpfen zusammenstießen und jeder sein Teil abbiß.
„Du, höre, das möchte ich aber gerne sehen“, sagte Günther, „darf ich mal zu dir kommen?“
„Ja freilich!“ antwortete Kokosch erfreut. Günther ging noch bis über die Brücke mit. Ein Dampfer kam den Kanal herab und legte seinen hohen Schornstein um. Die Jungen, über das Geländer gebeugt, sahen zu, wie das Schiff, mit den vielen Einzelheiten seines Decks und den Männern, die sich darauf bewegten, unter ihnen wegglitt, wobei man durch einige Augenblicke die Empfindung hatte, samt der ganzen Brücke stromauf zu fahren.
Kokosch hielt seine Molche drei Tage lang knapp bei Futter, sammelte aber Würmer von geeigneter Größe in die Blechbüchse ein.
Am dritten Tage gegen fünf Uhr kam Ligharts, wie verabredet. Als es schellte, lief Conrad in den Vorraum. In dem lichten Treppenhause stand der blonde Junge vor der Tür, und Conrad fühlte sich, wie schon einmal, in seltsamer Weise bewegt durch Günthers Antlitz, das, wenn auch breit und mit auseinandergestellten Augen, doch eine Überschärfung der Züge wies, als hätte man jeden einzelnen noch einmal nachgezogen, und eine Zierlichkeit im Ausdruck, die irgendein weit hinter diesem Gesichte liegendes sehr helles Geheimnis ahnen ließ.
Während sie dem putzigen Herumschießen, Schnappen und Beuteln der Molche zusahen – Günther konnte davon nicht genug bekommen, und sie verfütterten den gesamten Vorrat aus der Blechbüchse – trat das Mädchen ein, das auf Weisung Frau Leontinens für beide Knaben den Nachmittagskaffee und Kuchen brachte. Conrad setzte sich mit Ligharts, nachdem sie im Badezimmer die Hände gewaschen hatten, an das kleine Tischchen vor dem breiten Fenster, und Günther, der sich hier augenscheinlich wohlzufühlen schien, langte gleich zu. „Eine schöne Aussicht hast du da“, sagte er, mit dem Kuchen im Mund, schluckte und setzte hinzu: „Dieses Zimmer ist überhaupt gut, ich meine, es muß hier gut sein, und das ist doch sehr wichtig.“ „Ja“, antwortete Conrad und wurde für einen Augenblick nachdenklich, „es ist wichtig.“ Ligharts sprach ein ganz außerordentlich reines Deutsch, wovon er niemals abwich. Es war jedoch diese Sprache, die nicht nur von einer grammatikalischen Ordentlichkeit lebte, unbestimmbar nach ihrer Herkunft: man hätte daraus nicht sogleich entnehmen können, daß dieser Knabe gerade aus dem Norden stammte. Vielmehr schienen Sprachton und Ausdrucksweise sich von vielen, ja vielleicht von allen deutschen Mundarten sozusagen im geheimen zu nähren, wodurch Günthers Art zu reden bei aller Sauberkeit doch nie der Wärme ermangelte. Conrad vermochte sich diesen Sachverhalt allerdings nicht klarzumachen, jedoch er empfand ihn lebhaft auf seine Art.
„Du lernst fechten?“ fragte Günther, als er Conrads Fechtzeug, Rapier, Maske und Handschuh, in der Ecke sah. „Aber in der Schule nimmst du nicht am Fechtunterricht teil.“
„Mein Vater meint, daß beim Fechten mehr Einzelunterricht notwendig sei, als man in der Schule erteilen könne. Er ist heute noch Vorsitzender des Fechtklubs ‚Hellas‘ und läßt mich dort mit dem sogenannten Nachwuchs unterrichten.“
„So dachte ich auch oft“, meinte Günther, „daß nämlich diese Übungen in langen Reihen, zu dreißig und vierzig, nie den Wert eines Einzelunterrichtes erreichen könnten. Zudem ist mein alter Herr der gleichen Meinung.“
„Willst du bei ‚Hellas‘ fechten? Ich sag’s meinem Vater, und er läßt dich in den Nachwuchs aufnehmen.“
„Ja doch! Wenn du das einrichten könntest, das wäre fein.“
Günther begann plötzlich wieder von den Tieren zu sprechen und fragte mitten aus diesem Zusammenhang, ob Conrad ein Bild „Der Kampf mit dem Drachen“ von einem Maler namens Böcklin kenne.
Nein, Conrad kannte das Bild nicht. „Dort ist der Drache wie ein Molch gebildet, ganz so wie die deinen dort oben, nur groß und gepanzert“, holte Günther aus. Was nun zum Vorschein kam, war erstaunlich. Er wußte genauesten Bescheid in diesem Teil der Geschichte des Tierreiches: etwa, daß die Lurche gegenüber den Reptilien einen älteren Zweig darstellten, wovon man viele Überreste besitze, daß aber heute noch eine sehr große Salamanderart in Japan lebe, über einen Meter lang. Weiter sprach Günther von den eigentlichen Drachen früherer Zeitalter, von den Schlangendrachen, den Flugdrachen, deren Schwingen bis zu neun Metern klafterten, von den riesenhaften ungeflügelten Arten, wandelnden Bergen gleich: und er beschrieb lebhaft und genau die damalige Landschaft, und sagte, das Antlitz der Erde unter dem heißen blauen Himmel jener Zeiten müsse einen Zug unendlicher Leere und Offenheit gehabt haben, mit den wandernden Gruppen zauberischer stummer Tiere, den flachen Bergen, den eben erst vom Wasser verlassenen Ebenen, den starren Formen der Schachtelhalmwälder mit ihren von Leben wimmelnden Sümpfen.
Conrad sah in den Abend hinaus, der schon mit breiten rötlichen Lichtbahnen über den Stadtteil jenseits des Kanales trat. Eine Fensterreihe begann im Widerschein zu strahlen. Was er eben hörte, schien ihm wunderbar und neu. Aber das eigentlich Neue, wie es ihn berührte, war, daß Ligharts sich offenbar ganz aus eigenem mit alledem beschäftigt hatte. Man konnte also aus freiem Entschluß und Ermessen sich irgendeiner Sache zuwenden. Man konnte also – in irgendeine Richtung gehen. Er sah sich plötzlich selbst dort am Wasser auf dem waagrecht laufenden Stamme des Baumes sitzen, ganz still sitzen. Aber was dies nun bedeuten mochte, das wußte er nicht.
„Du hast dich mit alledem beschäftigt?“ sagte Kokosch. „Und wie kamst du darauf, wie verfielst du gerade darauf?“
„Ja“, antwortete Ligharts, „das könnte ich nun gar nicht angeben. Weißt du denn, wie du eigentlich auf deine Molche verfallen bist? Hast du denn eines Tages dich selbst gefragt: was will ich haben? – und die Antwort lautete: ich will Molche haben?“
„Nein, so war es nicht“, sagte Conrad.
„In der Tat, so war es nicht, auch bei mir nicht. Sollte aber wohl so sein. Dann wäre man – frei und täte, was man will.“
„Frei –“ sprach Conrad nach. Ein kleines Glucksen ertönte in der folgenden Stille. Er blickte, beinah verstohlen, zum Aquarium hinauf. Ligharts bemerkte es wohl.
„Komm“, sagte er, „laß mich deine niedlichen Burschen noch einmal ansehen. Sie sind zu nett.“
Nun standen sie wieder auf Stühlen und schauten in das Bekken hinein, dessen Wasser von zwei Taschenlampen durchleuchtet war, denn Ligharts hatte auch eine im Sack gehabt. Die zarte, tiefschwarze Haut der Tiere glänzte auf, wenn der Lichtkegel sie streifte, und ihre platten Ruderschwänze erschienen ganz durchsichtig.
4
Es scheint bemerkenswert, daß Kokosch, trotz des nunmehr häufigeren Umgangs mit Günther Ligharts, gleichwohl immer wieder Zeit zu finden wußte für seine in den Auen nach Molchen, Wasserschnecken und Schwimmkäfern fischenden Freunde. Er kümmerte sich um sie, ja, es wäre fast erlaubt zu sagen, daß er sich um sie bewarb. Neuestens sogar mit Zuckerwerk, wovon er auf dem Wege zu ihnen eine Tüte voll einzukaufen pflegte. Conrad hatte für Näschereien keinerlei Vorliebe – zum Unterschied von Günther, welcher derlei nahm, wo er’s nur kriegen konnte – aber er bot sie den Naturforschern dort am Tümpel an, die sich nicht selten in einer befremdlichen Weise zierten, sodann etwa sagten: „Ich bin so frei“, und zwar mit einem sozusagen zusammengenommenen und dabei säuerlichen Munde – und nun endlich zugriffen, um alsbald wieder in ihr plattnasiges und mürrisches Wesen zurückzufallen.
Conrad verhielt sich eigentlich so, als hätte er bei diesen Knaben irgendeine Sache von Wichtigkeit unerledigt gelassen, die hinter sich zu bringen ihm durchaus nicht gelingen wollte. Er empfand es in der Tat in solcher Weise. Seine Anstrengungen nahmen zu – und sie führten ihn denn eines Tages auch an den wendenden Punkt.
Wieder waren alle tätig am flachen Wiesenufer des versumpften toten Armes – Conrad neben jenem Knaben, der ihm einst geraten hatte, die Molche mit Fliegen zu füttern – als plötzlich Geschrei entstand. Eine Schlange kam über das Wasser geschwommen, ein harmloses Tierchen von jener Art, die man Ringelnattern nennt. Der Kopf mit den gelben Backen war über den Spiegel erhoben, und dahinter bewegte sich anmutig unter der Oberfläche der grausilberne Körper. Diese Tiere waren hier recht selten geworden – infolge des lebhaften Fischereibetriebes der Buben – und wurden auch nicht als Beute begehrt, denn der Tierhändler, mit welchem die kleinen Unternehmer in Verbindung standen, nahm ihnen Schlangen nicht ab. Jedoch das Auftauchen einer solchen, nach langer verstrichener Zeit, da man keine mehr gesehen hatte, bedeutete immerhin einen unterhaltenden Zwischenfall.
Trotz des Lärmens der Buben behielt die Schwimmerin ihre Richtung und kam auf das flache Ufer. Alsbald ward sie ergriffen und im Bogen über das Wasser hinausgeschleudert, in welches sie klatschend fiel, während zwei der Knaben rundum ans andere Ufer liefen, um das Tier dort am Landen und Entweichen aus dem Tümpel zu verhindern.
Jedoch war dies überflüssig. Kaum wieder im Wasser, begann die kleine Schlange in der früheren Richtung gegen das Ufer zu schwimmen. Wodurch das Tierchen veranlaßt wurde, seinen Peinigern immer wieder geradewegs in die Hände zu laufen, wäre schwer zu erklären gewesen – und die Buben kümmerte das auch wenig.
Vielleicht mochte das Steilufer jenseits, als zum Landen ungeeignet, die Natter abhalten, sich dorthin zu wenden.
Sie schwamm und dann flog sie wieder. Jeder versuchte den weitesten Wurf zu machen. Halb im Wasser versunken lag drüben ein vermorschter, gefallener Baum, die Trümmer seiner Äste standen kahl und zerbrochen empor. Ihn hatte noch niemand, die Schlange werfend, erreicht.
In Kokosch erhob sich jetzt etwas, was man sehr wohl als das Bewußtsein von einem entscheidenden Augenblicke bezeichnen könnte: denn es zeigte sich die Möglichkeit, nun endlich freizugeben, was in Gesellschaft dieser Knaben sonst immer in ihm zusammengedrückt und wie eine niedergehaltene Sprungfeder hatte liegen müssen – es freizugeben, kost’ es, was es wolle. Die Fäden durchzureißen, die ihn, wie es schien, ganz leichthin und zufällig an solches Treiben banden, beiseite zu treten, und sei’s, daß er dann allein dastünde, und die Anderen unmutig oder gar als Feinde ihm gegenüber.
Er schaute an dieser Möglichkeit entlang und in ihre Verlängerung sozusagen durch Augenblicke hinein. Jedoch, da landete die Schlange. Mit einem seltsam schweren, heftigen und ungelenken Schritte war Conrad als erster von allen bei ihr, ergriff das sehr ermattete und nur mehr schwach sich windende Tierchen und schleuderte es, den Arm zweimal ganz herumschwingend, hinaus. Und in der Tat, es war der weiteste Wurf. Die Natter schlug drüben, leblos wie ein Strick, um einen der scharfkantigen zerbrochenen Äste jenes im Wasser halb versunkenen Baumes und blieb dort hängen, ohne sich weiterhin im geringsten zu bewegen.
Eine Weile noch schauten die Jungen hinüber. Dann blickten sie Conrad von der Seite an und verstreuten sich wortlos längs des Ufers, um neuerlich dem Fange nachzugehen.
Auch Kokosch hockte gleich bei einer seichten Stelle nieder. Aber er bewegte sich so wie Menschen, deren Hände nach einem schrecklichen Unglücksfalle irgendwas vollends Nebensächliches tun, indem sie etwa einen Knopf am Rocke öffnen oder schließen. Auf solche Weise fing er, seltsam genug, innerhalb weniger Augenblicke bereits einen Salamander. Das Tier zappelte in seiner Hand. Er öffnete diese wieder, und es entschlüpfte. Kokosch erhob sich und ging sogleich weg, über das kurze Gras der Wiese, ohne daß ihn jemand von den Knaben bemerkte oder beachtete.
Seine Beine waren ganz steif, jeder Schritt schüttelte bis in den Kopf hinauf, als wandle er auf hölzernen Stelzen dahin, und er wäre jetzt völlig unvermögend gewesen, etwa eine kleine Strecke zu laufen. Die rechte Hand fühlte Kokosch noch naß und kühl vom Wasser, das zwischen den zusammengekrümmten Fingern haftete.
Bei alledem ging er schwerfällig immer weiter und kam auf eine breite Fahrstraße, die links und rechts von je einer mit Gerberlohe belegten Reitbahn begleitet wurde. Und schon jaukte es heran und mit großer Bewegung und dunklen Rossesbeinen zwei Schritte von ihm entfernt vorbei, der rotbraune Bodenbelag spritzte in Brocken, die Reiter aber waren oben irgendwo über Kokosch, sie kamen sozusagen gar nicht in Betracht, denn er ließ den Blick vor seinen Füßen liegen. Neuerlich sprengte es heran, eben als er die Bahn überqueren wollte, und so blieb er denn stehen. Aber da geschah vor ihm jezt ein Verhalten der Bewegung, die schweren großen Hufe traten tänzelnd ein wenig herum, die hohe dunkle Verschattung durch das Pferd ging nicht sogleich wieder vorüber, sondern setzte sich vor Conrad fest und blieb stehen.
„Kokosch!“ rief jemand mit heller Stimme von oben. Gleich danach sprang Ligharts aus dem Sattel und nahm Conrad um die Schultern. „Du, das freut mich nun einmal sehr!“ sagte er lachend, „was treibst du hier? Soll ich mit dir gehen? Ach bitte“ – er rief zu dem Reitlehrer hinauf, einem älteren Manne, der nun Günthers Pferd hielt und lächelnd auf die Jungen heruntersah – „ach bitte, ich treffe hier eben meinen Freund, würden Sie die Güte haben, Herr Brokmann, ‚Daisy‘ nach Hause mitzunehmen? Wir reiten nämlich schon heim“ – so wandte er sich jetzt erklärend an Conrad – „es ist nicht mehr weit, ich gehe mit dir. ‚Daisy‘ heißt sie“, setzte er hinzu und klopfte sein Pferd am Halse „sie ist eine Gute, Liebe. Siehst du, Daisy, das ist mein Freund Kokosch, sieh ihn dir nur an.“ Er umarmte den Kopf der braunen Stute und lachte.
Kokosch streichelte mit seiner noch immer feuchten Hand ‚Daisys‘ Mähne.
Sein Kopf war wie von Holz, die Zähne lagen im Munde, als hätte er ein steinernes Gebiß, der Körper drückte hinunter in die Gerberlohe, darauf er stand, und ihm war, als sei er bis zur Mitte darin eingegraben. Geläufig jedoch sprach sein Mund: „Nein, reite nur weiter, Günther, laß dich nicht abhalten. Ich war nur ein wenig in den Wiesen und muß jetzt wieder hinüber in den Kaffeegarten dort an der Allee, wo meine Eltern mit allerhand Tanten sitzen, die warten auf mich.“ Er brachte ein freundliches Lächeln fertig und eine deutende Bewegung der Arme in der Richtung, wo die erwähnte Örtlichkeit lag. Günthern in seinen gelben Stiefelchen und Reithosen empfand er während des Sprechens als ein aus unvorstellbar leichtem, reinem und glücklichem Stoffe bestehendes Wesen.
„Gut denn, auf morgen, in der Schule!“, sagte Ligharts, immer lachend, schüttelte Conrad die Hand, trat in den Bügel und stieg auf. Kokosch grüßte auch Herrn Brokmann und dieser ihn, und Günther wandte sich aus dem Sattel im Davonreiten noch einmal winkend um.
Conrad kreuzte die Fahrstraße, die etwas höher lag als die beiden Reitbahnen links und rechts. Beim Hinauf- und Hinabsteigen empfand er einen kleinen, müden Stich in den Knien. Ihm war heiß. Er fühlte jeden Teil seines Körpers, bis unter die Haarwurzeln.
Seine rechte Hand war jetzt schon ganz trocken. Er folgte einem schmalen Wege zwischen den Gebüschen, durchschritt eine Gruppe jüngerer Laubbäume, welche hier am Rand der weiten Wiesen standen, und trat auf diese selbst hinaus. Sie schienen ihm übermäßig groß, ausgestreckt in der Abendsonne vor seiner Müdigkeit. Ja, er hatte Günther abweisen müssen, das stand nun ganz außer Frage, „bei solchem Zustande!“ – das dachte er wörtlich – es war noch gut verlaufen. Im gleichen Augenblick fiel ihm ein, und zwar erstmalig, daß er noch niemals eine jener Tüten mit Zuckerwerk, wie er sie für die „Fischer“ dort unten oft erstanden, Ligharts angeboten hatte, obwohl dieser auf Näschereien versessen war und sie gelegentlich sogar stahl, wenn er konnte. Conrad schritt jetzt in der Mitte der größten Wiese dahin. Vom Kanal klang das Tuten eines Dampfers. Nein, er war nie darauf verfallen, Günther etwa in dieser Weise eine Freude zu bereiten.
Daheim kam das Fieber zum Ausbruch.
Er stand in der Mitte des Zimmers und fühlte sich durch eine weiche, unsichtbare und ungreifbare Schicht getrennt von allen Dingen um ihn herum, als wären sie von der Stelle, wo er sich befand, weiter weggerückt; das Zimmer schien ihm größer. Er sah nicht nach den Molchen. Frau Leontine trat ein und bemerkte gleich, daß Kokosch krank war. Er mußte ins Bett, ein Thermometer wurde unter seine Achsel gesteckt, er bekam Tee mit Milch und gebähtem Brot zum Abendessen. Er lag auf dem Rücken, und um seine Nase geisterte ständig ein Geruch wie von einem Sumpfe. Der Schlamm dort im Tümpel hatte so gerochen. Sobald er aber diesen Geruch aufmerksamer einziehen wollte, war’s verschwunden. Einige Augenblicke überlegte Kokosch, ob solch ein Hauch nicht vielleicht aus dem Becken der Molche steige? Der Vater trat ein mit dem Arzte, den man gleich hatte kommen lassen, die Decke ward zurückgeschlagen, das Herz behorcht, der Puls gefühlt. Des Doktors Kopf mit den sehr reinen weißen Haaren, denen irgendein strenger und bitterer Duft anhaftete, war einige Augenblicke hindurch dicht vor Kokosch. „Morgen bleibst du liegen“, sagte der Arzt und lachte, „und übermorgen kannst du schon wieder in die Schule laufen.“ Er wandte sich zu den Eltern und fuhr fort: „Es ist nichts von irgendwelcher Bedeutung. Wenn er morgen abend kein Fieber hat, dann lassen sie ihn ruhig aufstehen und am nächsten Tage ausgehen. Manche Menschen neigen überhaupt zu raschem und bald wieder vergehendem Fieber. Das hat nichts auf sich.“
Am nächsten Tage kam Ligharts. Er war augenscheinlich besorgt, fragte Kokosch, was ihm fehle, ob er müde sei und ob er nicht schon gestern sich krank gefühlt habe? Günther saß am Bett und hielt irgendeine in Seidenpapier eingemachte Sache zwischen den Knien. Frau Leontine trat ein, Günther stand auf und schlug die Hacken zusammen. Kokosch lag auf dem Rücken und fürchtete plötzlich, daß nun seine gestrige Lüge an den Tag kommen möchte, von dem Kaffeegarten, in welchem die Eltern säßen „mit allerhand Tanten“. „Darf er Eis essen?“ fragte Ligharts. „Ich denke, es wird ihm nicht schaden“, antwortete Frau Leontine. Aus dem Seidenpapier war ein großer weißer Becher zum Vorschein gekommen. „Da sieh mal, Kokosch, dein Freund hat dir Gefrorenes gebracht, ich will Schüsselchen und Löffel holen gehen“, sagte die Mutter.
Es war ein schöner Nachmittag, wenn auch von einer seltsamen und neuartigen Wehmut getränkt, die wie Grundwasser zwischen allen Dingen stieg. Kokosch löffelte sehr nachdenklich sein Eis. Er war völlig wohl und entsann sich verwundert seiner gestrigen Niedergedrücktheit. Das Thermometer zeigte ihn frei von Fieber. Der Sumpfgeruch war vergangen. Günther mußte gleichwohl in Conrads Auftrag das Becken mit den Molchen beschnüffeln. Aber es roch keineswegs, nur ein wenig nach Wasser und Pflanzen. Die Tiere bewegten sich munter. Ligharts saß bei Conrad am Bett und berichtete, was es in der Schule gegeben habe. Sie nahmen, über Kokoschs Vorschlag, gleich das für morgen Nötige durch, indessen war’s nicht viel und bald beendet.
Am nächsten Tage, gleich nach dem Mittagsmahle, eilte Conrad in die Au. Die Sonne lag überall schwer und heiß. In der Gegend des Tümpels war es still; zu so früher Nachmittagsstunde schien von den fischenden Knaben noch niemand zugegen.
Conrad trat entschlossen um ein Gebüsch und sah über das Wasser. An dem Aste dort drüben, der vom halbversunkenen Baume hervorragte, hing noch immer die tote Schlange.
Er bückte sich, fand einen Stein, wollte und mußte treffen. Sein Geschoss riß in der Tat das tote Tier aus der Gabelung des Astes. Während drüben der Stein im Ufergebüsch kurz raschelte, glitt der Körper herab ins tiefe Wasser und versank.
Ein Knabe stand neben Conrad.
„Warum hast du sie eigentlich erschlagen?“ sagte er.
Kokosch erlebte jetzt erstmalig die Grenze seiner eigenen Ausdrucksfähigkeit und der Worte. Er schwieg also, und zwar wie unter einem Zwange, wandte sich ab und ging heim.
Als er Günther am nächsten Tage sagte, daß er seine drei Molche heute wieder in Freiheit zu setzen gedenke, wollte jener unbedingt mitgehen.
„Hast du sie nun genug beobachtet?“ fragte Ligharts. Kokosch konnte sich unter dem Worte „beobachtet“ nicht viel denken. „Ich will gleich nach Tisch gehen, am frühen Nachmittage.“
„Gut, ich werde mich sputen, um dich abzuholen.“
Aber es wurde doch ein klein wenig später, denn Günther wohnte ja in einem anderen Viertel und mußte die Straßenbahn benutzen. Conrad war unruhig, er hatte den Freund schon im Vorzimmer auf und ab schreitend erwartet. Sie fingen nun die Tiere behutsam aus dem Becken und setzten sie in jenes rote Eimerchen, worin sie einst gekommen waren. Als die drei schwarzen Gesellen in dem wenigen Wasser herumzappelten, erschienen sie Kokosch auffallend groß und dick, und er glaubte sich zu besinnen, daß sie frischgefangen viel schmächtiger gewesen wären. Ligharts fand dafür eine natürliche Erklärung, nämlich die, daß es den Tieren in der Freiheit sicherlich nicht möglich gewesen sei, so viele Nahrung zu erbeuten, als sie hier erhalten hätten, daher denn das starke Wachstum begreiflich werde.
Als Günther und Conrad am Tümpel anlangten, liefen überall schon die Jungen herum, und im hohen Grase beim Baume standen die Einmachgläser. Der und jener kam heran, sie blickten in das rote Eimerchen, das Conrad am Henkel trug – und nun gab es aber Geschrei: den Jungen hier schien die ungewöhnliche Größe der drei Lurche ganz augenfällig zu sein.
„Gebt sie doch gleich herein in die Gläser!“ rief einer.
„Natürlich – du willst gleich alle drei haben! Nichts da –!“ fuhr ihn sein Nachbar an und stellte sich vor Kokosch.
„Gebt einmal Raum hier“, bemerkte Ligharts ruhig, in seiner genauen Aussprache, „wir wollen zum Wasser.“
Die Jungen standen dicht zusammengedrängt Günther und Conrad gegenüber.
„Was wollt ihr denn beim Wasser machen?“ fragte einer, der vor Günther stand.
„Wir gedenken die Tiere in Freiheit zu setzen“, antwortete Ligharts.
„Warum?!“ rief der andere.
„Weil es uns so beliebt“, sagte Günther.
„Weil es uns so beliebt“ – äffte ihn der Knabe mit übertriebener Aussprache nach. Gleich darauf sah Conrad, der mit seinem Eimerchen seitwärts getreten war, etwas Helles und Rasches in der Luft. Günther hatte seinem Gegenüber mit einer wahrhaft schrecklichen Roheit die Faust mitten ins Gesicht geschlagen. Der Vorgang wiederholte sich sogleich noch einmal, da ein anderer Junge nun seinerseits Ligharts angriff. Die beiden Geschlagenen bluteten in Bächlein aus den Nasen, sprangen davon und schimpften wild herüber, wobei sie, wie es denn für solche Burschen sehr bezeichnend ist, auch gleich mit der Polizei zu drohen wußten. Kokosch war völlig verdutzt. Er hätte kaum Zeit gehabt, das Eimerchen niederzusetzen, so schnell ging alles. Jedoch Ligharts bedurfte gar keines Beistandes. Die übrigen Jungen waren zurückgetreten und schienen keineswegs gesonnen, sich für ihre Kameraden – die inzwischen verschwunden waren – in den Handel zu mischen. „Wo wollen Sie die Tiere freilassen?“ fragte jetzt einer von ihnen Günther, höflich und mit etwas gezwungener Aussprache. „Drüben, wo es tief ist“, sagte Ligharts, wandte sich zu Kokosch, und sie gingen hinüber, in einer kleinen Entfernung von den anderen gefolgt.
„Geh allein“, sagte Günther zu Conrad und blieb oben stehen, während Kokosch sich das steile Ufer hinabbemühte; Günther reichte ihm den Eimer nach und wandte sich gleich wieder den herankommenden Jungen zu. Jedoch schien auch Kokosch das Ausgesetzte seiner jetzigen Lage zu spüren, an der jähen Uferböschung, die ihn nötigte, sich mit der Hand an einem Baume festzuhalten. Er kippte behutsam aber rasch das Eimerchen knapp über dem Wasserspiegel, sah die Tierchen noch schwänzelnd verschwinden, und war nun rasch wieder oben bei Günther.
„Womit habt ihr sie denn gefüttert?“ fragte einer von den Jungen, die jetzt den beiden Freunden wieder in einem Rudel gegenüberstanden.
„Mit Flie-gen“, antwortete Ligharts, die Silben betonend und trennend. Er sah den anderen durch einen Augenblick ruhig an, wandte sich ab und ging mit Kokosch davon.
„Warum sagtest du gerade: mit Fliegen?“ frug Conrad nach einer Weile.
„Das weiß ich nicht – es fiel mir just so ein“, antwortete Günther.
5
So ging die Molchzeit zu Ende. Und auch sonst änderte sich vieles, ja eigentlich bald alles im Leben Conrads.
Jetzt zunächst kamen die großen Schulferien, und ihr Beginn brachte das Ende des Umganges mit Günther Ligharts, und nicht nur eine Unterbrechung für zwei Monate. Denn Günthers Eltern übersiedelten nach Berlin, und Kokosch fand im Herbste beim neuerlichen Schulbeginn den Freund nicht mehr vor. Um Neujahr kam dann Nachricht von ihm. Eine Bilderkarte, die einen weißen Pierrot oder Harlekin zeigte, der ein wenig lächelte unter seiner hohen, spitzen Mütze. Kokosch bewahrte die Karte sorgfältig auf in der Lade bei seinen Schreibsachen. Er wollte antworten, das war ja selbstverständlich. Die Anschrift hatte Günther genau vermerkt: Uchatiusstraße 23. Conrad betrachtete die Ansichtskarte oft, das Bild schien ihm in irgendeiner Weise der Person Günthers verwandt oder dazu passend. Der Pierrot sah ihm ein wenig ähnlich. Beantwortet wurde die Karte niemals.
Jene auf die Molchzeit folgenden Sommerferien bildeten für Conrad späterhin noch dann und wann – wenn der blasse Scheinwerfer der Erinnerung einmal rasch und zwischendurch über diese Gründe spielte – einen Gegenstand der Verwunderung. Denn er hatte sich aus dieser Zeit – die da ganz zweifellos zwischen dem Ende und dem Wiederbeginn des Schulunterrichtes liegen mußte, die es also unbedingt gegeben hatte – schlechthin gar nichts gemerkt. Nur das war vorhanden, was sie mit anderen Schulferien eben verband: das Gemeinsame des Hintergrundes. Haus und Hof der Tante, in einer flachen Wiesensenkung mit sehr hohem Grase, das überall gleich hinter den Zäunen stand und wuchernd emporsprießte, wo gerade kein Weg oder Acker oder Gemüsebeet es fernhielt. Unweit davon die altmodischen, gittrig-geschnörkelten Holzveranden der Villen einer dörflichen Sommerfrische, ausgedörrt von der Sonne, nach Holz riechend, wenn man vorbeiging. Ein paar Zäune hin und her mit den um diese Jahreszeit längst abgeblühten Fliederbüschen, deren Blätter entweder fettig glänzten oder staubig von der Straße waren. Dahinter die Ausläufer des bergigen Waldes und der Bahndamm – jenseits dessen die vielgeteilte Ebene ansetzte, schachbrettweis mit Feldern überzogen, von Straßen und Industriekanälen geriemt, bis zu den Schornsteinen der Fabriken rückwärts und der fernen Stadt.