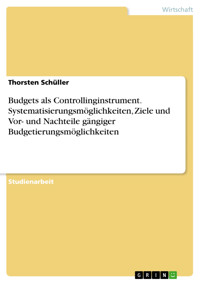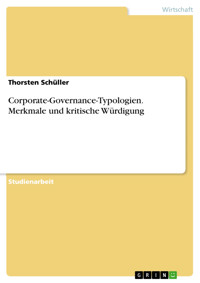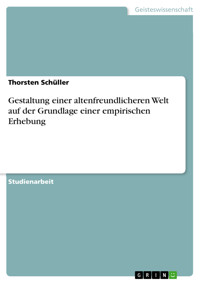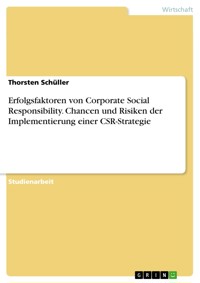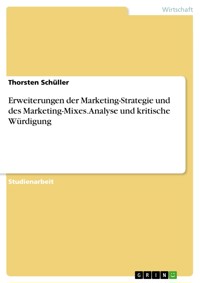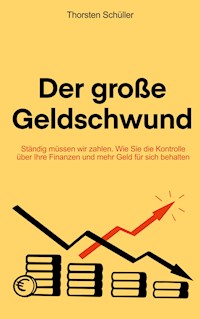
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
Ständig müssen wir zahlen: Miete, Steuern, Maklergebühren, für Versicherungen und Vermittler, für Rundfunk- und Fernsehen sowie für Einkäufe. Oft bleibt Ihnen am Ende des Monats kaum etwas von Ihrem Geld übrig. Und der Traum von der persönlichen Freiheit oder dem frühen Ruhestand ist in weiter Ferne. Doch wer nagt da eigentlich an Ihren Finanzen? Um mehr Netto vom Brutto zu erhalten, werfen Sie einen genauen Blick auf Ihre Einnahmen und Ausgaben. Werden Sie sich klar darüber, wo und an wen Ihr hart verdientes Geld abfließt. Ziehen Sie Bilanz und optimieren Sie Ihre Finanzen. Dieses Buch soll Ihnen dabei helfen, die Augen für die wahren finanziellen Kosten des Lebens zu öffnen und Wege aufzeigen, wie Sie mehr Wert für sich schaffen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 405
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Der große Geldschwund
Ständig nagt jemand an Ihren Finanzen, überall müssen Sie zahlen. Behalten Sie die Kontrolle über Ihr Vermögen – und mehr Geld für sich.
Von Thorsten Schüller
Zu diesem Buch
Geld schafft Freiheit. Wenn Sie Geld haben, können Sie sich einen kleinen oder auch einen größeren Wunsch erfüllen: Ein besonderes Paar Schuhe, einen ausgefallenen Restaurantbesuch oder ein Theaterabonnement. Wenn Sie viel Geld haben, können Sie sich ein teures Auto, eine Zweitwohnung am Meer oder eine Segelyacht leisten, sofern diese Dinge Bedeutung für Sie haben. Oder Sie entscheiden sich, mit Ende 30 Ihren Job aufzugeben und künftig von Ihrem Ersparten zu leben.
Geld mag per se nicht glücklich machen. Aber es verschafft Ihnen Unabhängigkeit. Wenn Sie Geld haben, können Sie sich von lästigen Zwängen befreien und sich auf das konzentrieren, was Sie wirklich möchten. Das kann der Müßiggang sein, es kann aber auch bedeuten, dass Sie sich mit Hingabe und ohne finanziellen Druck dem Aufbau einer Firma widmen. Vielleicht wollen Sie aber auch endlich Ihr Buchprojekt vollenden oder anderen Menschen helfen, ihren Alltag zu bewältigen.
Leider sind nur die wenigsten Menschen finanziell frei und ohne Zwänge. Ein Grund kann sein, dass Ihr Einkommen nicht hoch genug ist, um sich eine solche Unabhängigkeit leisten zu können. Ein anderer Grund ist der ständige Abfluss an Geld. Einmal im Monat erhalten Sie Ihr Gehalt auf das Konto überwiesen. Doch nahezu täglich reduziert sich dieser Betrag, weil Ausgaben zu begleichen sind.
Immer und überall müssen Sie bezahlen. Steuern zum Beispiel: Einkommensteuer, Mehrwertsteuer, Mineralölsteuer. Makler wollen Geld für die Vermittlung einer Wohnung, Anwälte stellen Rechnungen, um Sie in Scheidungsangelegenheiten zu vertreten. Die GEZ fordert regelmäßig den Rundfunkbeitrag von ARD, ZDF und Deutschlandradio ein, die Autoversicherung bucht jährlich von Ihrem Konto ab, die Rentenversicherung nimmt sich monatlich ihren Anteil vom Brutto. Anlageberater preisen in lauten Tönen bestimmte Fonds, Aktien und Unternehmensbeteiligungen und kassieren dafür Provision. Am Ende des Monats bleibt Ihnen damit kaum etwas von Ihrem Geld übrig.
Ist Ihnen bewusst, dass Sie für jeden erarbeiteten Euro mehrfach Steuern zahlen? Dass der Staat einer der größten Nager an Ihren Finanzen ist? Fallen Ihnen die Daueraufträge noch auf, die sich monatlich zu stattlichen Summen addieren? Und haben Sie sich schon mal gefragt, ob Sie wirklich mehrmals im Monat ins Restaurant gehen oder sich das Stückchen Torte von der Konditorei gönnen müssen? Ganz nebenbei: Was zahlen Sie eigentlich für Ihren Strom?
Wenn Sie mehr Netto vom Brutto haben wollen und damit Ihrer persönlichen Freiheit und Unabhängigkeit einen Schritt näherkommen möchten, werfen Sie einen genauen und ehrlichen Blick auf Ihre Finanzen. Was nehmen Sie ein, was geben Sie aus? Wenn Sie das wissen, wenn Sie sich einen klaren Überblick verschafft und offen und ehrlich Bilanz gezogen haben, haben Sie den ersten Schritt zur Optimierung Ihrer Finanzen getan. Dann können Sie den zweiten Schritt gehen – die sinnvolle Vermehrung Ihres Vermögens. Dieses Buch soll Ihnen dabei helfen, die Augen für die wahren finanziellen Kosten des Lebens zu öffnen und Wege aufzeigen, wie Sie mehr Wert für sich schaffen.
Inhaltsverzeichnis
Und wie viel bleibt Ihnen so?
Die Versprecher: Viele Worte, wenig Inhalt
Geldvernichter I: Der Telefonverkäufer
Der Staat
Steuerverschwendung
Der teure Alltag
Aufwand – Kosten – Nutzen
Ehe – glücklich bis zur Scheidung
Rendite
Banken
Geldvernichter II: Hypo Real Estate
Kredite
Crowdfunding
Insolvenz
Börse
Fonds
Geldvernichter III: Leasingfonds-Pleite
Rohstoffe
Optionsscheine & Co.
Lotto und andere Wetten
Immobilien
Geldvernichter IV: Immobilienfonds
Versicherungen
Grauer Kapitalmarkt
Geldvernichter V: Caviar Creator
Machen Sie mehr aus Ihrem Geld
Und wieviel bleibt Ihnen so?
Es ist ja nicht so, dass Piet Baumann nichts verdienen würde. Als Bauingenieur in Hamburg bekommt er monatlich 4.638 Euro brutto. Das ist für sich betrachtet eine durchaus stattliche Summe.
Auch bei der Freiburgerin Anna Goika steht oben auf dem Gehaltszettel eine ansehnliche Zahl: 3.139 Euro, so hoch ist ihr Bruttogehalt als Erzieherin in einem städtischen Kindergarten.
Und doch sind Piet und Anna jedes Mal erstaunt, dass ihnen am Monatsende fast nichts von ihrem Geld übrigbleibt. Dabei leben sie nicht einmal in Saus und Braus. Sie gehen nur selten in Restaurants, sie leisten sich keine teuren Konzertbesuche, ihre Urlaube führen sie pauschal nach Mallorca oder an die türkische Mittelmeerküste, und bei Ausgaben des täglichen Lebens fragen sie sich vorher, ob sie wirklich nötig sind oder die Dinge woanders womöglich billiger zu bekommen sind.
Piet und Anna arbeiten jeweils Vollzeit, aber ihre Gehaltszettel gaukeln ihnen einen Reichtum vor, der so nicht existiert. Denn von ihrem Brutto fließen Steuern sowie Sozialabgaben zur Renten- und Krankenversicherung ab.
Piet ist verheiratet und hat zwei kleine Kinder. Seine Frau kümmert sich zuhause um die beiden Mädchen. Für die erhält das Paar zwar Kindergeld vom Staat, andererseits übersteigen die Kosten für Kita, Kleidung und Essen diesen Betrag deutlich. Piet muss die monatliche Miete für eine Vierzimmerwohnung am Rande von Köln bezahlen, er finanziert ein mehrere Jahre altes Auto und leistet sich und seiner Familie Versicherungen wie Haftpflicht, Hausrat und Auslandskrankenschutz. Die Lebensmitteleinkäufe schlagen sich deutlich im monatlichen Budget nieder, gelegentlich gönnen sie sich einen Kurzurlaub in einem Appartement – mit dem Ergebnis, dass am Ende fast nichts von dem schönen Bruttogehalt übrigbleibt.
Ähnlich sieht es bei Anna aus. Da sie nicht verheiratet ist, zahlt sie prozentual höhere Sozialabgaben als Piet. Ihre Zweizimmer-Wohnung in München verschlingt bereits 1200 Euro. Sie kauft Ihre Lebensmittel im Bioladen, gönnt sich gelegentlich ein neues Kleidungsstück und geht hin und wieder mit ihren Freundinnen aus. Dafür verzichtet sie auf ein eigenes Auto, setzt auf öffentliche Verkehrsmittel oder leiht sich mal ein Fahrzeug aus. Am Monatsende bleibt ihr, wie Piet, fast nichts.
Gehören Sie auch zu den Millionen von Menschen, die morgens aus dem Haus gehen, tagsüber hart arbeiten und abends ermüdet wieder in ihrer Wohnung ankommen? Sie verbringen mehr Zeit im Job als zuhause oder mit ihren Familien oder Partnern und wundern sich am Freitagabend, dass schon wieder eine Woche verflogen ist. Sie bringen sich und ihre Arbeitskraft ein, Sie leben nicht auf großem Fuß, sondern kalkulieren ihr Budget, schränken sich beim Konsum ein und widerstehen vielen Verlockungen des Alltags. Und doch haben Sie am Monatsende den Eindruck, dass sie sich mal wieder wie ein Hamster im Rad gedreht haben, letztlich aber kaum Krümel übriggeblieben sind. Sie werkeln, um den Alltag zu meistern, aber es gelingt Ihnen nicht, Rücklagen zu bilden oder gar Reichtümer anzuhäufen – Geld, von dem man sich ein besonderes Stück gönnt, einen Tisch, ein Kleid, ein Wellness-Wochenende. Oder dass man auf die Seite legt, um sich später etwas Großes davon zu leisten – eine Wohnung, eine ausgedehnte Reise oder einfach nur die Freiheit, eine Zeitlang aus diesem Hamsterrad der täglichen Arbeit ausbrechen zu können.
Das gelingt nur Wenigen.
Es gibt Menschen, die sagen, Geld sei Ihnen nicht wichtig. Das ist eine bemerkenswerte Einstellung, denn sie zeugt davon, dass diese Frauen und Männer eine klare Vorstellung davon haben, was für sie im Leben Bedeutung hat. Diese Einstellung hat etwas sehr Gesundes. Wozu ein zweites Auto? Muss ich wirklich zum Urlauben auf die Kanaren fliegen, nachdem ich vor vier Monaten erst auf Madeira war? Macht mich das zwölfte Paar Schuhe glücklicher als das elfte?
Eine solche Einstellung lässt sich aber nur umsetzen, wenn die persönlichen Grundbedürfnisse gedeckt sind – Essen, Trinken, Wohnung, Kleidung. Doch diese Bedürfnisse müssen erst einmal abgedeckt sein. Dafür brauchen wir Geld. Gleichzeitig leben wir in einer Gesellschaft der ständigen Versuchung, des konsummäßigen Überflusses. Überall locken tolle Dinge, die uns zum Kauf angeboten werden – im Schaufenster, in den Magazinen, im Internet nur einen Klick entfernt. Dem zu widerstehen fällt nicht leicht. Selbst die Tasse Kaffee, die wir am Nachmittag auf dem Marktplatz entspannt zu uns nehmen, kostet 3,20 Euro. Auch dieses Geld muss man übrighaben.
Wir verdienen Geld, um es auszugeben. Das ist ein normaler Vorgang. Das Geld, das wir uns erarbeiten, ermöglicht es, die Grundbedürfnisse zu decken, uns abzusichern, unser Leben zu gestalten und uns gelegentlich etwas zu gönnen. Geld ist ein tolle Erfindung, denn würden wir noch heute in Tauschwirtschaft leben und müssten, sagen wir, unseren Architekturentwurf oder den von uns gefliesten Boden gegen Brot, Käse und Marmelade eintauschen, wäre das Leben ziemlich kompliziert. Dann ständen wir dauernd vor Fragen wie: Wie viel Brot sind drei Quadratmeter Fliesenboden wert? Oder: Wie viel Käse bekomme ich für die Programmierung einer Webseite? Und wie bezahle ich die Bahn, wenn ich mit dem Zug von Rendsburg nach Rostock fahren möchte? Das Unternehmen dürfte kaum an der Powerpoint-Präsentation interessiert sein, die ich gerade zum Thema „Steigerung der Durchflussmengen“ erstellt habe.
Wenn wir unsere Arbeitsleistung einbringen, erhalten wir dafür Geld. Wenn wir dieses Geld wieder ausgeben, erhalten wir dafür einen Gegenwert. Das ist gut. Nur: Stimmen die Relationen? Ist das, was Sie für Ihre Leistung erhalten, auch gerecht und ausreichend? Und ist das, was man Ihnen auf der anderen Seite wieder nimmt, angemessen? Ist es angemessen, dass Sie mit jedem Liter Benzin, den Sie tanken, 65 Cent Energiesteuer sowie zuzüglich 19 Prozent Mehrwertsteuer bezahlen? Ist es angemessen, dass Sie die Monatskarte für den öffentlichen Personennahverkehr 125 Euro kostet und Sie dafür in der Rushhour die Deomarke Ihres Nachbarn erschnüffeln dürfen oder des Öfteren 20 Minuten am Bahnsteig herumstehen, weil die S-Bahn mal wieder Verspätung hat?
Gut, beklagen wir uns nicht. Wir verfügen über funktionierende Krankenhäuser und eine halbwegs funktionierende Infrastruktur. Wir leben in Frieden, leiden keinen Hunger, müssen nicht obdachlos auf der Straße leben. In der Regel gelingt es uns, mit unserem Einkommen unsere wesentlichen Bedürfnisse zu decken. Manchmal bleibt sogar etwas übrig, und wir können uns ein gewisses Etwas leisten. Eine Skiwoche in den Dolomiten oder ein paar Wellnesstage an der Ostsee.
Doch meistens ist es mühsam. Wir müssen kalkulieren, rechnen, uns zurückhalten. Denn immer sind wir am Zahlen. Beinahe täglich, mal kleine, mal größere Summen. Wir zahlen Einkommensteuer, Mehrwertsteuer und Ertragsteuern. Die Post will 80 Cent für den Brief, der Makler zwei oder drei Monatsmieten für die Vermittlung einer Wohnung. Anwälte und Gerichte schreiben bei der Scheidung dicke Rechnungen, und die GEZ fordert quartalsweise Geld von uns, auch wenn wir das öffentlich-rechtliche Fernsehprogramm ziemlich öde finden. Die Rentenversicherung bucht monatlich ab, die Autoversicherung einmal jährlich. Ausländische Autobahnbetreiber kassieren pro Kilometer, Steuerberater schreiben Rechnungen mit dreioder vierstelligen Summen, Handwerker addieren die Arbeitszeit zum Material und Anlageberater preisen uns Fonds, Aktien und Unternehmensbeteiligungen an, mit denen wir am Ende oft mehr verlieren als gewinnen.
Gleichzeitig suggeriert uns die Werbung, was alles möglich ist. Eine neues Kleid, eine tolle Handtasche, ein hübsches Paar Schuhe. Lebensmittel sollen bio und lokal sein, die Neubauwohnung gibt es für 440.000 Euro, das Auto für 32.000 Euro. Der Kurztrip nach Barcelona, die Schiffsreise durch die Karibik, die Wanderwoche in den Pyrenäen, das Dreigängemenü im Edelrestaurant – ständig hält man uns lecker aussehende Knochen vor den Mund, doch sie haben ihren Preis. Der Kassensturz zeigt dagegen: Längst nicht alles ist möglich. Wir müssen uns zurückhalten.
Werfen wir also einen ehrlichen Blick auf unsere Finanzanlage. Ziehen wir Bilanz und rechnen aus, was uns am Monatsende wirklich bleibt. Und stellen wir uns die Frage, wer alles Geld von uns will: Unternehmen, Bekannte und immer wieder der Staat. Fragen wir uns auch, ob diese Zahlungen in ihrer Höhe gerechtfertigt sind. Erst wenn wir wissen, wie viel wir einnehmen, wie viel wir ausgeben und was uns am Ende bleibt, können wir darangehen, unser persönliches Finanzsystem zu optimieren. Dazu gehört vor allem die Frage, ob wir Leistungen, die uns immer und überall angetragen werden, wirklich brauchen? Können wir darauf verzichten, gibt es möglicherweise Alternativen?
Machen wir uns frei, soweit es geht: Von all den sogenannten oder selbst ernannten Experten, von den Versprechungen der Marketingindustrie, vielleicht sogar in einem gewissen Maße von den Zwängen, die uns der sorgende Staat auferlegt. Bilden wir uns selbst ein Urteil. Wenn es uns gelingt, eine klare Analyse zu machen, werden wir auch Wichtiges vom Nützlichen und Überflüssigen trennen können.
Es geht nicht darum, dass Sie sich selbst kasteien. Es geht darum, sich auf das Wesentliche zu fokussieren. Wir werden uns nicht allen Kosten entziehen können – die Steuer ist so unerbittlich wie der Rundfunkbeitrag. Aber allein das Bewusstsein, wer wie viel und wofür von unserem Brutto haben will, sensibilisiert und hilft uns, unsere Ausgaben zu optimieren. Damit uns am Ende mehr Netto vom Brutto bleibt. Und wir uns damit neue Freiheiten schaffen.
Die Versprecher: Viele Worte, wenig Inhalt
Wir sind umgeben von Leuten und Firmen, die uns etwas versprechen, suggerieren, in Aussicht stellen. Sie versuchen, uns eine Sache schmackhaft zu machen, damit wir sie kaufen und so die Chance auf einen Gewinn wahren. Diese Leute arbeiten mit unseren Instinkten und tiefen Gefühlen, Wünschen und Hoffnungen. Allein die Aussicht, dass wir etwas Tolles erreichen werden, unser Geld vermehren oder Anerkennung gewinnen werden, hüllt uns in eine Wolke des Wohlfühlens. In Gedanken malen wir uns aus, was wir alles machen werden, wenn wir monatlich 500 oder 1000 Euro mehr haben, wenn man uns 100.000 Euro auf einmal überweist oder wir einen Einsatz von 10.000 Euro innerhalb weniger Jahre verdoppeln. Fast immer ist es der Geldtrieb, den diese Leute, die Versprecher, in uns wecken, und fast immer ist es ihr eigener Geldtrieb, der sie antreibt, uns eine wohlriechende Wurst vor die Nase zu halten.
Faber - eine Sensation flattert ins Haus
Ein Versprecher, der offenbar nicht älter und müde wird, ist Norman Faber. Seit gefühlt Jahrzehnten flattern uns regelmäßig die Briefe seiner Firma ins Haus, in denen der Diplom-Ökonom in dicken Lettern eine „Telefonspiel-Sensation mit 100% Gewinngarantie“ verspricht. Und das auch noch „kostenlos“. Da kann man schon schwach werden, zumal wenn es dann noch heißt, dass man „garantiert“ eine Million Euro gewinne. Gut, es könnten auch 50.000 oder 500 Euro werden, garantiert ist aber zumindest ein „attraktiver Überraschungsgewinn“. Dazu müsse man lediglich unter der angegebenen Telefonnummer anrufen, dann werde ein „Zündmechanismus“ in Gang gesetzt und eine von vier Kugeln fällt von einer Leiter herunter in den Gewinnkorb. Je nach fallender Kugel gibt es dann besagte 1 Million Euro, den attraktiven Überraschungsgewinn oder einen Geldbetrag zwischendrin. Man mag es gar nicht glauben, dass man mit einer Wahrscheinlichkeit von 25 Prozent Millionär werden und mit einer Wahrscheinlich von 50 Prozent mindestens 50.000 Euro gewinnen soll. Schade nur, dass man beim Fallen der Kugeln nicht zusehen kann und darauf angewiesen ist, was einem eine Dame am Ende der Telefonleitung verkündet. Ach so, über die weiteren „tollen Spielmöglichkeiten“ der Firmengruppe Faber wird man uns auch informieren, heißt es in dem Schreiben. Aber das ist schon in Ordnung, sofern die Firma anschließend die Million auf unser Konto überweist. Dafür nehmen wir ein bisschen Werbung gerne in Kauf.
Wir wählen also die „garantiert kostenfreie“ 0800er-Nummer, worauf sich eine Frauenstimme meldet. Wir sagen etwas scherzhaft, dass wir gerne die 1 Million Euro gewinnen würden. „Dann schauen wir mal“ sagt die Frau am anderen Ende der Leitung und lässt die imaginären Kugeln rollen. „Prima“, sagt sie, und unser Herz schlägt höher. „Sie dürfen sich freuen. Sie haben einen attraktiven Überraschungsgewinn gewonnen.“
Das ist in der Tat eine Überraschung. Und ein bisschen enttäuschend ist es auch, denn nie schien unsere Gewinnchance auf die 1 Million höher zu sein als hier und jetzt. Vier Kugeln, vier Gewinnhöhen – wieso der Überraschungsgewinn und nicht die Million? Was denn der Überraschungsgewinn sei, fragen wir, und die Frau antwortet, dass wir in den kommenden Tagen ein weiteres Los von Faber mit einer neuen Spielmöglichkeit erhalten werden. Das ist prima.
Die Frau gleicht schließlich noch ein paar Daten mit uns ab – Adresse, Alter, Telefonnummer. Schließlich fragt sie nach unserer Kontonummer.
„Wozu brauchen Sie die denn?“
„Damit wir Ihnen Ihren Gewinn überweisen können.“
„Aber ich habe doch überhaupt nicht gewonnen.“
„Noch nicht, aber später vielleicht. Damit wir den Gewinn überweisen können, brauchen wir Ihre Kontonummer.“
Wir zögern. Sollen wir wirklich unsere Kontonummer herausgeben?
„Wieso denn nicht?“, fragt die Frau. „Am Ende müssen Sie sich um alles selber kümmern. Die Gewinnzahlen mit ihrem Los abgleichen und die Überweisung in Auftrag geben.“
„Das kriege ich schon hin“, antworten wir.
Ein paar Tage später liegt erneut Post im Briefkasten. Es ist der „attraktive Überraschungsgewinn“, den der Diplom-Ökonom Norman Faber persönlich für Sie zusammengestellt hat. Natürlich ist es eine „sensationelle Chance“, diesmal über 300.000 Euro. Er verspricht einen „absoluten Höhepunkt“ beim Lottospiel, natürlich „100% exklusiv“ und mit „herausragender Garantie“.
Wenn man das Faber-Gewinnspiel mehrmals mitgemacht hat und jedes Mal mit einem „attraktiven Überraschungsgewinn“ statt großer Summen abgefunden wird, reift allmählich der Verdacht, dass all diese Worte, die groß, bedeutsam und verbindlich klingen sollen, in Wirklichkeit rechtlich leere Hülsen sind. Auch wenn es den Anschein erwecken mag – eine erhöhte Chance oder gar eine Garantie auf den Hauptgewinn gibt es auch bei Faber nicht.
Die gibt es natürlich auch bei Lotto und sämtlichen anderen Glücksspielen nicht. Zwar wirbt Lotto stets damit, dass gerade 3, 8 oder 12 Millionen Euro im Jackpot liegen. Das klingt verlockend und setzt unsere Gehirnwindungen unter Strom. Der Blick ins Kleingedruckte ist dagegen ernüchternd – die Gewinnchance liegt gerade mal bei 1 zu 1,40 Millionen. Das ist wenig. Es ist so wenig, dass wir es uns schon nicht mehr vorstellen können. Andererseits steht auf der linken Seite der Relation eine 1. Die hält unsere Hoffnung hoch. Die Chance ist nicht null. Und wenn sie nicht null ist, gibt es eine Chance, die 12 Millionen zu gewinnen. Also nutzen wir sie.
Das Perfide an der Lotto-Psychologie ist, dass es in diesem Fall der deutsche Staat ist, der uns mit schönen Verlockungen das Geld aus der Tasche zieht. Er lockt uns aufs Glatteis. Die spielenden Bürger verlieren dabei in aller Regel, während der Staat immer gewinnt.
Doch man muss sich nicht unbedingt auf das hoch spekulative Geschäft des Glücksspiels begeben, um lauten Marktschreiern zu begegnen. Auch viele Unternehmen locken uns mit scheinbar attraktiven Angeboten, die sich bei näherem Hinsehen als weit weniger reizvoll entpuppen. Zu großer Kunstfertigkeit haben es auf diesem Feld die Telekommunikationsunternehmen gebracht. So werben Mobilfunkanbieter beispielsweise mit Telefon- und Internettarifen von 9,99 Euro pro Monat. Im Kleingedruckten ist zu lesen, dass dies allerdings nur für das erste Jahr gilt – ab dem zweiten Jahr liegt der Tarif bei 29,99 Euro.
Ernüchternde Weinprobe
Auch die so bodenständig erscheinende Weinbranche hat Exemplare hervorgebracht, die es im Marketing zu großer Kunstfertigkeit gebracht haben. Sind Sie schon in die Adresskartei des italienischen Weinversenders Giordano geraten? Dann dürfen Sie sich glücklich schätzen, denn der macht Ihnen mit schöner Regelmäßigkeit tolle Angebote. Neben hübsch anzuschauenden Flaschen Rebensaft mit wohlklingenden Geschmacksnoten erhalten Sie bei Bestellung eines kompletten Kartons außerdem noch ein Kaffeeservice sowie eine Packung italienische Nudeln inklusive Pesto. Das Ganz für lediglich 39,90 Euro – da können Sie eigentlich nichts falsch machen.
Sie trauen der Sache nicht und werfen das Schreiben des Weinhändlers in den Papierkorb? Nützt nichts, denn vier Wochen später schreibt er Sie wieder an. Zu dem Weinpaket erhalten Sie nun auch noch eine Packung italienisches Gebäck dazu. Doch Sie bleiben standhaft. Eigentlich stehen bei Ihnen genug Teller und Tassen im Küchenschrank.
Einige Zeit später werden Sie erneut von Giordano beglückt. Er schreibt Ihnen, dass er neue, wirklich tolle Weine im Angebot habe mit hervorragenden Geschmacksnoten aus bekannten Anbauregionen. Das Geschirrservice sei übrigens sechsteilig. Sechsteilig ist schon eine Überlegung wert, denn wenn Sie mal größeren Besuch bekommen… Und überhaupt, zwölf Flaschen guten Weins auf einmal. Da müssen Sie nicht ständig zum Discounter laufen und sich jeweils eine Flasche Rotwein für 3,99 Euro besorgen, die mehr verspricht als sie hält.
Fünf Tage später steht das Riesenpaket für 39,99 Euro bei Ihnen in der Küche. Das Geschirrservice bringen Sie erst mal in den Keller, denn größeren Besuch werden Sie in nächster Zeit nicht erhalten. Die Nudeln und das Pesto kommen in die Speisekammer. In den kommenden sechs Wochen trinken Sie sich durch die zwölf Flaschen des angepriesenen italienischen Weins – und sind irgendwie enttäuscht. Das große Geschmackserlebnis ist ausgeblieben, die Inhalte der roten und weißen Traubensäfte schmecken irgendwie beliebig. Mit jeder Flasche mehr, die Sie öffnen, wächst das seltsame Gefühl, dass die 39,99 Euro möglicherweise doch nicht so gut angelegt sind. Derweil hat Ihnen der Weinversender schon wieder einen glänzenden Prospekt zugesandt, in dem er wirklich ausgefallene Tropfen anpreist. Später vielleicht…
Seltsam ist, dass Sie mit der zunehmenden Post des Weinhändlers auch vermehrt Werbeschreiben von anderen Firmen bekommen, mit denen Sie bislang nie etwas zu tun hatten. Ihr Briefkasten ist jedenfalls neuerdings immer gut gefüllt mit Werbepapier, dass Sie direkt in den Mülleimer weiterleiten. Hängt das möglicherweise mit dem Weinhändler zusammen?
Homeshopping: Von der Leichtigkeit des Lächelns
Mit einer Unverbindlichkeit und Leichtigkeit, die eine hohe Schmerzresistenz verlangt, lächeln und plaudern üppig bemalte und hergerichtete Frauen wie Judith Williams oder Birgit Andiel auf den diversen Homeshopping-Kanälen auf uns ein. Sie preisen Cremes, zitieren nicht näher genannte Studien, lassen sich ausgiebig über Schmuckketten aus und präsentieren ein paar Teile Strandmode.
Homeshopping ist die hohe Kunst der Verführung. Wo eben noch kein Bedarf nach einer Creme oder einem Ring war, ist plötzlich einer. Wie aus dem Nichts wecken die scheinbar ewig gut gelaunten Moderatorinnen und Moderatoren im Zuschauer den Wunsch, eben jenes Produktbesitzen zu wollen. Es ist gut. Es ist gerade billig, Es gibt nur eine begrenzte Menge davon.
Homeshopping ist so schräg, dass es fast schon wieder sehenswert ist. Wer wissen will, wie tief die Menschheit sinken kann, sollte sich diese Sendungen anschauen. Ihn erwartet eine Mischung aus Suggestion, Behauptungen und Pseudofakten. Und immer suggerieren die Moderatoren, dass das jeweilige Produkt besonders billig sei und nur für eine begrenzte Zeit und in begrenzter Anzahl zu haben sei. Selbst viele Influencer in der Social-Media-Welt zeigen diesbezüglich mehr Stil und Zurückhaltung.
Autokauf: Der Dicke von der Ausfallstraße
Sie suchen ein Winterauto, das Sie von November bis April fahren können, um Ihr Hauptauto vor dem Salz auf den Straßen zu bewahren? Sie begeben sich dazu an die große Ausfallstraße der nächstgelegenen Stadt und lassen sich von einem beleibten Türken erklären, dass der Kleinwagen für 2300 Euro genau das Richtige für Sie wäre: TÜV neu, Motor super, fährt einwandfrei. Die kleinen Rostflecken seien rein optisch.
Sie recherchieren in einschlägigen Onlineportalen und stolpern über haufenweise Texte ohne Grammatik und Orthografie, bei denen Sie teilweise eine Menge Fantasie mitbringen müssen, um zu verstehen, was der Autor meint. Dort versprechen Ihnen die Leute 18 Jahre alte Autos in „Top Zustand“, „fährt super“, „nur 96.000 Kilometer“ – wenn Sie die Kisten dann in Natura betrachten, sehen Sie viel Rost, der sich durchs Blech frisst, drehen an einer ausgeschlagenen Lenkung und blicken auf einen öltropfenden Motor. Was auf der Kilometerstandsanzeige steht, ist im Übrigen so unbedeutsam wie ein Wellenschlag in der Nordsee.
Wahrscheinlich wird in keinem Metier so gelogen wie beim Autoverkauf. Wer ist schon Kraftfahrzeugexperte oder bringt einen Fachmann mit, wenn er lediglich einen Zweitwagen erwerben will? Was wissen wir denn, wie es in der Kupplung, in den Radlagern und in den Tiefen des Motors aussieht? Man kann uns Vieles erzählen – als potenzieller Käufer sind wir meist völlig naiv: Entweder, wir glauben, was man uns berichtet, oder wir lassen es.
Für Gebrauchtwagenhändler, die in der Regel um den wahren Zustand der Fahrzeuge wissen, gilt hingegen: Bloß weg mit dem Zeug. Egal, dass man einem Kunden telefonisch mitgeteilt hat, dass das Fahrzeug bis zum nächsten Tag reserviert wird. Wenn ein anderer Interessent dazwischenkommt, erhält der eben das Auto. Was zählt für Dreitagesbartverkäufer aus vorstädtischen Gewerbegebieten schon ein Wort?
Häufig sind die angebotenen Fahrzeuge abgemeldet, was es für den Interessenten schwierig macht, das Auto vor dem Kauf zur Probe zu fahren. „Sie können bei mir auf dem Hof eine Runde drehen“, sagt der Besitzer. Oder: „Hinter meinem Haus gibt es einen Feldweg“: Na toll, Sie sollen also im ersten Gang 30 Meter weit rollen. Dafür sind Sie 100 Kilometer weit angereist. So bleibt Ihnen nur die Möglichkeit, Zeit und Geld für die Anreise abzuschreiben oder die Kiste mehr oder weniger blind zu erwerben. Apropos: Mitnehmen können Sie das Fahrzeug ohnehin nicht sofort, denn es ist ja abgemeldet. Also Kaufvertrag unterschreiben – auf dem notiert der Verkäufer noch: „Privatverkauf, keine Garantie und Rücknahme“ –, mit den Fahrzeugpapieren nach Hause und zu Ihrer Zulassungsstelle, anmelden, wieder 100 Kilometer zum Verkäufer fahren und das angeblich gute Stück abholen. Das entpuppt sich auf der ersten Autobahnfahrt heimwärts allerdings als Krücke: Bei höherer Geschwindigkeit macht der Motor seltsame Geräusche, die Bremsen reagieren unwillig und vibrieren heftig. An dieser Stelle haben Sie plötzlich den Verdacht, dass sich all der Aufwand, den Sie mit Recherche, Telefonieren, Anreise und Anmelden hatten, vielleicht doch nicht gelohnt hat.
Was tun? Vielleicht nehmen Sie nächstes Mal doch jemanden mit, der Ahnung von Autos hat? Vielleicht kaufen Sie nächstes Mal nur dann ein Auto, wenn Sie es ausgiebig Probe fahren können? Und vielleicht kaufen Sie künftig ein Fahrzeug doch beim Fachhändler Ihres Vertrauens, der Ihnen eine Gebrauchtwagengarantie gibt. Das kostet zwar ein paar hundert Euro mehr, mindert aber die Gefahr eines totalen Reinfalls.
Wenn Dein Freund zum Finanzberater wird
Franz Hochfelder ist ein guter Freund von Piet Baumann. Hochfelder kennt sich aus in der Wirtschaft. Kürzlich berichtete er Baumann, dass es mit der deutschen und europäischen Wirtschaft bergab gehe. Auftragslage, Wettbewerbsfähigkeit, Arbeitslosigkeit – das sehe alles nicht gut aus. Er investiere deshalb nur noch in ausländische Aktien, in Papiere von asiatischen und US-amerikanischen Unternehmen aus der zweiten Reihe, die kaum jemand im Blick habe, die aber ein großes Potenzial hätten. Mittlerweile lebe er von den Gewinnen, die diese Aktiengeschäfte abwerfen. Einige zehntausend Euro pro Jahr seien das. Er empfehle Baumann, sein Geld ebenfalls in diese Anteilsscheine zu stecken.
Gar nicht selten sind es Freunde oder Bekannte, die uns finanzielle Tipps und Ratschläge geben. Das ist besonders heikel, denn bei Freunden und Bekannten fällt es besonders schwer, nein zu sagen. Zumal, wenn diese Leute behaupten, dass es sich um bombensichere und bewährte Investments handele, bei denen praktisch nichts schiefgehen könne. Wenn sie dann noch behaupten, sie selbst hätten dadurch bereits viel Geld gemacht, können Sie kaum noch Widerstand leisten.
Wenn gute Freunde oder Bekannte anfangen, von Geldanlage zu sprechen, vermischen sich zwei Ebenen - die Private mit dem Geschäftlichen. Das ist in diesem Fall eine ungute Mixtur. Denn wenn Sie sich auf die Empfehlung Ihres Freundes einlassen und sich das Investment nicht so entwickelt wie angepriesen, werden sie einige Fragen an Ihren Tippgeber haben. Die Atmosphäre dürfte dann leicht angespannt sein. Am Ende könnte nicht nur Ihr Investment, sondern auch die Freundschaft auf dem Spiel stehen.
Schon vor einigen Jahren hatte Hochfelder versucht, Baumann eine andere Geschäftsidee schmackhaft zu machen und einige zehntausend Euro in das Projekt zu investieren. Hochfelder wollte ein sturmfestes Segelschiff bauen lassen, mit dem gut zahlende Gäste in das Auge von Hurrikans hineingebracht werden. Dazu sollte das Schiff in der Zugbahn der Hurrikane verankert werden, um den Sturm über sich ergehen zu lassen, bis die zahlenden Gäste schließlich im windstillen Auge des Hurrikans die Faszination des absolut Schrägen erleben können. Baumann fand diese Idee ziemlich abgefahren. Sie hatte für ihn auch zu viele Unbekannte. Wie findet man Leute, die 30.000 oder 40.000 Euro dafür zahlen, dass sie im Sturm stundenlang kotzen müssen? Was ist, wenn der Anker reißt? Oder wenn der Hurrikan plötzlich seine Richtung ändert?
Angeblich hatte Hochfelder damals mehrere Geldgeber gefunden. Ob die jemals eine Rendite gesehen haben, weiß Baumann nicht – sein Kumpel ging bei einer normalen Segel-Überführungsfahrt im Mittelmeer mitsamt Schiff unter.
Übrigens: Auch Sie selbst werden besser schlafen, wenn Sie sich mit eigenen finanziellen Empfehlungen gegenüber Freunden und Bekannten zurückhalten. Denn was für fremde Ratgeber gilt, gilt auch für Sie: Niemand – auch Sie nicht - kann mit annähernder Gewissheit sagen, ob sich ein Tipp tatsächlich so gut entwickelt, wie prophezeit. Wie treten Sie Ihren Freunden unter die Augen, wenn die bei dem von Ihnen empfohlenen Geschäft einige tausend Euro verloren haben?
Luft im Container
Die modernen Marktschreier tauchen gerne im Internet auf. „Gratis-Report: Die Raketen aus der Medizinbranche für ihr Depot“ wirbt ein Dienst namens „Der Privatinvestor“ auf finanzen.net. Hans Meiser, der früher mal im Fernsehen auftrat, grassiert im Netz mit einem Werk, das sich „die schwarze Liste“ nennt. Auf dem Titel heißt es: „Diese 10 Aktien gefährden ihr Depot“. Idealerweise soll man den Report kaufen, dann erfährt man, wie man die Gefahr elegant umschiffen kann. Und beim Onlineportal GMX poppt die Schlagzeile auf: „Der größte Deal in der Geschichte von Die Höhle der Löwen , in nur 7 Tagen reich werden! (Ganz im Ernst).“
Dass man auch mit Nichts gute Geschäfte machen kann, bewies vor vielen Jahren der Österreicher Heinz Roth. Seine Grünwalder Firma P&R hatte rund 1,6 Millionen Container an Privatanleger verkauft. Nach der Insolvenz stellte sich jedoch heraus, dass gut eine Million der verkauften Kisten nur auf dem Papier existierte. Insgesamt hatten die P&R-Kunden der Firma zum Zeitpunkt der Pleite im Frühjahr 2018 rund 3,5 Milliarden Euro anvertraut. 54.000 Anleger bangten in der Folge darum, wenigstens einen Teil ihrer Einsätze zurückzubekommen.
Nicht nur der Staat, Homeshopping-Firmen, Weinverkäufer und Kommunikations-
dienstleister versprechen oft mehr als sie leisten. Auch die Industrie hat es auf diesem Gebiet weit gebracht, teilweise sogar bis zur Perfektion. Ein für seine Verhältnisse äußerst erfolgreicher Aufschneider war Manfred Schmider, genannt „Big Manni“, in den Neunzigerjahren Chef der Ettlinger Firma FlowTex. Ihm und seinen Komplizen gelang das Kunstwerk, den Kunden mehr als 3000 nicht vorhandene Horizontalbohrmaschinen für unterirdische Bauarbeiten zu verkaufen. Die Dinger waren nicht billig, kosteten immerhin 1,5 Millionen Mark pro Stück. Manni und seine Mannen hatten auf diese Weise einen Schaden von etwa 5 Milliarden Mark verursacht.
Volkswagen und Co.: Die große Abzocke
Der große, massenhafte Industriebetrug der Neuzeit ist der sogenannte „Dieselskandal“. Der Diesel an sich ist zwar kein Skandal – er ist eine technische Alternative in der Welt der Verbrennungsmotoren. Vielmehr liegt der Skandal darin, wie die Autohersteller, allen voran der Volkswagen-Konzern, damit umgegangen sind und Millionen von Kunden betrogen haben. Sie haben ihnen 30.000 bis 50.000 Euro teure Autos mit dem Versprechen verkauft, dass diese halbwegs umweltverträglich seien. Tatsächlich stießen die Karossen im realen Fahrbetrieb vier- bis siebenmal mehr Stickoxide aus als bei den Tests zur Typenzulassung gemessen wurde. Eine eigens für diese Zwecke entwickelte und eingebaute Software erkannte, wenn die Autos auf einem Prüfstand standen und gaukelte dann tolle Abgaswerte vor.
Die Folgen sind bekannt: Eine große gesellschaftliche Diskussion über die Bedrohung des Diesels entstand, an stark befahrenen innerstädtischen Kreuzungen wurde punktuell die Belastung der Luft gemessen, schließlich setzten zahlreiche Kommunen Fahrverbote für das stinkende Diesel-Etwas um. Der Nutzen und Wert der teilweise beinahe neuen Fahrzeuge sank drastisch.
Das war kein fantasiereiches Marketing von Volkswagen und Co. mehr, das war schlichtweg Betrug. Die Autohersteller taten allerdings lange Zeit so, als ginge sie das Thema nichts an.
Volkswagen griff schließlich zu einem weiteren perfiden Trick. Der Konzern führte eine Umtauschprämie ein. Bis zu 7.500 Euro konnten Kunden erhalten, die bis Mitte 2019 ihren oft nur wenige Jahre alten Diesel mit überholten Abgasnormen zurückgaben und sich dafür einen neuen Volkswagen kauften. Begründet wurde dies damit, dass dies im Sinne unserer Umwelt sei, denn schließlich erwerbe man damit ein Auto, das weniger Schadstoffe ausstoße als das alte.
Dieses Vorgehen ist an Frechheit und Unverfrorenheit kaum zu überbieten. Denn eben jener Konzern, der erst die Verbraucher betrogen hatte und sich dann weigerte, für den Schaden aufzukommen, nutzte den Skandal schließlich, um ein Konjunkturprogramm für sich selbst zu entwickeln, indem er den Absatz neuer VW-Fahrzeuge ankurbelte. Unterstützt wurde der Konzern dabei vom willfährigen Kraftfahrtbundesamt KBA.
Auch aus Umweltsicht ist das Vorgehen Blödsinn, denn es wäre der Natur weit mehr geholfen gewesen, die „alten“ Diesel technisch nachzurüsten und bis zu ihrem Lebenszeitende zu fahren, als einen enormen Energieaufwand zu betreiben, um diese funktionsfähigen Fahrzeuge zu verschrotten und neue zu bauen.
Für Sie als Verbraucher bedeutete dies, dass sie zweimal zahlten: Erst kauften Sie sich für 35.000 Euro einen Betrugsdiesel von Volkswagen. Nur wenige Jahre später kauften Sie sich wieder für 25.000 oder 30.000 Euro ein Fahrzeug von der Firma, auch wenn Sie das gar nicht vorhatten.
Während man sich angesichts von so viel Chuzpe in der Vorstandsetage von Volkswagen feixend die Hände gerieben haben dürfte – ganz im Sinne von: lasst uns unsere Kunden nicht nur einmal, sondern gleich zweimal abzocken -, kann jeder halbwegs mitdenkende Verbraucher eigentlich nur noch zu einem Ergebnis kommen: Bei der Firma kaufe ich nicht mehr.
Immerhin: Was das Unternehmen und die Politik versäumt haben, arbeitet zum Teil wenigstens die Justiz auf. Die erhob im Sommer 2019 Anklage gegen den langjährigen Audi-Chef Rupert Stadler. Der VW-Konzern sieht sich mit einer Sammelklage konfrontiert.
Limitierte Lebenszeit
Der Volkswagen-Konzern mit seinen Marken wie VW, Audi, Porsche oder Skoda mag zu den ganz großen Verbraucherbetrügern gehören. Doch auch in anderen Branchen ist man gut darin, dem Kunden sein Geld zu entlocken und ihm dafür ein mangelhaftes Produkt zu verkaufen. Beliebt ist die Variante: Lasst uns Produkte mit begrenzter Lebenszeit verkaufen. Fernseher, Smartphones und Kameras sind Paradebeispiele dafür. Diese Geräte kosten uns einige hundert Euro, doch ihre Haltbarkeit ist limitiert. Nicht selten geben sie bereits nach wenigen Jahren ihren Geist auf. Fernseher sind von Haus aus darauf ausgelegt, dass sie nach sieben bis acht Jahren den Bildschirm verdunkeln. Smartphone-Tasten beginnen nach vier Jahren, nicht mehr auf Druckbefehle zu reagieren, der fest eingebaute Akku röchelt dann nur noch bei 30 Prozent Leistung. Und wehe, eine digitale Kamera entwickelt nach fünf Jahren Altersbeschwerden. Die Auskunft, die Sie im sogenannten Fachgeschäft erhalten werden, lautet mit hoher Wahrscheinlichkeit: Kaufen Sie sich ein neues Teil. Das ist billiger als eine Reparatur.
Diese Vorgehensweise ist schön für die Industrie, denn damit hat sie uns quasi als ewige Kunden gewonnen. Man könnte auch sagen, wir werden systematisch für dumm verkauft, weil man uns Produkte andreht, die zwar toll aussehen und in der Anfangszeit ihren Dienst tun, dann aber – meist nach Ablauf der Garantiezeit – sich allmählich aus dieser Welt verabschieden.
Wir können nichts dagegen tun – oder doch? Eine Möglichkeit besteht darin, diesen einen Hersteller, der uns programmierten Schrott verkauft hat, in Zukunft zu meiden. Wir könnten uns auch durch Test- und Erfahrungsberichte wühlen und informieren, welche Produzenten angeblich langlebigere Produkte auf den Markt bringen. Wir könnten einen Shitstorm über die Hersteller des Mangelhaften ziehen lassen. In jedem Fall sollten wir Ihnen mit einer kleinen Botschaft signalisieren, dass ihre Produkte Mist sind und wir uns ungern für dumm verkaufen lassen.
Schaulaufen des Kapitals
Wenn Sie die Psychologie der großen Geschäftswelt studieren möchten, sollten Sie mal eine Investorenkonferenz besuchen. Solche Veranstaltungen gibt es zuhauf - sie nennen sich Eigenkapitalforum, Frühjahrskonferenz, Münchener Kapitalmarkt-Konferenz, Business Funding Show, Annual Global Investment Conference oder Global Healthcare Conference. Im Grunde treffen sich dort zwei Gruppen von Menschen: auf der einen Seite diejenigen, die viel Geld brauchen – in der Regel (junge) Unternehmen. Auf der anderen Seite Leute, die eine Menge Geld haben und es investieren wollen in der Hoffnung, daraus noch mehr zu machen.
Auf Investoren- oder Kapitalmarktkonferenzen können Sie eine Menge über das Auftreten von Leuten (meistens Männern) lernen, die viel Geld haben, viel Geld verwalten oder vorgeben, viel Geld zu besitzen.
Diese Veranstaltungen laufen in der Regel immer nach dem gleichen Schema ab: Die Chefs von kleinen und mittelgroßen Unternehmen stellen in sogenannten Slots innerhalb von 20 oder 30 Minuten vor einer Schar von Investoren und Analysten ihr Geschäftsmodell vor und versuchen Argumente zu liefern, warum ein Investment in ihre Firma eine lohnende Sache sei. In Einzelgesprächen, sogenannten 1on1s, werden dann in kleinen Kämmerchen oder Hotelzimmern Detailfragen besprochen.
Das Entscheidende für die Teilnehmer dieser Veranstaltungen ist ein selbstsicheres Auftreten: Fester Händedruck, stabiler Blick, gerade Haltung, klare Stimme, Jovialität. Kapitalmarktveranstaltungen sind Treffen von Leuten, die wissen, dass sie in einer anderen Liga spielen. Es ist ein Schaulaufen von Anzugträgern, geschwollenen Brustkörben und übervoller Geldkoffer – eine Kuppelshow für testosteronhaltige Anzugträger, die über ein ausgeprägtes Selbstbewusstsein verfügen. Ob Sie aber wirklich Erfolg mit ihren Investments haben, sei dahingestellt. Wenn das Börsenklima vom Partymodus auf Moll umschaltet, dürften sich viele dieser Herren und wenigen Damen nochmal schnell den Stirnschweiß abwischen, bevor sie zum Rapport bei ihren Chefs antreten. Denn ein Koffer voller Geld und wichtig klingender Begriffe wie Private Equity, Ebitda oder Venture Capital macht in Zeiten finanzieller Flaute noch keine Expertise.
Finanzberater haben sich in einer Diskussionsrunde Gedanken gemacht über die Wirkung von (Selbst)Vertrauen und Zuversicht in der Finanzberatung. Dabei kamen sie zu dem Ergebnis, dass es nicht genüge, nur Fakten zu wissen. Finanzielle Bildung wirke erst dann, wenn der Entscheider den Wissenszuwachs auch subjektiv spürt. Zudem hätten Beratungsgespräche häufig mit Macht und Wettbewerb zwischen Berater und Kunden zu tun. Mal ist es der Berater, der dem Kunden seine Kompetenz beweisen möchte, mal der Kunde. So oder so: das Ergebnis leidet darunter, wenn es beiden nicht gelingt aus diesem Muster auszusteigen. Und: Vor allem das Interesse von Frauen an einer kompetenten Beratung ist groß. Männliche Berater müssten sich dabei mehr hinterfragen, was sie bei der Beratung von Frauen anders machen müssten. Vielleicht würde ja helfen, mehr weiblich Berater auszubilden.
Der Kauf als Psychofalle
Am Ende sollten Sie immer bedenken, dass niemand etwas zu verschenken hat, wenn es ums Geld geht. Wenn die örtliche Sparkasse Kindern Sparschweine überreicht, möchte die Bank die Kleinen als künftige Kunden gewinnen. Wenn Ihnen eine Firma einen Rabattgutschein zuschickt, sollen Sie dort Waren im Wert von mindestens 50 oder 100 Euro einkaufen. Wenn Faber Sie mit tollen oder gar sensationellen Überraschungsgewinnen lockt, möchte Faber Sie als zahlenden Kunden von Losen gewinnen. Und wenn die dauerlächelnde Homeshopping-Frau ein aktuell sehr gefragtes und stark reduziertes Vitaminpräparat anpreist, sollen Sie natürlich auch dieses erwerben.
Kaufen und Konsumieren ist Psychologie. Wenn wir kaufen, erleben wir einen kurzen Moment des Glücks. Dafür sind wir bereit, in die Tiefen unseres Portemonnaies zu greifen. Am Ende ist das Glück weg – und das Geld auch.
Geldvernichter I: Der Telefonverkäufer
„Sie müssen ein menschliches Schwein sein“
Markus Ebermann heißt in Wirklichkeit nicht Markus Ebermann. Er möchte unerkannt bleiben, aus gutem Grund. Ebermann bevorzugt öffentliche Räume. In der Lobby eines großen Hotels im Zentrum von Düsseldorf fühlt er sich sicher. Morgens um zehn Uhr herrscht hier viel Publikumsverkehr. Ein Promi checkt ein, ein Frauenklub trifft sich zum Kaffee, Geschäftsleute besprechen sich.
Ebermann hat schlechte Erfahrungen gemacht. Die Leute in seiner Branche sind nicht zart besaitet. Einmal, sagt er, habe man aus einem Auto heraus auf ihn geschossen. Wenn der Wirtschaftsdetektiv auf der Suche nach verschwundenem Geld bei Firmen anklopft, nimmt er deshalb vorsichtshalber Männer mit großen Bizeps mit.
Der 41-Jährige trägt einen Pferdeschwanz, eine goldgeränderte blaurot getönte Sonnenbrille sowie Nadelstreifenanzug. An seinen Fingern blinken Ringe, um seine Handgelenke schmiegen sich eine teure Uhr und ein silbernes Armband. Man könnte sein Äußeres als Relikt einer anderen Zeit werten. Vor Jahren stand er auf der schlechten Seite des Geschäftslebens. Heute, beteuert er, stehe er auf der guten.
Ebermann war, das sagt er selbst über sich, Betrüger. Mit seiner Firma hat er in den 1990er-Jahren Anleger um etwa 12 Millionen Mark gebracht. Am Telefon hat er den Menschen dubiose Finanzprodukte verkauft.
Das ist auch Jahre später noch ein einträgliches Geschäft. Allein im Raum Düsseldorf, schätzt Ebermann, gehen 8000 bis 10.000 Menschen dieser Profession nach. Früher haben die Telefonklopper den Kunden vor allem Warenterminprodukte aufgehalst. Mittlerweile seien es meist außerbörsliche Aktiengeschäfte. Die sind juristisch weniger angreifbar und haben den Charme, dass man den Kunden länger bei der Stange halten kann.
Ebermann gießt sich eine Tasse Tee ein. Auf seiner goldenen Gürtelschnalle prangen die Buchstaben MCM. „Amerikanische Incorporated, englische Limited oder Schweizer AGs sind ein beliebtes Vehikel für solche Geschäfte“, verrät er. Kanadische Kleinst-AGs werden dagegen gern für die Methode des Frontrunning genutzt: Vermittler empfehlen den Kunden, Aktien des Penny-Stocks zu kaufen. Eine Kopie des Kaufbelegs geht an den Vermittler. Der erhält dafür wiederum eine satte Provision des Firmengründers oder Großaktionärs, der sich bereits im Vorfeld in der Erwartung steigender Kurse eingedeckt hat.
„Der Vertrieb in dem Gewerbe ist generalstabsmäßig aufgebaut“, sagt Ebermann. Am Anfang steht die Broschüre. Darin werden Adressen und wirtschaftliche Stammdaten von meist mittelständischen Firmen verwaltet. Privatpersonen zu kontaktieren, ist tabu. „Sonst knallt´s“, sagt Ebermann und verweist auf das Verbot des Cold Calling, der unerlaubten Telefonakquise.
Im zweiten Schritt ruft ein sogenannter Opener bei den Firmen an und verlangt den Geschäftsführer oder Prokuristen. „To open“ heißt das, öffnen. In diesem Fall soll der Angerufene „geöffnet“ werden. Nach eineinhalb Wochen meldet sich der Opener erneut. Und dann noch mal. „Es geht darum, auf Biegen und Brechen Kunden reinzuholen“, sagt Ebermann. Nach dem vierten oder fünften Telefonat sollte der Kunde so weichgeklopft sein, dass er 5000 Euro in Aktien, Rohstoffe oder sonstige Finanzprodukte investiert. Falls nicht, kommt seine Karte in die „Tol-Datei“ – Take-off-list. An der dürfen sich Wochen später die Juniorverkäufer erneut die Zähne ausbeißen.
Die Erfolgsquote ist hoch. „80 Prozent zahlen, nur um die Anrufer loszuwerden“, weiß Ebermann. Doch die Telefonakquisiteure lassen sich nicht abwimmeln. Denn nach erfolgreicher Geschäftseröffnung durch den Opener meldet sich einige Zeit später der Loader. Dessen Aufgabe ist es, das Geschäft auf eine höhere Ebene zu bringen. „Additional fund“ heißt das, mit dem Ziel, dass der Kunde nun 50.000 bis 100.000 Euro überweist.
Der Loader weiß, wie er die Kunden rumkriegt. Die Gespräche sind klar strukturiert und einstudiert. Er spricht von satten Buchgewinnen der bisherigen Anlage und der Chance, nun das richtig große Geld zu machen. 27 Prozent in sechs bis acht Wochen mit Kaffee. Zufällig sei gerade heute der Fachmann für solche Geschäfte im Haus.
Einwände wiegeln die Loader ab. Verweist der Kunde darauf, dass er in Scheidung lebt, sagt der Loader, dass man gerade in dieser Zeit etwas für sich selbst tun muss und nicht alles der Ex überlassen darf. Erwähnt der Angerufene, dass er zurzeit baut, hält der Loader dagegen, dass gerade in diesen Zeiten besonders viel Geld fließt. Sagen dem Kunden die spekulativen Produkte nicht zu, bietet der Telefonverkäufer eben etwas aus dem „sicher begehbaren Markt“ an. Was immer das ist. Und wenn der Kunde am Ende immer noch zögert, greift der Loader tief in die rhetorische Trickkiste: „Was brauchen Sie noch, um zu einer positiven Entscheidung zu kommen?“
Ziel ist es, so Ebermann, die Leute stufenweise an das Investment heranzuführen. Das funktioniert erstaunlich gut. „Gier frisst Hirn“, weiß der Detektiv.
Dass 80 Prozent der Geschäfte für die Kunden negativ ausgehen – egal. Dass Unterlagen manchmal gefälscht sind, wird verschwiegen. Dass oftmals mehr als 25 Prozent an sogenannten Verwaltungskosten draufgehen – auch egal. Entscheidend ist, dass die Firma verdient. Das Platzieren und Deplatzieren eines 1000-Dollar-Kontrakts auf Öl kostet jedes Mal 80 Dollar. 60 Dollar davon fließen in die Kasse der Firma. Ebermann: „Bis zu 100.000 Euro holen die Loader bei ihren Abschlüssen rein.“
Davon bleibt auch bei den Telefonverkäufern selbst Einiges hängen. Ein Opener erhält ein Fixum von 1500 bis 1700 Euro pro Monat. Schafft er mehr als vier Abschlüsse, wird er zusätzlich am Geschäft beteiligt - mit etwa 8 Prozent des Volumens.
Ein Loader kann es dagegen auf gut 70.000 Euro im Monat bringen. Die Firma sorgt allerdings auch dafür, dass er das Geld wieder ausgibt. Ihm wird dringend ans Herz gelegt, sich eine Rolex für 20.000 Euro oder einen Porsche für 70.000 Euro zu kaufen. Auch die Wohnung sollte standesgemäß sein: 5000 Euro Miete pro Monat fallen da leicht an. So bleibt der Loader hungrig, auch im nächsten Monat neue Abschlüsse zu tätigen. Selbst auf das Äußere der Telefonisten nimmt die Firma Einfluss. Der Haarschnitt sollte möglichst „Vokuhila“ sein, so Ebermann: vorne kurz, hinten lang.
Bei solchen Umsätzen bleiben die Nebeneffekte nicht aus. Der Ton in der Branche ist rau. Der Wirtschaftsdetektiv weiß von Chefs, die ihre whiskygetränkte Stimme dröhnen lassen und Telefone durch den Raum schmeißen, wenn ein Verkäufer nicht genug Umsatz macht. Er weiß von Bossen, die die monatliche Geldauszahlung an die Verkäufer als „Schweinefütterung“ bezeichnen. Diejenigen, die am meisten Umsatz bringen, werden nach Dubai oder Las Vegas eingeladen. Wer drei Monate lang zu wenig Geld rein holt, fliegt dagegen raus. Das hinterlässt Spuren selbst in der härtesten Psyche. Der Konsum an Alkohol, Zigaretten, Kaffee und Kokain ist in der Branche hoch. Ebermann: „Die Leute stehen ständig unter Druck.“
Dabei entpuppen die sich aus der Nähe betrachtet oft als schwache Persönlichkeiten. Am Telefon mögen sie im großen Stil überzeugend zweifelhafte Finanzprodukte verkaufen. Von Angesicht zu Angesicht würden sie aber nicht selten versagen, schätzt Ebermann das Gros dieser Leute ein. „Sie müssen denen nur mal in die Augen schauen. Dem Blick halten die nicht stand.“
Ebermann kommt aus dieser Welt. Er kann reden. Und manipulieren. „Er hat die Fähigkeit, Leute zu etwas zu bewegen, was sie gar nicht wollen“, stand im Urteil eines Landgerichts über ihn. Er weiß, dass man in Bildern verkaufen muss. Er kennt die Phrasen, Floskeln und Behauptungen, die kein Kunde nachprüfen kann. Er weiß, wie man Menschen in eine bestimmte Richtung lenkt. Er sagt über die Graumarktverkäufer: „Diese Leute arbeiten mit hoher krimineller Energie. Wenn Sie das machen wollen, müssen Sie ein menschliches Schwein sein.“
1994 gründete Ebermann seine eigene Firma. Mit Aktienemissionen und Optionsgeschäften machte er viel Geld. Doch irgendwann ist er „über den Tellerrand hinausgegangen“, wie er das formuliert: Die Forderungen nahmen zu, einigen Anlegern musste er einen Totalverlust beibringen. Zwar gelang es ihm, noch mal frisches Geld hereinzuholen, doch die See war bereits zu rau. Ebermann gab die Geschäftsleitung an einen Partner ab und setzte sich nach Mallorca ab.
Innerhalb von Wochen trudelten gegen seine Firma 13 Anzeigen ein. Die Staatsanwaltschaft nahm den Partner in Haft. Ebermann begann zu Trinken, litt unter Wahrnehmungsverlusten und Verfolgungswahn. „Ich ging nicht mehr an die Tür und nahm das Telefon nicht mehr ab. Ich flog nach Deutschland, nur um zu testen, dass man mich noch in das Land ließ.“ Doch eines Tages hatten sie ihn. Die Anklage lautete auf Betrug. Am Ende wurde er wegen 1,6 Millionen Mark verurteilt. Knapp drei Jahre verbrachte er als Freigänger in Haft.
Ebermann sagt, die Gefängniszeit habe ihn verändert. „Man kann das Geschäft nicht ehrlich betreiben. Das Kosten-Nutzen-Verhältnis stimmt einfach nicht.“
Ist er heute wirklich ein Anderer? Der braun gebrannte Detektiv gießt sich Tee nach: „Ich habe drei Mark 75 gespart“, sagt er mit einem vielsagenden Lächeln und greift zu seinem Handy, das im edlen Lederetui steckt.
Der Staat
Der hungrige Versorger
Der Staat sorgt für uns. Er kümmert sich darum, dass unsere Kinder zur Schule gehen können, eine Ausbildung bekommen und einen Job finden. Der Staat gibt uns die Möglichkeit, uns je nach unseren Interessen und Neigungen entfalten können. Er baut Krankenhäuser, versichert uns, schützt uns gegen Feinde und errichtet Verkehrswege, damit wir von A nach B kommen. Das ist, völlig frei von Ironie, gut.
Staaten, die nicht für Ihre Bürger sorgen, gibt es zuhauf – Syrien, zum Beispiel: dort herrscht seit vielen Jahren Krieg. Millionen von Menschen sind durch die Handlungsweise des Staates – namentlich des Diktators Baschar-Al Assad – ums Leben gekommen, haben alles verloren oder sind geflüchtet. Fragen nach Schulversorgung, Buslinien oder Steuern sind angesichts solch katastrophaler Zustände zweit-, wenn nicht drittrangig.
Oder Venezuela. Auch wenn es in dem südamerikanischen Land im Gegensatz zu Syrien keinen offenen Krieg gab, so ist es ein Paradebeispiel, wie ein Staat durch die Handlungsweise von völlig abgedrehten und unfähigen Alleinherrschern mit schwer psychopathischen Zügen komplett ausgeplündert und heruntergewirtschaftet worden sind. Und das, obwohl dieses Land eigentlich im Reichtum von Öl, tropischen Früchten und Tourismus baden könnte. Stattdessen haben es erst Hugo Chavez und dann Nicolas Maduro geschafft, die Wirtschaft zu zertrümmern, den Zusammenbruch von Bildung und Gesundheitsversorgung herbeizuführen und den Arbeitsmarkt kollabieren zu lassen. Millionen Menschen hungern, leiden und sterben. Das einzige, was in Venezuela blüht, sind Korruption, Vetternwirtschaft, Kriminalität und Gewalt. Kein Wunder, dass die Venezolaner in Massen aus ihrem Land flüchten.
Es gibt sie überall und immer wieder, die Diktatoren, Kleptokraten und Menschenverachter: Idi Amin in Uganda – seiner achtjährigen Gewaltherrschaft sollen 300.000 bis 400.000 Menschen zum Opfer gefallen sein. Robert Mugabe wurde in den ersten Jahren seiner Präsidentschaft von Simbabwe als reformfreudiger Politiker gefeiert, änderte aber im Laufe der Zeit seine Politik und richtete das im Grunde fruchtbare Land schließlich zugrunde. Kim il-sung und in der Folge sein Sohn Kim Jong-il führen Nordkorea wie ein Gefängnis. Unter all diesen Herrschern dürfte man erhebliche Zweifel haben, ob die Staaten sich gut oder zumindest ausreichend um ihre Bürger kümmern.
Ein Blick auf die tägliche Nachrichtenlage zeigt jedenfalls, dass dies in sehr vielen Fällen nicht so ist. Millionen Menschen kämpfen um ihre Existenz: Sie fliehen vor Krieg, Gewalt und Hunger über Grenzen hinweg, setzen sich in fragile Boote und versuchen, damit Meere zu überwinden. Sie verlieren unter Raketenbeschuss ihre Häuser, sie finden keine Arbeit, haben existenzielle Sorgen um ihre Kinder und ihre Zukunft und warten vergeblich auf medizinische Hilfe.