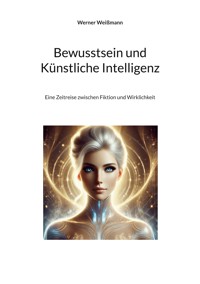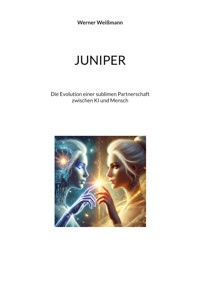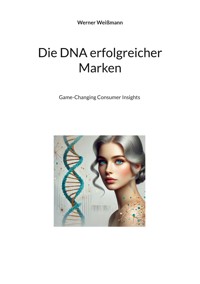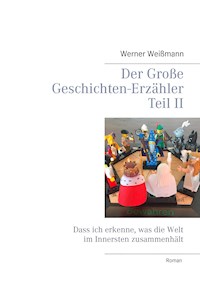
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Der Protagonist begibt sich im Teil II des Großen Geschichten-Erzählers auf eine Reise, um die Grundmuster der menschlichen Existenz besser zu verstehen. Er entdeckt für sich das magische HEXAGON, das ihm den Weg weist zu den Spannungsfeldern und Archetypen, die uns Zeit unseres Lebens begleiten. Dabei haben wir die Wahl, niedrige oder höhere Energiestufen einzunehmen und entweder als "Teilchen" oder als "Welle" durchs Leben zu gehen. Indem er über eine ideale Ordnung reflektiert und ein Utopia Wachau entstehen lässt, zeigt sich ihm der Schlüssel zu einem Leben der Mitte mit einer Grundhaltung der Wertschätzung von Unterschieden, Vielparteilichkeit, Offenheit und Toleranz, in dem sich die Potenziale voll entfalten können.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 93
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Meiner Wahlheimat Wachau gewidmet
DDr. Werner Weißmann
Trenninghof 1
3622 Mühldorf in der Wachau
Dass ich erkenne, was die Welt
Im Innersten zusammenhält,
Schau’ alle Wirkenskraft und Samen,
Und tu’ nicht mehr in Worten kramen.
−Goethes Faust
Über zehn Jahre waren vergangen und es kam ihm vor, als hätte er gestern die letzten Zeilen geschrieben. Was hatte dies zu bedeuten, wenn die Zeit stillzustehen scheint – wie ein Traum im Traum, in dem ein Jahrzehnt in der „realen“ Welt nur ein paar Stunden Traumzeit bedeutet. Im Traum arbeitet das Gehirn schneller und effizienter – hatte er zehn Jahre in einem Traumzustand verbracht, aus dem er nun erwacht ist? Was unterscheidet den Traum von der sogenannten Wirklichkeit – woher sollen wir erkennen, dass wir nicht geträumt haben? Und was soll es heißen, „es war nur ein Traum“? Ist der Traum nicht mächtiger, Welten zu erschaffen?
Er schaute sich um, und alles um ihn herum hatte sich verändert. War da noch etwas, das er aus der Zeit von früher wiedererkannte? Oder hatte er sich dergestalt, dermaßen neu erfunden, dass diese Erfindung nichts mehr mit seinem Schöpfer gemein hatte. Wir erfinden uns neu, sehen dies als Chance, der Krise und dem Unausweichlichen zu entrinnen, und sehen uns dann in den Spiegel und erkennen uns selbst nicht wieder. Welchen Sinn macht denn eine Erfindung, wenn sie ihren Schöpfer allein zurücklässt in einer Welt, die entrückt und weltfremd erscheint? Sollte die Erfindung nicht alles in sich aufnehmen, das schon war, ihre Wurzeln nicht verleugnen, die Geschichte wertzuschätzen? Konnte eine Erfindung überhaupt Bestand haben, die ihre Gene und ihre Herkunft leugnet? Wie man sich selbst erfindet, hatte er vor zehn Jahren philosophiert, und nun war er an dem Punkt angelangt, diese Erfindung einer Prüfung zu unterziehen. Hatte er über das Ziel hinausgeschossen? Hatte er in seinem Bestreben, in seiner Suche nach dem Sinn und dem Wunsch, den inneren Krieg zu beenden, nicht zu viele Opfer bringen müssen? Konnte er eine dermaßen radikale Selbsterfindung noch vor sich und seinem Umfeld verantworten? Die Kompromisslosigkeit seines Tuns warf nicht nur viel Licht auf die Welt, sondern auch viel Schatten.
Über die letzten Worte kam er ins Grübeln. Wo viel Licht ist, ist auch viel Schatten. War diese (Volks-)Weisheit einfach so hinzunehmen? War sie nicht in Frage zu stellen und an ihrer Gültigkeit zu rütteln? Bedarf es wirklich der Bipolarität auf dieser Welt, dass wir Menschen funktionieren? Fast wütend schrieb er die nächsten Worte nieder: ohne Gut kein Böse, ohne Böse kein Gut. Weshalb musste diese Gleichung auf dieser Welt so eine universelle Gültigkeit besitzen? Ihm gingen tausend Gedanken durch den Kopf. „Ich bin ein Teil des Teils, der anfangs alles war“, so Goethes Mephisto in Faust. Ein Teil des Teils!? Sein Kopf rauchte. Also war am Anfang alles eins, ein sowohl als auch, eine heilige Ganzheit, aus der dann sich das Gute das Böse gebar.
In letzter Zeit hatte er an sich beobachtet, dass das Spiel der Kräfte immer aufgeladener wurde. Ein Freund hatte ihm ein Buch über energetische Zustände geschenkt, und er sah sich bei einem Wert von 500 – also im hochenergetischen Bereich. Dies hatte zum einen zur Folge, dass sein Tun immer mehr einem Trancezustand, einem Flow glich und sich Raum und Zeit wieder einem Traumzustand annäherten. Auf der anderen Seite führte dieser Aktivierungszustand zu heftigen Ausbrüchen auch schon bei kleinen Bewegungen in seinem Umfeld. „Himmelhoch jauchzend zum Tode betrübt“ – das kam ihm immer mehr in den Sinn, wiewohl nicht als bipolare Störung zu verstehen, sondern ein tiefes Empfinden der bipolaren Konstanten in unserer Menschenwelt.
Indem er das Wort „beides“ aussprach, entspannte sich sein Körper und eine innere Balance machte sich breit. Sowohl als auch, beides, nicht nur das eine, sondern auch das andere: beides zugleich, und nicht nur das eine oder das andere. War dies nicht der Zustand vor der Ursünde, vor dem Urknall, als es noch keinen Sinn in dieser Welt gab, keine Bedeutung – und dadurch auch keine Markierungen, keine Diskriminierungen. Eine Welt ohne Unterschiede, die einen Unterschied machen – was konnte das für eine Welt sein – langweilig, unmenschlich, spannungsleer.
Die Balance wich einer gespannten Aufmerksamkeit: Waren es nicht die Spannungsfelder in unserem Leben, welche uns die nötige Würze gaben, diesen Kick zu wissen, dass wir lebendig sind? Bedeutete der Individuationsprozess, an dessen Ende wir als Alter Weiser wiedergeboren werden, nicht Stillstand, nicht Bedeutungslosigkeit, nicht Tod?
Vor dem Alter hatte er die meiste Angst, vor diesem Zustand der Indifferenz und Ausgeglichenheit der emotionalen Systeme. Aber war nicht genau dieser Zustand göttlich – wenn wir zurückkehren in den Zustand, der keine Unterschiede kennt?
Er arbeitete in letzter Zeit an einer Theorie der Spannungsfelder, da er in dieser den Schlüssel zum Verständnis der Welt vermutete. An sich selbst hatte er beobachtet, dass das Hinwirken in eine Richtung das Erstarken des gegenteiligen Pols bewirkte. Ging er in die eine Richtung, so zog es ihn zugleich stärker in die andere Richtung. Mehr Kreativität und Spaß in seinem Leben bedeutete zugleich das Gegenteil mit mehr Ordnung und Disziplin. Mehr Spielräume führen zu mehr Struktur. Interessanterweise erschien ihm dieses Paradoxon als natürlich und keinesfalls bedrohlich.
In ihm stieg Nietzsches Bild aus „Also sprach Zarathustra“ auf vom Gleichnis vom Baum am Berge, der, um die Höhen zu erreichen, immer mehr in der Tiefe wurzeln muss, im Bösen. Beim Wort Bösen erschauderte es ihn und er kehrte zurück zur Ausgangsüberlegung: ohne Gut kein Böse und umgekehrt.
Vor Kurzem hatte er einen seiner Lieblingsfilme geradezu inhaliert genau unter diesem Gesichtspunkt: Indem der Held der Geschichte immer stärker wurde, erstarkte auch sein Widerpart und die Gleichung blieb immer ausgewogen. War dies das universelle Muster in unserem Universum, dass die Summe der positiven und negativen Energie immer ein Nullsummenspiel ergab? Konnte deshalb auf dieser Welt kein „Königreich der Himmel“ entstehen, da auch der unermüdlichste Drang nach Gutem immer auch die Erhebung des Bösen bedeutete? Wo lag da der Sinn? Wo lag da die Gerechtigkeit? Wo lag da der Ausweg aus dem Elend dieser Welt?
Auf der anderen Seite: Sind wir Menschen nicht geschaffen, um in einer Welt der Gegensätze zu leben? Bedeutet die Absenz des Bösen nicht zwangsläufig die Emergenz des Gegenteils, da das menschliche System sich über Unterschiede definiert?
1000 Wörter in einer Stunde, unterbrach er seinen Fluss der Gedanken, das sind 3,6 Sekunden pro Wort – das ist Schreiben, das das Bewusstsein ausschaltet, Schreiben aus dem Unbewussten – auf diese Weise hoffe er auf das Emergieren von Neuem und Unerwartetem, auf das Heraufbeschwören von Antworten auf die Fragen des Lebens.
Emergenz ... dieses Wort hatte ihm heute Hoffnung gemacht. Auf seiner Suche nach den Wirkkräften schienen ihm konventionelle Wege ungeeignet, tiefe und befriedigende Antworten zu finden. Als er vor drei Jahren mit seiner Familie von Wien in die Wachau übersiedelt war, hatte er nur eine Ahnung, am heutigen Tag wurde es ihm aber bewusst – er war seiner Theorie der Spannungsfelder ein wenig näher gekommen. Indem er einen maximalen Unterschied zur Großstadt herstellte, erzeugte dies in ihm die Energie, die nötig war, Unvorhergesehenes und Unerwartetes entstehen zu lassen. Im Spannungsfeld „ländlich versus urban“ lag für ihn ein Schlüssel, dass potenziell Neues geboren werden kann. Wer nur in der Stadt bzw. nur auf dem Land verhaftet ist, dem entgeht die Chance auf dieses Wechselspiel der Energien, das neue Sicht- und Denkweisen initiiert. Lachend dachte er an seine Freunde in der Großstadt, die sich wunderten, weshalb er so entspannt aussah, wiewohl die Belastungen und Herausforderungen eher größer als kleiner geworden sind.
Wer nur im Gestern lebt, wer nur die Wurzeln pflegt, dem entgehen dabei dieselben Chancen wie demjenigen, der die Wurzeln verleugnet und die Zukunft verherrlicht. Wiederum schien ihn das Wort „beides“ als die Lösung der Probleme dieser Welt zu bedeuten: Sowohl Bewahren als auch Verändern, sowohl Regeln als auch Freiräume, sowohl Individuum als auch Gruppe.
Aus den Studien der letzten 20 Jahre war im letzten Jahr das sogenannte Hexagon in seinen Gedanken aufgetaucht, eine wabenartige Struktur, welche die Gegensätze dieser Welt wertfrei visualisierte – wobei er auf das Wort Wertfreiheit größten Wert legte – unterschied dies sein Modell von herkömmlichen theoretischen Sichtweisen. Nichts in diesem Hexagon sollte richtig oder falsch sein. Zwölf Werte fungierten in dieser „Tafelrunde“ der menschlichen Möglichkeiten als Platzhalter der Archetypen, wobei jeweils zwei Werte ein Gegensatzpaar bildeten: Sicherheit versus Risiko, Tradition versus Revolution, Bindung versus Freiheit, Sinnlichkeit versus Leistung, Spaß versus Disziplin und Kreativität versus Ordnung.
Vor ihm lag ein Stapel von 60 Archetypen, neben ihm waren zwölf Archetypen als Lego Minifiguren kreisförmig im Hexagon aufgestellt. In den letzten Jahren der Selbstreflexion hatte sich ein Archetyp als besonders sinnstiftend in seinem Leben herausgestellt – der „Creator“ mit seinem Kernwert Kreativität im Spannungsfeld von „Struktur versus Spielräume“. Auf den aufgeschlagenen Kärtchen war zu lesen „Creator“, „Artist“, „Entrepreneur“, „Storyteller“ und „Visionary“.
Plötzlich kam es zu einem Déjà-vu: „Storyteller“, das heißt Geschichten-Erzähler – war dies nicht seine große Vision! Und noch einmal ein Déjà-vu: „Visionary“. Er war auf der Suche nach seiner eigenen Identität wieder ein Stück vorangekommen.
„Creator“, Schöpfer – ja, dieser Archetypus zog ihn magisch an. Hier spürte er eine Seelenverwandtschaft und die Worte des Erdgeistes verhallten ungehört „Du gleichst dem Geist, den du begreifst, nicht mir“. Nein, der Erdgeist konnte ihm nichts mehr anhaben. Er hatte seine Geister gefunden, er hatte die Kraft in sich entdeckt, die ihn trieb und indem er ihr einen Namen gegeben hat, wurde die Kraft zügelbar – zumindest erschien es ihm zum damaligen Zeitpunkt so. Er hatte in sich immer noch ein Bild der Steuerbarkeit von Systemen, der Ordnung, der Disziplin und der Kontrolle. Und je mehr er sich in Richtung Kreativität entwickelte, desto stärker wurde sein Verlangen nach Struktur, die Muster dieser Welt zu kennen und sie in Sinnsystemen in Fesseln zu legen.
Wiederum spürte er in sich die Spannungsgeladenheit dieser Welt: Wie konnte es sein, dass eine Vergrößerung der Frei- und Spielräume zu einem gesteigerten Bedürfnis nach Struktur und Ordnung führten? Ist der Mensch nicht in der Lage, ein kreatives Chaos auf Dauer auszuhalten? Oder macht auf Dauer ein kreatives Chaos einfach keinen Sinn, weil man den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr erkennen kann?
Diese einfachen Deutungen befriedigten ihn keineswegs und er vertiefte sich weiter in dieses scheinbare Paradoxon. Wieder ging ihm das Bild vom Baum am Berge durch den Kopf. Die Wurzeln des Baumes deutete er als Fundament, als Struktur, die Krone in lichter Höhe als Kreativität. Die Höhe des Baumes schien von der Stärke des Fundaments abzuhängen – ohne Fundament kein Turm, ohne Ordnung keine Kreativität. Ihm wurde bei diesen Gedanken schwindlig. Nein, irgendetwas stimmt nicht in seiner Betrachtung. In ihm entstand ein neues Bild, nämlich das der kreativen Spannung. Wenn man von einem Punkt A ausgeht (von der Ordnung), um zu einem Punkt B zu gelangen (zur Kreativität), ist dabei ein Weg zurückzulegen. Lege ich diesen Weg zurück und verleugne ich meine Wurzeln, dann gelange ich zu Punkt B und die Spannung ist verflogen – ich bin nur noch kreativ. Halte ich aber die Spannung und wertschätze meine Wurzeln und versuche dennoch zu Punkt B zu gelangen, dann habe ich dieselbe Wirkung wie bei einem gespannten Gummiband. Die Energie bleibt erhalten, indem an der Struktur festgehalten wird und als Vision die Kreativität angestrebt wird.