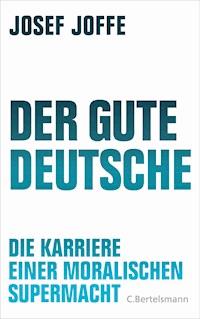
17,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: C. Bertelsmann Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Die zweite deutsche Republik ist das beste Deutschland, das es je gab: liberal, stabil, sozial, und international ein anerkannter Partner. Wie kam es zu dieser Karriere vom hässlichen zum guten Deutschen? Josef Joffe erzählt die Geschichte der Wiedergutwerdung des schuldbeladenen Parias Deutschland - vom Kunststück, das moralisch Gebotene mit dem politisch Nützlichen zu verbinden. Von Konrad Adenauers genialer Strategie des Machtgewinns durch Machtverzicht, Willy Brandts Friedenspolitik als Instrument der Machtverstärkung, Helmut Schmidts Vabanque-Spiel angesichts von RAF-Terror und Protest bis hin zu Angela Merkels konsequentem Aufbau einer europäischen Führungsrolle. Doch obwohl Deutschland auch in internationalen Umfragen an Beliebtheit gewaltig zugenommen hat, tun sich die Deutschen immer noch schwer mit ihrer neuen Rolle.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 391
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Buch
Die Zweite Deutsche Republik ist das beste Deutschland, das es je gab: liberal, stabil, sozial – und international ein anerkannter Partner. Wie kam es zu dieser Karriere vom hässlichen zum guten Deutschen? Josef Joffe erzählt die Geschichte der Wiedergutwerdung des schuldbeladenen Parias Deutschland. Von Konrad Adenauers genialer Strategie des Machtgewinns durch Machtverzicht, Willy Brandts Friedenspolitik als Instrument der Machtverstärkung, Helmut Schmidts Vabanquespiel angesichts von RAF-Terror und Protest bis hin zu Angela Merkels konsequentem Aufbau einer europäischen Führungsrolle. Doch obwohl Deutschland auch in internationalen Umfragen an Beliebtheit gewaltig zugenommen hat, tun sich die Deutschen immer noch schwer mit ihrer neuen Rolle.
Autor
Josef Joffe ist seit dem Jahr 2000 Herausgeber der ZEIT. Davor war er Ressortleiter Außenpolitik bei der Süddeutschen Zeitung. Er lehrte Internationale Politik in München, an der Johns Hopkins University und in Harvard; in Stanford unterrichtet er seit 2004. Josef Joffe hat bereits mehrere hochgelobte Bücher veröffentlicht.
JOSEF JOFFE
DER GUTE DEUTSCHE
DIE KARRIERE EINER MORALISCHEN SUPERMACHT
C. Bertelsmann
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten,
so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung,
da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf
deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Copyright © 2018 C. Bertelsmann Verlag, in der Verlagsgruppe Random House GmbH, Neumarkter Str. 28, 81673 München
Umschlaggestaltung: Büro Jorge Schmidt, München
Umsetzung eBook: Greiner & Reichel, Köln
ISBN 978-3-641-21491-3 V002
www.cbertelsmann.de
INHALT
EINLEITUNG
Die Bundesrepublik als Bildungsroman
TEIL I
DER MYTHOS VOM DEUTSCHEN SONDERWEG
KAPITEL 1
Der »hässliche Deutsche«
KAPITEL 2
Der deutsche Sonderweg
Katastrophe oder Konstrukt?
TEIL II
DIE WIEDERGUTWERDUNG
KAPITEL 3
Der gute Deutsche
Vom »Untertan« zu Angela Merkel
KAPITEL 4
»Auferstanden aus Ruinen«
Adenauer und die wundersame Jugend der Bonner Republik
KAPITEL 5
Die »Adenauer-Restauration«
Legende und Wirklichkeit
KAPITEL 6
Willy Brandt und der Kniefall
Der Wiedergutwerdung zweiter Teil
TEIL III
AUF DEM HOCHSITZ DER MORAL
DIE SCHATTENSEITEN DER WIEDERGUTWERDUNG
KAPITEL 7
Friedensmacht Deutschland
KAPITEL 8
Tabu und Entschuldung
Israel und das neue Deutschland
KAPITEL 9
Der böse Übervater Amerika
SCHLUSSBETRACHTUNG
Das gute Deutschland
ANMERKUNGEN
EINLEITUNG
DIE BUNDESREPUBLIK ALS BILDUNGSROMAN
Nationen berufen sich auf ihre Helden und Sagen, auf eine gloriose Vergangenheit, die ihnen Halt und Haltung, eine Raison d’Être und Rechtfertigung verleiht.Die Bundesrepublik ist der krasse Sonderfall – ein Waisenkind der Geschichte. Sie hatte keine verwendbare, schon gar keine heroische Vergangenheit; sie entsprang der Konkursmasse des »Zwölfjährigen Reiches«. Diese besudelte Hinterlassenschaft war ein Erbe, das die Republik keinesfalls antreten durfte.
Der normale Nationalstaat lebt von den Wurzeln, die in eine verklärte Vorwelt zurückreichen. Doch wurden die deutschen 1945 abgehackt. Andere Nationen verehren ihre Gründer, seien es mythische oder verbürgte. Auf wen aber sollte sich das junge Geschöpf beziehen? Doch nicht auf Wilhelm oder Adolf, die Väter des Unheils.
Vielleicht ganz weit zurück, auf Hermann den Cherusker? Den hatten die Deutschen im hochschießenden Nationalismus des 19. Jahrhunderts als »Vater der Nation entdeckt. Doch bei genauerem Hinsehen gibt auch Hermann keinen guten Gründervater her. Als er vor 2000 Jahren noch auf gut Lateinisch »Arminius« hieß, gelang es ihm, drei römische Legionen zu zerschlagen. Doch die untereinander verfeindeten Germanen, die gelegentlich mit Rom gegen die eigenen Stämme paktierten, konnte er nicht einen. Er starb nicht den Heldentod, sondern unter den Händen seiner übel gesinnten Verwandtschaft.
Andere Völker haben es besser. Die Israeliten haben Moses; ihr Nationalmythos ist die Befreiung aus der ägyptischen Sklaverei und der Bund mit dem Allmächtigen. Die sagenhaften Väter Roms heißen Romulus und Remus. Die Briten haben die Magna Carta und Winston Churchill, der die Nation vor Hitler rettete. An der Wiege der vaterlosen Bundesrepublik standen bloß die Besatzungsmächte, argwöhnische Erziehungsberechtigte von eigenen Gnaden.
Ebenso wenig konnte sich der junge Staat auf eine Gründermutter wie die legendenumwobene Johanna von Orléans berufen. Mit dem Schlachtruf »Bottez les Anglais au dehors«, »Schmeißt die Engländer raus!«, läutete sie das Ende der Fremdherrschaft in Frankreich ein. Dergestalt legte die verklärte Jungfrau das Fundament des französischen Nationalstaats; den Sockel gefestigt haben die Revolution von 1789 und die Siege Napoleons. Im Dôme des Invalides zu Paris hat ihm die Nation ein Heldengrab eingerichtet, obwohl der Triumphator zum Schluss als Verlierer dastand.
In der Schweiz gab Wilhelm Tell den mythischen Gründervater. Im Zentrum des Aufstandes gegen die Habsburger steht die anheimelnde Erzählung vom Rütli-Schwur. Die poetische Fassung des Gründungsaktes stammt von Schiller, der in Wilhelm Tell dichtet: »Wir wollen sein ein einzig Volk von Brüdern, / in keiner Not uns trennen und Gefahr. / Wir wollen frei sein, wie die Väter waren, / eher den Tod, als in der Knechtschaft leben.«
Auf solches Erlöser-Epos konnte die Bundesrepublik nicht zurückgreifen. Befreit wurde sie von Ausländern, von Amerikanern, Briten und Franzosen. Zu einem anständigen Gründungsmythos taugt nur der Triumph aus eigener Kraft. Ein Musterbeispiel ist der amerikanische über die Briten im Unabhängigkeitskrieg – der Sieg über die Unterdrücker als Geburtshelfer der Nation. Das Muster wiederholt haben die Befreiungskriege gegen die Kolonialherren in der Dritten Welt.
Derlei herzerwärmende Erzählung gibt die deutsche Geschichte des 20. Jahrhunderts nicht her: erst die Schmach des verlorenen Ersten Weltkriegs, dann das klägliche Ende der ersten deutschen Demokratie, schließlich die Verbrechen und der Untergang des Dritten Reiches.
Wer hätte denn 1945 den George Washington, Heros der amerikanischen Revolution, spielen können? Oder den Giuseppe Garibaldi, der die Unabhängigkeit Italiens erkämpft hatte? Die Republik der Westdeutschen konnte sich nicht einmal auf Bismarck berufen, der die Habsburger verjagt und 1871 das Zweite Reich im Krieg gegen Frankreich zusammengezwungen hatte. Die Huldigung des Gründers kannte damals keine Grenzen. Leider war das Reich seit 1919 perdu, als Staat wie als Idee.
Konrad Adenauer, der erste Kanzler der zweiten Demokratie? Bismarck hat Hunderte von Bismarckdenkmälern, -türmen und -straßen hinterlassen. Doch erinnern nur zwei Denkmäler an Adenauer: eines in Berlin, das andere in Köln, wo in der Weimarer Republik seine politische Karriere als Oberbürgermeister begann. Die Nachgeborenen schätzen Adenauer, aber sie verehren ihn nicht, obwohl immerhin ein Regierungsflugzeug »Konrad Adenauer« heißt.
VOM WAISENKIND ZUM WUNDERKIND – EIN BILDUNGSROMAN
Der märchenhafte Aufstieg vom Findling zur europäischen Zentralmacht ist das Leitmotiv des nachkriegsdeutschen Bildungsromans. Wieso »Bildungsroman«, eine literarische Gattung, die sich mit dem Einzelnen beschäftigt, nicht mit dem Werdegang von Nationen?1 Was hat die Bundesrepublik mit Goethes Wilhelm Meisters Lehrjahre zu tun? Oder mit dem Genre des Entwicklungsromans insgesamt, das sich im 18. Jahrhundert herausbildete und die Regale auf beiden Seiten des Atlantiks zu füllen begann?
Greifen wir zu den Klassikern, um die charakteristischen Motive und Parallelen herauszuarbeiten, die sehr wohl zur Karriere der Bundesrepublik passen. Der bekannteste deutsche Entwicklungsroman ist Wilhelm Meister. In England wurde Charles Dickens im 19. Jahrhundert mit Große Erwartungen (Great Expectations) und David Copperfield berühmt. Zuvor hatten Tom Jones von Henry Fielding und Tristram Shandy von Laurence Sterne die britischen Leser gefesselt. In Frankreich glänzte Stendhal mit Rot und Schwarz (Le Rouge et le Noir), in Italien Carlo Collodi mit Pinocchio, der ungezogenen Holzpuppe, die im Zuge ihrer unrühmlichen Abenteuer Anstand und Weisheit lernt, dann mit der Menschwerdung belohnt wird.
Hermann Hesses Demian, J. D. Salingers Fänger im Roggen (The Catcher in the Rye) und Philip Roths Goodbye, Columbus gehörten zur Pflichtlektüre Heranwachsender im 20. Jahrhundert. Mark Twains Huckleberry Finn wird von den Jungen gleich nach Tom Sawyer gelesen, ist aber kein Kinderbuch, sondern ein Bildungsroman, wo der Held Huck die genretypische Entwicklung durchläuft. Er entflieht seinem übel beleumdeten Vater, einem Säufer und Schläger, meistert auf dem Mississippi Fährnisse und Versuchungen und erwirbt in der Freundschaft mit »Nigger Jim« jene Charakterstärke, die ihn die Unmoral einer Sklavenhaltergesellschaft überwinden lässt.
Das Leitmotiv dieser Romane lädt dazu ein, es auf die Bundesrepublik zu übertragen: hier der Weg der erdichteten Figuren, dort die Laufbahn der westdeutschen Republik. Der Entwicklungsroman ist eine Art weltlicher Heilsgeschichte in drei Teilen: die Not der Jugendjahre, die Prüfungen der Wanderjahre, die Läuterung und Reifung im Erwachsenenalter.
Christoph Martin Wieland, ein deutscher Dichter des 18. Jahrhunderts, erklärt in Agathon, einem Prototyp der Gattung: »Der Charakter Agathon« sollte »auf verschiedene Proben gestellt werden, durch welche seine Denkart und seine Tugend geläutert«, das Unechte »nach und nach von dem reinen Golde abgesondert würde«.2 Begriffe wie »Proben« und »Läuterung« lassen schon mal eine Parallele zur Biographie der Zweiten Republik aufscheinen – eine Geschichte monströser Herausforderungen und wundersamer Bewährung.
Eine zweite Parallele liefert ein oft zitiertes Wort von Hegel, der in seiner Ästhetik über die »Lehrjahre, die Erziehung des Individuums an der vorhandenen Wirklichkeit« doziert. Im Zentrum der Erzählung agiere ein Wesen, das »sich in die bestehenden Verhältnisse und die Vernünftigkeit derselben hineinbildet, in die Verkettung der Welt eintritt und in ihr sich einen angemessenen Standpunkt erwirbt«.3 So verlief die Karriere der Bonner Republik.
Die dritte stammt von Wilhelm Dilthey, dem Literaturtheoretiker und Begründer der Hermeneutik. Er schreibt mit Blick auf den Bildungsroman von einem »Jüngling«, der »mit den harten Realitäten der Welt in Kampf gerät und so unter mannigfachen Lebenserfahrungen heranreift, sich selber findet und seiner Aufgabe in der Welt gewiss wird«.4 Mit »harten Realitäten« hatte der westdeutsche Jüngling zuhauf zu kämpfen: Totalniederlage, Ruinenfelder, wo einst Städte standen, Besatzung, Verachtung, Bestrafung, Fremdherrschaft.
Joseph von Eichendorff hat vor 200 Jahren eine Regel niedergelegt, die sich eins zu eins auf die Bundesrepublik übertragen lässt. Es komme darauf an, »sich innerlichst nur recht zusammenzunehmen zu hohen Entschließungen und einem tugendhaften Wandel«.5 Das war just das Anforderungsprofil, dem sich die neue Republik stellen musste. Der Stalin-treue Romancier Johannes R. Becher, Kulturminister der DDR und Verfasser ihrer Nationalhymne, drückte es ironisch aus. Ein Verächter bürgerlicher Wohlanständigkeit, lässt er in Abschied den jungen Hans spötteln: Sein Vater wolle ihn auf das vornehme Münchner Wilhelmsgymnasium schicken, »damit ich mir die schlechten Manieren abgewöhne und lerne, mich beizeiten in guter Gesellschaft zu bewegen«.6
»Schlechte Manieren« hatte der Vorgänger der Bundesrepublik en masse – und gute überhaupt nicht. Das Urbegehren des Waisenkinds musste es sein, Einlass in die »gute Gesellschaft« des Westens zu erringen. Auch das Gymnasium des Schülers Hans passt zum Werdegang des deutschen Zöglings. Vor seinem Wiederaufstieg lagen harte Schuljahre, so weit das Auge reichte. Das Curriculum hieß Re-Education, die Lehrer waren die Siegermächte.
Das vorliegende Buch ist offenkundig kein Bildungsroman, aber die Karriere der Zweiten Deutschen Republik liest sich wie einer. Denn der Held durchläuft all die klassischen Stadien des Entwicklungsromans – und mehr: Ungemach und Unglück, das Leben mit der geerbten Schuld, die Vormundschaft der gestrengen Besatzer, der Wille zur Besserung, die Versuchungen der Neutralität zwischen Ost und West, die mörderischen Krisen des Kalten Krieges.
Über allem schwebte die zentrale Frage des Bildungsromans: Wer bin ich, wer will ich sein – neudeutsch: Was ist meine Identität? Wie finde ich eine, wenn meine Wurzeln gekappt sind, meine Vergangenheit vergiftet ist, meine Ahnen kein Vorbild hergeben?
BIOGRAPHISCHE TANGENTE
Dieser Autor ist etwa so alt wie die Republik. Er hat während der Berlin-Blockade im trüben Licht einer Petroleumfunzel grausliches Trockenfutter (Ei- und Milchpulver, mit Wasser verrührt) geschluckt, das die Versorgungsflugzeuge der Luftbrücke gebracht hatten. Er hat in der Trümmerlandschaft der heute piekfeinen Mommsenstraße Burgen im Schutt gebaut, gelegentlich Überbleibsel des Krieges – Gewehre, Panzerfäuste – im Geröll gefunden. Er kämpfte aber nur mit Holzschwertern gegen die Knaben von der gegnerischen Festung. Lesen und Schreiben lernte er im Schichtunterricht – mal ab acht Uhr, mal ab zwei – mit 50 Mitschülern im Klassenzimmer. Denn der Schulraum in Berlin war im Bombenkrieg arg verknappt worden. Die Schulspeisung bestand aus Eintopf im zerbeulten »Henkelmann«, der am Ranzen hing.
Das Kind ging den Weg der fast gleichaltrigen Republik. Zu Beginn straften die Lehrer noch mit Hand oder Lineal, doch bald verschwanden solche Methoden aus dem erzieherischen Repertoire, derweil die Westmächte sich vom Büttel zum Mentor wandelten. Nach und nach verschwanden die Pauker aus der Nazizeit, die zu Hause Erbauung in rechtsextremen Zeitungen suchten und im preußisch-protestantischen Berlin Katholiken ebenso hassten wie Juden. Im Land der früheren NS-Diktatur schlug die Demokratie unerwartet Wurzeln, weichte der Staat seine herrschaftlichen Allüren auf, freundeten sich die Besiegten mit der westlichen Lebensart an. Das Quasi-Einparteienregime der Christenunion wuchs zum kompetitiven System heran, wo die SPD zwanzig Jahre nach der »Stunde null« die halbe Regierungsmacht erobern, schließlich den Kanzler stellen konnte.
Vor allem ist dieser Autor wie die Republik ein Kind des Wirtschaftswunders, das der ungeübten Demokratie den Weg ebnete, mit einem wachsenden Kuchen Verteilungskonflikte planierte und Millionen von Flüchtlingen eingliederte. Die Stationen des Wirtschaftswunders spiegelten sich im Privaten: Währungsreform, Ende des Schwarzmarkts und der Lebensmittelmarken, Elektrokühlschrank statt Eisblöcken vom Eismann, das Auto vor der Tür, das schwarze Wählscheibentelefon, auf das man monatelang warten musste. Die Zentralheizung ersetzte bald den Kohleofen und den Brikettboiler, der ein Bad pro Woche erlaubte. Der Schwarz-Weiß-Fernseher mit nur einem Sender zog ein. Es folgten die ersten Auslandsreisen, aber nicht weiter als nach Tirol oder zum Gardasee.
Parallel dazu entfaltete sich die bescheidene politische Karriere des Heranwachsenden, die er der von den Alliierten verfügten Schülermitverwaltung verdankte – Demokratie von ganz unten: Klassensprecher, Schulsprecher, Berliner Schülerparlament. Die alterstypische Revolte gegen die Autoritäten endete knapp vor dem Rausschmiss aus der Friedrich-Ebert-Schule (früher: Hindenburg-Gymnasium). Der drohenden Relegation entzog sich der 17-Jährige durch Flucht nach Amerika – als Austauschschüler in Michigan, wo er die Segnungen des Wäschetrockners und den späteren Präsidenten Gerald Ford kennenlernen sollte. Sein schulisches Sündenregister kannte an der East Grand Rapids High School niemand; er konnte wie Abermillionen echter Einwanderer neu anfangen – Tabula rasa.
Auf ein Schuljahr angelegt, geriet der Ausflug nach Amerika zum Langzeitaufenthalt in Etappen: B. A. in Politik, Ökonomie und Philosophie am Swarthmore College, einer Quäker-Gründung, M. A. in International Studies an der Johns Hopkins University, Ph. D. in Government in Harvard. Lehrtätigkeit in Johns Hopkins, Harvard und Stanford, aber Hauptberuf als Journalist bei der Süddeutschen Zeitung und der Zeit.
Bei so vielen Transatlantiktrips kommen richtig viele Frequent-Flyer-Meilen zusammen. Doch sind die nur eine ersprießliche Fußnote in dieser Geschichte. Ihren Kern illustriert am besten der Untertitel eines Buches über Weimar aus der Feder des befreundeten deutsch-amerikanischen Historikers Peter Gay (einst Fröhlich) von der Yale University: Weimar Culture. The Outsider as Insider (1968) – verschiedene Standpunkte, verschiedene Perspektiven.
Wer in zwei Kulturen zu Hause ist, kennt beide, kann mal die eine von außen betrachten, mal die andere. Oder beide von innen. Er kann mit der Lupe auf dem Teppich herumkriechen und Risse erspähen, wie es nur Insidern gegeben ist. Er kann aber auch von außen durchs Fenster blicken. So nimmt er wahr, wie sich Mobiliar und Bewohner von Mal zu Mal verändern – ob der Riss größer geworden ist oder da plötzlich ein neuer, makelloser Teppich liegt. Er kann weiter zurückgehen und die ganze Nachbarschaft einfangen. Wie verändern sich Architektur, Wertegefüge und Kultur? Was ist neu, was beständig?
Wer nach längeren Abwesenheiten zurückkehrt, sieht nicht bloß Momentaufnahmen, sondern einen Film – eben den Entwicklungsroman eines Gemeinwesens. Anders als dieser erzählt ein Film nur selten eine lineare Geschichte; die Kamera wechselt ständig Zeit und Standort. Mal steht sie mitten im Geschehen, mal zoomt sie von außen hinein. Dieses Buch ist ebenfalls eine Abfolge unterschiedlicher Perspektiven: von außen nach innen und umgekehrt, von vorn nach hinten und wieder zurück.
Die wechselnde Sicht schärft den Blick für den Unterschied zwischen dem Selbstverständnis eines Gemeinwesens und den Triebfedern seines Handelns im Kreise der Nationen. Der Beobachter nimmt Interessen wahr, wo hehre Prinzipien aufgeboten werden. Wie verhält sich die Rhetorik zur realen Politik? Die Spannung zwischen diesen Polen widerspiegelt der Titel dieses Buches. Der gute Deutsche steht für die spektakuläre Verwandlung eines Aussätzigen in eine liberale Musterdemokratie. Den Untertitel – Die Karriere einer moralischen Supermacht – darf man mit einer Prise Ironie lesen.
Auf dem Weg in die Gemeinschaft der Nationen hat sich die Bundesrepublik Deutschland einen Stil angeeignet, der die Artikulation schnöder Interessen strengstens untersagt. Wer am Boden liegt, darf nichts für sich fordern, geschweige denn auftrumpfen. Wer im Fokus des Misstrauens steht, wird Selbstzucht statt Selbstsucht predigen. Er wird im Dienste der Resozialisierung nicht dem sacro egoismo der Nationen frönen, sondern der Werte- und Versöhnungspolitik: Schuldanerkenntnis, Reue, Frieden, Gemeinschaft, Selbstbindung, Europa – kurzum: »Nie wieder!«
Nur sind Staaten nicht interessenlos. Schon gar nicht war es die junge Republik, die Vergebung, Sicherheit, Stimmrecht und Selbstbehauptung anstrebte, von der Wiedervereinigung nicht zu reden. Alle Staaten halten das Gute hoch, derweil sie das Nützliche betreiben; die Bundesrepublik hat diesen Balanceakt zur Kunstform erhoben.
In der offiziellen Rhetorik scheint nie das nackte nationale Interesse auf, geschweige denn die grandeur der Nation, wie sie routinemäßig in Frankreich zelebriert wird. Kein deutscher Politiker wird wie Donald Trump geloben, »Deutschland wieder groß zu machen«. Das deutsche Waisenkind entwickelte sich in seinem Bildungsroman zum bravsten aller Eleven. Der moralische Auftritt geriet zur Staatsräson der Friedens- und Zivilmacht. Interessenpolitik kam und kommt grundsätzlich als Werte- und Gemeinschaftspolitik daher – kein Wunder angesichts des Verdachts, der den Bewährungskandidaten auf seinem Weg begleitete.
Das Misstrauen saß tief. Hatte dieser Kandidat überhaupt eine Chance auf Besserung? Hatte Deutschland nicht schon lange vor Hitler jenen deutschen »Sonderweg« beschritten, der das Land von den westlichen Demokratien trennte und geradezu schicksalhaft ins totalitäre Verderben führen musste? Was demgemäß in der DNS des deutschen Wesens angelegt war, konnte doch nicht umprogrammiert werden, wie es das Projekt der westlichen Sieger vorsah.
Erfreulicherweise ist der »Sonderweg« ein Mythos, obwohl der aus der Perspektive von 1945 so zwingend erschien wie eine mathematische Ableitung. Oder so: Wenn die Deutschen die unverbesserlichen Gefangenen ihrer eigenen Geschichte waren, hätte sich das demokratische Wunder der Bundesrepublik, von dem dieser Bildungsroman erzählt, nie entfalten können, Im Gegenteil hätte das Unheil fortlaufend Unheil gezeugt. Stattdessen entwickelte sich der Nachfahr des Dritten Reiches zur fest verwurzelten Musterdemokratie.
Teil I präsentiert im ersten Kapitel die literarische Version des »Sonderwegs«. Die bekannteste ist Heinrich Manns Untertan, der Inbegriff des »hässlichen Deutschen« mit seinen fürchterlichen Eigenschaften. Er ist ein obrigkeitsgläubiger Kaiserverehrer, ein gewissenloser Opportunist, der nach oben buckelt und nach unten tritt – ein arroganter Nationalist, der Liberale, Sozialisten und Juden hasst. Perfekt verkörpert er den »Sonderweg« außerhalb des Westens und gegen ihn. Diese Lesart, die insbesondere im Nachkriegsdeutschland die Geschichtsschreibung färbte, ist eine Interpretation, welche die vielen Ähnlichkeiten zwischen Deutschland und seinen westlichen Nachbarn übersieht. Warum das so ist, versucht das zweite Kapitel »Der Sonderweg: Konstrukt oder Katastrophe?« zu erklären.
Tatsächlich war das kaiserliche Deutschland des Untertans im Guten wie im Bösen Teil der europäischen Familie. Der »Sonderweg« war in Wahrheit in eine breite europäische Trasse eingebettet, wo das liberaldemokratische Prinzip überall im Gespann mit Antisemitismus, Rassismus, Autoritarismus und Chauvinismus lief. Auf diesem Weg war nichts vorbestimmt – weder Hitler noch Holocaust. Und schon gar nicht Verdammnis in alle Ewigkeit, wie die wundersame Karriere der Bundesrepublik zeigen sollte.
Leicht waren die Prüfungen des Bewährungskandidaten nicht. Am Anfang galt der Argwohn dem Nachfolger des abscheulichen Naziregimes. Später war es die wachsende Macht des einstigen Parias, welche die Gemüter der europäischen Nachbarn bedrängte – erst recht nach der Wiedervereinigung, als die Angst vor dem »Fourth Reich« die Gemüter im Westen zu quälen begann. Dem Kaiserreich wäre diese Vorstellung nicht nur egal, sondern geradezu willkommen gewesen – als Zeichen seiner Machtfülle.
Die Bonner Republik schlug den entgegengesetzten Weg ein – mit einem außenpolitischen Stil, der das Land bis heute prägt. Demographisch und ökonomisch die Nummer eins in Europa, musste das Land im eigenen Interesse leise auftreten, sich kleiner machen, als es war. Das Wesen dieser Staatskunst ist das Herunterspielen, ja die Verschleierung von Interessen – vor den anderen wie vor sich selber. Denn die überzeugendste Ideologie ist jene, die man nicht nur plakatiert, sondern auch internalisiert. Wie meisterlich das neue Deutschland Real- und Idealpolitik verknüpft hat, zeigt Teil II dieses Buches: »Die Wiedergutwerdung«.7
Freilich ist ein Verwandter der Moral das Moralisieren, das nicht nur das Gute predigt, sondern auch die eigene sittliche Überlegenheit zelebriert, zum Beispiel mit der unbeugsamen Friedfertigkeit des geläuterten Deutschlands (»Wir haben unsere Lektion gelernt«). Dazu Teil III – »Auf dem Hochsitz der Moral: Die Schattenseiten der Wiedergutwerdung« –, der auch von »Amerika-Kritik« und »Israel-Kritik« handelt, einer deutschen Spezialität. Solche Begriffe kennen andere westliche Sprachen nicht; auch gibt es im Deutschen keine »Frankreich-« oder »England-Kritik«. Die Funktion liegt auf der Hand. Amerika verkörpert die machtpolitische Abhängigkeit vom einstigen »Umerzieher«, Israel die dauerhafte Erinnerung an die Schuld der Vorväter, und beides nährt eine Mischung aus Ressentiment und Selbstbelobigung.
Dennoch: Nichts ist erfolgreicher als der Erfolg. Was zu Beginn des Entwicklungsromans aus der Not geboren wurde, formt seitdem das Selbstverständnis der »moralischen Supermacht«, die in allem das Gegenteil des Zwölfjährigen Reiches sein will. Da jeder Staat zuvörderst Interessen transportiert, mag auch ein Quantum Heuchelei mit im Spiel sein. Aber wer die historische Elle anlegt, wird sehen, dass Europa mit dem selbst gebändigten Moralstaat sehr viel besser gefahren ist als mit dem ausgreifenden Machtstaat seit dem Preußen des Großen Friedrich.
Der gute Deutsche zeichnet den Weg vom Waisen- zum Wunderkind. Hier nun im Vorgriff die verknappte Vorschau – der »Trailer« in der Sprache des Films.
DEUTSCHE WANDLUNGEN, TEIL 1
Die erste Phase in unserem Bildungsroman gehörte bis in die frühen Sechziger dem Wiederaufbau und dem Vergessenwollen. Die Prüfung im Lehrfach »Materielle Erneuerung« hat das Land mit 1+ bestanden. Es war, als hätte sich das evangelisch-katholische Westdeutschland plötzlich dem Calvinismus verschrieben. Der verheißt den Gläubigen: Wer auf Erden mit Fleiß und Entsagung Wohlstand erwirtschaftet, dem ist sein Platz im Himmel sicher – das Wirtschaftswunder als Fingerzeig göttlicher Gnade. In den Fünfzigern wuchs die Wirtschaft um bis zu acht Prozent jährlich.
Die »Vergangenheitsbewältigung«, ein geflügeltes Wort dieser Zeit, verlief nicht so glatt. Das Gestern konnte nicht entsorgt, aber doch wie radioaktiver Restmüll eingebunkert werden. Die NS-Zeit geriet etwa zwei Jahrzehnte lang zum weißen Fleck in der kollektiven Psyche.
Der Autor erinnert sich: In den Geschichtsbüchern der unteren Gymnasialklassen war 1940/41 Schluss; die »Endlösung« musste warten. Eine hervorragende popkulturelle Ausnahme war die Satire Wir Wunderkinder (1958) – Erleichterung durch Gelächter. Der Film handelt von dem raffinierten Opportunisten Bruno Tiches, der es vom Nazifunktionär zum reichen Schwarzhändler, dann zum Generaldirektor im Wirtschaftswunderland schafft. Zum Schluss erreicht ihn die gerechte Strafe. Die hat freilich nicht der Recht sprechende Staat verhängt, sondern ein Deus ex Machina, ein kaputter Fahrstuhl. Tiches übersieht das Warnschild und stürzt im leeren Schacht zu Tode.
Eine andere Ausnahme, die sich freilich ebenso wenig an das Menschheitsverbrechen herantraut, ist Rosen für den Staatsanwalt (1959). Die bittere Komödie zeichnet den Weg des Nazi-richters Wilhelm Schramm nach. Der hatte im Krieg Todesurteile wie am Fließband unterschrieben. Nun agiert er in einer Kleinstadt wie in alten Zeiten als hartleibiger Oberstaatsanwalt und liest heimlich die National- und Soldatenzeitung. Die böse Vergangenheit lebt fort, flüstert der Film; sie ist nur verdrängt worden. Gestellt wird Schramm von einem nur durch Zufall überlebenden Opfer, das er im Krieg wegen einer Lappalie zum Tod verurteilt hatte. Doch bleibt die Gerechtigkeit auf halbem Wege stecken. Schramm kommt nicht vor Gericht: Er wird bloß beurlaubt und verliert die Beförderung.
Derweil schreitet die politische Resozialisierung der jungen Republik fürbass. Sie besteht die Prüfungen und Versuchungen. Die Adenauer-Regierung betreibt gegen starken inneren Widerstand die materielle Wiedergutmachung gegenüber den Juden und dem jüdischen Staat. Die Bonner Republik widersteht der Versuchung des Neutralismus im Tausch gegen die Wiedervereinigung – ein Deal, den Moskau immer wieder hinhält, um die Westintegration zu verhindern. Bonn überwindet das Misstrauen der Franzosen, die den deutschen Angstgegner an die kurze Leine legen wollten. »Wir leinen uns selber an, nämlich in der Europäischen Gemeinschaft und im Atlantischen Bündnis«, war die unausgesprochene Parole. In der Innenpolitik setzt die Regierung Adenauer die Wiederbewaffnung und die Westbindung gegen die zähe Opposition der Sozialdemokraten wie auch großer Teile des Wahlvolks durch. Hierzu Kapitel 4: »Adenauer und die wundersame Jugend der Bonner Republik«.
In ihren Lehrjahren entwickelt sich die Republik, wie Hegel schreibt, zu einem Geschöpf, das die »vorhandene Wirklichkeit akzeptiert«. Es gelingt ihr, wie Becher lästert, die »schlechten Manieren« vergessen zu machen und in die »gute Gesellschaft« des Westens vorzudringen. Rechts- und linksextreme Parteien verschwinden oder werden verboten.
DEUTSCHE WANDLUNGEN, TEIL 2
Die zweite Phase – die Prüfungen der Wanderjahre – beginnt in den frühen Sechzigern. Die Selbstbetäubung weicht der Konfrontation mit der Vergangenheit. Der herausragende Markstein auf dem neuen Weg sind die Auschwitz-Prozesse. Über den ersten, der am 20. Dezember 1963 begann, schreibt der Spiegel:
»18 Jahre lang hatten es die Deutschen vermieden, mit der NS-Vergangenheit aufzuräumen. Kollektiv wurde geschwiegen, verdrängt und vergessen, die Schuldfrage unter den Teppich gekehrt. Damit war es nun vorbei. Der Prozess verstörte und empörte die Deutschen. Denn im öffentlichen Verständnis urteilten die Frankfurter Richter nicht nur über 22 SS-Aufseher, sondern über die ganze Nation.«8
Es urteilten aber deutsche Richter, nicht die der Alliierten wie in Nürnberg. Mit den NS-Prozessen stellten sich die Westdeutschen ihrer verdrängten Geschichte. Doch zeugen rechtsstaatliche Prozeduren – die minutiöse, frustrierende Wahrheitsfindung im Wust der Akten und Aussagen – keine Katharsis. Die ist laut Aristoteles die Selbstreinigung durch »Schauder und Mitleid«. Das Prinzip in dubio pro reo, im Zweifel für den Angeklagten, spricht Recht, schafft aber nicht unbedingt Gerechtigkeit.
Die Katharsis wurde merkwürdigerweise von einem Pop-Drama ausgelöst: der vierteiligen TV-Serie Holocaust: Die Geschichte der Familie Weiss vom Beginn der Judenverfolgung bis zur »Endlösung«. Was unzählige Dokumentationen zum Völkermord nicht vermocht hatten, gelang 1979 einer Serie über das Schicksal einer einzigen jüdischen Familie, sozusagen Hollywood meets Holocaust. Sie fesselte zehn oder gar 15 Millionen Zuschauer pro Sendung an den Bildschirm.
Es war eine erinnerungsgeschichtliche Wasserscheide. Unter der Wucht des emotionalen Bebens, hieß es seinerzeit, habe der Bundestag 1979 endlich, nach mehreren gescheiterten Anläufen, die Verjährungsfrist für Mord aufgehoben.9 Der Autor des Buches Erfundene Erinnerung sieht die Miniserie als »Beginn der Bereitschaft nun auch eines Massenpublikums, sich mit der NS-Vergangenheit überhaupt auseinanderzusetzen«.10 Das Fernsehen als Erziehungsanstalt im Wohnzimmer – oder: Vier TV-Episoden sind mehr wert als Millionen von Wörtern.
Im Jahre 1979 markierte Holocaust eine Prüfung der Kollektivseele, einen nachträglichen moralischen »Stresstest«, dem sich die breite Masse erst zwanzig Jahre nach dem Untergang gestellt hatte. Damit aber nicht genug. Im selben Jahrzehnt, in den Siebzigern, bestand die Halbnation zwei weitere harte Prüfungen.
Die eine war Willy Brandts heftig umkämpfte Ostpolitik, die den eingebauten Revisionismus der Bundesrepublik ad acta legte. Im Kern war die Ostpolitik »Verzichtpolitik«: die Aufgabe ehemaliger deutscher Gebiete in Polen und in der Sowjetunion sowie die Hinnahme der DDR als zweiten deutschen Staat. Es war ein Verzichtfrieden, gewiss, aber einer, um abermals Hegel zu bemühen, wo der Proband »sich in die bestehenden Verhältnisse«, in die machtpolitischen Realitäten, einfügt. Eine solche Prüfung hatte die Weimarer Republik nicht bestanden; die »Heimholung« der amputierten Ostgebiete schweißte alle Parteien von rechts bis links zusammen und lieferte Hitler den Vorwand, mit dem Angriff auf Polen den Weltkrieg zu entfesseln. Die Ostpolitik »entfesselte« dagegen den europäischen Frieden (siehe Kapitel 6, »Willy Brandt und der Kniefall«). Krasser konnte der Unterschied zwischen dem Dritten Reich und der Zweiten Republik nicht sein.
Die zweite Prüfung der Siebziger war der Terror der Rote Armee Fraktion und ihrer Ableger. Mord, Entführung und Erpressung summierten sich über Jahre hinweg zum unerklärten Ausnahmezustand (siehe Kapitel 10). Würde der Staat mit verzehnfachter Härte zurückschlagen, um im Namen der Sicherheit die Säulen der liberalen Demokratie einzureißen? Er tat es nicht; die Regierung Helmut Schmidt besiegte den Terror, ohne das Fundament des Staates, die Bürgerfreiheit, zu demolieren.
In der folgenden Dekade, in den Achtzigern, musste die Republik abermals eine außenpolitische Prüfung bestehen. Das war der Binnenkrieg gegen die Nachrüstung mit nuklearen Mittelstreckenwaffen – eine Generation nach den massenhaften Protesten gegen Wiederbewaffnung und Westbindung. Bedrängt von atomaren Untergangsvisionen auf dem »Schießplatz der Supermächte«, gingen Millionen auf die Straße (siehe Kapitel 7).
Die Position der Bundesrepublik im Westen wackelte, die Regierung Schmidt fiel. Doch sollte der geschasste Kanzler recht behalten, die kühle Staats- und Bündnisräson sich unter seinem Nachfolger Helmut Kohl in der Machtprobe mit Moskau durchsetzen. Der Kreml musste erkennen, dass Westdeutschland, der Dreh- und Angelpunkt der Nachrüstung, nicht kapitulieren würde. Die Raketen kamen und gingen, weil die Sowjetunion ihre Vorrüstung im Zuge der »Null-Lösung« zurücknahm.
DEUTSCHE WANDLUNGEN, TEIL 3
Diese Phase – das Erwachsenenleben im Bildungsroman – beginnt 1990 mit der Wiedervereinigung, einem weltpolitischen Wunder, und sie hält an bis in unsere Tage. Die Zweiteilung Deutschlands zerbrach zusammen mit der Zweiteilung Europas, die scheinbar auf eine Ewigkeit angelegt worden war. Es war, als hätte der Weihnachtsmann seinen größten Geschenkesack bei dem Waisenkind Deutschland abgeladen.
Die strategische Bedrohung aus dem Osten verschwand mit dem Zerfall des Warschauer Paktes und dem Abzug der russischen Armeen. Es fielen die Ketten der Abhängigkeit vom Westen. Mit der stärksten Wirtschaft und der größten Bevölkerung war Deutschland abermals die Hauptmacht auf dem europäischen Schachbrett. Was nun?
Der Zögling hatte während seiner Lehrjahre verinnerlicht, wie zweischneidig Macht ist. Sie schafft Vorteile wie auch Versuchung und Selbstüberhebung, die den Deutschen regelmäßig das Desaster beschert hatten. Das neue Deutschland schlüpfte eben nicht in die Knobelbecher seiner Vorgänger, das »Fourth Reich« blieb nur eine Angstfantasie seiner Nachbarn. Stattdessen kassierte Deutschland nach dem Kalten Krieg eine reiche Friedensdividende und betrieb im folgenden Vierteljahrhundert eine geradezu beispiellose Abrüstungspolitik. Von 3500 Kampfpanzern blieben nur 250 übrig.
Auf dem neu geordneten europäischen Brett positionierte sich das vereinte Deutschland nicht als Macht-, sondern als Moralstaat (siehe Kapitel 3, »Der gute Deutsche: Vom ›Untertan‹ zu Angela Merkel«). Peinlichst vermied der Hüne Gesten der Stärke, legte sich anstelle der alten Ketten freiwillig neue an – ein einzigartiger Vorgang in der Staatengeschichte. Nicht weniger, sondern mehr europäische Integration sollte es sein – durch Souveränitätsverzicht auf dem Weg zu einer »immer engeren Union«, durch Vergemeinschaftung der mächtigen D-Mark im Euro.
Um die strategische Arena machte die Bundesrepublik im krassen Gegensatz zum Zweiten und zum Dritten Reich einen weiten Bogen. Die Liste: Kuwait-Krieg 1990 gegen den Eroberer Saddam Hussein, Afghanistan-Krieg gegen al-Qaida und Taliban nach dem Terrorangriff auf New York 2001, Zweiter Irak-Krieg 2003, Libyen-Luftkrieg 2011, Bombardement syrischer C-Waffen-Anlagen 2018. Im letzteren Fall galt die Devise: Wir sind dafür, nicht dabei.
Amerikas Alliierte kämpften mit, die »Zivilmacht« Deutschland entzog sich den Einsätzen mit viel Geld und nicht-militärischen Gaben. Die Zivilreligion des »Nie wieder!« warf einen doppelten Bonus ab, wie Kapitel 7, »Friedensmacht Deutschland: Erhebend, praktisch, gut«, zeigt. Mit seiner nachgerade unbedingten Friedfertigkeit konnte Deutschland Läuterung und moralischen Selbstwert bezeugen, zugleich den kostenträchtigen Zumutungen seiner Verbündeten ausweichen. Das Nützliche als Zwilling des Guten.
In diesem Sinne hat sich der Held unseres Bildungsromans nicht in ein »normales Land«, gar ein »Modell für den Westen« verwandelt, wie der Economist 2018 in seiner Titelgeschichte Cool Germany applaudierte.11 »Normale« Groß- oder auch nur Mittelmächte wie Frankreich und Britannien verstehen, wie es Clausewitz gelehrt hatte, Gewalt und Diplomatie als zwei Seiten derselben Medaille. Deutschland aber hat sich mit dem Verweis auf seine Vergangenheit eine »Kultur der Zurückhaltung« – oder Strategie der Selbstfesselung – auferlegt. Es setzt Gewalt in kleinen Dosen nur im Verbund mit anderen ein, wo die Risiken gering sind, vor allem keine Konfrontation mit einem militärischen Schwergewicht droht. Das Hehre und das Dienliche Hand in Hand – das ist ein Leitmotiv des deutschen Entwicklungsromans.
Im siebten Buch von Wilhelm Meister ruft der Abbé, der im Hintergrund die Geschicke steuert, dem Zögling zu: »Heil dir, junger Mann!, deine Lehrjahre sind vorüber.« Für die Bundesrepublik, inzwischen kein »junger Mann« mehr, trifft der Glückwunsch noch nicht zu. Eine »normale Nation« würde nicht nur als Konsument, sondern auch als Mitproduzent von Sicherheit auftreten – zumal in einer Zeit, wo die Konflikte immer dichter an das einst so friedvolle Europa heranrücken und der Chefproduzent Amerika seit der Ära von Barack Obama (2009–2017) von Europa abrückt.
In der Literatur steht am Schluss des Bildungsromans das Happy End. In der realen Welt aber hört das Lernen nie auf. Eichendorffs »tugendhafte Wandlung« ist längst bewältigt; die Bundesrepublik ist das funkelnde Gegenmodell zu ihren blutig gescheiterten Vorgängern. »Normal« aber wird sie noch lange nicht sein. Wieso auch, wenn sie in ihrem eigenen Entwicklungsroman gelernt hat, dass sie in ihrer selbst gewählten Rolle als Friedens- und Zivilmacht mit ihren gezügelten Ambitionen so sehr viel erfolgreicher agiert hat als der untergegangene deutsche Machtstaat.
TEIL I
DER MYTHOS VOM DEUTSCHEN SONDERWEG
KAPITEL 1
DER »HÄSSLICHE DEUTSCHE«
DER »UNTERTAN« DIEDERICH HESSLING
Der hässliche Deutsche heißt Diederich Heßling. Er ist die literarische Hauptfigur in Heinrich Manns Der Untertan, einem Roman, der wie kein anderer die Sicht auf Wilhelminien geprägt hat – das Zweite Reich, den ersten deutschen Nationalstaat, der sich aus dem Völkergemisch des Heiligen Römischen Reiches († 1806) herausgeschält hatte. Warum Heßling und nicht Hitler? Der spielt in einer anderen galaktischen Liga, mit Stalin, Mao und Pol Pot. Heßling ist kein Millionenmörder, keine Ausgeburt des Bösen, sondern ein normaler Deutscher seiner Zeit, jedenfalls so, wie Heinrich Mann ihn mit seiner galligen Feder gezeichnet hat.
Heßling ist obrigkeitshörig und feige. Ein Mitläufer und Konformist, Burschenschaftler und Stammtischagitator, Intrigant und Kaiserverehrer. Er ist ein Tyrann gegen die Schwachen und ein Untertan, der sich der überlegenen Macht beugt. Heßling verabscheut den Liberalismus, dem sich das aufsteigende britische Bürgertum verschrieben hatte. Sein Leitstern ist ein glühender antidemokratischer Nationalismus, der einen weiteren Unterschied zu England und Amerika markiert, wo der Stolz auf die Demokratie als einzigartige angelsächsische Errungenschaft den Nationalismus befeuerte.
Der Liberalismus war »jüdisch«. Die Neuteutonen, Diederichs Burschenschaft, stimmen »alle darin überein, dass der jüdische Liberalismus die Vorfrucht der Sozialdemokratie sei und die christlichen Deutschen sich um den Hofprediger Stöcker zu scharen hätten«, den Begründer der antisemitischen Christlich-Sozialen Partei. An dieser Stelle lässt der hellsichtige Autor schon den Hitler aufblitzen, obwohl das Manuskript 1914 abgeschlossen wurde. Die Juden, doziert Diederichs Freund, der »hochfeudale« Herr von Barnim, »waren das Prinzip der Unordnung und Auflösung, das Prinzip des Bösen selbst«. Und »Diederich fühlte mit ihm«.
Der Sentimentalist Heßling ist ein Machtmensch von »deutscher« Art: »Jeder muss über sich einen haben, vor dem er Angst hat, und einen unter sich, der vor ihm Angst hat.« In Diederichs Volksgemeinschaft regiert nicht der freie citizen oder citoyen, sondern der Untertan, der sich nach oben duckt und nach unten tritt.
Heßling ist zugleich Heuchler und Opportunist, im öffentlichen wie im eigenen Leben. Schlau entzieht er sich dem Wehrdienst, besingt aber die Armee bei jeder Gelegenheit als Inbegriff deutscher Zucht und völkischer Überlegenheit. Er wütet gegen die »Sozen« und applaudiert, als die Büttel einen demonstrierenden Arbeiter erschießen. Denn die »Bande« müsse wissen, »wer die Macht hat«, nämlich der Kaiser. »Sie werden ihn kennenlernen«, böllert Diederich. »Blut und Eisen bleibt die wirksamste Kur! Macht geht vor Recht!« Auch hier zeichnet Mann unbewusst einen scharfen Kontrast zum angelsächsischen Westen. In England wurde die rule of law schon vor achthundert Jahren in der Magna Carta festgeschrieben – das Prinzip, wonach der Souverän unter, nicht über dem Gesetz steht.
Sein Hass auf die »vaterlandslosen Feinde der göttlichen Weltordnung« hindert Heßling freilich nicht daran, ein Bündnis mit dem SPD-Funktionär Napoleon Fischer einzugehen, um so in den Stadtrat des Provinzkaffs Netzig gewählt zu werden. Solange es gut fürs Geschäft ist, paktiert er auch mit den liberalen Kräften, die der »alte Herr Buck« verkörpert.
Wieso das Bündnis mit dem ideologischen Todfeind? Weil es opportun ist. Herr Buck sei »noch immer der mächtigste Mann der Stadt«, schmeichelt ihm Heßling; überdies sei er selber »ein durchaus liberaler Mann«. Lügen in Zeiten des Aufstiegs. Doch ist der »alte Buck« der Einzige, der Heßling durchschaut. Auf dem Totenbett nimmt er Heßling als »Teufel« wahr. Aber »Diederich war schon entwichen«, wie Heinrich Mann auf der letzten Seite des Romans voller Vorahnung notiert.
Wie in der Politik, so auch im Privaten, wo unser wilhelminischer Held jeden Wert so hochhält, dass er bequem darunter durchlaufen kann. Seine erste Liebe, Agnes Göppel, lässt er eiskalt fallen, um die reiche Erbin Guste Daimchen zu heiraten, die er bald als »fette Gans« und »frisch gewaschenes Schweinchen« verachten wird. Dennoch unterwirft er sich dem Weibe so hündisch wie der Macht des Monarchen.
In einer hinreißenden nächtlichen Szene, die nur deshalb nicht ins Pornographische abrutscht, weil Mann sie clownesk überzeichnet, wird das Sexuelle zum Politischen: Unterwerfung als Lustprinzip. Mit nachtwandlerischem Instinkt zeichnet Mann hier die Erotik der Macht vor, die Hitler genial nutzte, um ein ganzes Volk zu unterjochen. In ihrem Essay Faszinierender Faschismus spricht Susan Sontag von einer »Sexualität«, die umgewandelt wird »in die Anziehungskraft von Führergestalten und das Glück der Gefolgschaft«. Die Filme dazu, vorweg den »Triumph des Willens«, lieferte Leni Riefenstahl.
»… und plötzlich hatte er [Diederich] eine mächtige Ohrfeige – worauf er nichts erwiderte … seine Augen … voll Angst und dunklen Verlangens standen … Guste … erhob sich … und den wurstförmigen Finger gebieterisch gegen den Boden gestreckt, zischte sie: ›Auf die Knie, elender Schklafe!‹ Und Diederich tat, was sie heischte! In einer unerhörten und wahnwitzigen Umkehrung aller Gesetze durfte Guste ihm befehlen: ›Du sollst meine herrliche Gestalt anbeten!‹ – und dann auf den Rücken gelagert, ließ er sich von ihr in den Bauch treten. Freilich … fragte [sie] plötzlich ohne ihr grausames Pathos und streng sachlich: ›Haste genug?‹
Diederich rührte sich nicht; sofort ward Guste wieder ganz Herrin. ›Ich bin die Herrin, du bist der Untertan‹, versicherte sie. ›Aufgestanden! Marsch!‹ – und sie stieß ihn mit ihren Grübchenfäusten vor sich her nach dem ehelichen Schlafgemach. ›Freu’ dich!‹ verhieß sie ihm schon, da gelang es Diederich, zu entwischen … Versagenden Herzens vernahm er, wie Guste dort hinten ihm die wenigsten anständigen Namen gab, wobei sie freilich schon wieder gähnte … Diederich aber … kroch auf allen vieren die Estrade hinan und versteckte sich hinter dem bronzenen Kaiser.«
»Hinter dem bronzenen Kaiser«, dem ersten. Den zweiten Wilhelm imitiert Heßling mit Gestik, Mimik und gezwirbeltem Schnurrbart. Er unterbricht sogar seine Flitterwochen, um dem angebeteten Monarchen in Rom nachzulaufen: endlich Aug’ in Aug’ mit der gottgleichen Gestalt. Er durchbricht die Sperren, die Soldaten jagen hinter ihm her. Als die kaiserliche Karosse vorfährt, »schwenkt Diederich den Hut, er brüllt auf, dass die Herren im Wagen ihr Gespräch unterbrechen«. Wilhelm beugt sich vor, »und sie sahen einander an, Diederich und sein Kaiser. Der Kaiser lächelt kalt.« Doch ein paar Sekunden sind sie »miteinander allein, der Kaiser und sein Untertan«.
Diederich erlebt die Macht wie im Rausch, sei’s die der Gattin oder des Herrschers. Ironisch schreibt Mann: »ein Rausch, höher und herrlicher als der, den das Bier vermittelt … Die Macht, die über uns hingeht und deren Hufe wir küssen! Die über Hunger, Trotz und Hohn hingeht! Gegen die wir nichts können, weil wir alle sie lieben.«
Heinrich Mann hat das Manuskript im Juli 1914, nur Wochen vor dem Ersten Weltkrieg, abgeschlossen. Auf den letzten Seiten erblickt er bereits den Abgrund, in den die Nation stürzen würde. Auf Heßlings Betreiben hatte Netzig zum 100. Geburtstag des ersten Wilhelm ein Denkmal für den Kaiser beschlossen. Doch gerät die Einweihung zur Vorschau auf die Apokalypse.
»… da platzte der Himmel … mit einer Heftigkeit, die einem lange verhaltenen Ausbruch glich. … Die Tribünen verschwanden hinter Stürzen Wassers … dass die Zeltdächer sich gesenkt hatten unter der Wucht des Wolkenbruches, in ihren nassen Umschlingungen wälzten links und rechts sich schreiende Massen. … in jagendem Geisterlicht, schwefelgelb und blau, bäumten sich die Pferde …, die Besitzenden und Gebildeten dagegen waren in der Lage, dass sie auf ihren Köpfen schon die fliegenden Trümmer des Umsturzes fühlten, samt dem Feuer von oben.« Die »Weltordnung« zerbrach in »Entsetzen und Auflösung«. … Aber die apokalyptischen Reiter flogen weiter; Diederich merkte es, sie hatten nur ein Manöver abgehalten für den Jüngsten Tag, der Ernstfall war es nicht.«1
Der kam am 28. Juli 1914. Nach vier Jahren und zehn Millionen Gefallenen war das Reich Geschichte und Diederichs göttlicher Kaiser im Exil. Heinrich Manns Porträt des hässlichen Deutschen Diederich Heßling war eine Karikatur – linksgestrickte Agitprop im Gewande der Ironie. Aber auch andere Literaten zeichneten solche Fratzen. »Alles ist Pathos, Phrase«, notierte der bayerische Schriftsteller Ludwig Thoma. »Der Durchschnittsdeutsche von heute [ist] ein ekelhafter Komödiant, der seine Gefühle, seinen Patriotismus auf den Markt trägt.«
Solche Gestalten gab es en masse auch in der Wirklichkeit – an den Stammtischen wie im öffentlichen Leben, im Klein- wie im Großbürgertum. Doch haben nicht die Heßlings deutsche Geschichte gemacht, sondern umgekehrt. Erst im Verlauf dieser Geschichte, in der Rückschau, sind diese Figuren zu Vorboten des Unheils mutiert.
Heinrich Manns genial überzeichneter Heßling als Prototyp des hässlichen Deutschen hat sich zwar tief in das kulturelle Gedächtnis eingegraben, jedenfalls in dessen literarischen Teil. Aber er kann nicht einmal Hitler erklären, geschweige denn Konrad Adenauer, Willy Brandt oder Angela Merkel, die sich zum absoluten Gegenmodell vereinten. Wenig war vorgegeben, nichts war vorbestimmt, wie das folgende Kapitel zeigen soll.
KAPITEL 2
DER DEUTSCHE SONDERWEG KATASTROPHE ODER KONSTRUKT?
RÜCKWÄRTSGEWANDTE PROPHETIE
War der hässliche Deutsche der wahre Deutsche? Damals wie auch hundert Jahre später? Die kürzeste Antwort lautet: »Nein.« Die längere folgt sogleich.
Wer vom Heute auf das Gestern blickt, riskiert jenen Trugschluss, der die historische Kontingenz – den offenen Ausgang – mit Notwendigkeit, Schuld und Schicksal verwechselt, etwa: »So war es; so musste es kommen.« Erst das Danach hat Heinrich Manns Karikaturen zum Wegbereiter der Katastrophe Made in Germany gemacht. Aus der Danach-Perspektive führt scheinbar eine gerade Linie vom preußischen Absolutismus zum wilhelminischen Machtstaat, der die demokratische Moderne erstickte und den Hegemonialkrieg 1914–1918 auslöste – Deutschlands Griff nach der Weltmacht. Nahtlos schließen sich in dieser Sicht die nächsten Katastrophen an – von Weimar bis Auschwitz.
Der nationalen Erniedrigung von 1918 folgte der Untergang der ersten deutschen Demokratie im Kreuzfeuer der rechten und linken Totalitären. Die Weimarer Republik überlebte nicht einmal 14 Jahre lang. Sie versank in der schwarzen Nacht des Nazismus, die mit der Totalniederlage im Zweiten Weltkrieg und der Zerstückelung des Deutschen Reiches durch die Siegermächte endete. Von dieser Warte aus entpuppt sich Heßling als Menetekel – wie im Buch Daniel, wo der Prophet dem Babylonier-König Belsazar wegen seiner Sünden die »gezählten Tage« seiner Herrschaft offenbart.
War der Verlauf der modernen deutschen Geschichte von Wilhelm zu Adolf, von Sedan nach Auschwitz tatsächlich vorherbestimmt? Nach 1945 sah es tatsächlich so aus, als hätten die Deutschen schon lange zuvor den weidlich zitierten »Sonderweg«2 beschritten, der sie von den europäischen Nachbarn abkoppeln, sodann ins Verderben führen sollte – Europa mit dazu. Wer im Geiste auf diesem Weg zurückwandert, so die These vom Sonderweg, wird all die Stationen erkennen, die mit historischer Notwendigkeit in den Untergang führten. So war es, so musste es sein.
Hatte nicht schon Martin Luther Judenhass, Deutschtum und Gehorsam gegenüber der Obrigkeit gepredigt? Wenn sich die Untertanen »empören und auflehnen, wie es jüngst die Bauern taten, ist es recht und billig, gegen sie mit Gewalt vorzugehen«, dozierte Luther in Ob Kriegsleute auch in seligem Stande sein können (1526).
Ein Blick nach draußen, der in der Theorie vom »Sonderweg« gern als Folie für die Verirrungen der deutschen Geschichte benutzt wird: Im Unabhängigkeitskrieg 1775–1783 hatten sich die Jung-Amerikaner des britischen Königs George III. entledigt. In der Revolution von 1789 hatten die Franzosen König und Adel auf der Guillotine beseitigt. Nach den Bürgerkriegen in der Mitte des 17. Jahrhunderts hatten die Engländer ihre Monarchen immer enger zwischen Parliament und rule of law eingezwängt. Doch anstatt nach der Macht zu greifen, so die These vom Sonderweg, unterwarf sich das deutsche Bürgertum einer preußischen Militärmonarchie, welcher der Adel als Prätorianergarde und Herrschaftskaste diente.
WEITER AUF DEM SONDERWEG
Die Verwerfungen der Moderne, zumal Industrialisierung und Verstädterung, Verelendung und märchenhaftes Wachstum, die anderswo der Demokratie den Weg bereiteten, wurden zugedeckelt von einem zügellosen Nationalismus, der sich zum Rassismus steigerte. Gepaart mit Aggressivität nach außen, fungierte dieses exaltierte Nationalgefühl als großer Gleichmacher, der die Konflikte zwischen Klassen und Konfessionen, Agrar- und Industriewirtschaft in der alles überwölbenden »Volksgemeinschaft« aufhob. Land- oder Edelmann, Proletarier oder Profiteur, Protestant oder Papist – sie alle waren gleich und erhaben als Deutsche, die über allen anderen Völkern standen. In der scheinbar konfliktfreien Volksgemeinschaft gab es »keine Parteien mehr, … nur noch Deutsche« – so lautete die legendäre Parole des zweiten Wilhelm.
Der These nächster Teil: Statt politische Teilhabe einzufordern, ließ sich das Bürgertum mit dem Opiat der kulturellen Überlegenheit ruhigstellen. In dieser Vorstellung überragte die hehre deutsche »Kultur« turmhoch die minderwertige materialistische »Zivilisation« des Westens. Deutschland war auserwählt unter den Völkern. Welch berauschender Trank! Er beglückte, indem er betäubte.
Diederich Heßling, der Bürgersohn auf dem Weg nach oben, kandidiert zwar für den Stadtrat, beugt aber das Knie vor dem Kaiser. Denn »der hat die Macht«. Sie wird nicht geteilt, sondern mit »Blut und Eisen« befestigt. »Macht geht vor Recht«, tönt Diederich, und die gehöre allein dem geheiligten Monarchen. Wo das Bürgertum in Frankreich und England die Macht Stück um Stück, Rückschlag um Rückschlag eroberte, machte es sich das deutsche im Herrenzimmer bequem, dort, wo hinter dem Glas des eichenen Bücherschranks Schiller, Lessing und Kant auf dem Altar des deutschen Idealismus prangten.
John Locke, Adam Smith und David Hume, die Meisterdenker der schottisch-englischen Aufklärung, blieben draußen – der kaltäugige Realist Machiavelli sowieso. Das »Bildungsbürgertum«, ein Begriff, den keine andere westliche Sprache kennt, hatte – so die Theorie vom Sonderweg – sein Erstgeburtsrecht für den Ohrensessel im Reich der Innerlichkeit verkauft. Dergestalt wurden die Deutschen thesengemäß zum Außenseiter des westlichen Europas.
Wie spottete doch Heinrich Heine im »Wintermärchen«:
»Franzosen und Russen gehört das Land,
Das Meer gehört den Briten,
Wir aber besitzen im Luftreich des Traums
Die Herrschaft unbestritten.
Hier üben wir die Hegemonie,
Hier sind wir unzerstückelt;
Die andern Völker haben sich
Auf platter Erde entwickelt.«
Das Adelsabzeichen des Bildungsbürgertums war der »Herr Doktor«, nicht die blau-weiß-rote Kokarde des Republikanismus, die den Machtanspruch des Bürgertums in England, Amerika und Frankreich symbolisierte. Dieser Anspruch forderte nicht kulturelle, sondern reale Mitbestimmung bei der Schlüsselfrage aller Politik: Wer kriegt was, wann und wie? Ein typischer Vertreter des Verzichts war Heinrichs Bruder, Thomas Mann. In seinem Buch mit dem bezeichnenden Titel Betrachtungen eines Unpolitischen (von dem er sich allerdings bald distanzierte) begründete Thomas Mann den deutschen Sonderweg, lange bevor der Begriff in die Historiographie einging.
Seine Vorstellung von »Deutschtum« lief konträr zu den demokratischen Glaubenssätzen der Franzosen und Angelsachsen. Diese siedelten im profanen Reich des Politischen, »auf platter Erde«, die Deutschen im erhabenen Reich des Geistes. »Der Unterschied von Geist und Politik«, lehrte Thomas Mann, sei der »von Kultur und Zivilisation, von Seele und Gesellschaft, von Freiheit und Stimmrecht«. Für ihn war »Deutschtum« eben nicht »Zivilisation, Gesellschaft und Stimmrecht« – notabene der Kern der liberalen Demokratie –, sondern »Kultur« und »Seele«. In dem Essay Einiges über Menschlichkeit preist der Nobel-Literat Demut, Dienen und Gehorsam, mithin die Abwendung von der realen Politik.
Im Reich der Politik, im revolutionären Amerika, wären derlei Betrachtungen unvorstellbar gewesen, obwohl sich auch dort, wie in England, eine romantische Bewegung im frühen 19. Jahrhundert entwickelte; nur war sie fest in der liberal-demokratischen Tradition verwurzelt. Dort schleuderte ein Patrick Henry, ein Vordenker der Revolution, dem britischen Gottesgnadentum entgegen: »Give me liberty, or give me death!«
In seinem Traktat Common Sense donnerte der Chefideologe der Revolution, Thomas Paine: Der wahre »König Amerikas« regiere allein im Himmel, nicht auf Erden, wo George III., der »royale Rohling der Briten, die Menschheit verwüstet«. In den Federalist Papers, der Bibel des liberaldemokratischen Staates, zerbrachen sich Alexander Hamilton, John Jay und der spätere Präsident James Madison den Kopf über die Checks and Balances der Verfassung. Diese müssten die Tyrannei im Keim ersticken, aber auch die »Tyrannei der Mehrheit«, welche die Architekten der Constitution so fürchteten wie die Willkür der Kaiser und Könige.
Von Innerlichkeit und »Kultur« hört man kein Wort bei John Locke, David Hume und den amerikanischen Federalists, dagegen umso mehr von der Mechanik praktischer Politik. Die sollte nicht Ideale befördern, sondern Interessen so austarieren, dass im Widerstreit stets die Freiheit obsiege. Umgekehrt wird man im damaligen Diskurs der Deutschen nicht auf die »unveräußerlichen Rechte« des Einzelnen stoßen, die kein Staat je antasten dürfe. Solche Grundrechte wurden erst im westdeutschen Grundgesetz verankert; unter der Weimarer Verfassung konnten Parlament oder Präsident die Verfassung aufheben oder verändern.
KRANKHAFTE ERBANLAGEN





























