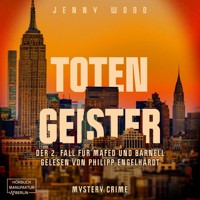Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Art Skript Phantastik Verlag
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2018
"Ich würde meiner Persönlichkeit weitere Rädchen hinzufügen und sie so eines Tages perfektionieren." Konstantin Balthasar von Heerstein ist ein Lebemann – gutaussehend, charmant und pleite. Verstoßen von seiner Familie, mit einem Hang zu Alkohol, Kartenspiel und Frauen versucht er, über die Runden zu kommen. Mit dem Auftauchen eines Anwalts verändert sich jedoch plötzlich alles. Konstantin erbt die Verantwortung für ein Unternehmen, doch die Vorstandssitzungen mit biederen Geschäftsmännern langweilen ihn schnell. Stattdessen weckt das Hausmädchen Sandrin seine Neugierde, die junge Frau wacht über das Geheimnis des Hains hinter dem Herrenhaus. Dort lauert eine noch viel größere Versuchung, die Konstantins Ruf, Vermögen und Verstand gefährdet.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 165
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Der Hain hinter dem Herrenhaus
Eine Novelle der Gaslicht-Romantik
Jenny Wood
Impressum
Copyright © 2018 Art Skript Phantastik Verlag
Copyright © 2018 Jenny Wood
Art Skript Phantastik Verlag | Salach
Lektorat » Rohlmann & Engels
www.lektorat-rohlmann-engels.com
Korrektorat » Melanie Schneider
Gestaltung » Art Skript Phantastik Verlag
Cover-Wald » Jokubas Banaitis - Unsplash
Innenseite-Schmetterling » Fotolia
Der Verlag im Internet
www.ArtSkriptPhantastik.de
Alle Personen und Handlungen sind frei erfunden. Ähnlich- keiten mit realen Personen sind zufällig und nicht beabsichtigt.
Über die Autorin
Jenny Wood lebt - seit sie 1985 geboren wurde - im schönen Ruhrgebiet. Ihr Heim teilt sie mit einem verrückten Schlagzeuger, einer Katze und jeder Menge Büchern. Seitdem sie ein Teenager war, schlägt ihr Herz für Fantasy- Literatur. Da nie ein Brief aus Hogwarts kam und Drachentöter auch nicht mehr gebraucht werden, entschied sie sich nach einer längeren Findungsphase für den öffentlichen Dienst. Die Arbeit mit Menschen bereitet ihr große Freude und die Literatur ist der perfekte Ausgleich zur harten Realität.
Widmung
Für alle,
die das Gefühl haben,
nicht die Erwartungen zu erfüllen.
Das müsst ihr nicht.
Ihr seid schon perfekt
1.
Der schicksalshafte Tag, an dem alles seinen Anfang nahm, an dem der Zerfall meines Verstandes und der meiner Welt einsetzte, begann mit einem Herrn, der unter dem Fenster der bescheidenen Unterkunft, in der ich zurzeit residierte, auf einer dampfbetriebenen Drehorgeln ein eingängiges Kinderlied spielte. Bis heute kann ich nicht sagen, warum besagter Gentleman an diesem Tag, zu dieser Stunde, unter diesem Fenster aufspielte, wo ihm doch in anderen Vierteln die betuchteren Bürger gewiss den ein oder anderen Pfennig mehr zustecken konnten. Vielleicht – wenn ich so darüber nachdenke – wollte er nur den Kindern im Heim am Ende der Gasse eine kleine Freude machen.
Mir allerdings bereiteten die tiefen, dröhnenden Töne, das schrille Pfeifen und das Zischen des Dampfmotors einen großen Unmut, dauerte es doch nur einen kurzen Moment, bis meine Kopfschmerzen in die Kakofonie einstimmten. Unwillig, mich den tröstenden Armen des Schlafes zu entziehen, schob ich meinen Kopf unter die raue Wolldecke und murrte leidend. Doch das Dampfungeheuer ließ sich nicht von meinem stummen Flehen erweichen und brüllte weiter diese prägnante Melodie, die sich wie ein Parasit in meinen Gehörgang fraß und im Hirn einnistete.
Geschlagen warf ich meine Decke zurück und schwang die Beine aus dem Bett, bereit mich dem Untier und dem Peiniger, der ihm diese Töne entlockte, zu stellen. Tage, die mit solch einer Ruhestörung am frühen Morgen begannen, konnten schon keine guten werden. Ich wählte meine Waffe – einen Krug mit Wasser vom Waschtisch – und überbrückte die wenigen Schritte zum Fenster.
Erst als ich den schweren, grauen Vorhang zur Seite zog, bemerkte ich die grelle Frühlingssonne. Fast hätte ich dabei meinen Plan vergessen, doch als die Drehorgel zu einer Wiederholung dieses schaurigen Rattenfängerliedes anhob, besann ich mich auf den Feind und kippte den Krug ohne Vorwarnung um. Zwei Stockwerke unter mir traf das kühle Nass auf Musiker, Instrument und – den entrüsteten Stimmen nach – diverse Passanten.
Rasch trat ich vom Fenster zurück, um dem wütenden Geschimpfe kein Ziel zu liefern. Ein abgetretener Schuh bahnte sich seinen Weg durch die Luft zu mir herauf und fiel klappernd neben mir auf die zerkratzten Dielen. Ich zuckte schmunzelnd mit den Schultern bei dem Gedanken, dass dessen Besitzer nun mit einem vorliebnehmen musste.
Mit dem Gefühl, die Welt etwas besser gemacht zu haben, stellte ich den Krug zurück neben die Schale auf den Rasiertisch. Mein Blick streifte das Bild in dem stumpfen Spiegel, der sich gerne einen Scherz mit mir erlaubte und mich wie ein Gespenst aussehen ließ. Heute war wieder einer dieser Tage. Meine dunklen Augen lagen tief in dem blassen Schädel, als ob es ihnen gelingen könne, sich dort vor dem unnachgiebigen Tageslicht zu verstecken. Das braune Haar war strähnig und schien ein Eigenleben entwickelt zu haben, indem es versuchte, ein explodiertes Federvieh zu imitieren. Die Wangen wirkten hohl und machten mich der Erscheinung nach zu einem nahen Verwandten des Gevatters Tod. Ein schaler Geschmack lag mir auf der Zunge und verschlimmerte den Durst, der mich dank des billigen Brandweins quälte.
Ich rümpfte die Nase, als ich feststellte, dass die einzige Wasserquelle, mit der ich mich hätte herrichten können, meinem verzweifelten Racheakt zum Opfer gefallen war.
»Konstantin, du hast schon mal besser ausgesehen«, predigte ich mir selbst und zog die schlanken, schwarzen Augenbrauen zu einem eleganten Bogen. Eine Geste, die meine Mutter – möge sie mit anderen Gift spuckenden Nattern in der Hölle braten – stets zur Weißglut gebracht hatte. Dieses einem griechischen Epos würdige Monster war schuld an meiner Misere.
Ich bin der dritte Sohn von Sigismund Thaddäus von Heerstein und seiner ungeliebten Frau Elisabetha Philomena von Heerstein, geborene Cosburg-Mayer. Nach einem angesehenen Juristen sowie einer braven, gottesfürchtigen Schönheit und späteren Ehefrau war ich der Taugenichts der Familie und das Gesprächsthema, welches die gesamte Sippe grazil umschiffte. Seit drei Jahren existiere ich für meine Eltern offiziell nicht mehr. Sie waren es leid, einen Schnorrer und Schmarotzer zu beherbergen, der ihrer Meinung nach nichts lernen wollte und ihr Geld mit beiden Händen für Gemälde, Kartenspiel und Alkohol ausgab. Mein Studium in Kunstgeschichte war in ihren Augen nichts wert. Lieber hätten sie mich als Arzt, Theologen oder sogar Philosophen gesehen.
Ich gestehe an dieser Stelle – und das ist ein denkwürdiger Moment, den man sich notieren sollte, da er nie wiederkehren wird -, dass ich mich auf dem Namen und dem Geld meiner Eltern ausgeruht habe und die Vorzüge des Lebens eine gewisse Zeit genießen wollte. Aber der plötzliche Rausschmiss aus meinem Elternhaus vereitelte all meine Pläne, ein bekannter Kunsthändler mit eigener Galerie zu werden. Ohne eine müde Mark in der Tasche wurde dieser Traum zu einer Seifenblase, die mit einem ohrenbetäubenden Knall zerplatzte.
Seufzend griff ich nach dem Jackett, das über dem Bettpfosten hing, und zog meine Uhr aus der Innentasche. Das kleine Werk aus Zahnrädern und Federn surrte und schnurrte wie ein zufriedener, dicker Kater. Als ich sie aufspringen ließ, schnellten an den Seiten kleine, filigran gearbeitete Flügelchen heraus, die man einst aufziehen konnte, sodass die Uhr wie ein vergoldeter Spatz durch das Zimmer flatterte. Die einfältigen Damen der Oberschicht hatte dieses Spielzeug oft begeistert. Nach einem unsanften Absturz hatte dieser Mechanismus allerdings den Geist aufgegeben und es mangelte mir am Kleingeld, es reparieren zu lassen.
Die Zeiger verrieten mir, dass es erst kurz nach Mittag war. Frühster Morgen, wenn man bedachte, dass ich mich erst zum Sonnenaufgang in mein kleines Zimmer geschlichen hatte – besoffen, pleite und am Boden zerstört. Doch nun war ich schon wach und konnte mir einfallen lassen, wie ich an das Geld kam, das ich erst letzte Nacht verspielt hatte.
Gerade als ich mich auf dem Rand meiner Schlafstätte niederlassen wollte, hämmerte es laut an der Tür. Mit jedem Schlag bebten die alten Bretter, als ob sie vor dem Menschen auf der anderen Seite flüchten wollten. Hatte der Dampforgel-Musiker also den Weg zu mir gefunden, um sich für die unangemeldete Dusche zu bedanken.
Ich stieß genervt die Luft aus. Das war zu viel für einen Morgen – und das alles noch vor einer Tasse Tee. Im Vorbeigehen hob ich den geworfenen Schuh auf, denn vielleicht forderte auch nur der Besitzer sein Eigentum zurück.
Als ich nach dem Schlüssel griff, erzitterte die Tür unter erneuten Schlägen.
»Herr von Heerstein?«
Ich zögerte. Die Stimme klang weder wütend noch sonst wie aufgebracht, und ihr Besitzer wusste, zu wem er wollte und wo derjenige zu finden war. Die Erfahrung der letzten Jahre riet mir, dass es nichts Gutes bedeutete, wenn man nach mir suchte. Eilig kramte ich in meinem von Alkohol vernebelten Gedächtnis, bei wem ich mir etwas zu Schulden kommen lassen hatte.
Um den Gast nicht doch noch zu erzürnen, drehte ich an dem Schlüssel. Ein leises Klappern verriet mir, dass die Zahnräder in der Wand den Befehl verstanden hatten und sich mühsam in Bewegung setzten. Kurze Zeit später schnellte der Riegel zurück und die Tür schwang nach innen auf.
Vor mir stand ein untersetzter Mann in einem teuren Nadelstreifenanzug. Der buschige Schnauzbart und die gewaltige Körperfülle erinnerten mich prompt an ein Walross. Eine schwarze Melone, die sonst die graue Halbglatze verdeckte, wurde von ihm nervös in den Händen gedreht. Unter seinem rechten Arm klemmte eine modische Aktentasche in dunklem Leder passend zu seiner geschmackvollen Garderobe sowie ein Gehstock. Die dicken Augenbrauen zogen sich überrascht hoch, als er mich in meinem Nachtgewand erblickte. Ich selbst muss nicht minder verwirrt geschaut haben.
»Herr Konstantin Balthasar von Heerstein?«, wiederholte er seine Frage und versuchte, an mir vorbei ins Zimmer zu schielen.
Nachdenklich klopfte ich mit dem ausgetretenen Schuhwerk gegen meinen Oberschenkel und versuchte, mir einen Reim auf mein Gegenüber zu machen. »Verzeihen Sie, Sie sehen weder aus wie ein Dampforgelspieler noch wie ein erzürnter, nasser Mitbürger. Geldeintreiber sind Sie auch nicht. Und mit Verlaub«, ich blickte hinab zu seinen Füßen, die, wie sollte es auch anders sein, in feinen, polierten Halbschuhen aus italienischem Leder steckten, »dieser hier scheint Ihnen nicht zu gehören. Also, wer möchte das wissen?«
Die Verwirrung des Walrossmannes nahm zu, als er den Gegenstand in meiner Hand erkannte, und ich war mir sicher, dass er für einen Moment an meinem Verstand zweifelte. Ein Fehler, der auch mir des Öfteren unterläuft.
»Verzeihung. Natürlich, ich sollte mich erst einmal vorstellen. Mein Name ist Conrad Berghausen. Prokurist, Rechtsanwalt und Notar. Ich komme im Auftrag Ihres Ur-Groß-…« Er stockte und schien nach den richtigen Worten zu suchen, die sich möglicherweise in seinem struppigen Bart verfangen hatten. »Im Auftrag eines entfernten Verwandten«, korrigierte er sich schließlich. »Ich habe geschäftliche Dinge mit Ihnen zu besprechen.« Sein Seitenblick auf den dunklen, heruntergekommenen Flur machte meinem schlaftrunkenen Hirn klar, dass er das nicht zwischen Tür und Angel erläutern wollte.
Ich kniff mir mit Daumen und Zeigefinger in die Nasenwurzel, um meine Gedanken zu sortieren und die Müdigkeit zu vertreiben. Nach einem tiefen Atemzug trat ich zur Seite und bat den Herrn Berghausen in meine bescheidene Unterkunft.
Er folgte dem Wink, ohne zu zögern, und ließ seinen Blick aufmerksam und, wie mir nicht entging, angewidert schweifen. Viel gab es in meinen Räumlichkeiten nicht zu entdecken. Ein Bett, ein Waschtisch, ein Stuhl und eine Kommode bildeten das komplette Interieur, sodass Herr Berghausen recht rasch seine Inspektion beendet hatte.
Ich hob meine Kleidung vom Stuhl und bat dem Anwalt den Platz an. Die grauen Schnurrbarthaare zuckten, was ich als Lächeln interpretierte. Ich wartete geduldig, bis Herr Berghausen ein spitzenbesetztes Taschentuch aus der Anzugtasche zog, es über das mottenzerfressene Polster des Stuhls legte und sich setzte, ehe ich mich selbst ihm gegenüber aufs Bett sinken ließ.
»Nun, Herr Advokat, wie kann ich Ihnen helfen?«, fragte ich geradeheraus und überspielte die Tatsache, dass ich ein Nachthemd trug, mit ausreichend Selbstbewusstsein.
Conrad Berghausen hatte mittlerweile Tasche und Gehstock neben sich abgelegt und hob abwehrend eine Hand. »Die Frage, mein junger Freund, lautet wohl eher, wie ich Ihnen helfen kann.«
Ich überhörte die vertraute Anrede. Irgendetwas an mir brachte die Menschen dazu, mich schnell sympathisch zu finden, was wohl dieses großväterliche Verhalten erklärte. Meine Schwester hatte mir oft geraten, ich solle doch ein durchtriebener Gauner und Fälscher werden wie einer dieser mysteriösen, romantisch verklärten Helden aus ihren Schundromane. Ich hätte den Charme, die Gerissenheit und das künstlerische Talent, um es weit zu bringen. Leider scheute ich sowohl vor den Gendarmen als auch vor der Arbeit zurück, die eine solche Karriere mit sich brachte.
Aufmerksam legte ich den Kopf zur Seite und schlug die Beine übereinander.
Als ob der Anwalt auf dieses Zeichen gewartet hatte, beugte er sich zu seiner Aktentasche und zog einen großen Umschlag heraus. »Es sind in erster Linie traurige Umstände, die mich zu Ihnen führen.«
»Mein Vater …«, entwich es mir, bevor die Fasson wieder Herrin über mich wurde.
»Dem geht es bestens«, entgegnete Berghausen und strich sich über den Schnauzbart. Ein dumpfes Lachen ließ den Walrossleib erbeben. »Wenn man von einem kleinen Wutanfall absieht.«
Ich verdrehte die Augen und schickte ein stummes Stoßgebet zu dem Dämon, der mich in diesem Moment mit nervigen Diskussionen und einem schmerzenden Schädel peinigte. Mein Geduldsfaden war nach der Dampforgeltortur recht kurz. »Erklären Sie sich«, forderte ich mit einer unwirschen Geste.
»Ich bin hier, um Ihnen die traurige Mitteilung zu überbringen, dass Ihr Ur-Groß…« Wieder geriet er ins Stocken.
»Entfernter Verwandter?«, half ich nach, worauf Berghausen eifrig nickte.
»Herr Franz Josef von Heerstein ist leider von uns gegangen.«
Ich brauchte einen Moment, um diese Nachricht zu verarbeiten. Mein Hirn war sich nicht sicher, wie es darauf reagieren sollte. Musste ich erschüttert sein? Traurig? Sogar in Tränen ausbrechen? Nein, das schickte sich nicht für einen Herrn meines Standes. So entschied ich mich für das Einfachste und fragte: »Wer?«
Erneut zuckte der Bart und die Augen des Advokaten wurden zu fröhlichen Schlitzen. »Ja, ich dachte mir, dass Sie das fragen werden.«
Ein Teil von mir atmete beruhigt auf. Diese Aussage verriet mir zumindest, dass ich mir noch nicht das komplette Gedächtnis versoffen und ich diesen Franz Josef von Heerstein wirklich nicht kennengelernt hatte.
Bedächtig öffnete Berghausen den Umschlag – mir fiel auf, dass das Siegel bereits gebrochen war – und zog ein paar Blätter heraus. »Herr Franz Josef von Heerstein ist der Sohn der Tante Ihres Großvaters väterlicherseits.«
Ich versuchte stumm, die Verästlungen meines Stammbaumes im Geiste nachzumalen. »Demnach der Großcousin meines Vaters?«
»Korrekt, mein junger Freund. Mir obliegt die traurige Ehre, mich um den Nachlass des Verstorbenen zu kümmern, ganz so, wie er es testamentarisch festgelegt hat.« Bedeutungsschwer ruhte seine große Hand auf den Pergamenten in seinem Schoß.
Voller Überraschung und Zweifel erhob ich mich, was den Advokaten zusammenzucken ließ. »Entschuldigen Sie, Herr Berghausen, aber Sie müssen sich irren. Weder kannte ich diesen Mann, von dem Sie sprechen, noch glaube ich, dass er mich in seinem Testament bedacht hat. Wenn Sie sich einen üblen Scherz -«
»Aber nicht doch«, fuhr mir der Anwalt über den Mund und hob beschwichtigend die Hände. Mit einem Nicken bedeutete er mir, dass ich mich wieder setzen und seine Erklärung hören sollte.
Ich folgte dem Wink, verschränkte aber die Arme vor der Brust, nicht erfreut darüber, dass dieser Berghausen meine kostbare Zeit stehlen wollte.
»Glauben Sie mir, Herr von Heerstein«, sprach der Advokat mit erhobenem Zeigefinger weiter. »Es war mir kein Leichtes, Sie ausfindig zu machen. Unser guter Freund Franz – Gott habe ihn selig – ist bereits vor sechs Monaten verstorben und stellte mich mit seinem Testament vor eine große Herausforderung.«
Die Neugier in mir horchte auf und zwang mich dazu, mich aufmerksam vorzubeugen.
»Herr von Heerstein forderte in seinem letzten Willen, dass nur eine bestimmte Person sein Vermögen, seinen Landsitz sowie die Firma erben sollte, da er selbst ohne Nachkommen war.«
»Und diese Person bin ich?« Ungläubig deutete ich auf mich selbst, doch Berghausen ließ sich davon nicht beirren.
»Die einzige Vorgabe war, dass der Erbe das ärmste Familienmitglied aus der Blutlinie derer von Heerstein sein muss. Also machte ich mich auf die Suche, sprach mit Vettern und Basen des Verstorbenen und zuletzt mit Ihren Eltern.«
Trotz regte sich im mir und ließ mich schnaufen. »Mit Verlaub, ich kann mir nicht vorstellen, dass meine entzückende Frau Mutter Ihnen voller Stolz von ihrem missratenen Sohn erzählt hat, geschweige denn, dass ihr meine Adresse bekannt ist.«
»Da liegen Sie ganz richtig.« Amüsiert zuckte Berghausen mit den massigen Schultern. »Es war Ihre reizende Schwester.«
»Emilia?«, raunte ich ungläubig und saß mit einem Schlag aufrecht. Von all meinen Familienmitgliedern war sie mir stets die Liebste. Zu Beginn meiner familiären Verbannung hatte sie mir hier und da ein paar Mark zugesteckt und regelmäßig Briefe geschrieben. Ihr Mann, der sich den Zuspruch meiner Eltern erhalten wollte, war allerdings gegen den Kontakt und unterband ihn mit deutlichen Worten. Ich musste zugeben, dass sie mir fehlte. Emilia, mit ihrem warmen Lächeln und den sanften, braunen Rehaugen.
Mein Herz wurde schwer vor Sehnsucht und ich versuchte, ihr mit einem tiefen Seufzer Luft zu machen. »Wie geht es meiner Schwester?«
»Ausgezeichnet«, jubilierte Berghausen. »Man kann sagen, die Schwangerschaft steht ihr hervorragend. Sie strahlt förmlich.«
»Sie ist in anderen Umständen?«, brach es aufgeregt aus mir heraus. Wie lange hatte ich sie nicht mehr gesprochen? Drei Monate? Oder vier? Was hatte ich nur alles versäumt von meinem Schwesterchen, das früher täglich durch mein Leben getanzt war!
Der Anwalt lachte leise und legte mir großväterlich die schwammige Hand auf den Unterarm. »Aber ja, mein Freund. Es geht ihr bestens. Sie erzählte mir alles über Sie und da wurde mir klar, dass ich in Ihnen genau die Person gefunden habe, nach der ich suchte. Außerdem bat Ihre Schwester mich, Ihnen auszurichten, dass sie Sie sehr vermisse und sie sich freuen würde, Sie bald wiederzusehen.«
»So geht es mir auch.« Traurig ließ ich die Schultern sinken und schweifte mit dem Blick in die Ferne, in Gedanken an all das, was ich zurückgelassen hatte. Warum traf mich das Heimweh heute so unvorbereitet?
»Nun, ich bin mir sicher, dass wir daran bald was ändern können«, murmelte Berghausen und zog ein in Leder geschlagenes Buch aus seinem Aktenkoffer. Er schlug es auf und drehte es so, dass ich hineinschauen konnte.
Meine Augen huschten über Aufzeichnungen, Zahlen und Buchstaben. Es waren Notizen zu Ausgaben und Einnahmen, Aufstellungen von Vermögen und Wertgegenständen, Schätzungen von Immobilien. Am Ende stand eine Zahl. Eine gewaltige Zahl, die mir den Atem raubte.
»Herr von Heerstein, ich möchte Ihnen zu Ihrem Erbe gratulieren. Von nun an sind Sie ein einflussreicher Geschäftsmann mit finanziellen Mitteln. Ausreichenden Mitteln für drei Leben. Ich bin mir sehr sicher, dass Ihre Eltern und damit auch Ihre entzückende Schwester bald wieder Ihre Nähe suchen.«
2.
Die dampfbetriebene Kutsche ruckelte über das Kopfsteinpflaster. Ihre Zylinder und Kolben keuchten und pfiffen wie ein altersschwacher Esel, der versuchte, mit einer Karawane in der Wüste mitzuhalten. Nicht nur, dass die Reise mit diesem Gefährt recht unbequem war, sie gestaltete auch noch sehr laut. Seitdem wir losgefahren waren, hatte ich keinen klaren Gedanken mehr fassen können. Ganz zu schweigen davon, eine Konversation mit meinem Kutscher zu betreiben – wobei der generell wortkarg wirkte.
Erneut stellte ich für mich fest, dass die Fahrt mit einer altertümlichen Kutsche samt Pferd deutlich angenehmer war, und beschloss, mir gleich solches anzuschaffen, wenn ich mein neues Domizil erreicht hatte. Obwohl ich mich für die Errungenschaften der Dampftechnik interessierte, war doch nicht alles davon ein Gewinn für die Menschheit.
Die Reise mit dem Zug von Berlin ins Ruhrgebiet war schon anstrengend gewesen, doch seit ich in diesem schaukelnden Monster saß, pochte ein leichter Schmerz hinter meinen Schläfen, der mich missgestimmt werden ließ. Bisher hatte ich Berlin nur selten verlassen. Meine Mutter hatte es gelegentlich zur See gezogen, da dort die Luft besser war und sie es liebte, auf der Promenade zu flanieren. Mit meinem Vater waren wir Kinder für eine Silvesterfeier nach München zu Geschäftspartnern gereist und mein Studium hatte ich mit einem halbjährigen Aufenthalt in Italien gekrönt. Sonst hatte ich stets in der Hauptstadt verweilt, denn ich liebte ihren Reiz und ihren Puls.
Doch jeder Industrielle, der etwas auf sich hielt, zog früher oder später ins Ruhrgebiet. Das schmuckvolle Herrenhaus – wie Berghausen es beschrieben hatte – und die Fabrik befanden sich ein paar Kilometer außerhalb von Essen. Meine Befürchtung, die Landschaft würde grau, zugebaut und schäbig wie ein Hinterhof im Armenviertel sein, zerschlugen sich schnell. Statt qualmender Schornsteine, dreckiger Straßen und schlechter Luft erwartete mich eine moderne Stadt, umgeben von saftigem Grün. Ich beschloss, dass ich mich hier wohlfühlen könnte.