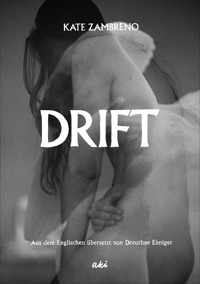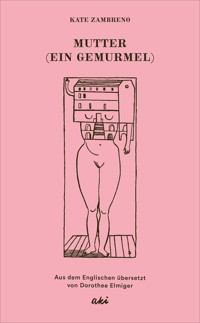19,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: AKI Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
In Der helle Raum entfaltet Kate Zambreno eine literarische Meditation über das Leben als Mutter zweier kleiner Töchter, als Künstlerin und Lehrende. Sie kreist um die Frage, was es bedeutet, neues Leben und neue Kunst in eine von Prekarität und Krisen geprägte Welt zu bringen, und wie sich Erfahrung und Erinnerung in ihrer Flüchtigkeit festhalten lassen. In fragmentierter Prosa beschreibt sie die scheinbaren Kleinigkeiten des Lebens – Spaziergänge im Park, das Vergehen der Jahreszeiten, die Spiele ihrer Kinder, das sich verändernde Licht – und wie diese zu Trägern von Schönheit, Erschöpfung und Transzendenz werden können. Der helle Raum erzählt vom Versuch, kreative Arbeit und familiäre Fürsorge miteinander zu vereinen, und denkt nach über Zeit, Veränderung, Isolation und Erschöpfung, über die Bedeutung von Routinen und Ritualen sowie die Momente, in denen Kunst und Leben ineinanderfließen. Inspiriert von Schriftsteller*innen und Kunstschaffenden wie Natalia Ginzburg, Yūko Tsushima, Bernadette Mayer und Etel Adnan ist Der helle Raum eine ehrliche Auseinandersetzung mit dieser brennenden Welt und eine entschlossene Suche nach dem Schönen darin.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Kate Zambreno
Der helle Raum
Überlegungen zu Kunst und Kinderbetreuung
Aus dem Englischen von Eva Bonné
AKI
Für meine Töchter
Lichtboxen
Otoño
Einige Wochen nach der Geburt des Babys wird aus dem Sommer Herbst. Mit unserer größeren Tochter besuchen wir jetzt öfter eine Spielgruppe, die sich auf einer Wiese mitten im Prospect Park trifft. Die offene Fläche nennt sich Nethermead und ist von den ältesten Bäumen des Parks gesäumt. Wir sitzen in einem Kreis aus leuchtend bunten Picknickdecken neben einer hohen Linde, die sich im Laufe der Jahreszeiten ständig verändert; wir sehen sie grün, braun, kahl und abermals grün. Die Kinder spielen unter dem moosbewachsenen Baum, klettern auf die Buckel am Stamm, springen wieder zu Boden. In einigem Abstand spielen andere Kinder unter anderen Bäumen, beobachtet von anderen Erwachsenen.
Die Gruppe kommuniziert größtenteils auf Spanisch. Die Leiterin, eine Bekannte von uns, hatte die Eltern-Kind-Waldgruppe gegründet, damit ihre Tochter in der Betreuung dieselbe Sprache sprechen kann wie zu Hause, und die Natur sollte der Gruppenraum sein. Die Leiterin wohnt im selben Viertel wie wir, und auch sie hat vor Kurzem ein zweites Kind bekommen – ein weiteres nichtöffentliches Pandemiebaby, das keine anderen Gesichter kennt als die seiner Familie, denn die Gesichter draußen in der Welt sind immer noch verhüllt. Wir sitzen im Schneidersitz auf der Wiese, tragen Masken und stillen unsere Neugeborenen. Wir befragen einander zu unseren Gefühlen, klagen über die Babytragen, an die wir uns erst wieder gewöhnen müssen, und berichten von Schlafmangel. Wir lächeln den Babys ins offene Gesicht, staunen jede Woche über die Veränderungen und fragen uns, ob die Neugeborenen den großen Schwestern ähnlich sehen, empfindsame, fordernde Kinder, die nun gekränkt sind und nicht mehr durchschlafen, weil sie aus der Rolle des jüngsten Familienmitglieds verdrängt wurden. Das Baby der Gruppenleiterin ist ein paar Monate älter als meins und stopft sich Zweige und Gras in den Mund, welche die Mutter geduldig wieder herausholt. Ich bewundere sie für ihre Gelassenheit, obwohl wenige Monate später ich diejenige sein werde, die dort sitzt und sich freut, wenn kleine Füße den Erdboden erkunden.
Wie ich mich fühle, ist schwer zu sagen. Ich habe kaum Zeit, über mich nachzudenken, denn schon wenige Wochen nach der Entbindung muss ich wieder von zu Hause unterrichten und mich außerdem um zwei kleine Kinder kümmern. Anfangs ist der Weg vom Auto in den Park echte Arbeit – unter der Brücke durch, vorbei an den hohen Bäumen, dem Bootshaus, den Hügel hinauf und am Wasserfall vorbei auf die große Wiese. Unbeholfen trage ich das Baby vor dem Körper; meine Muskeln können sich an nichts erinnern. Vom Tragen bekomme ich Rückenschmerzen. Ich gehe langsam. Die Zeit dehnt sich. Nach diesen Vormittagen – der Dienstag ist einer meiner beiden unterrichtsfreien Tage – liege ich bis zum Abend mit schmerzendem, verspanntem Oberkörper auf dem Sofa und stille das Baby. Liegt es am Tragen oder daran, dass das Kind den ganzen Tag auf mir schläft? Trinke ich zu wenig, kann ich den durchs pausenlose Stillen verursachten Kalorienmangel nicht ausgleichen? Ich weiß es nicht.
Mit der Zeit fällt mir die Strecke zum Gruppentreffpunkt leichter. Eigentlich darf ich meine dreijährige Tochter immer noch nicht hochnehmen, was ich aber dennoch tue; ich hebe sie an und trage sie von Streits und Rangeleien weg, natürlich, wie könnte ich nicht. An den Parktagen trinke ich möglichst wenig, weil die öffentlichen Toiletten immer noch geschlossen sind. Trotzdem muss ich die ganze Zeit, mein Unterleib ist geschwollen und empfindlich. Obwohl es unangenehm ist, mit voller Blase zu stillen, hole ich eine Brust aus dem wollenen Stillunterhemd und gebe sie dem Baby. Manchmal stehe ich währenddessen wenige Schritte von den anderen entfernt unter den alten Bäumen. Ich ziehe mir die Maske herunter, weil ich die kühle Luft an meinen Wangen spüren will, irgendeine Verbindung zur Natur. Als aus dem Sommer erst Herbst wird und dann Winter, bekomme ich für ein paar Wochen frei. Mein Körper fühlt sich weniger bleiern an, er wird leichter und ich kann lange gehen, ohne zu bluten, und da weiß ich, ich heile.
Ich mache mir Sorgen um meine ältere Tochter, für die sich in diesem Jahr der tektonischen Verschiebungen so viel verändert hat. Ich beobachte sie, wie eine Meteorologin Wetterumschwünge registriert, und frage mich ständig, ob ein Ausbruch ihrer, wie ich sie inzwischen nenne, »sehr großen Gefühle« bevorsteht; es wäre ganz normal für ihr Alter, selbst ohne die zusätzlichen Krisen dieses Jahres. In einer der ersten Wochen geht sie in die Luft, weil ihre Freundin, die Tochter der Gruppenleiterin, ein bestimmtes Spielzeug bekommt. Den Kindern wurde ein Beutel voller Spielsachen angeboten, darunter eine Lupe, eine Schaufel, ein Metalleimer, ein Holzlöffel, eine Rassel und ein Regenbogentuch, und jedes einzelne Stück war säuberlich mit schwarzem Filzstift mit dem Namen eines Kindes versehen. Doch an diesem Tag bekommt die Freundin meiner Tochter ein zusätzliches Spielzeug von der Gruppenleiterin. Ich weiß nicht mehr, was es war, aber wir hörten wochenlang davon. Ich weiß nur, dass meine Tochter dem Mädchen das Spielzeug aus der Hand reißt und behauptet, es sei ihr gestohlen worden. Als ich versuche, es an mich zu nehmen, rastet sie aus und ich muss sie – obwohl ich es eigentlich nicht darf – viele Schritte von der Gruppe wegtragen und sie beruhigen. Sie macht sich los und rennt über die Wiese auf ihre Freundin zu, ich bin mir sicher, sie wird sie schlagen und ihre Wut an dem nichtsahnenden Kind auslassen. Ich laufe meiner Tochter hinterher, auch wenn ich der Hebamme versprochen hatte, genau das nicht zu tun, fange sie ein und trage sie weg, während sie schluchzt, als hätte sie alles in der Welt verloren, sie ist überwältigt von Scham, Trauer und Kummer, und da ist auch immer noch eine gehörige Menge Wut. Wir gehen früher und lassen John zurück, der unsere Sachen zusammenpackt und sich um das Baby kümmert.
Wir setzen uns an den See und beobachten die Enten. Ich lasse meine Tochter Käse und Apfelstücke essen, schleimige Scheiben in der von ihrem Vater vorbereiteten Snackdose. Ich halte sie auf dem Schoß, streiche ihr über den Kopf und sage ihr, wie sehr wir sie lieben, dass alles gut wird. Ich versuche, ihr zuzuhören. Weil sie traurig ist, muss auch ich weinen; wir weinen zusammen. Ihr gefällt nicht, dass alle Kinder der Gruppe sich anscheinend kennen und eine Sprache sprechen, die sie nicht versteht. Aber bald wird sie die Älteste dort sein, erkläre ich ihr, und es wird ihr Spaß machen, sich mit adios zu verabschieden. Genau so kommt es dann auch. Bin ich jetzt in der Schule?, fragt sie in dem Herbst immer wieder. Bin ich in der Vorschule? So ähnlich, sage ich.
Eine Woche später gehen sie und ihre Freundin nach dem Gruppentreffen auf den Spielplatz im Park. Sie sitzen auf der Reifenschaukel und lassen sich von einem der Väter Anschwung geben, alles ist wieder in Ordnung. An einem anderen Tag in jenem Herbst sausen ihre Freundin und ein anderes Mädchen auf ihren Rollern davon, ohne sie zu fragen, und sie erleidet abermals einen Zusammenbruch. Von dem Tag an moderiere ich die Verabschiedung so, dass die Mädchen nach der Spielgruppe immer zu dritt losfahren, über die Brücke und den Hügel hinunter, vorbei an den Enten, den Trauerweiden und den hohen Bäumen und durch den Tunnel. Die richtige Verabschiedung erfolgt erst am Ausgang des Parks, und bald gehört sie zum Ablauf des Dienstagvormittags. Das Vergnügen angesichts der drei nebeneinander abgestellten Roller, an jedem Griff baumelt ein leuchtender Helm – Pflaumenlila (unserer), Taxigelb, Sattgrün.
Am Ende des otoño wird meine Tochter vier. Ihr Haar ist lang und sie selbst einen ganzen Kopf gewachsen und damit so groß wie ihre Freundinnen. Sie flitzt den Hügel hinunter, läuft lachend vor mir weg, während ich sie rufe. Bei den ersten Zusammenkünften ist es auf der offenen Fläche sehr sonnig, ich trage einen breitkrempigen Strohhut und wir wandern mit dem Schatten um den Lindenstamm herum. Später ist es kühler und dunkler, und wir lernen alles über den Herbst. Neuerdings beschäftige ich mich mit den Jahreszeiten und damit, wie sie die Zeit einteilen. Die Gruppenleiterin, eine junge Mexikanerin, streift mit den Kindern über die Wiese und macht sie darauf aufmerksam, wie die Blätter sich verfärben. Bald weicht das Grün der Linde Schattierungen von Gelb und Rostrot. Die Kinder laufen ans andere Ende der Wiese zum Milchorangenbaum und lesen grüne, stachelige Früchte vom Boden auf, die an fusselige Tennisbälle erinnern. Die Leiterin versucht, die Kinder zum Spazierengehen zu animieren, denn für gewöhnlich laufen sie lieber weg, kämpfen, spielen und rempeln einander an, während die Eltern sie pausenlos ermahnen, um Erlaubnis zu bitten – du musst erst fragen, ob sie das wollen! Achte darauf, ob sie lächeln! Eine absurde Forderung, schließlich tragen wir alle Masken. Aber irgendwie kriegen wir es hin. Oft versucht die Gruppenleiterin, die Kinder zur Zusammenarbeit zu bewegen, zum Beispiel, um einen der Baumstämme auf die Wiese zu schleppen oder eine Wippe aus Ästen zu bauen, auf und nieder, auf und nieder. Am Fuß der Linde liegt alles bereit, was man für Matschkuchen braucht. Manchmal befestigt die Leiterin das Regenbogentuch an einem Ast, wo es sich im Wind verdreht. Ich stelle mich mit dem Neugeborenen davor und es schaut zu, wie die Farben sich entfalten. Beim morgendlichen Begrüßungslied singen wir ein Hallo für die Babys.
Bald beginnt die regnerische Jahreszeit. Die Bäume sind immer noch sattgrün, aber dann fällt das erste Laub. Das Licht im Wäldchen hat einen bestimmten, ins Bräunliche kippenden Gelbton. Wir ziehen unseren Kindern warme Einteiler an, wasserdichte Hosen mit Hosenträgern und die Gummistiefel, auf die sie so stolz sind und deren bunte Farben beim Stampfen durch die Pfützen ununterscheidbar werden. Die Stiefel meiner Großen sind strahlend blau, passend zum Futter ihrer Regenjacke. Als ich diesen Text schreibe, knapp ein Jahr später, ist sie aus den Stücken natürlich schon herausgewachsen. In Regenkleidung hockt sie am Stamm der Linde und formt vorsichtig Matschkuchen. Sie zerdrückt sie mit den Händen, rührt mit einem Löffel im Schlamm. Ich lungere in der Nähe herum, schaue zu und versuche, sie zu stärken, indem ich ihr Freiraum gebe. Am liebsten würde sie die ganze Zeit nur im Matsch spielen, und ich könnte ihr die ganze Zeit dabei zuschauen; das Zuschauen ist wie ein Balsam, von dem ich gar nicht wusste, dass ich ihn benötige. Das ist es, was ich meiner Tochter jetzt geben kann: die Erlaubnis, sich von Kopf bis Fuß mit Matsch einzuschmieren, ohne sich dafür schämen zu müssen. (Aber nicht die Maske, die Maske soll sauber und trocken bleiben.) Mit meinem Handy filme ich, wie sie einen schlammigen Schwamm in die Metallschüssel tunkt und dann den Lindenstamm damit abtupft. Sie in ihrer absoluten Versunkenheit zu beobachten ist tröstlich. Sie liebt es, durch Pfützen zu springen, sich nass zu machen, andere anzuspritzen, so fest wie möglich mit dem Fuß aufzustampfen. Sie liebt es, sich mitten in einer riesigen Schlammpfütze hinzusetzen, selbst wenn sie dafür mit durchnässter Kleidung bezahlt. Hinterher reinige ich das Regenzeug und die Spielsachen unter einer der Wasserpumpen des Parks. Ich versuche, dabei nicht nass zu werden; ich selbst besitze keine passende Kleidung.
An so heftigen Regen kann ich mich nicht erinnern, nicht während der zehn Jahre, die ich nun hier lebe. Ich kenne den Grund und ich weiß, es wird noch schlimmer, der Meeresspiegel wird weiter steigen. Nach heftigen Niederschlägen verwandelt sich der Weg durch den Wald in einen Bach, den wir watend durchqueren müssen. Die Kinder mit ihren Masken und Regenanzügen springen juchzend im dreckigen Wasser herum, während wir Erwachsenen aus einigem Abstand zuschauen. Meine Tochter ist das Kind in der grün-braunen Regenhose, wie immer im Zentrum des Geschehens; ekstatisch springt sie auf und ab.
Räume des Lichts
Wir wohnen im Erdgeschoss eines alten, ursprünglich einmal schieferblauen Hauses zur Miete. Die ehemals weißen Fensterrahmen sind verwittert, die Haustür ist backsteinrot. Wir leben seit fast einem Jahrzehnt hier. Nun sind wir zu viert, plus der Hund. Wir halten uns hauptsächlich im offenen Wohnzimmer auf, wobei man hier kaum noch von offen sprechen kann – überall stehen Stühle und Tische und hinter dem Sofa ein Bücherregal, weitere Bücher liegen auf dem steinernen Sims gleich neben der Garderobe, vor der wir beim Hereinkommen unsere Taschen fallen lassen. Die Mäntel stehen als Masse von der Wand ab. Mein ans Fenster gerückter Schreibtisch wird nur selten benutzt, morgens dringt schwaches Winterlicht durch die transparenten Vorhänge. Der Vorhangsaum ist zerschlissen, weil der Hund an dieser Stelle herumspringt und wie besinnungslos Postboten und Kurierfahrer anbellt. Oft sitze ich auf dem Sofa im Wohnzimmer, weil ich dem Morgenlicht näher sein will, und meinen spielenden Kindern; wir hocken im Chaos beisammen.
An den Wochentagen unterrichten wir abwechselnd von zu Hause. Das eine oder das andere unserer Gesichter in einer Kachel, im Hintergrund ist das halbdunkle Zimmer zu erahnen, während wir auf dem Monitor Kacheln mit anderen Gesichtern und anderen Zimmern sehen. Meine Augen schmerzen, weil ich den ganzen Tag am Computer sitze. Wenn ich höre, dass das Baby mich braucht, mache ich eine Pause, etwa ein Mal pro Stunde. Mit »brauchen« meine ich ihren markerschütternden Hungerschrei. Während des Unterrichtens und der Online-Meetings mit Studierenden höre ich das Baby ständig nach mir schreien, egal, wie wir uns in der Wohnung verteilen, selbst wenn John sich mit den Kindern ins Schlafzimmer zurückzieht oder in das Zimmer meiner älteren Tochter, das früher mein Arbeitszimmer war.
Weil ich bereits wenige Wochen nach der Entbindung wieder arbeite, richten wir mir auf dem Sofa ein Lager ein. Die Vorlesungen finden neuerdings online statt; ich gebe sie aus einem Bollwerk aus Kissen und sitze dabei auf einem Handtuch, das wir über das vom Hund in den Sofabezug gekratzte Loch gebreitet haben. Wir geben unser Bestes und richten das Licht so aus, dass sich auf meinem Gesicht keine harten Schatten abzeichnen und der Rest des Zimmers im Dunkeln liegt. Jetzt schon kann ich die Arbeitsüberlastung als körperlichen Druck spüren, und an besonders anstrengenden Tagen, sprich an den meisten, sehe ich sie als Blut in der Toilette. Um ein neues Sofa bezahlen zu können, sage ich eine Vertretung zu und arbeite im November eine Woche lang jeden Abend. Hinterher werde ich den ganzen Tag auf diesem neuen Sofa liegen, abgesehen von den Stunden, in denen ich beim Unterrichten am Schreibtisch sitze oder das Baby stille oder versuche, etwas zu lesen oder Vorlesungen am Laptop vorzubereiten. Manchmal schreibe ich Tagebuch, während das Baby auf mir schläft; ich verwende die wenige Zeit, die mir bleibt, um die täglichen, flüchtigen Eindrücke aus jenem Herbst und Winter festzuhalten.
Als das Sofa endlich geliefert wird, im Januar und in Teilen, die wir selbst zusammenmontieren müssen, erweist es sich als härter und unbequemer als gedacht. Es sieht eher gewöhnlich aus, aber nun, da das Zimmer den visuellen Hintergrund unseres pausenlosen Arbeitens bildet, wirkt es immerhin vorzeigbar. Außerhalb des Bildausschnitts: Bauklötze, Spielzeug, Puppen, die verdreckten Läufer, gewaschene Kleidung auf dem Esstisch, die gefaltet werden muss, Pakete, die soeben zugestellt wurden oder demnächst abgeschickt werden müssen, Hundespielsachen, ein Stapel Windeln, das weinende Baby, der bellende Hund, die Vierjährige, die Aufmerksamkeit verlangt.
In diesem Semester unterrichte ich ein Graduiertenseminar zum Thema Zeit. Die einzige Gelegenheit, bei der ich dazu komme, für den Unterricht zu lesen, ist nachts; ich sitze da, halte das Baby auf dem Schoß und warte darauf, dass seine Arme erschlaffen und ich es ins Bettchen zurücklegen kann. Ich schalte die Taschenlampe meines Handys ein und werfe einen Blick aufs Thermometer. In den meisten Nächten wache ich in durchgeschwitzten Laken auf. Die Heizkörper zischen und laufen den ganzen November pausenlos durch, nur um dann am Winteranfang auszufallen. Ich wache auf, nehme das Baby hoch, schaue auf die Uhr, rechne nach, wie viele Stunden es geschlafen hat, kontrolliere das Thermometer, lege das Kind an beiden Seiten an in der Hoffnung, dass es wach genug zum Trinken ist, greife nach dem schweren Wasserglas, um selbst etwas zu trinken und den Flüssigkeitsverlust auszugleichen, und muss mich zusammenreißen, um das Glas nicht auf seinen Kopf fallen zu lassen. Ich stille das Baby, wann immer es aufwacht, wann immer es weint. Das leuchtende Handydisplay wirft Schatten an die Wand, ich sehe aus wie ein Berg oder wie ein Gespenst. Am Ende des Semesters bin ich durchsichtig vor Erschöpfung.
Anfang Dezember lese ich mitten in der Nacht und mit um den Hals gehängter Leselampe Yūko Tsushimas Roman Räume des Lichts. Es geht darin um eine Mutter, die ihre Tochter im Japan der 1970er allein großzieht. Die schimmernden Pastelltöne des Covers der englischen Übersetzung haben mich angezogen, rosa und hellblau. Während einer kurzen Phase wache ich jeden Morgen – genau genommen ist es noch Nacht – um vier, halb fünf oder spätestens um fünf Uhr auf, lasse meinen Partner weiterschlafen und gehe mit dem Baby nach nebenan, weil ich weiß, dass es trinken will. Die frühe Stunde euphorisiert mich, ich lese den Roman weiter. Aber irgendwann führt mich der angestaute Schlafmangel an eine Grenze, ich bin vor Müdigkeit wie gelähmt und kann nicht mehr lesen. Tsushima veröffentlichte ihren Text ursprünglich als Fortsetzungsroman in einer Zeitschrift. Anscheinend ist für mich nun die Zeit gekommen, dieses Werk über den Taumel der frühen Mutterschaft zu lesen, über Verausgabung, Verzweiflung und die kleinen Freuden, über Licht und Dunkel. Ich werde in Tsushimas traumgleiche Welt hineingezogen, die nur aus Stille, innerer Einkehr und Einsamkeit besteht. Ich interessiere mich dafür, wie der Text die Jahreszeiten einfängt und anordnet. Wie wir uns in der Zeit voranbewegen.
Obwohl John zu Hause ist und sich einbringt, vor allem mit der Großen, habe ich mich niemals einsamer gefühlt als in jenen frühen Morgenstunden, in jenem ersten Jahr mit dem Baby. Ich bin diejenige, die von seinem Weinen geweckt wird. Diejenige, von der es sich am schnellsten beruhigen lässt. Mit dem Kind und dem Roman begegne ich der Nacht.
Die lange Wiese
In dem Herbst laufen wir jeden Freitag zur anderen Wiese im Prospect Park, der fast zwei Kilometer langen Long Meadow, wo wir uns mit einer Freundin treffen. Ihr Sohn ist im selben Alter wie meine Tochter, vor der Pandemie haben die Kinder dieselbe Spielgruppe besucht. Freitags habe ich frei, nur während meiner Sprechstunde am späten Nachmittag telefoniere ich mit meinen Studierenden. Eigentlich telefoniere ich fast täglich mit ihnen, und oft lege ich dabei das Kind an, um Ruhe zu haben. Ich erkundige mich, wie es ihnen geht, wie sie ihre Zeit verbringen, ich bemühe mich, Hoffnung und Optimismus zu verbreiten, wenigstens im Hinblick auf ihr Leben und ihre Zukunft. Die meisten sind in ihrem alten Kinderzimmer gestrandet, viele erleben den Rückschritt als großes Unglück. Ich rate ihnen, nach draußen zu gehen. Es ist eine ernst gemeinte Aufgabe; das Seminar widmet sich dem Nature Writing, genauer gesagt jenem Schreiben, das fragt: Wie können wir angesichts des bedrohlichen Klimawandels schreiben? Wie können wir das Kleine ebenso berücksichtigen wie das Kosmische? Ich für meinen Teil versuche immer noch, Trost im städtischen Idyll zu finden, im Prospect Park.
Meistens fahren wir mit dem Auto zum Park. Das Baby schreit die gesamte Strecke, weil es Autofahren hasst. Es ist ein fröhliches Baby, außer im Auto, wo es sich eingepfercht fühlt. In jenen ersten Monaten dauert es ewig, bis wir fertig sind, oft streiten wir Erwachsenen uns vor dem Hinausgehen, ich übernehme immer die Versammlungsleitung, versuche den Zeitplan einzuhalten. Es sind zwangsläufig wir beide plus unsere zwei Kinder; wir haben noch nicht herausgefunden, wie sich etwas delegieren oder der Ausflug allein bewerkstelligen ließe. Gleichzeitig haben wir trotz des ausufernden Chaos das Bedürfnis, ständig zusammen zu sein, außerdem wird von einer Mutter erwartet, dass sie dauerpräsent ist. In letzter Zeit nimmt das Gezanke überhand, aber immerhin schaffen wir es, trotz des Schlafmangels in Vollzeit an unterschiedlichen Institutionen zu unterrichten, ganz ohne Elternzeit.
Anfangs wird das Baby nachts alle drei Stunden wach, dann alle zwei Stunden, irgendwann landen wir bei einer Stunde oder fünfundvierzig Minuten; ich messe die Zeit nicht mehr. Es fühlt sich an wie Folter. Oft schicke ich John zum Schlafen aufs Sofa; er ist ohnehin nur schwer dazu zu bewegen, aufzustehen, das Baby aus dem Bettchen zu nehmen und mir zu bringen. Das Problem: Wenn ich mich aufrappele und während der nächtlichen Stillsession aufs Handy schaue oder gar zu lesen anfange, bin ich irgendwann so voller Adrenalin, dass an Einschlafen nicht mehr zu denken ist. Selbst wenn das Baby sich wieder beruhigt, liege ich stundenlang mit geschlossenen Augen da. Niemand interessiert sich für mein Schlafdefizit, kein Mensch fragt danach, es sei denn, er ist selbst betroffen. Erst später wird uns klar, wie schwarz-weiß unser Denken gerät, wenn der Schlafmangel es zermalmt und dekonstruiert; während ich aufgrund von Kleinigkeiten einen häuslichen Krieg anzettele, meistens kurz vorm Hinausgehen, macht er komplett dicht. Wo ist die Babymütze mit den Ohrenklappen, wo sind die Socken, diese verdammten Socken? Warum mahlst du schon wieder Kaffee, obwohl wir die Handschuhe noch nicht gefunden haben, nein, nicht die, die gelben. Wir sagen 14 Uhr, aber wenn wir im Park ankommen, ist es meistens schon drei und das Baby schläft im Tragetuch an meiner Brust. In jenen ersten Monaten kommen wir ständig zu spät. Wir kommen niemals nicht zu spät.
Der erste Freitag im Dezember, an dem wir meine Freundin und ihren Sohn auf der langen Wiese treffen wollen, ist grau, leicht regnerisch und friedlich. Wir gönnen uns Kaffee und eine Packung Kekse von einem italienischen Laden, den wir seit dem Lockdown nicht mehr besucht haben. Als wir den Park erreichen, fühlen wir uns wohl und voller Hoffnung; so ist es immer, am Ende finden wir zur Harmonie zurück. Normalerweise haben wir nach einer Weile vergessen, worüber wir überhaupt gestritten haben. Ich trinke zu viel Kaffee, obwohl ich ständig dehydriert bin und es nicht mehr genug öffentliche Toiletten gibt. Die Kinder sitzen auf einer Bank und essen die Kekse, sie bieten uns ebenfalls welche an und sind entzückt von der Mission. Wir nehmen das Gebäck mit dicken Handschuhfingern entgegen, fast erscheint es zu riskant, auf diese Weise sein Essen zu teilen. Unsere Freundin steht ein paar Schritte abseits und zieht sich die Maske herunter. Wir sitzen neben den Kindern auf der Bank und empfangen ihre Gaben.
Unserer Freundin einen Kaffee mitzubringen, fühlt sich gut an. Sie ist den ganzen Tag mit ihrem Sohn allein, weil ihr Mann immer noch draußen in der Welt arbeiten geht, und selbst an seinen freien Tagen lässt er sich zu Hause kaum blicken. Sie schiebt ihr Kind den knapp zwei Kilometer langen Weg von ihrem Zuhause zum Park im Buggy. Wir entdecken sie immer zuerst, am anderen Ende der Wiese im grauen Niesellicht – ihre leuchtend blaue Strickmütze, die neongelbe ihres Sohnes. Irgendwann will er mit dem Roller in den Park fahren, sie muss ihn ziehen. Wie üblich berichtet sie von ihrer sogenannten Müttergruppe, die sich nun online trifft, und was sie dort über gute Kommunikation mit ihrem Sohn gelernt hat. Er neigt zu Wutausbrüchen, ganz normal in dem Alter, in diesen Zeiten vielleicht umso mehr. Sie erzählt mir noch einmal von einer Übung, bei der sie fünf Minuten lang völlig präsent sein und alles tun muss, was er verlangt. Wenn sie das erzählt, fühle ich mich schuldig, denn obwohl ich immer mit meiner Tochter zusammen bin, lege ich mich fast nie zu ihr auf den Boden, sondern schaue lieber aus einigem Abstand zu, vom Sofa aus. Erst einen Tag zuvor war meine Tochter auf dem Sofa auf und ab gehopst, während ich das Baby stillen wollte. Sie hörte nicht auf, obwohl ich sie darum bat. Zuletzt beschimpfte ich sie, auch wenn ich mich sofort dafür entschuldigte. Meine Freundin und ich sind sehr nachsichtig miteinander, was unsere Ungeduld mit den Kindern und ihren Wutanfällen betrifft, obwohl ich gestehen muss, dass mich die Ausbrüche fremder Kinder ermüden. Die ihres Sohnes ereignen sich häufig. Absolut hemmungslos wirft er sich auf meine Tochter. Nicht das Gesicht!, rufe ich erschöpft und meine es nur halb im Scherz.
Wir kamen direkt von der Impfung für Vierjährige. Ich war mit meiner Großen hineingegangen, weil wegen der neuen Vorsichtsmaßnahmen nur ein Elternteil gestattet war. Wie klein sie auf meinem Schoß plötzlich wirkte, so ohne das Baby. Zuerst bekam ihre Puppe eine Spritze, dann ein Pflaster in Himbeerrosa. Die Ärztin, die selbst kleine Kinder hat, wollte wissen, ob meine Tochter bereits Gesichter male. Die Frage überraschte mich, denn meine Tochter hatte tatsächlich in der Woche angefangen, Gesichter zu malen. Die erste Zeichnung liegt immer noch auf einem Tischchen neben dem Sofa: ovaler Körper, zwei Arme, zwei Beine, Augenbrauen, über dem Bauchnabel ein gepunkteter Mund – ein Kartoffelmännchen. Das bin ich, sagte sie. Wir anderen waren nur kopfstehende Flecken am Seitenrand. Gelber Textmarker, lila Textmarker, roter Buntstift; hektische Zeichnungen, schön in ihrer Chaotik.
Ich erzähle meiner Freundin davon, als wir auf der Bank sitzen und Kekse essen. Von einem solchen Meilenstein zu berichten, fühlt sich falsch an, alles wird so kompetitiv, vor allem hier. Ihr Sohn malt noch keine Gesichter. Er wird jeden Tag damit anfangen, versichere ich ihr, das hat die Ärztin gesagt. Meiner Freundin scheint es egal zu sein. Sie ist eher bodenständig, typisch Maine, falls das Sinn ergibt. Ich weiß nicht, wie gut wir befreundet sind. Es gibt da eine bestimmte Kategorie von Mütterfreundinnen, die ich im Park für Playdates treffe und deren Namen ich erst nach denen ihrer Kinder erfahren habe. Aber wir beide unterstützen einander wirklich. Wenn ihr Arbeitgeber anruft, übernehmen wir ihren Sohn. Wir überqueren die Wiese und gehen zum Picknickhaus, wo die Toiletten sind, wobei meine schlanke, agile Freundin lieber in den Wald pinkelt. Ich pinkele nie in den Wald, denn ich habe eine Postpartumvagina und würde mich selbst anpinkeln, außerdem trage ich meistens einen Jumpsuit. Als ich hineingehe, erinnert meine Freundin mich daran, sofort nach Betätigung der Spülung wieder herauszukommen. Sie selbst geht mit einer zusätzlichen Maske hinein, FFP2, ich sehe sie zum ersten Mal.
Als ich herauskomme, sehe ich, wie unsere Kinder sich in der Ferne prügeln. Es ist nicht untypisch für sie, wobei ihr Sohn meistens derjenige ist, der anfängt, beispielsweise wenn er sich darüber aufregt, dass der T-Rex auch der Lieblingsdinosaurier meiner Tochter ist oder dass sie dort steht, wo sie nicht stehen soll. Der Junge weint jetzt, seine Mutter hat ihn hochgenommen und trägt ihn weg. Meine Tochter hat ihm um ein Haar einen Zweig ins Auge gerammt, aus Versehen, wie ich glaube, und so ist es nun an mir, mich zu entschuldigen. Zum Glück hat er keinen körperlichen Schaden erlitten; nur seine Gefühle sind verletzt. Wir dirigieren die Kinder zu einem großen Baum, wo irgendwelche Schulkinder eine Art Fort aus Ästen gebaut haben, in diesem Jahr kein ungewöhnlicher Anblick im Park. Die Kinder kriechen hinein, zeichnen mit Stöcken Muster auf den Boden. Es ist ein Vergnügen, die wilden Wesen in ihrem Unterschlupf zu sehen. Eben wollten sie einander noch umbringen, sagt John, aber jetzt sind sie solidarisch. Ich wünsche mir, dass sie so lange wie möglich dort in der kahlen Schönheit des Forts hocken bleiben. Aber irgendwann müssen wir zurück, durch gelbe Blätter und Dezemberlicht.
Jahreszeiten
Einen Tag später fahren wir zum ersten Mal seit dem Lockdown für einen Galeriebesuch in die Stadt, eine Ausnahme, weil John Geburtstag hat. Der Regen ist eiskalt, wir tragen Masken. Bei einer Ausstellung mit neuen, während der Pandemie entstandenen Arbeiten von Etel Adnan bleiben meine Töchter und ich vor einem mehrteiligen Tableau der vier Jahreszeiten stehen. Schwarze Baumstriche mit farbigen Tupfen. Frühling in Rosa, Blau und Orange. Der Herbst ist braun und apricot. Ist der Winter ein gelber Himmel? Der Sommer ein blassgrüner Fleck?
Eine Frau, die sich die Bilder ebenfalls sehr aufmerksam angesehen hat, spricht mich an. Sie ist in Begleitung einer anderen Frau, anscheinend ihre erwachsene Tochter. Ich kann nicht aufhören, Ihr Baby anzusehen, sagt sie. Ich murmle etwas darüber, wie meine Tochter auf die Bilder reagiert, auf den elementaren Gebrauch von Formen und Farben, selbst dem Baby scheint es zu gefallen. Ich freue mich über den Austausch, aber hinterher werde ich paranoid: Habe ich uns einem Risiko ausgesetzt, indem ich in einem geschlossenen Raum mit einer Fremden gesprochen habe? Auch wenn wir beide Masken trugen? Erst hinterher wird John und mir bewusst, dass die Frau die Malerin Vija Celmins gewesen sein könnte, eine Vorstellung, die uns mit diebischer Freude erfüllt. Uns erfasst ein neuer Glaube daran, dass wir außerhalb unserer engen Wohnung Leute treffen können, wir können Kunst sehen und mit anderen Menschen darüber reden, draußen in der Welt.
Wenn wir draußen in der Welt sind, lächeln die meisten Leute das Baby an, und es lächelt zurück. Ich begreife, dass es ihnen Freude macht, draußen in der Öffentlichkeit in das unbedeckte Gesicht eines Babys zu schauen. Alle anderen Gesichter sind versteckt, auch das meiner Großen. Ich erzähle meiner Freundin nicht, dass meine Tochter mit dem Gesichtermalen so schnell wieder aufgehört, wie sie damit angefangen hat. Sie malt schon seit einer ganzen Zeit keine Gesichter mehr. Ich weiß nicht, ob es etwas zu bedeuten hat, und falls ja, was. Ich mache mir Sorgen, sie könnte keine Gesichter mehr malen, weil sie keine mehr sieht.
Als ich das schreibe, wacht das Baby auf meinem Schoß auf. Seine hübschen roten Wangen erinnern an die Kirschen auf den riesigen Gemälden von Cecily Brown, die wir an dem Tag gesehen haben. Die Kleine wirkt jetzt wie in ihrem Körper angekommen, weniger zerbrechlich. Ich krümme mich und schiebe ihr eine Brustwarze in den Mund, damit ich weiterdenken kann. Sie trinkt gierig, schläft wieder ein und stöhnt dabei ganz leise. Aus dem Augenwinkel beobachte ich meine Große. Sie trägt den Weihnachtspyjama, den meine Schwester ihr geschenkt hat, steht vor dem Spiegelschrank und singt voller Inbrunst eine zerstückelte Fassung von »The Hills Are Alive«. Ihre Fingerabdrücke auf dem Glas wird wochenlang niemand wegwischen. Heute fühlt sich die Erschöpfung an wie eine Glasur. Inzwischen nehme ich das Baby abends mit ins Bett, um ein bisschen mehr Schlaf zu bekommen, egal wie unterbrochen. Während es schläft, ruhen meine Finger an seinem Nacken, denn ich will mich vergewissern, dass es nicht friert. Die Heizung schaltet sich immer wieder ab. Der Vermieter lebt woanders und kümmert sich nicht darum. Ich krümme mich um die Kleine, um sie zu wärmen. Ich versuche abermals, Räume des Lichts zu lesen. Ich fange noch einmal beim ersten Kapitel an und lese wieder und wieder dieselbe Seite. Ich versuche zu verstehen, wie Tsushima das schafft – wie sie diese Leichtigkeit und auch diese Melancholie heraufbeschwört. Eine Stimmung heimeliger Furcht, wie ich meine – womöglich habe ich den Ausdruck irgendwo aufgeschnappt. Die Romane der japanischen Autorinnen, die ich in der Übersetzung lese, scheinen sich in diesem Punkt zu gleichen. Die befremdliche Kälte, der leicht surreale Kapitalismus, die prekären, austauschbaren Bürojobs, die Hierarchie des Häuslichen. Die Sehnsucht nach äußerlichen Anzeichen des Erfolgs, eine Hoffnung auf Verwandlung – wenn man auf eine Vollzeitstelle befördert wird oder in eine größere Wohnung umzieht –, die sich aber nie erfüllt. Und doch findet sich Wärme darin, daheim zu kochen, auf einer Bank zu sitzen oder mit den Kindern zusammen zu sein. Die Freuden des Alltäglichen, des Tagesablaufs, die Behaglichkeit der eigenen Lebensumstände. Vielleicht liegt es daran, dass die meisten von uns nichts anderes haben als das Kleine und Private. Das Baby ist so fröhlich. Nachts weiß ich manchmal nicht, ob ich schlafe, lese oder wach bin.
Glücklich, glücklich stampft meine Tochter zu ihren Magnetblöcken hinüber, die in einem Korb am Fenster liegen. Sie nimmt sie auseinander, baut etwas Neues. Wir bedeuten ihr, leise zu sein. Das Baby auf meinem Schoß rührt sich. Sein kleiner Fuß zuckt. Es wird wach, schnappt nach mir. Ich kann es wieder beruhigen. Statt zu lesen, schaue ich zu, wie meine Tochter mit den neuen Blöcken spielt, ausgesucht und bezahlt von ihren fernen Großeltern, die sie seit über einem Jahr nicht gesehen hat und die nur selten anrufen. Zu Weihnachten werde ich ihnen ein weiteres Set abringen, zusammen mit einer Lichtbox, einem leuchtenden Quader, auf dem meine Tochter die transparenten Blöcke stapeln kann. Wie konzentriert und fleißig sie ist. Sie baut Häuser und zertrümmert sie mit einem befriedigenden Schlag. Wir nennen die Gebilde Schlaghäuser. Ich esse einen frischen Blaubeermuffin und nippe an meinem kalten Kaffee. Meine Tochter baut auf der Lichtbox, wieder und wieder. Irgendwann ist sie gelangweilt. Ich überblicke die Szenerie. Überall im Zimmer stehen Körbe herum, die ich letzten Herbst in einem Anfall von Ordnungswahn bestellt habe. Die Körbe passen unter das Bücherregal und meinen Schreibtisch; für die Blöcke brauchten wir unbedingt eine kleine Freifläche am Fenster, wo die durchsichtigen, schlampig gekürzten IKEA-Vorhänge wie schiefe Schleier herunterhängen. Zufrieden betrachte ich den hölzernen Regenbogen, den meine Tante ihr zum ersten Geburtstag geschenkt hat, und den Korb mit den Holzklötzen, der genau an der Stelle steht, wo die Morgensonne hereinkommt. Dort ist das Wohnzimmer, in dem wir unsere gesamte Zeit verbringen, am schönsten. Ich ignoriere die allgegenwärtigen Wollmäuse, die ich irgendwann zusammentreiben und auflesen muss, so regelmäßig, wie ich Kleider und Handtücher vom Boden auflese und den Tisch abräume. Ich habe sehr viel Zeit damit verbracht, diesen Teil der Wohnung zu gestalten. Ich habe Unmengen von Körben gekauft, Kartons und noch mehr Kartons voller Körbe kamen mit der Post, damit die Spielsachen am Boden aufbewahrt werden können oder in einem niedrigen, leicht zugänglichen Regal. Es war die Zeit des Nestbaus. Ich machte mich daran, sobald mir klar wurde, dass ich mein Kind in diesem Jahr daheim würde unterrichten müssen, was immer das für eine Drei- und später Vierjährige bedeutet; solange sie mit den richtigen Bauklötzen spielte, denselben wie in einem richtigen Kindergarten, würde vielleicht alles gut.
Der Roman, den ich gerade lese, beginnt mit der Beschreibung einer Wohnung mit umlaufender Fensterfront. Sie ist zu jeder Tageszeit lichtdurchflutet. Als die Erzählerin sich von ihrem Mann trennt, ist ihre Tochter drei, so alt wie meine Tochter zu Beginn der Pandemie. Als sie die Wohnung zum ersten Mal besichtigen, ist das Kind entzückt über so viel Licht. Die Mutter unterschreibt den Mietvertrag, um ihrer Tochter dieses Licht zu schenken, und um sie vor der aufziehenden Lebenskrise zu schützen. Die Erzählerin schildert die vielen Wohnungsbesichtigungen, die sie zuvor absolviert hat; als sie die neuen Räume beschreibt, schlägt sie einen anderen Ton an. Sie nennt die Zimmer Kammern, bemerkt die Einzelheiten des kleinen Bereichs, wo sie und ihre Tochter schlafen werden, unter einem nach Osten gehenden Fenster, wo Platz für zwei Tatamimatten ist. Sie verweilt beim roten Bodenbelag von Küche und Esszimmer, der zu leuchten beginnt, wenn die Sonne hereinscheint, und auf einmal fühle ich mich wie in einer Installation aus Licht, dem beschriebenen ebenso wie dem hellen Klang des Textes, der der Verzweiflung trotzt. Sie beschreibt den Alltag, das Voranschreiten der Jahreszeiten, aber alles wird durch ihr Schreiben transformiert, durch ihre ruhige Sprache und die Schönheit ihres Blicks. Die Sinnlichkeit und Selbstgenügsamkeit der Wohnung, von der aus sie auf Wäscheleinen blickt und auf die Dächer einiger Bürogebäude. Sie entdeckt alte Leute im Morgenmantel, deren Topfpflanzen ihnen den Garten ersetzen. Aus dem Badezimmerfenster sind der Bahnhof und Züge zu sehen. Das Bewusstsein für andere Räume, draußen und drinnen, für andere Narrative, die über die von uns bewohnte Blase hinausgehen. Sie erzählt von einem Leben in geschlossenen Räumen; die Tochter hat Fieber und kann nicht in die Krippe, die Mutter lernt Kinderlieder, um sie, wenn sie krank ist, zu unterhalten, und dann bricht die Zeit der Kirschblüte an und sie träumen davon, im Sommer eine Lichterkette auf die Dachterrasse zu hängen.