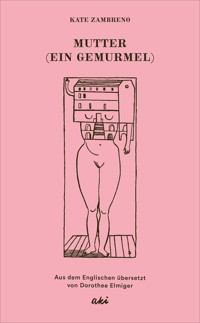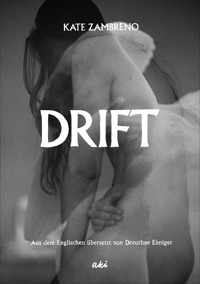
19,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: AKI Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Englisch
Drift erzählt von der Unmöglichkeit des Schreibens, vom Mysterium der Kreativität, von der Besessenheit, das Jetzt auf dem Papier einfangen zu wollen. Die Erzählerin arbeitet an einem längst überfälligen Roman, verbringt lange Tage zu Hause, streift mit ihrem ruhelosen Terrier Genet durch die Straßen der Nachbarschaft und korrespondiert mit Schriftstellerkolleginnen, die ihre Schreibkrise teilen, ihr aber dennoch nicht helfen können. Sie ist besessen von der Herausforderung, die Gegenwart zu schreiben, die Zeit selbst literarisch zu erfassen. Fasziniert von den Werken von Rainer Maria Rilke, Robert Walser oder Chantal Akerman spaziert sie, fotografiert die Bewohnenden und Streuner ihres Viertels und hält ihre Gedanken in einem gelben Notizbuch fest. Sie will schreiben, aber immer wird sie abgelenkt. Dann wird sie schwanger mit ihrem ersten Kind und dieser Zustand verleiht ihrem Denken und Schreiben plötzlich eine neue Dringlichkeit. Sie findet eine literarische Form für ihre intellektuellen Spaziergänge, eine Sprache, die beschreiben will, »was es heißt, in einem Körper herumzulaufen« und wie es gelingen könnte, die Textur eines Gefühls festzuhalten. Als ihre Tochter zur Welt kommt, beendet sie das Buch und gibt ihm den Titel Drift. »Was ist eine Drift? Vielleicht eine Art Form.«
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 310
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Kate Zambreno
Drift
Aus dem Englischen von Dorothee Elmiger
AKI
Für Sofia Samatar
Null. Null.
Man muss berücksichtigen, dass sie überwiegend mit Vorarbeiten beschäftigt waren: Skizzen, Notizen, Anmerkungen.
César Aira, Eine Episode im Leben des Reisemalers
ein scheinbar unfertiges Werk, schmal, Berichte von Unpässlichkeiten und Krankheiten, Bücher für Erkrankte, Tagebücher, Geflüster, Notizen
Aus den gelöschten Tweets von Sofia Samatar
ISkizzen von Tieren und Landschaften
Im Sommer 1907 denkt der Dichter Rainer Maria Rilke in einem Brief, den er aus Paris an seine Frau schickt, über drei Heidezweige nach, die in einer mit blauem Samt ausgekleideten Schreibschatulle vor ihm auf dem Tisch liegen. Seit Tagen bestaunt er die Pracht dieser Fragmente, die sie ihrem letzten Brief beigelegt hatte. Der Dichter erwähnt die unterschiedlichen Farben und Texturen der Zweige, ihr strahlendes, goldgeflecktes Grün, als wären sie mit violetter Seide in einen persischen Teppich gestickt, die komplizierten Herbstdüfte, die sie enthalten, eine Tiefe, Grabestiefe fast, und doch auch wieder Wind, Teer, Terpentin und Ceylontee, und auch harzig riechen sie, wie Räucherwerk. Zu diesem Zeitpunkt spielt sich seine Ehe fast nur noch in Briefform ab. Seine Frau, die Bildhauerin Clara Westhoff, ist nach Deutschland in ihr Bauernhaus zurückgekehrt und kümmert sich dort um ihre gemeinsame kleine Tochter Ruth. Die Zeit, die sie als nomadische Künstlerin zubrachte und Ateliers in Paris und Rom unterhielt, während Ruth in der Obhut der Großeltern auf dem Land verblieb, war nun vorbei. Rilke schreibt Clara, er schäme sich sehr, dass er in jenem gemeinsam verbrachten Jahr nach ihrer Hochzeit nicht glücklich gewesen sei, obwohl er damals durch ein Meer von Heidekraut hätte gehen können, und er zählt die Blumen des Stadtsommers auf – Dahlien und große Gladiolen und rote Geranien. Es sind diese Briefe, in denen er sich an einer Schreibweise versucht, die dem Wetter gleicht, das er schildert, Passagen, die er später für seinen Roman verwendet, an dem er fast zehn Jahre lang schreibt. Wie verschieden sind Sehen und Arbeiten, schreibt er an Clara. Es ist dieser Brief, in dem ihn die Betrachtung der Heide-Fragmente, jener Zweige, die ihm entgangen waren, als sie damals vor ihm in den Feldern wehten, zu einer Erkenntnis über die Unmöglichkeit des Tages und deren Bedeutung für das Schreiben führt: »So schlecht lebt man doch, weil man in die Gegenwart immer unfertig kommt, unfähig und zu allem zerstreut.«
Im Sommer 2015 hätte ich eigentlich an Drift arbeiten sollen, einem Buch, dessen Vertrag ich schon fast so lange hatte, wie ich in dieser Stadt lebte. Ich bewohnte das Erdgeschoss eines heruntergekommenen viktorianischen Hauses in einem von Bäumen gesäumten Viertel, so weit draußen, dass es sich fast schon um einen Vorort handelte. Der Titel des Buches war einem Gefühl entsprungen, und ich wollte mit diesem Gefühl schreibend umgehen. Vor allem wollte ich meine eigene Gegenwart, mein Präsens schreiben, aber das schien ganz unmöglich zu sein: Wie kann ein Absatz ein Tag sein, ein Tag ein Absatz werden? Es gelang mir nicht oft, ganz in diesem Raum zu existieren, nicht einmal in diesem Absatz, hier. Immer lenkte mich etwas ab.
Die Leute vom Verlag erklärten mir, was ich schriebe, sei ein Roman, aber ich selbst war mir nicht sicher. Ich verschwieg ihnen mein Verlangen nach einem schmalen Buch über Streifzüge, Tiere. Nach einem hauchdünnen Objekt, einem Gespenst, das glühte angesichts der Möglichkeit eines Buches und sich gleichzeitig davon lähmen ließ. Vielleicht schrieb ich an einem Roman im Sinne Robert Walsers, seine kleinen Formen wie Launen, Abschweifungen. »Für mich sind die Skizzen, die ich dann und wann hervorbringe, kleinere oder umfangreichere Romankapitel. Der Roman, woran ich weiter und weiter schreibe, bleibt immer derselbe und dürfte als ein mannigfaltig zerschnittenes oder zertrenntes Ich-Buch bezeichnet werden können.«
Was ist eine Drift? Vielleicht eine Art Form.
Seit einer Weile interessiere ich mich für das Schreiben, das dann geschieht, wenn man nicht schreibt. Mehrmals pro Tag tausche ich mich per E-Mail mit Anna aus, einer erfolgreicheren Schriftstellerin aus einer anderen Stadt. Beide haben wir die Verträge für unsere Romane vor etlichen Jahren unterzeichnet. Kunst ist Zeit, schreibt Anna, und der Roman ganz besonders – er muss langsam sein, er muss sich Zeit nehmen. Jenen ganzen Sommer lang versuche ich mich an der Zeit. Ich bemühe mich, die Tage nicht zerfließen zu lassen. Ich versuche, im Raum zu sein, außerhalb des Internets. Damals, im Sommer, beginne ich, neben meinen schwarzen Notizbüchern, in die ich täglich schreibe, und die sich wie Grabsteine reihenweise ansammeln, ein Notizheft zu führen, das ich mir als Drift-Heft denke, sein kanariengelber Umschlag passt zu meiner Ausgabe von Walsers Roman Geschwister Tanner, den ich in kleinen Abschnitten lese, zu allen Jahreszeiten, ohne je fertig zu werden.
Ich hebe nun den Kopf und sehe das erste dieser gelben Notizhefte auf dem kleinen Tisch am anderen Ende des Raumes liegen, auf einem Stapel mit anderen vollen und halb vollen Notizbüchern, mit Schreibblöcken, ausgedruckten Notizen, Manuskriptseiten, Fotografien. In das gelbe Notizheft hatte ich meine Adresse und meinen Namen geschrieben, meinen Nachnamen allerdings in leicht abgewandelter Version, was mir das Gefühl gegeben hatte, den Raum der Fiktion betreten zu haben. Das Heft war einem Buch namens Drift gewidmet, aber das war ein anderes Buch als jenes, das ich jetzt schreiben will. Die Notizen, die ich darin gemacht hatte, überraschten mich, als ich sie fand: Sie beschrieben Drift als Kriminalroman, als rätselhaften Mordfall vielleicht. Es klang nach einem Antonioni-Film. Die Suche nach etwas Verlorenem oder Verschwundenem, aber damals wusste ich noch nicht, wonach oder nach wem.
Ganze Sommer lang schaue ich zu, wie Genet, mein kleiner schwarzer Terrier, auf dem Teppich oder dem Holzboden immer wieder neue, dunkle Formen annimmt, den Mustern des Lichts folgend. Nervös streicht er durchs Büro, wartet bei der Tür, lässt sich schließlich für eine Weile auf dem künstlichen Schaffellteppich unter meinem Schreibtisch nieder. All die weichen Stellen, die ich überall im Haus für ihn einrichte. Im Büro kommt er nicht zur Ruhe, dort gibt es keine Tageslichtquelle, kein Fenster, aus dem er schauen könnte. Um überhaupt nachdenken zu können, muss ich ihn ignorieren, ihn und seinen Wunsch, gefüttert zu werden, zu spielen, seinen Versuch, mir einen Ball in die Hand zu drücken. Ich füttere ihn mit den getrockneten Mangoschnitzen, die ich selbst esse, damit ich auf etwas Ledrigem herumkauen kann. Kauen als Denken, Denken als Kauen. Morgens ein Kaffee nach dem anderen, wenn John Richtung Museum aufgebrochen ist, aber nicht zu viele Tassen, das ist der Trick, und das Frühstück nicht vergessen – Müsli, Joghurt und Früchte oder Toast um Toast. Daran denken, das Internet auszuschalten, das ist der Trick, und es dann auch ausgeschaltet zu lassen. Still zu sitzen. Genets Bellen, eine Ablenkung. Seine periodischen Ausbrüche angesichts potenzieller Eindringlinge. Sein Ruf-und-Antwort-Spiel mit Fritz, dem albernen, blonden Labradoodle, der nebenan aus dem Erdgeschossfenster des hellgelben, im Kolonialstil gebauten Hauses kläfft. Die plötzliche, psychotische Explosion des Briefschlitzes, das Herz meines Hundes hämmert in seiner kleinen, fassförmigen Brust. Ein tiefes Knurren, das immer lauter wird, während er durch das Haus schießt, schlingernd um die Ecken rast, mit kratzenden Krallen aufs Fenster zu, wo er wegen einer weiteren Postsendung für die Wohnung über uns noch einmal ausrastet. Sein sympathisches Nervensystem, dessen Nutznießerin ich bin. Die Paranoia, die Intensität, die auch mir selbst nicht fremd sind. Ich sehe den Postboten, der draußen vor dem Haus seine kleinen braunen Zigaretten raucht. Wir winken uns zu. Ich vermute, dass er sich jeweils eine anzündet, nachdem er hier war. Er hat mich schon oft in mehr oder weniger unbekleidetem Zustand erlebt, an Tagen, die ich auf der Couch und vor Bildschirmen verbringe. Wie oft ich meinen Posteingang wie ein Orakel mustere, wenn ich das Haus nicht verlasse, um mich so daran zu erinnern, dass ich noch existiere.
Der fragile Fritz. Nietzsches Spitzname. Ich habe ihn einmal zu streicheln versucht. Er mag keine anderen Hunde und nicht einmal andere Menschen – ein richtiger Einzelgänger. Ich muss auch an Marianne Fritz denken, die österreichische Schriftstellerin, die über ihren Zetteln saß, ohne aus dem Haus zu gehen, und unentwegt an ihrem dichten, zunehmend kryptischen Werk arbeitete. Nach wie vor treibt mich die Frage um, wer in der Literatur als Einsiedler oder Einsiedlerin verklärt wird, und wer ganz einfach als verrückt gilt, weil er oder sie nicht aus dem Haus geht. Der Irrsinn des Schreibens. Der Irrsinn des Nicht-Schreibens. Walser, der nicht nach Herisau ging, um zu schreiben, wie er sagte, sondern um irre zu sein.
Wirf deine Notizen weg, riet mir der männliche Schriftsteller, der noch nie etwas veröffentlicht hatte, zu einer Zeit, als ich tief in einer Sinnkrise steckte. Es war mein erster Sommer hier. Damals arbeitete ich an einem anderen Buch, sein Titel der Name eines Landes. So wie alle meine Vorhaben der vergangenen Jahre sollte sich jenes Buch mit literarischer Traurigkeit befassen. Aber alles, was ich hatte, waren meine Notizen. Fragmente dieses Buches existieren heute in schwebenden und verwundeten Zuständen, in Notizheften, auf Schreibblöcken, in Schachteln, als endlose Aufzeichnungen und als Dateien auf meinem Desktop. Der männliche Schriftsteller schickte mir die Notizen, die er in seinen ersten Studienjahren zu Nietzsche gemacht hatte – seine nervösen Randbemerkungen zählten die Philosophen auf, die ihr Leben lang unverheiratet geblieben waren. (Fast alle außer Hegel, stellte er fest.) Habe ich seinetwegen eine Faszination für ledige Schreiber entwickelt? (Robert Walser, Kafka, Nietzsche, Wittgenstein, Joseph Cornell, Fernando Pessoa und auch Rilke gaben vor, Junggesellen zu sein.) Er war noch keine 30 und verzweifelt, weil er noch keinen Roman veröffentlicht hatte. Wie der 28-jährige Kafka, der sich in seinen Tagebüchern mit zwiespältigen Gefühlen als 40-jähriger Junggeselle entwirft.
Ich bestehe aus Literatur, offenbart Kafka seiner zukünftigen Verlobten Felice in einem seiner ersten Briefe, und er erinnert sich an das Gespräch über Goethe, das sie führten, als sie sich im Wohnzimmer der Brods zum ersten Mal begegneten. Ich bin nichts anderes und kann nichts anderes sein.
Den ganzen Sommer über sitze ich im kaputten Adirondack-Stuhl auf der Veranda, existiere ganz in der Gegenwart, im Präsens, jenem tranceartigen Zustand des Sehens, so wie die Tiere. Mein Notizbuch auf dem Schoß, meine Bücher um mich herum verstreut. Das häufige Verlangen, nichts zu tun. Genet starrt mich an mit seinen Bernsteinaugen, ich starre zurück. Zwischen den Stapeln auf meinem Schreibtisch könnte ich irgendwo einen fleckigen, unvollständigen Ausdruck von Susan Sontags Essay »Die Ästhetik des Schweigens« ausgraben, der mir erklärt, dass Tiere nicht schauen, sondern starren. Ich ziehe am kleinen weißen Sontag-Mohawk meines Hundes, und er dreht sich auf den Rücken, damit ich seinen weichen rosa Bauch kraule, oder ich hebe ihn hoch, um sein kleines Affenmaul zu küssen. Auf der Veranda ist Genet ganz ruhig, die Sonne betäubt ihn, er steht auf und sinkt dann wieder zu Boden, wandert von einer hellen Stelle zur nächsten oder in den Schatten, wenn sein Fell überhitzt. Im Sommer starren wir zusammen auf den violetten Schmetterlingsflieder am Fuß der Stufen, während die Schmetterlinge träge durch die Gegend flattern. Aber dann, im Herbst schneidet der Hausbesitzer den Strauch zurück, und im Sommer danach blüht er überhaupt nicht mehr. Eine Zeile aus Sontags Tagebüchern, die ich mir immer wieder notiere: »Alle Kunst birgt in ihrem innersten Kern Kontemplation, eine dynamische Kontemplation.«
Ruhig, ruhig, sage ich zu Genet, wenn Hunde vorbeigehen, und er gehorcht mit einem leisen, aber bestimmten Wuff. Zusammen schauen wir zu, wie die Hunde durchs Viertel promenieren. Ich winke der nepalesischen Frau aus dem Mietshaus an der Ecke, die mit dem silbernen Pitbull mit den geschmeidigen Muskeln spazieren geht. Er war noch ein Welpe, als wir hier einzogen. Dann ist da die Yorkie-Hündin, die ein paar Häuser weiter auf ihrem Posten hoch oben in einem Gebäude ständig explodiert. Wie sensibel sie in Wahrheit sind, diese Stadthunde, aber sie merken es einander nicht an. Der eisäugige Schäferhund, ein schlaksiger, manischer Welpe, der einem älteren, muskulösen Fitnesscoach gehört, der immer kurze Hosen trägt und zusammen mit seiner Mutter, die im Rollstuhl sitzt, eines der Häuser in unserer Straße bewohnt. Jetzt, da ich dies schreibe, wird mir bewusst, dass der Schäferhund kein Welpe mehr ist, sondern ein ausgewachsener Hund, auch wenn er noch genauso zappelig ist wie früher. Ich frage mich oft, ob der Fitnesscoach mich für faul hält, wenn er sieht, wie ich mit dem Sonnenhut auf der Veranda sitze und zusammen mit Genet der Prozession durchs Viertel beiwohne. Aber ich arbeite, ich mache Notizen und denke nach. Nicht nur Faulheit also, so habe ich das für mich entschieden, sondern das, was Blanchot désœuvrement nennt – mal übersetzt als »Unwirksamkeit«, »Trägheit«, als »Untätigkeit«, mal als »Entwerkung« oder, mein Favorit, »Werklosigkeit«. Eine geistige, aktivere Haltung, die mit der décréation, der Rückschöpfung verwandt ist. Ein Zustand, in dem das Schreiben des Fragments an die Stelle des Werks tritt. Kafka, der nachts ein Notizbuch nach dem anderen füllt. Er sitzt im Wohnzimmer mit einer Decke über den Knien und muss den Käfig mit den Kanarienvögeln verhüllen, bis sie sich beruhigen, der Rest der Familie schläft. In seinen Notizbüchern beklagt er sich über die Fabrik, über Felice und seine Familie und später darüber, wie viel Zeit ihm seine erste Veröffentlichung, ein kleines Buch mit dem Titel Betrachtung, raubt, Zeit, die ihm nun für sein literarisches Schaffen fehlt. Obwohl er dann, als es darum geht, seine Texte endlich zu publizieren, panisch feststellt, wie klein der Ertrag all jener Stunden ist, die er nachts über seinen Notizbüchern und über den Fragmenten verbringt, die er hin und wieder in Zeitschriften veröffentlicht. Er klagt über die Künstlichkeit des Unterfangens, einen Text zur Veröffentlichung vorzubereiten, wo er doch eigentlich möchte, dass sich sein Werk ganz frei entfalten kann. Was er möchte, ist eine neue Schreibweise. Ich schicke Anna eine E-Mail mit der Frage, ob ich mein Buch in Anlehnung an Kafka Betrachtung nennen soll. Nein! Ihre Antwort nur ein Wort. Die Schreibkrisen anderer Leute sind mühsam. So mühsam wie die Listen mit Titeln, die sie mir schickt. Das alles ist, keine Frage, leidenschaftliche Prokrastination. In jenem Sommer hatten wir beide eine Deadline – jetzt ist dein Buch da, steht auf allen Bestenlisten. Ich bin noch immer hier.
Nur im Innern des Hauses kann man wirklich alleine sein, schreibt Marguerite Duras. Draußen, vor dem Haus, liegt ein Garten, vielleicht sind da Katzen und Vögel. »Im Haus aber ist man so allein, dass man manchmal davon irre wird.« Erst jetzt, schreibt Duras, werde ihr bewusst, dass sie sich seit zehn Jahren in diesem Haus befinde, in dem sie ihre Bücher geschrieben habe. Erst jetzt wird mir bewusst, dass ich seit sieben Jahren hier bin.
In Der Spaziergang lässt Walsers Erzähler seine Schreibblockade, sein Geisterzimmer hinter sich zurück und unternimmt einen pikaresken Spaziergang durch die Stadt und übers Land. Walser selbst legte in seinem abgetragenen Anzug 140 Kilometer zu Fuß zurück, um so nicht zu existieren, in der Landschaft zu verschwinden. Sein Gehen ist wie sein Schreiben Ausdruck seiner Versunkenheit. Ich will von der älteren Frau schreiben, die sich mir auf meinen Hundespaziergängen in schlaufenhafter Wiederholung zeigt. Sie muss über 90 sein und lebt alleine in dem großen, verfallenen gelbbraunen Haus an der Ecke – auf dem Dach splittern die hellbraunen Dachschindeln ab. Sie trägt ein Haarband in ihrem Silberbob, ein bisschen mädchenhaft, und über ihrem dünnen Körper Varianten des immer gleichen Outfits, meist eine blaue oder rosarote Bluse mit weißen Streifen und eine beige Männerhose mit einem Gürtel hoch um die Taille. Wenn das Wetter gut genug ist, sitzt sie oft in der Nähe des Pfeilers auf ihrer Verandatreppe und wendet ihr Gesicht der Sonne zu. Manchmal sitzt sie dort mit einer kleinen Katze, die vor einer Weile aufgetaucht ist, und starrt ins Leere. Diese Katze lebe draußen, sagt sie zu mir, aber sie habe auch eine Katze, die drinnen lebe. Ich winke ihr zu, manchmal winkt sie zurück. Später sehe ich dann, wie sie den Stuhl reinnimmt. Manchmal steht lange Zeit kein Stuhl draußen, und ich mache mir Sorgen um die Frau. Ich denke oft an sie, allein in diesem großen, gähnenden Haus. Vielleicht fährt sie irgendwohin, wo das Wetter besser ist. Vielleicht hat sie irgendwo Familie.
Zu gewissen Jahreszeiten sehe ich die alte Frau regelmäßig, meist auf meinen Morgenspaziergängen, wenn ich John, der zur Arbeit muss, zur Bahn begleite. Dann wieder vergeht ein ganzer Monat, ohne dass ich sie erspähe. Wenn wir uns begegnen und grüßen, wiederholt sie immer einen von wenigen Sätzen: Schöner Tag für einen Spaziergang. Oder: Schönes Hündchen. Manchmal sehe ich sie fern von ihrer Veranda und ihrem Garten, wie sie langsam die Straße runtergeht. Sie hat etwas von meiner Mutter, diese Frau, zumindest wenn ich mir vorstelle, dass meine Mutter auch so alt hätte werden dürfen. Vielleicht hat es damit zu tun, dass man meine Mutter auch oft in unserem Vorstadtgarten antraf, wo sie in Khakihose kauerte und jätete. Wenn ich mit der alten Frau spreche, dann tritt sie näher, weil sie, so meine Vermutung, kaum noch etwas hört – was auch ihre formelhaften Phrasen erklären würde –, und gewährt Einblick in einen mit Gold und verfaulten Zähnen gefüllten Mund. Schöner Tag für Gartenarbeit, sage ich, und sie hält sich an das Drehbuch: Die Leute meinen, ich habe kein Geld für einen Gärtner, sagt sie, aber mein Arzt sagt, das halte gesund. Ihre Sträucher sind dieses Jahr sehr schick, sage ich, obwohl sich das Gras braun färbt und vertrocknet, was ich aber nicht erwähne. Oft fragt sie mich nach dem Wochentag, und manchmal nenne ich ihn ihr, aber im Sommer, wenn die Tage immer stärker miteinander verschmelzen, weiß ich es manchmal selbst nicht, und da stehen wir dann einen Augenblick lang und haben keine Ahnung, an welchem Punkt der Woche wir uns befinden.
Wer sind die Figuren in deinem Roman, fragen mich die Leute vom Verlag, und passiert irgendetwas?
In einem Buch über Architektur lese ich, der Raum des Viertels, der Nachbarschaft sei der Raum der Kindheit. Und wenn ich mich zu Fuß oder auf dem Fahrrad durch das von Bäumen gesäumte Viertel bewege, das im Sommer einer Geisterstadt gleicht, dann habe auch ich das Gefühl, in meine Kindheit zurückzukehren. Im vergangenen Sommer erspähte ich auf einem Morgenspaziergang einen kleinen Hund, den ich auf einem der Suchplakate gesehen hatte, die andauernd von neuen überklebt werden, sobald sie verblassen oder kaputtgehen. Der Hund verschwand gerade hinter einem der leer stehenden und baufälligen viktorianischen Häuser, die bei Tag einen ruinösen Anschein machen. Danach fuhr ich wochenlang auf meinem Rad herum und hielt Ausschau nach dem kleinen weißen Geisterchihuahua, der sich so gefürchtet hatte, als wir uns näherten, umso mehr weil Genet beschlossen hatte, ebenfalls die Nerven zu verlieren. Ich machte mir Sorgen um den Hund, verschreckt und zitternd, ganz allein.
Zu Beginn, als wir gerade erst hergezogen waren, hatte ich die Blicke der verwilderten Katzen unheimlich gefunden. Ich begegnete ihnen in den Gassen und Einfahrten, zu zweit, zu dritt, Silhouetten oder Geister, die mich anstarrten und zurückwichen, wenn ich ihnen beim Versuch, sie zu fotografieren, zu nahe kam. In der 19. Straße hatte ein alter Mann eine große Katzenkolonie mit Futter versorgt. Sie versammelte sich immer vor seinem Haus, bis er irgendwann starb. Das Haus verwaiste, dann schaltete sich der Sohn ein, strich es neu und schrieb es zum Verkauf aus. Nun zählt es zu den neuen, frisch renovierten Villen, während so viele andere noch immer baufällig und unbewohnt sind. Die stattliche Veranda ist leer, es fehlen die eng gedrängten Gestalten der Katzen, die nicht mit der Wimper zucken. Wo sind sie hin?
Seit ich hier wohne, bin ich besessen von einer winzigen, getigerten Katze. Sie ist heimatlos und verschwindet manchmal für mehrere Monate am Stück. Ich nenne sie Waschbärkatze wegen ihres gestreiften Schwanzes und ihres Tigerfells. Im letzten Winter war ich mir ganz sicher, sie draußen vor dem Schlafzimmerfenster gehört zu haben, ein unheimlicher Schrei, der dem eines Wechselbalgs glich. Am nächsten Morgen zog ich die Stiefel an und stapfte durch den Schnee, um sie zu suchen. Dann, im Frühling sah ich sie auf einer Mülltonne in der Gasse thronen, sie wirkte überrascht, nagte an den Resten eines Pizzastücks herum. Ich begann, sie mit Sardinen und Katzenfutter zur Verandatreppe zu locken, obwohl Genet protestierte. Oft sauste sie davon, wenn ich ihr zu nahe kam. Aber manchmal ließ sie es zu, dass ich im Stuhl saß, während sie selbst unter der Bank hockte und fraß – jedes Mal empfand ich große Freude beim Anblick ihrer kleinen Zunge, die sich zeigte und wieder verschwand. Manchmal genügte es mir, ihr vom Fenster aus beim Fressen zuzusehen. Bald statteten auch andere streunende Katzen der Veranda regelmäßig Besuche ab, und ich fütterte auch sie, obwohl ich ihnen weniger zugetan war. In meinem Notizheft vermerkte ich jede Begegnung mit der Katze, ich zeichnete ihre Bewegungen auf. Das gab mir das Gefühl, an meinem Roman zu arbeiten, und so ging es mir auch, wenn ich meine Interaktionen mit der alten Frau festhielt. Aber die Katze verschwand immer wieder, und ich sorgte mich, bis ich sie Monate später wieder sah, als sie gerade mit wogendem Waschbärschwanz unter ein geparktes Auto rannte. Noch immer weigere ich mich, ihr einen Namen zu geben.
Als ich gerade erst hierhergezogen war, lehrte ich an einem Liberal Arts College und leitete dort ein Schreibseminar zum Thema »Fragment«. In jedem der drei fragmentarischen Romane, die wir behandelten, sorgt sich eine Erzählerin, deren psychische Verfassung sich nicht zuletzt ihrer Einsamkeit wegen zunehmend verschlechtert, um eine verschwundene Katze. In keinem der Bücher wird klar, ob es diese Katze tatsächlich gibt. Über diese unheimliche Wiederholung des gleichen Handlungsstrangs in verschiedenen Büchern sagte ich damals zu meinen Studierenden: Vielleicht ist das echte Einsamkeit. Man sorgt sich um eine verschwundene Katze, von der man nicht einmal weiß, ob es sie gibt. Alle schrieben sie in ihre Hefte, als ich das sagte, als hätte ich etwas Tiefgründiges gesagt.
Suzanne und ich versuchen uns ständig zu erreichen, wir senden uns kleine Botschaften, versuchen uns zum Chatten zu verabreden. Früher war es einfach: Wir hatten beide unsere Blogs und konnten dort lesen, wie sich die andere fühlte, die Tage erlebte. Auch heute noch sind wir uns dann am nächsten, wenn wir Texte voneinander lesen. Ich schreibe ihr von meinem Gefühl der Isolation, nun, da ich mich von den sozialen Medien abgemeldet habe. Es sei mir zunehmend schwergefallen, allein zu sein, schreibe ich ihr, obwohl ich doch das Alleinsein früher sehr gemocht hätte. Ich habe mich online in Fragmente zerstreut. Und trotzdem google ich mich noch immer ständig selbst. Es ist eine Krankheit. Suzanne liest auf mein Drängen hin May Sartons Journal of a Solitude. Eben erst hat sie, Suzanne, ihre eigene Wohnung bezogen und sich von ihrem Lyriker-Ehemann getrennt, der jetzt mit einer anderen Frau, schlimmer noch, mit einer anderen Autorin, noch schlimmer, mit einer Lyrikerin mit Doktortitel und Aussicht auf eine feste Professur etwas angefangen hat. Suzanne quält sich online, indem sie sich Fotos anschaut, auf denen die beiden bei literarischen Veranstaltungen zu sehen sind. Das nährt ihre Isolation zusätzlich: Der Verlust der Gemeinschaft, den die Trennung mit sich brachte. Alle sagen, es sei so gesund, Freunde zu haben, schreibt sie mir, aber manchmal habe ich das Gefühl, es isoliere mich nur noch mehr. Die Selbstverletzung durch die sozialen Medien – wir kennen es beide. Und doch können wir uns ihnen nicht entziehen, diesen Bildern und Erzählungen, die von Glück und Erfolg berichten, egal wie fiktiv sie sein mögen.
Zuletzt sah ich Suzanne damals im Mai, als sie wegen einer Veranstaltung zu ihrem Buch bei uns übernachtete. Es kamen nur eine Handvoll Leute zur Lesung – einige Bekannte von ihr, mein Lektor, zwei meiner Studierenden und die Person von der Buchhandlung, die ganz begeistert war. Ich hätte wohl für Publikum sorgen sollen. In jenem Sommer sind wir selten in Kontakt, aber wenn wir es sind, dann erzählt sie von ihrem Ex und seinem neuen Leben. Irgendwie müsse ihr dieser Zorn ja auch Genuss bereiten, schreibt sie, warum sonst könne sie sich nicht davon lösen, ihr vergangenes Leben loslassen? Jahrelang durchläuft sie Phasen des Zorns, der Verzweiflung und der Trauer angesichts ihrer Scheidung, und ich lasse sie diese Fragmente wiederholen, weil ich weiß, dass sie sie wiederholen muss. Damals, in jenem Sommer versuche ich es mit einem Scherz: Aber den Umgang mit Gefühlen sollte man sich nicht bei Elena Ferrante abgucken! Wie erschöpft ich nach ihrem Besuch bin, erschöpft davon, emotional verfügbar sein zu müssen, aber gleichzeitig möchte ich ja unbedingt Zeit mit ihr verbringen. Manchmal ist es unangenehm, einer anderen Frau so nah zu sein. Es zeigt sich mir in der Art, wie wir uns zurückziehen, uns innerlich reparieren müssen. Das ist Schreiben für uns. Dieser innere Raum.
Einmal, als ich mit dem Hund spazieren gehe, sehe ich zwei Post-its auf dem Gehsteig vor dem Haus. Es dauert eine Weile, bis ich merke, dass die Handschrift darauf meine eigene ist. Ich muss sie weggeschmissen haben, irgendwie sind sie dann auf der Straße gelandet. Ich habe die Zettel aufgehoben, zerknüllt liegen sie jetzt irgendwo auf meinem Schreibtisch:
Dringendes Bedürfnis zu kommunizieren
Dringendes Bedürfnis zu verschwinden (mich zurückzuziehen)
Die allerletzten Notizen des schwindsüchtigen Kafka, die er schrieb als er sterbend im Sanatorium lag: An die Krankenschwestern adressierte Gesprächsblätter. Schrift als Röntgenbild. Seine letzte Notiz lautete ungefähr: Zu glauben, dass ich einfach einen großen Schluck Wasser wagen könnte.
In jenem Sommer blute ich plötzlich so stark und lang, dass ich überzeugt bin, die Zeit der Perimenopause sei gekommen, obwohl ich erst 37 Jahre alt bin. Ich finde kein System, mit dem ich das Blut zuverlässig eindämmen kann. Eines Tages, als ich in ein Restaurant fliehe, um trotz der Hitze in mein Notizheft zu schreiben, hinterlasse ich einen Blutfleck auf dem hölzernen Gartenstuhl. So gut wie möglich versuche ich ihn zu entfernen, ich kippe Wasser darüber und sauge es mit Papierservietten auf, die Finger blutverschmiert. Am Ende schleiche ich aus dem Restaurant, ich meide den Augenkontakt mit dem routiniert freundlichen Personal und stehle mich schluchzend davon, nach Hause. Auf dem Klo blute ich große Klumpen, ihre Textur faszinierend, schwabbelig, ich untersuche sie mit den Fingern, während ich gleichzeitig all jene anrufe oder anschreibe, von denen ich weiß, dass sie eine Gebärmutter mittleren Alters haben. Meine Gynäkologin verordnet mir eine vaginale Untersuchung, um die Größe einer neuen Zyste bestimmen zu lassen, die an meinem Eierstock wächst. Sie verschreibt mir die Pille, die ich abgesetzt hatte, und ich werde davon so psychotisch, dass ich mir eines Tages ein Truthahn-Sandwich nach dem anderen zubereite, wie am Fließband, und sie alle esse, bis mir schlecht wird.
Ich soll zu einer Veranstaltung reisen, aber ich sage ab. Fast alles sage ich ab.
Unsere Reinigungskraft, die zweimal im Monat vorbeikommt, eine peruanische Großmutter namens Beatriz, zieht ihre Jogginghose auf der einen Seite herunter, um mir ihre Operationsnarben zu zeigen. Sie habe sich die Eierstöcke bei ihr daheim, in der Nähe von Lima, entfernen lassen, erzählt sie, dort sei es billiger gewesen. Daraufhin ziehe ich mein T-Shirt hoch und zeige ihr die Narben auf meinem Bauch. Oft fühle ich mich faul und ziemlich erbärmlich angesichts der Tatsache, dass eine andere Person das Haus putzt, während ich selbst zu Hause bin und manchmal auch gar nicht arbeite, sondern mir mit Kopfhörern etwas auf dem Laptop anschaue, weil ich nicht gut denken und arbeiten kann, wenn noch jemand im Haus ist und Geräusche macht. Sie putzt das Haus seit Jahren, hat lange vor unserem Einzug damit angefangen. Und doch mag ich es, wenn sie da ist. Ich bin froh um ihre Gesellschaft, eine Person, mit der ich Kaffee trinken kann. Ich gehe ihr nach, helfe ihr, die Möbel zu verrücken. Sie erinnert mich an die Familie meiner Großmutter, aus der auch viele putzen gingen, auch das Haus meiner Großmutter putzten sie, als sie selbst zu alt dafür war.
Nicht mehr fruchtbar zu sein – wie eigenartig. In einem gewissen Sinne wäre ich vor allem erleichtert, wenn man mir diese Entscheidung abgenommen hätte. Ich sehe Babys und weiß, dass auch ich eins wollen sollte. Aber John ist mehr oder weniger dagegen – Überbevölkerung, Klimawandel, Geld, unsere Kunst, unsere Leben, mögliche zukünftige Reisen – und ich war selbst nie entschieden genug dafür, dass ich ihn oder wenigstens mich selbst vom Gegenteil hätte überzeugen können. Vielleicht wenn wir älter sind und die Kunst machen, die wir machen wollen, sagen wir zueinander. Aber wir sind jetzt schon älter. Und so vieles habe ich bereits aufgegeben – den Versuch, mich für ein Promotionsstudium zu bewerben, um Chancen auf eine feste Anstellung zu haben, den Gedanken an ein Kind. Geblieben ist mir nur das prekäre Leben der Schriftstellerin.
Obwohl: Ich bin nicht sicher, ob ich je wirklich an meine Fruchtbarkeit geglaubt habe. Ich fand es merkwürdig, dass ich nie schwanger wurde, obwohl ich mich zwei Jahrzehnte lang, müde im Dunkeln liegend, davon hatte überzeugen lassen, dass es sich einfach viel besser anfühlte ohne Kondom, bitte, bitte. Ein*e Lyriker*in und Übersetzer*in erzählte mir mal, beim Anblick der eigenen Brüste unter der Dusche denke sie*er: Unmöglich, dass da je Milch rauskommt, physisch unmöglich. In einem gewissen Sinne habe ich das wohl selbst auch so empfunden. Und geglaubt, dass mein Körper dieser Empfindung absurderweise Folge leisten würde. Aber mein Körper hielt sich nie an meine Vorstellungen, wie er zu sein oder sich zu verhalten hatte.
Ich habe nie verstanden, warum David Markson seine Kate in Wittgensteins Mätresse ständig bluten lässt. Sollen wir etwa glauben, dass sie sich in den Wechseljahren befindet, als könne nur die phantastische Literatur von alternden weiblichen Körpern handeln? Vielleicht stellte er sich so den Körper einer Frau mittleren Alters vor, der sich nicht in Gesellschaft befindet – nackt und ohne Monatsbinden blutet er Klumpen ins Meer.
Seit ich hier wohnte, begann ich mich endlich langsam damit abzufinden, dass ich mich in eine alte Hexe verwandelte, also unsichtbar wurde. Mein gestreifter Hippie-Poncho, die behaarten Beine, der große Strohhut im Sommer. Vielleicht war die Hexe ja mit der Einsiedlerin verwandt – eine Berufung nicht ohne Anmut und Strenge.
Jetzt, da ich dies schreibe, fällt mir auf, dass ich meine Tage schon eine ganze Weile nicht mehr bekommen habe. Sie messen die Zeit nicht mehr für mich mit ihrem vernichtenden Schmerz, den Tagen, die im Bett verstreichen.
Den restlichen Sommer lang versuche ich, die Tage streng zu regeln, ein beinahe asketisches Leben zu führen. Zur Vermeidung von Stress, von Entzündungen – körperlich und gedanklich. Ganz rituell, fast abergläubisch will ich werden – morgens zwei Stunden ohne E-Mails, ohne mich selbst zu googeln, stattdessen Sport, Vorbereitungen fürs Mittagessen, zwei weitere Stunden am Nachmittag. Die Erinnerung am Badezimmerspiegel: Versuche, die ayurvedischen Rituale zu praktizieren. Ich mag es, wenn die Tage mir eine Struktur vorgeben. Nach dem Aufwachen sieben Mal blinzeln. Die Zunge sieben Mal schaben. Neti-Pot. Ich bewege Kokosnussöl im Mund, das wie Sperma schmeckt, und spucke es dann in den Müll, damit es nicht den Abfluss verstopft. Trockenbürsten. Ölmassage. Eine kurze Dusche. Wasser mit Zitrone vor dem Kaffee. Mittags Yoga. Oder mit dem Rad zum nahen College, um zu schwimmen. Supermarkt. Dann mache ich mir Mittagessen – gedünsteter Lachs, rote Quinoa, etwas Grünes. Meine Hände kalt vom Wasser, mit dem ich den Federkohl fürs Abendessen wasche. Dann noch einmal zur Arbeit zurück, wenn ich es schaffe. Es ist anstrengend, neben der ganzen Hausarbeit auch noch zu denken und zu schreiben. Nachmittags lasse ich mich oft auf die Couch und ins Internet sinken. Sowieso laugt es mich aus, wenn ich allzu produktiv bin, mich zu sehr verausgabe. Irgendwann fange ich an, jede Woche in die Gruppen-Akupunktur zu gehen, ich liege mitten im Yogastudio auf einem Liegestuhl und versuche, die geflüsterten Empfindlichkeiten anderer auszublenden, auf meinem Bauch eine Linie aus Nadeln, über mir eine Heizlampe.
Kafkas nackte Gymnastik am offenen Fenster, sogar im Winter. Im August schreibt er in einem Tagebucheintrag, dass er zwar den ganzen Sommer über kein Wort geschrieben habe, aber fast jeden Tag in der Zivilschwimmschule in Prag schwimmen gegangen sei. Endlich habe er die Verzweiflung über seinen Körper, seine Schwäche ein Stück weit überwunden.
Aber ist es nicht schwer, schreibt Anna, so gesund zu sein, ganz körperlich, während du dich zugleich in deinem Kopf aufhältst, in deinem Denken, in deiner ganz eigenen Welt? Hier die Welt des Körpers, die mit anderen geteilt wird, und da die Welt des Texts, des Rückzugs?
In letzter Zeit habe ich im Zusammenhang mit einer Erzählung, die ich gerne schreiben möchte, über Rilke nachgedacht. Seine Unfähigkeit, im Sommer zu arbeiten, ein Muster, das sich in den Briefen abzeichnet: Flucht aus dem Stadtsommer, Land versus Stadt. Rilke schreibt Lou Andreas-Salomé aus einem roten Gartenhaus bei Rom. Er ist Clara nachgereist, die dort ein eigenes Atelier hat. Rilke beschwert sich über das schwüle Klima, die leblose, museale Atmosphäre, die grässlichen deutschen Touristenhorden. Ständige Geldsorgen. Ein so großer Teil seiner Korrespondenz widmet sich der Aushandlung von Publikationsverträgen und Zahlungen, der Suche nach neuen Aufträgen. Rilke muss seinen Lebensunterhalt schreibend bestreiten. Sein nächster Aufenthalt, schreibt er, wird sich abhängig von seiner Arbeit entscheiden. Hier, in Italien, hat er die Idee zu seinem Roman, an dem er über sechs Jahre lang arbeiten wird – er denkt sich hinein in den hysterischen dänischen Adeligen, seinen Protagonisten, und kehrt noch einmal zu seiner ursprünglichen, verwirrenden Einsamkeit in Paris zurück. Er möchte, dass man ihm seine eigenen Briefe zurückschickt. Er plant Monographien, die er dann doch nie schreibt: Für eine über einen Dichter will er nach Kopenhagen reisen, eine zweite, die sich mit einem Maler befasst, macht eine Reise nach Spanien nötig. Er will Dänisch lernen, sein Russisch verbessern und noch mehr aus dem Französischen übersetzen. Er klagt über seine Klaustrophobie, die Nerven, Zahnschmerzen. Später, in Berlin, wo Clara ein weiteres Atelier bezogen hat, leidet er an einem erkrankten Zahn, das Zahnfleisch und sein Gesicht geschwollen. Die vielen Störungen, die jeder Tag mit sich bringt, die Geldsorgen, die Gerüche. All die Dinge, die seinen transzendenten Zustand gefährden. Er beginnt Ausschau zu halten nach einem abgeschiedenen Ort, wo die Winter gut sind. Eine Zuflucht in Capri. Es ist schwierig, mit seinem nomadischen Leben Schritt zu halten, auch damals schon – flieht er aus dem Raum, in dem er sich eben noch befand, oder bewegt er sich vorwärts auf den nächsten zu? In Rom sehnt er sich nach einem Hund, der ihm Gesellschaft leistet, aber er erlaubt sich keinen. Was, wenn er reisen möchte? Die Arbeit am Roman hat er aufgegeben.
Als Rilke Lou Andreas-Salomé kennenlernte, war er 26 und sie zehn Jahre älter. Sie war mit einem berühmten, älteren Gelehrten verheiratet, eine Ehe, die aber nie vollzogen wurde. Dem jungen René Maria fehle der Hinterkopf, schrieb sie in ihr Tagebuch: Alle Weisheit entfalle ihm gleich wieder. Sie gab ihm einen neuen Namen, einen richtigen deutschen Vornamen, unter dem man ihn später veröffentlichen würde. Sie brachte ihm eine kleinere, genauere Handschrift bei und kritisierte seinen Stil, den sie zu blumig fand. Sie hatte ihn, den Novizen allein nach Florenz geschickt und ihm aufgetragen, die Kunst, die er dort sah, in einem Tagebuch festzuhalten. Manche vermuten, sie habe sich auf diese Weise von ihrem alles verschlingenden und viel jüngeren Liebhaber, der zu heftigen Launen und Wutanfällen neigte, befreit, um sich so selbst Raum zum Nachdenken und Schreiben zu verschaffen. Einer der Biographen mutmaßt, die 38-Jährige habe Rilke damals weggeschickt, um eine Abtreibung vornehmen zu lassen.
Statt zu schlafen streite ich mit John. Unsere geteilte Misere. Sein ständiges Verlangen, aus der Stadt wegzuziehen, damit wir nicht das ganze Geld für die Miete ausgeben, damit er ein Atelier mieten kann. Du wirkst ja selbst auch nicht glücklich hier, sagt er. Manchmal bin ich nicht sicher, ob es überhaupt möglich ist, glücklich zu sein. Wenn ich nicht von der Couch hochkomme, an Tagen, die ich nicht strukturieren kann. Es sind die Sommer, die mich so lähmen. Den ganzen Tag über beklage ich mich via Chat bei John, der in der Bibliothek ist. Wie leer sich diese Stadt anfühlt. Wie groß die Distanz zu den anderen. Wir suchen neue Räume, aber was wir eigentlich suchen, ist Rückzug, Klarheit, ein Weg hinaus aus unserem inneren Chaos. Tage, die sich nicht anfühlen, als klebten sie alle aneinander.
In ihrem Tagebuch fragt May Sarton: Gibt es glückliche Kunst, muss sie stets depressiv sein? Die rosaroten Rosen, die sie am Schreibtisch studiert. Wie Rilkes Heidezweige. Nur wenn sie allein ist, so schreibt sie, kann sie die Blumen wirklich sehen, kann sie ihnen ihre Aufmerksamkeit schenken.
Anna schreibt mir, solange man mit jemandem zusammmenlebe, sei die Arbeit an einem Roman nicht möglich. Was man brauche, um zu schreiben, sei im Gegenteil die Möglichkeit, allein zu sein. Sobald ihr Freund zu Hause sei, werde ihr Raum, werde auch sie häuslich …
Eine Zeile aus dem krisenhaften Anfang der Aufzeichnungen des Malte Laurids Brigge: »Mein Gott, wenn etwas davon sich teilen ließe. Aber wäre es dann, wäre es dann? Nein, es ist nur um den Preis des Alleinseins.«
Rausfinden, was Rilke mit »es« meint.
Auf der ersten Seite von Ingeborg Bachmanns Malina die wahrste Zeile, die je über das Schreiben eines Romans verfasst wurde: »Heute