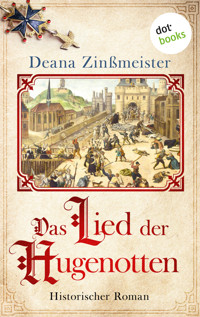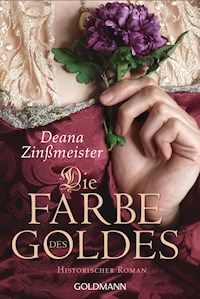6,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 2,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: dotbooks Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Muss sie den Tod einer Hexe sterben? Der fesselnde historische Roman »Der Hexenturm« von Deana Zinßmeister jetzt als eBook bei dotbooks. Sie verweigerte sich einem Mann – nun droht ihr der Scheiterhaufen ... Wellingen, in den Hessenlanden: Nach einer aufreibenden Flucht aus ihrer Heimat Thüringen hat die junge Katharina Unterschlupf und Arbeit auf einem Gestüt gefunden. Obwohl der hiesige Pferdehändler sie gerne bei sich aufnimmt, sind ihr und ihren Reisegefährten nicht alle im Ort wohlgesonnen: Katharina erfährt das schon bald am eigenen Leib, als sie den groben Annäherungsversuch eines der Knechte zurückweisen muss – und kurzerhand von ihm der Hexerei beschuldigt wird. Nur allzu bereitwillig glauben ihm die Dorfleute und sperren die junge Frau in den Hexenturm, wo ihr alsbald der Prozess gemacht werden soll. Ist ihr Leben verwirkt – oder können der Franziskanermönch Burghard und ihre anderen Freunde sie noch retten? »Deana Zinßmeisters Geschichten haben Erfolgsgarantie.« Bild Jetzt als eBook kaufen und genießen: Der authentische historische Roman »Der Hexenturm« von Bestsellerautorin Deana Zinßmeister ist der zweite Band ihrer Hexentrilogie, die Fans von Doris Röckle und Astrid Fritzsch begeistern wird. Wer liest, hat mehr vom Leben: dotbooks – der eBook-Verlag.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 583
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Über dieses Buch:
Sie verweigerte sich einem Mann – nun droht ihr der Scheiterhaufen ... Wellingen, im Land an der Saar: Nach einer aufreibenden Flucht aus ihrer Heimat Thüringen hat die junge Katharina Unterschlupf und Arbeit auf einem Gestüt gefunden. Obwohl der hiesige Pferdehändler sie gerne bei sich aufnimmt, sind ihr und ihren Reisegefährten nicht alle im Ort wohlgesonnen: Katharina erfährt das schon bald am eigenen Leib, als sie den groben Annäherungsversuch eines der Knechte zurückweisen muss – und kurzerhand von ihm der Hexerei beschuldigt wird. Nur allzu bereitwillig glauben ihm die Dorfleute und sperren die junge Frau in den Hexenturm, wo ihr alsbald der Prozess gemacht werden soll. Ist ihr Leben verwirkt – oder können der Franziskanermönch Burghard und ihre anderen Freunde sie noch retten?
Über die Autorin:
Deana Zinßmeister widmet sich seit einigen Jahren ganz dem Schreiben historischer Romane. Bei ihren Recherchen wird sie von führenden Fachleuten unterstützt, und für ihren Bestseller »Das Hexenmal« ist sie sogar den Fluchtweg ihrer Protagonisten selbst abgewandert. Die Autorin lebt mit ihrem Mann und zwei Kindern im Saarland.
Die Website der Autorin: www.deana-zinssmeister.de
Bei dotbooks veröffentlichte die Autorin »Der Duft der Erinnerung«, »Fliegen wie ein Vogel«, die Pesttrilogie mit den Romanen »Das Pestzeichen«, »Der Pestreiter« und »Das Pestdorf« sowie die Hexentrilogie mit den Romanen »Das Hexenmal«, »Der Hexenturm« und »Der Hexenschwur«.
***
eBook-Neuausgabe März 2024
Copyright © der Originalausgabe 2010 by Deana Zinßmeister
Copyright © der Neuausgabe 2024 dotbooks GmbH, München
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlages wiedergegeben werden.
Titelbildgestaltung: Wildes Blut – Atelier für Gestaltung Stephanie Weischer unter Verwendung mehrerer Bildmotive von © shutterstock
eBook-Herstellung: Open Publishing GmbH (mm)
ISBN 978-3-98952-064-6
***
Liebe Leserin, lieber Leser, wir freuen uns, dass Sie sich für dieses eBook entschieden haben. Bitte beachten Sie, dass Sie damit gemäß § 31 des Urheberrechtsgesetzes ausschließlich ein Leserecht erworben haben: Sie dürfen dieses eBook – anders als ein gedrucktes Buch – nicht verleihen, verkaufen, in anderer Form weitergeben oder Dritten zugänglich machen. Die unerlaubte Verbreitung von eBooks ist – wie der illegale Download von Musikdateien und Videos – untersagt und kein Freundschaftsdienst oder Bagatelldelikt, sondern Diebstahl geistigen Eigentums, mit dem Sie sich strafbar machen und der Autorin oder dem Autor finanziellen Schaden zufügen. Bei Fragen können Sie sich jederzeit direkt an uns wenden: [email protected]. Mit herzlichem Gruß: das Team des dotbooks-Verlags
***
Sind Sie auf der Suche nach attraktiven Preisschnäppchen, spannenden Neuerscheinungen und Gewinnspielen, bei denen Sie sich auf kostenlose eBooks freuen können? Dann melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an: www.dotbooks.de/newsletter (Unkomplizierte Kündigung-per-Klick jederzeit möglich.)
***
Wenn Ihnen dieser Roman gefallen hat, empfehlen wir Ihnen gerne weitere Bücher aus unserem Programm. Schicken Sie einfach eine eMail mit dem Stichwort »Der Hexenturm«an: [email protected] (Wir nutzen Ihre an uns übermittelten Daten nur, um Ihre Anfrage beantworten zu können – danach werden sie ohne Auswertung, Weitergabe an Dritte oder zeitliche Verzögerung gelöscht.)
***
Besuchen Sie uns im Internet:
www.dotbooks.de
www.facebook.com/dotbooks
www.instagram.com/dotbooks
blog.dotbooks.de/
Deana Zinßmeister
Der Hexenturm
Historischer Roman
dotbooks.
Für meine Freundin
Monika M. Metzner
und
in Erinnerung an all die Frauen, Männer und Kinder,die dem Hexenwahn zum Opfer gefallen sind
Man darf mit Menschenblut nicht spielen,
und unsere Köpfe sind keine Bälle,
die man nur so hin und her wirft.
Wenn vor dem Gericht der Ewigkeit Rechenschaft
für jedes müßige Wort abgelegt werden muss,
wie steht’s dann mit der Verantwortung
für das vergossene Menschenblut?
zitiert nach Friedrich Spee
Prolog
Püttlingen im heutigen Saarland, 1618
Johann von Baßy preschte auf seinem Rappen in den Burghof, saß ab und überließ das Pferd dem Stallburschen, der sogleich herbeigeeilt kam. Ohne anzuklopfen, riss er das Eingangsportal auf, rannte den Gang entlang und stürmte geradewegs in den Wohnsalon. Durchnässt stellte er sich vor den wärmenden Kamin und rieb sich die klammen Finger über dem Feuer.
»Es muss dir sehr unter den Nägeln brennen, wenn es dich bei diesem Wetter zu mir treibt«, lachte Thomas Königsdorfer spöttisch. Er saß in einem Sessel am Feuer und hatte von Baßy bereits erwartet. »Hier, trink den heißen Würzwein!«, sagte er und reichte dem Freund einen Becher.
Dankend nahm der Amtmann aus Wellingen das dampfende Getränk entgegen. Zwischen zwei Schlucken sah er auf und fragte: »Hast du meine Nachricht bekommen und dir meinen Vorschlag überlegt?«
Königsdorfer zuckte mit den Schultern. »Du bist Amtmann in Wellingen und kannst die Frau jederzeit ins Gefängnis schaffen lassen. Warum belästigst du mich damit? Ich habe in meinem eigenen Amtsbezirk genug zu tun.«
Johann von Baßy wusste, dass Thomas Königsdorfer nur versuchte Gewinn aus der Sache zu schlagen.
»Du hast mehr Macht, Thomas!«, schmeichelte er ihm. »Wenn ich die junge Frau bei mir ins Gefängnis bringen lasse, läuft meine Tante direkt zu den Nassauern nach Saarbrücken. Dann ist sie schneller wieder frei, als mir lieb sein kann.«
»Woher stammt die Frau? Ich habe gehört, dass es mehrere Fremde sind, die bei der alten Rehmringer Unterkunft erhalten haben.«
Von Baßy nickte. »Es sind drei Männer und zwei Frauen. Sie sollen von der anderen Seite der Werra kommen. Der Landstrich heißt angeblich Eichsfeld.«
»Das weiß ich bereits.« Thomas Königsdorfer schien zu überlegen. Dann stand er auf, ging zum Fenster und blickte hinaus.
Johann von Baßy stellte sich neben ihn und folgte seinem Blick. Als er das mächtige, runde Gebäude vor sich sah, das in der Abenddämmerung unheimlich und düster wirkte, fragte er: »Wie viele Frauen sind zurzeit im Hexenturm eingesperrt?«
»Bis jetzt sind es fünf Weiber«, antwortete Königsdorfer mit Abscheu in der Stimme. »Seit heute Morgen werden sie der peinlichen Befragung unterzogen.«
»Sind sie schuldig?«
»Dass es Hexen sind, wusste ich schon, bevor sie gestanden haben!«, sagte Königsdorfer voller Hohn. »Und bereits morgen werden sie brennen.«
Erstaunt blickte von Baßy auf. »So schnell?«
»Worauf soll ich warten? Schließlich haben sie schlimmen Wetterzauber über uns gebracht.«
»Das haben sie zugegeben?«
»Kannst du dich erinnern, dass wir jemals um diese Jahreszeit solches Wetter gehabt haben?«, fragte der Püttlinger Amtmann zornig. Von Baßy wollte Königsdorfer nicht weiter reizen und blieb stumm. Schweigend wandten sich die beiden Männer vom Fenster ab und setzten sich.
»Was ist jetzt, Thomas? Wirst du die Frau verhaften lassen?«
Königsdorfer musterte sein Gegenüber. »Weshalb willst du ausgerechnet diese eine Frau in den Hexenturm werfen lassen? Und weshalb nicht gleich alle fünf?«
Der Amtmann überlegte kurz. »Nein, die Frau reicht. Wir wollen ja nicht übertreiben!« Er lächelte zynisch, bevor er hinzufügte: »Sollten die anderen dann noch immer nicht vom Gestüt verschwinden, kannst du sie meinetwegen alle einsperren lassen!«
»Und was springt für mich raus?«
Von Baßy wusste, dass es dem Amtmann von Püttlingen im Grunde nur auf seine Entlohnung ankam. »Es soll dein Schaden nicht sein, Thomas! Das Geldsäckchen wird reich gefüllt sein. Und wenn ich das Gestüt erbe, erhältst du außerdem ein prächtiges Ross.«
Fragend zog Königsdorfer eine Augenbraue in die Höhe. »Weshalb so großzügig? Da steckt doch noch mehr dahinter!«
Von Baßys Gesichtsausdruck verfinsterte sich. »Es geht mir nur um die eine Frau. Und die will ich dort drüben im Hexenturm weggesperrt sehen!«
Kapitel 1
Irgendwo in Nassau – Anfang Oktober 1617
Der Sturm hatte nachgelassen, und das Donnergrollen war nicht mehr zu hören. Clemens kroch auf allen vieren zum Höhleneingang und streckte vorsichtig den Kopf hinaus. Überrascht stellte er fest, dass es bereits dämmerte. Er drehte den Kopf zur Seite und rief seinen Weggefährten über die Schulter zu: »Wacht auf, ihr Schlafmützen! Es regnet nicht mehr. Lasst uns weiterziehen.«
Franziska setzte sich auf und schüttelte ihre rötlichen Haare. Trockenes Laub fiel zu Boden. Verschlafen rieb sie sich die Augen. Burghard kauerte sich gähnend neben Clemens und blickte zweifelnd zum Himmel. »Wohin willst du denn jetzt noch? Bald wird es dunkel.«
Katharina schlug zaghaft vor: »Wir könnten die Nacht in der Höhle verbringen. Hier ist es trocken und sicher.«
»Nein, ich finde, Clemens hat Recht! Wir sollten weiterziehen«, entgegnete Johann. »Schließlich haben wir den ganzen Nachmittag geschlafen. Ich bin nicht mehr müde und wüsste nicht, weshalb wir hierbleiben und kostbare Zeit vergeuden sollten. Wir müssen ja nicht bis zum Morgengrauen marschieren. Aber wenigstens eine Weile. Zumal uns der Vollmond den Weg erhellen wird.«
Mit diesen Worten kroch er hinter Clemens nach draußen. Burghard zögerte, doch als Franziska hinter ihm drängelte, schlüpfte auch er durch den kleinen Eingang.
»Wir gönnen uns kaum Ruhe«, maulte Katharina leise. »Immer müssen wir weiter. Ich bin erschöpft und könnte tagelang schlafen. Wir wissen nicht einmal, wo wir sind. Ich habe keine Lust, durch die Nacht zu stapfen, ich bleibe hier.«
Franziska, die eben hinter Burghard nach draußen kriechen wollte, hielt inne und wandte sich zu Katharina um, die stur auf dem Boden saß und sich nicht von der Stelle rührte. »Nun komm, Katharina«, sagte sie sanft, »sonst müssen wir ohne dich gehen. Und du willst doch nicht allein hier zurückbleiben.«
Katharina zögerte noch immer, doch als auch Franziska die Höhle verlassen hatte, gab sie sich einen Ruck und kroch hastig hinterher. Draußen warteten ihre Weggefährten bereits auf sie. Als sie in ihre aufmunternden Gesichter blickte, verflog ihre Übellaunigkeit allmählich, und sie schulterte wie die anderen ihren Beutel mit den wenigen Habseligkeiten und folgte Clemens durch den Wald.
***
Seit Johann und Franziska, Clemens, Katharina und Burghard auf der Flucht waren, blieben sie nie länger als eine Nacht am selben Ort. Obwohl die fünf nach monatelanger Reise erschöpft waren, trieb stete Unruhe sie vorwärts. Denn die Angst, dass ihre Häscher sie einholen könnten, saß ihnen in jedem Augenblick im Nacken.
Sie sprachen kaum über das, was sie erlebt hatten. »Wir wollen nach vorn blicken und nicht zurückschauen!«, hatten sie beschlossen. Sie hofften, mit diesem Leitspruch ihre Sehnsucht nach dem verlorenen Zuhause erträglich zu machen. Dennoch stimmte sie jeder heimliche Gedanke daran traurig.
Das Eichsfeld in Thüringen war bis vor drei Monaten ihre Heimat gewesen, und alle fünf hatten sie von dort fliehen müssen. Das verband sie, obwohl ein jeder von ihnen seine ganz eigenen Gründe für die Flucht hatte.
Der neunzehnjährige Clemens war der Schweigsamste unter ihnen. Anfangs hatte er mürrisch die Gesellschaft der anderen abgelehnt und war stets einige Schritte hinter ihnen gegangen. Er blieb nur in der Gruppe, weil das Reisen mit anderen sicherer war. Stumm ertrugen seine Weggefährten sein schroffes Wesen, denn sie ahnten, dass sein Verhalten mit seinem entstellten Aussehen zu tun haben musste. Sobald man ihn ansprach, wandte er den Kopf ab und vermied so, dass man ihm ins Gesicht blicken konnte. Nur langsam vertraute er ihnen, und erst als er ihnen eines Tages offen in die Augen sehen konnte, erfuhren sie seine ganze Leidensgeschichte.
Mit versteinertem Blick berichtete Clemens stockend, was ihm widerfahren war: Seine Eltern hatten ihm und seiner Schwester Anna ein beachtliches Vermögen hinterlassen, das Annas Mann, der Notar Wilhelm Münzbacher, an sich reißen wollte. Nachdem er sich Annas Vertrauen erschlichen hatte, verfolgte er den Plan, seine Frau in einem Kloster wegzusperren. Seinen Schwager Clemens aber versuchte er kaltblütig bei lebendigem Leib in einer Scheune zu verbrennen. Nachdem der Mordversuch fehlgeschlagen war, beauftragte er einen Meuchelmörder, der die Tat vollenden sollte.
Zwar war Münzbacher durch einen Unfall zu Tode gekommen, doch der Mörder verfolgte sein Opfer weiter. Clemens kannte den Namen des Meuchelmörders, doch wusste er nicht, wie sein Verfolger aussah. Jeden Fremden, der ihren Weg kreuzte, beäugte Clemens deshalb misstrauisch. Auch war es in seinem Sinne, dass sie abseits der öffentlichen Wege marschierten, wo ihnen kaum jemand begegnete. Clemens war sich bewusst, dass er wegen seines Gesichts und seiner Hände, die seit dem Brandanschlag entstellt waren, die Blicke Fremder auf sich zog. Und er konnte das Entsetzen und das Mitleid in ihren Augen dabei nur schwer ertragen.
Auch Burghard, der junge Franziskanermönch, hatte von einer Fluchtgeschichte auf Leben und Tod zu berichten. Mitten in der Nacht hatte er die thüringische Stadt Worbis eilends verlassen müssen, weil sein Lehrmeister ihm nach dem Leben trachtete.
Der Lehrmeister hieß Servatius und war wie Burghard ein Mönch aus dem Kloster zu Mainz. Als Servatius auf Geheiß der älteren Mönche das geliebte Kloster verlassen musste, um Burghard auf der Wanderschaft zu begleiten, schürte das seinen Hass auf den Jungen. Dieser Hass schlug in mörderischen Zorn um, als Servatius unterwegs Geld vermisste und sofort den jungen Burghard des Diebstahls verdächtigte und drohte, ihn eigenhändig zu erschlagen. So blieb Burghard nur die Flucht aus dem Eichsfeld. Um jedoch nicht als Franziskaner erkannt zu werden, legte er die Mönchskutte ab und verkleidete sich als Bauer. Als schließlich auch seine Haare nachgewachsen waren, dankte er dem Himmel, denn so war mit der Tonsur auch der letzte Hinweis auf sein Mönchsdasein verschwunden.
Katharina war wegen des Mannes ihrer toten Schwester auf der Flucht. Katharinas Wunsch war es seit jeher gewesen, der heiligen Elisabeth von Thüringen nachzueifern. Jede freie Minute verbrachte sie bei den Armen und Kranken und wünschte sich nichts sehnlicher, als so leben zu können wie die Heilige.
Dieser Traum zerplatzte jäh, als ihre Schwester Silvia auf dem Totenbett verlangte, dass Katharina ihren Mann Otto heiraten und Mutter ihrer drei Kinder werden sollte.
Doch noch bevor Katharina widersprechen konnte, starb Silvia, und ihre Eltern und ihr Schwager verlangten, dass der Wunsch der Toten erfüllt werden müsse. Katharina wusste, dass sie sich nicht widersetzen konnte, und nutzte eine Wallfahrt zum Hülfensberg, um diesem Schicksal zu entgehen.
Johann und Franziska wiederum hatten um ihr Leben laufen müssen. Sie wurden verfolgt, weil Johanns Vater, der Großbauer Bonner, nicht duldete, dass sein Sohn eine einfache Magd liebte oder gar zur Frau nahm. Und so hatte er alles daran gesetzt, Franziska der Hexerei zu bezichtigen. Fortan war die junge Frau in Thüringen nicht mehr sicher, denn man wollte sie auf dem Scheiterhaufen brennen sehen.
Zuflucht hatten die beiden Liebenden auf Burg Bodenstein gefunden und dort heimlich den Bund der Ehe geschlossen. Doch auch von dort mussten sie fliehen, da Bonner mit einer Truppe Mordgesellen auf dem Weg zu ihnen war. Nun suchten die jungen Eheleute einen Ort, an dem sie sicher waren und sesshaft werden konnten, denn Franziska erwartete ein Kind. Doch jedes Gebiet, das sie durchquerten, erschien Johann zu nahe am Eichsfeld gelegen. Die Angst, dass sein Vater sie aufspüren und Franziska töten könnte, trieb Johann an, sich täglich weiter von Thüringen zu entfernen.
***
Mühsam versuchten die fünf Weggefährten in der anbrechenden Dunkelheit den Weg zu finden. Obwohl das Mondlicht ungehindert durch die kahlen Äste auf den Waldboden fiel, konnten sie nur schwer den Pfad erkennen, dem sie folgen wollten. Der Sturm, der am frühen Nachmittag stundenlang über das Land gezogen war, hatte die gelb gefärbten Blätter wie Schnee von den Bäumen auf die Erde rieseln lassen. Nun bedeckte eine dichte Blattschicht den Waldboden und ließ alles gleich aussehen. Immer wieder blieben Clemens und Johann stehen und versuchten die Richtung zu bestimmen. Als sie auf einen Bachlauf stießen, beschlossen sie, diesem zu folgen.
Nach stundenlangem Regen schoss das Wasser geräuschvoll durch das ausgewaschene Bachbett. Das Plätschern war so laut, dass eine Verständigung durch Worte unmöglich wurde.
Immer wieder rutschen die jungen Leute auf dem glitschigen Boden aus. Steine lösten sich hier und da aus dem aufgeweichten Grund und brachten sie zum Straucheln. Wie Kinder hielten sie sich an den Händen fest und versuchten sich gegenseitig zu stützen. Als sie in der Ferne Lichter erkennen konnten, ahnten sie, dass ein Ort vor ihnen liegen musste, und machten einen großen Bogen darum.
Mitten im Gehen blieb Franziska plötzlich stehen. Erschrocken fragte Johann: »Was hast du?« Statt zu antworten, drückte sie sachte seine Handfläche auf ihren Leib. »Spürst du das?«, wisperte sie.
Johann wusste, was sie meinte. Immer wenn Franziska das heranwachsende Leben in sich fühlte, hoffte sie, dass auch er die Bewegungen des Kindes spüren würde, wenn er ihr die Hand auf den Bauch legte. Doch jedes Mal hatte er enttäuscht den Kopf geschüttelt. »Beim nächsten Mal!«, versuchte er sie dann aufzumuntern.
Vielleicht können nur Frauen die Bewegungen des Kindes fühlen, tröstete sich Johann im Stillen. Er war sich sicher, dass er auch dieses Mal nichts spüren würde. Liebevoll lächelte er seiner Frau zu, als er plötzlich erschauerte. Angespannt hielt er die Luft an. Da! Ja, da war etwas. Zaghaft, nicht mehr als der Flügelschlag eines kleinen Vogels, aber eindeutig eine kleine Bewegung in ihrem Leib. Erschrocken zog Johann seine Hand fort, um sie gleich wieder auf Franziskas Bauch zu legen. Wieder spürte er das Kind – sein Kind! Zärtlich umarmte und küsste er Franziska, doch Clemens trat zu ihnen heran und packte ihn jäh am Arm. Erschrocken blickte Johann auf. Stumm wies Clemens ihn an, ruhig zu sein, und zeigte vor sich. Johanns Blick folgte seinem ausgestreckten Arm. In der Ferne zwischen den Bäumen konnte er kleine Lichtpunkte erkennen, die sich bewegten.
Auch die anderen hatten das Licht bemerkt. Vorsichtig schlichen die Freunde an den Baumreihen entlang, den Lichtern entgegen. Neben ihnen floss gurgelnd der Bach und teilte sich schließlich. Ein Arm floss wild und ungestüm weiter, während der andere einen Bogen schlug, um dann ruhig dahinzuplätschern.
Während die Männer leise beratschlagten, welchem Wasserarm sie folgen sollten, beobachteten sie angespannt die Lichter. Doch plötzlich verschwand das Licht, und stattdessen drangen undeutlich Stimmen zu ihnen durch. Katharina und Franziska versteckten sich sogleich im Unterholz, wie sie es immer taten, sobald Gefahr im Verzug war. Erst wenn die Männer ihnen Zeichen gaben, dass alles in Ordnung war, schlossen sie sich ihren Weggefährten wieder an.
Zufrieden, dass dichtes Buschwerk die beiden Frauen verbarg, folgten die Männer dem ruhigeren Wasserlauf, da dieser sie in Richtung der verschwundenen Lichter zu führen schien. Immer noch klangen aus der Ferne unverständlich Stimmen an ihr Ohr. Auf einmal lichteten sich die Bäume, und vor ihnen lag ein Wiesenstück, durch das sich der Bach schlängelte. Johann glaubte am Ende der Lichtung ein Gebäude zu erkennen und zeigte stumm mit dem Finger in die Richtung. Angestrengt blickten die jungen Männer in die Dunkelheit, als die Lichter wieder zu sehen waren und die Stimmen lauter wurden.
»Das müssen Fackeln sein«, sagte Clemens leise.
»Es sieht aus, als ob sie in der Luft hängen«, warf Burghard ein.
»Du hast Recht, Clemens, das sind Fackeln. Ich denke, dass Reiter sie in die Höhe halten«, erklärte Johann mit gedämpfter Stimme.
Unerwartet zerriss ein Schrei die Nacht und ließ die Burschen zusammenzucken. Kurz darauf standen Katharina und Franziska neben ihnen.
»Ihr sollt in Deckung bleiben!«, schimpfte Johann verhalten.
»Nein!«, fuhr Katharina ihn an. »Hier hat jemand fürchterlich geschrien, da bleibe ich nicht allein zurück!«
»Lasst uns umkehren«, flüsterte Franziska Johann zu.
»Vielleicht ist jemand verletzt«, gab Burghard zu bedenken. »Ich will wissen, was da vorn vor sich geht! Vielleicht braucht jemand unsere Hilfe!«
»Gut, sehen wir nach!«, stimmte Clemens zu. »Katharina, Franziska, ihr bleibt hier!«
»Ganz bestimmt nicht!«, fauchte Katharina, doch Johann unterbrach sie: »Ihr folgt uns in sicherem Abstand. Sobald wir euch Zeichen geben, versteckt ihr euch.«
Franziska und Katharina nickten.
Als sie sich über die Wiese dem Gebäude näherten, sanken sie immer wieder in dem aufgeweichten Boden der Bachaue ein. Mit den blanken Füßen steckten sie im kalten Morast, und nur mühsam gelang es ihnen, einen Fuß vor den anderen zu setzen. Jetzt, da sie das Gebäude deutlich erkennen konnten, verstanden sie, dass eine Mühle vor ihnen lag. Als das Stimmengewirr immer lauter wurde, gab Johann den Frauen Zeichen, sich zu verstecken, und Katharina und Franziska verschwanden zwischen den Bäumen.
Clemens, Burghard und Johann pirschten sich im Schutz der Dunkelheit dichter an die Mühle heran. In der Nähe des Mühlrads versteckten sie sich, da sie von dort den Vorhof der Mühle einsehen konnten, ohne selbst gesehen zu werden.
Sie sahen fünf Männer hoch zu Ross, von denen ein jeder eine brennende Fackel in der Hand hielt, ganz wie Johann vermutet hatte. Ein Reiter hatte sich vor die anderen gestellt, sein Pferd kratzte unruhig mit dem Vorderhuf den nassen Mehlstaub vom Boden. Die Reiter blickten grimmig auf den Mann und die Frau herab, die vor dem Hauseingang standen.
»Ich frage dich zum letzten Mal: Wo ist dein Sohn, Müller?«, schrie der Anführer der Reitergruppe.
»Lasst den Jungen in Ruhe!«, krächzte die Frau, allem Anschein nach die Müllerin.
»Halt’s Maul, Weib, sonst lass ich dich einsperren!«
Hastig ergriff die Frau einen Stock und schabte damit um sich herum einen Kreis in den Boden.
»Dann komm und hol mich!«, keifte sie.
»Dein magischer Kreis wird mich nicht abhalten«, brüllte der Reiter, doch sein Blick verriet Unsicherheit. Er wandte sich seinen Begleitern zu und befahl: »Ihr zwei durchsucht die nähere Umgebung, und ihr beiden schaut in der Mühle nach. Der Saubub muss sich hier versteckt haben.«
»Herrgott, Raimund! Warum willst du uns Böses? Seit Jahren mahle ich das Korn für dich. Nie hatten wir Streit«, ergriff nun der Müller das Wort.
»Aber jetzt erzählt dein Sohn überall, dass er das Wetter vorhersagen könnte. Erst gestern hat er mir für einen Kreuzer vorausgesagt, dass es trocken bleiben würde. Und was hatten wir? Blitz und Donner sind über das Land gefegt, und nun liegt meine Kuh erschlagen unter den Obstbäumen!«
»Was kann Achimchen dafür, wenn du Trottel dem Geschwätz eines Kindes vertraust?«, fragte der Müller spöttisch.
»Du wirst mir die Kuh ersetzen!«, forderte der Reiter.
»Was kann ich für deine Dummheit?«, erregte sich der Müller. »Der Junge ist acht Jahre alt! Du bist ein Narr, wenn du einem Kind Glauben schenkst. Von mir bekommst du keinen Kreuzer.«
Der Reiter wusste, dass der Müller Recht hatte. Er war Opfer seiner eigenen Dummheit, und das ärgerte ihn am meisten.
»Du Hohlkopf weißt anscheinend nicht, dass wir schon bald für die Hochzeit Sondersteuern leisten müssen. Eine dieser Kühe war als Abgabe gedacht.«
Der Reiter erkannte, dass die Mundwinkel des Müllers zuckten. »Ich schwöre dir, wenn du mich verhöhnen willst, werde ich dich und deine Frau einsperren lassen. Jeder weiß, dass sie eine Hexe und euer Sohn ein Hexenbalg ist!« Aufgebracht schleuderte er die brennende Fackel nach dem Müller, der ihr mit einem Sprung zur Seite auswich.
»Jakob, komm zu mir in den Kreis!«, kreischte die Frau und fuchtelte aufgeregt mit den Händen in der Luft.
»Ich muss mich nicht in deinem magischen Kreis verstecken. Auch du, Helga, kannst da heraustreten. Raimund wird es nicht wagen, uns anzufassen!«
»Was macht dich so sicher?«
»Deine Frau wird in wenigen Wochen euer fünftes Kind gebären, und wie bei den vier anderen wird sie die Hilfe meiner Frau benötigen.«
Mutig trat die Müllerin aus dem Kreis und stellte sich neben ihren Mann.
»Ist dein Furunkel am Hintern abgeheilt?«, fragte sie den Reiter mit blitzenden Augen. Als der Mann nicht antwortete, lachte sie laut. »Dann hat meine Tinktur also geholfen.«
Die drei unfreiwilligen Zeugen der nächtlichen Auseinandersetzung wurden durch ein Geräusch unterhalb des Mühlrads abgelenkt. Der Kopf eines Knaben kam zum Vorschein. Der Junge stand bis zum Kinn im kalten Wasser des Mühlenbachs. Erschrocken blickte er in die Gesichter der jungen Männer und wagte es nicht, sich zu rühren. Nur seine Zähne schlugen vor Kälte leise aufeinander.
Die drei jungen Männer wussten sofort, wer der Bursche sein musste. Clemens zwinkerte ihm zu und legte den Zeigefinger auf den Mund zum Zeichen, dass er ruhig bleiben solle. Dann wandten die drei sich wieder dem Geschehen auf dem Hof zu.
Die beiden Reiter, die losgeschickt worden waren, den Jungen im Wald zu suchen, kehrten zurück. »Wir konnten ihn nirgends entdecken«, erklärten sie. Auch die beiden anderen, die in der Mühle gesucht hatten, traten nach draußen und zuckten stumm mit den Schultern.
»Wie sollen wir ihn in der Dunkelheit auch finden? Er könnte sich überall versteckt haben. Lass gut sein, Raimund. Es ist spät, und ich bin hungrig«, sagte einer der Männer.
Statt zu antworten, riss der Reiter, der Raimund hieß, mürrisch sein Pferd am Zügel herum und galoppierte davon. Die anderen folgten ihm. Rasch wurden die Männer und das Getrampel der Pferdehufe von der Nacht verschluckt.
Nach einer Weile, als der Müller sich sicher zu sein schien, dass die Reiter wirklich verschwunden waren, rief er mit verhaltener Stimme: »Achim, du kannst rauskommen!«
Doch nicht nur sein Sohn, sondern drei weitere Gestalten kamen hinter dem Mühlrad hervor.
Als auf Clemens’ entstellte Gesichtshälfte das Mondlicht fiel, konnte man hören, wie die Müllersleute scharf die Luft einsogen. Zwar sagten sie kein Wort, doch die Müllerin zog sofort ihren Sohn in den von ihr gezeichneten Kreis. »Wer seid ihr? Und was wollt ihr von uns?«, fragte sie misstrauisch.
Burghard hob die Hände in die Höhe. »Gute Frau, wenn wir euch Böses gewollt hätten, dann wäre euer Sohn jetzt nicht hier, sondern die Reiter hätten ihn mitgenommen. Außerdem hätte ich ihm dann sicher nicht meinen Umhang geliehen.«
Erst jetzt bemerkte die Frau, dass ihr Sohn zwar durchnässt, aber in einen trockenen Umhang gehüllt war. Trotzdem blickte sie die unbekannten Männer argwöhnisch an. Dann vernahm sie ein Knacken im Gehölz, und Katharina und Franziska erschienen im Mühlenhof.
»Wie viele Landstreicher seid ihr?«, rief der Müller gereizt, während er achtsam die Umgebung im Auge behielt.
»Wir sind keine Landstreicher, sondern fünf Freunde, die sich auf Wanderschaft befinden«, erklärte Johann und legte schützend den Arm um seine Frau.
»Ach ja? Wohin wollt ihr denn?«, fragte der Müller zweifelnd. Der Ton in seiner Stimme verriet, dass er Johann nicht glaubte. Der Blick der Müllerin wanderte derweil über Franziskas Gestalt. Bevor ihr Mann weiter schimpfen konnte, sagte sie: »Dann seid ihr sicherlich hungrig, zumal du, mein Kind, für zwei essen musst.«
Erstaunt schaute Franziska auf. »Man sieht doch noch nichts. Woher weißt du?«
Jetzt huschte ein Lächeln über das abgearbeitete Gesicht der Frau. »Ich weiß vieles, und deshalb haben die Menschen Angst vor mir.«
»Aber jetzt braucht der Junge trockene Kleidung«, sagte die Müllerin zu ihrem Mann und verschwand mit Achim an der Hand in der Mühle.
»Kommt rein oder zieht weiter«, brummte der Müller und folgte seiner Frau und seinem Sohn nach drinnen.
Flehend blickten die beiden Frauen in die Runde. Die Aussicht auf ein warmes Essen hob ihre Laune. Auch die Männer überlegten nicht lange und betraten die Mühle.
***
In der Küche brannte ein wärmendes Feuer, über dem in einem gusseisernen Topf eine Suppe köchelte. Der Duft von frisch gebackenem Brot hing in der Luft.
»Wir wollten gerade essen, als die Reiter auftauchten«, erklärte die Müllerin. »Achim, zieh dir rasch trockene Kleidung über und setz dich dann ans Feuer, damit deine Haare trocknen können.« An Franziska und Katharina gewandt, sagte sie: »Ihr könnt das Brot aufschneiden und die Suppe in die Schüssel füllen.«
Die jungen Frauen taten, wie ihnen geheißen. Vorsichtig goss Katharina die heiße Kohlsuppe in eine Holzschüssel, die sie zu dem geschnittenen Brot auf den Tisch stellte.
»Wir haben nur drei Löffel«, entschuldigte sich die Müllerin.
»Das macht nichts!«, beruhigte Burghard sie. »Wir sind dankbar, dass ihr euer Essen mit uns teilen wollt. Es ist schon einige Tage her, dass wir etwas Warmes zu uns genommen haben.«
In diesem Augenblick betrat Achim in frischer Kleidung die Küche, und sogleich gab ihm sein Vater eine Ohrfeige. Erschrocken sahen die Freunde auf. Aufgebracht schimpfte die Mutter: »Lass den Jungen in Ruhe, Jakob! Er hat nichts getan.«
»Nichts getan?«, ereiferte sich ihr Mann. »Seinetwegen haben wir großen Ärger! Von was sollen wir Raimund die Kuh ersetzen? Wir können froh sein, wenn wir selbst nicht verhungern.« Sein hageres Gesicht, das von tiefen Falten zerfurcht war, zeugte von harter Arbeit und einem kargem Dasein. Mehlstaub hing in seinen Haaren und ließ ihn blass und grau erscheinen. Seine Frau schwieg. Achim hielt sich die gerötete Wange und sah den Vater trotzig an.
»Schau nicht so, sonst setzt es gleich noch eine Backpfeife.«
Hastig kauerte sich der Knabe zwischen die Gäste. Seine Eltern nahmen ebenfalls Platz. Bevor der Müller zu essen begann, befahl er seinem Sohn: »Gleich morgen früh wirst du die Frösche am Mühlenteich aussetzen.«
Der Junge riss die Augen auf und blickte flehend zu seiner Mutter. Doch die sagte nur: »Du hast gehört, was dein Vater befohlen hat.«
Die Löffel wurden herumgereicht, so dass jeder abwechselnd Suppe aus der Schüssel schöpfen konnte. Dazu trank man verdünnten Wein. Während des Essens wurde kaum gesprochen. Nur schmatzende Geräusche waren zu hören. Nach einer Weile sagte Clemens an ihren Gastgeber gewandt: »Wir wissen leider nicht, wo wir uns genau befinden.«
Mürrisch blickte der Müller auf. Mit dem Löffel zeigte er hinter sich und brummte: »Arborn!« Dann wies er mit dem Löffel vor sich auf Katharina: »Nenderoth!« Anschließend hieb er mit der Löffelspitze auf den Holztisch und knurrte: »Cödinger Mühle!« Ohne ein weiteres Wort tunkte er seinen Kanten Brot in die Brühe und aß weiter. Die Freunde sahen sich fragend an, doch keiner wagte zu sprechen. Erst nachdem das Essen beendet war, ergriff Johann das Wort. »Der Reiter erzählte von einer Hochzeit ...« Weiter kam er nicht, denn der Müller fing sogleich wie ein Hund an zu knurren und seinen Sohn scharf anzusehen.
»Komm, Achim, lass uns zu Bett gehen«, sagte die Müllerin und zog ihren Sohn von der Bank in die Höhe. Bevor sie die Treppe hinaufstieg, sagte sie an die Gäste gewandt: »Ihr könnt in der Mehlkammer schlafen. Da ist es warm. Auch liegen dort leere Säcke, mit denen ihr euch zudecken könnt.«
Dankbar lächelte Franziska ihr zu.
Der Müller schenkte verwässerten Wein nach und begann zu erzählen: »Im März wird Prinzessin Elisabeth von Hessen-Kassel den Herzog Johann Albrecht II. zu Mecklenburg heiraten. Solch eine Hochzeit ist teuer, und deshalb werden Sondersteuern erhoben. Doch von was sollen wir die bezahlen?«
Nachdem er einen Schluck Wein genommen hatte, fuhr er fort: »Ich kann verstehen, dass Raimund wütet, weil seine Kuh verreckt ist. Aber was kann der Junge dafür?«
»Wie kommt dein Sohn dazu, das Wetter vorhersagen zu wollen?«
Der Müller zuckte mit den Schultern. »Ein Magier hat ihm den Floh ins Ohr gesetzt.«
Burghard wurde kreidebleich. Zitternd stellte er seinen Becher zurück auf den Tisch. »Ein Magier?«
Auch seine Freunde blickten erschrocken auf. Jeder wusste, was das bedeuten konnte. Da Burghard stumm blieb, fragte Johann: »Wann war der Magier bei euch? War er allein? Wie sah er aus?«
Der Müller sah ihn mürrisch an. »Das sind aber viele Fragen. Kennst du den weisen Mann etwa?«
»Um dir diese Frage beantworten zu können, musst du ihn mir beschreiben«, forderte Johann ihn auf.
Der Müller überlegte und kratzte sich das unrasierte Kinn. »Er war groß und von hagerer Gestalt. Damit meine ich aber nicht vom Hunger hager. Der Alte hatte lange, fast silbrige Haare. Im Gegensatz zu seinem Begleiter, der von Pusteln übersät war, wirkte der Magier gesund und sauber. Trotzdem fand ich ihn unheimlich! Nicht nur, weil er täglich im Mühlenteich baden ging, was kein normaler Mensch macht. Ich hatte das Gefühl, dass seine schwarzen Augen bis in meine Seele blicken konnten. Doch frag meine Frau, wenn du mehr wissen willst. Sie hat lange mit ihm gesprochen. Ich bin ihm aus dem Weg gegangen.«
»Wie lange war er bei euch?«
»Wenn es nach mir gegangen wäre, hätte ich die beiden augenblicklich fortgejagt. Doch als der Magier mir zwei Münzen für Essen und Lagerstatt in die Hand drückte, habe ich ihn und diesen Widerling geduldet. Sie blieben eine Woche.«
»Barnabas und Servatius!«, flüsterte Burghard. Sogleich trat ihm Clemens unter dem Tisch gegen das Schienbein, damit er schwieg.
Der Müller hatte nichts bemerkt. »Was ist? Kennt ihr den Magier nun?«, wollte er arglos wissen.
Johann blickte Burghard an. Schweißperlen glänzten auf der Stirn des Mönchs.
»Nein!«, antwortete Clemens laut. »Das ist nicht der Magier, den wir unterwegs kennengelernt haben. Es scheint mehr von der Sorte zu geben, die sich so nennen«, versuchte er zu scherzen, doch niemand lachte.
»Das dachte ich mir, denn sie suchen einen Mönch, und keiner von euch sieht aus wie einer«, erklärte der Müller.
»Warum suchen sie ihn?«
»Von Servatius, dem die Boshaftigkeit schon ins Gesicht geschrieben stand, weiß ich, dass sein Ordensbruder das Klostergelübde gebrochen haben soll. Doch wer weiß, ob man seinem Geschwätz Glauben schenken kann.«
Fragend schauten ihn nun fünf Augenpaare an.
»Was könnte er damit gemeint haben?«, wollte Johann wissen.
»Ha!«, lachte der Müller auf. »Das kann man sich wohl denken. Der Klosterbruder soll der Fleischeslust verfallen und mit einem Mädchen durchgebrannt sein, das einem anderen versprochen war.«
Katharina spürte, wie ihr Hitze in die Wangen schoss. Der Müller goss sich Wein nach und meinte: »Das ist wahrlich eine schwerwiegende Sünde, die der Klosterbruder begangen haben soll. Wenn das die Wahrheit ist, wird Gott ihn richten, wenn dieser Servatius ihm nicht zuvorkommt. Er sprach so voller Hass von seinem Mitbruder, dass ich ihm alles zutrauen würde.« Der Müller leerte seinen Becher, erhob sich und ging zur Treppe.
»Wann waren die beiden hier?«, wagte Katharina mit zittriger Stimme zu fragen.
»Sie sind erst vor wenigen Tagen fortgegangen. Doch was kümmert es dich, Mädchen?«, fragte der Müller und kniff die Augen zusammen. Katharina wollte ihm antworten, doch Johann fiel ihr ins Wort: »Und dieser Magier hat deinen Sohn das Wettervorhersagen gelehrt?«
Der Müller kam zurück an den Tisch und schimpfte: »Daran seht ihr, dass der Mann ein Tunichtgut ist. Er hat meinem Achimchen einen Trog voll Frösche gesammelt und behauptet, dass das Wetter gut wird, wenn die Viecher den Zweig im Topf hochkrabbeln. Bleiben sie am Boden sitzen, dann würde das Wetter schlecht werden. Nun ist der Junge ganz närrisch mit den Viechern und vernachlässigt seine Arbeiten. Wegen dieses faulen Zaubers muss ich jetzt eine Kuh ersetzen, die vom Blitz erschlagen wurde.«
Wütend stapfte er die Treppe hinauf, und schon beim Öffnen der Schlafkammer hörte man ihn nach seinem Sohn brüllen.
Vier Augenpaare starrten Burghard mitfühlend an. Verängstigt und bleich blickte er in die Runde und flüsterte: »Was soll ich nun tun?«
»Was heißt hier du? Ich bin ebenso betroffen, denn es ist wohl klar, dass Servatius mich gemeint hat, als er von einem Mädchen sprach, das einem anderen versprochen war«, ereiferte sich Katharina.
»Senk deine Stimme!«, befahl Clemens barsch. »Der Müller muss nicht erfahren, dass es Burghard ist, den Barnabas und sein Begleiter suchen.«
»Weißt du, was Servatius’ Anschuldigung bedeutet? Sie bedeutet nichts anderes, als dass ich eine Hure bin.« Vor Wut und Scham schossen der jungen Frau Tränen in die Augen, die sie mit dem Handrücken energisch wegwischte. Franziska legte ihr den Arm um die Schulter. »Es ist doch einerlei, was dieser Mensch sagt. Wir wissen, dass du kein leichtes Mädchen bist.«
Katharina schnaubte wütend. »Wenn wir nur wüssten, in welche Richtung sie gegangen sind. Dann könnten wir unseren Weg in die andere fortführen.«
»Es wäre schon gut, wenn wir überhaupt wüssten, wohin wir gehen wollen. Bis jetzt hatten wir Glück, dass uns nichts zugestoßen ist. Doch wie der Müller schon sagte – in den Augen von Fremden sind wir Landstreicher. Was nicht unwahr ist, schließlich haben wir kein Dach über dem Kopf und hausen in Höhlen.«
»Ich weiß, Franziska«, pflichtete Johann ihr bei. »Und die Zeit drängt, aber ich kenne mich in diesem Teil des Landes nicht aus und weiß nicht, wohin wir gehen sollen. Allein oder zu zweit wäre es schwierig genug, vor dem Winter irgendwo unterzukommen. Aber wer soll fünf Menschen Unterkunft gewähren? Den meisten geht es doch wie den Müllersleuten: zum Leben zu wenig, zum Sterben zu viel.«
Bedrückende Stille breitete sich aus. Die jungen Menschen wussten, dass Johann die Wahrheit sprach. Meist bewirtschafteten nur ein Bauer und seine Frau das Land. Kaum ein Gehöft konnte sich Gesinde leisten, erst recht nicht, wenn die kalte und karge Jahreszeit vor der Tür stand. Mit einem Mal wurde ihnen schmerzlich bewusst, dass sich ihre Wege trennen mussten.
Katharina blickte Franziska an. Ihre Lippen bebten, und obwohl sie sich zusammennehmen und nicht weinen wollte, entfuhr ihr ein Schluchzen.
»Und ich?«, meldete sich nun Burghard zu Wort. »Ich kann nicht zurück ins Kloster. Servatius hat sicherlich dafür gesorgt, dass meine Brüder von seinem Verdacht erfahren haben.«
»Wo bleibt die Barmherzigkeit? Deine Brüder würden dich sicher anhören und dich nicht fortjagen«, warf Katharina ein und schniefte laut in ihren Handrücken.
»Natürlich könnte ich es versuchen. Aber was ist, wenn Servatius zu Ohren kommt, in welchem Kloster ich mich aufhalte? Nein, es hilft nichts. Ich muss ihm weiterhin als Bauer getarnt aus dem Weg gehen.«
»Aber du, Clemens? Du könntest zurück zu deiner Schwester gehen«, schlug Johann vor. »Münzbacher ist tot, und die Wahrscheinlichkeit, dass der Meuchelmörder dich dort aufspürt, ist gering.«
Clemens’ Gesicht verfinsterte sich. »Du bist wohl von Sinnen, Johann! Ich weiß nicht einmal, wie der Mann aussieht. Ich weiß nur, dass er sich Adam Hastenteufel nennt und Söldner war. Er könnte mir also auch zu Hause auf dem Gestüt auflauern, ohne dass ich ihn erkennen würde.«
»Vielleicht sucht er dich aber schon nicht mehr, und du machst dir unnötig Sorgen«, wandte Franziska ein.
»Aber was, Franziska, wenn er bei meiner Schwester auf mich wartet? Womöglich bringt er dann auch Anna um. Nein, ich kann nicht nach Thüringen zurück«, erklärte Clemens bestimmt.
Johann wusste, dass es auch für ihn und Franziska keine Rückkehr gab. »Wir sind ebenfalls in großer Gefahr. Mein Vater wird nicht eher ruhen, bis er uns gefunden hat.«
Alle sahen nun Katharina an.
»Im Grunde könntest nur du unbesorgt zurückkehren«, stellte Clemens ruhig fest.
»Zwar trachtet mir keiner nach dem Leben, das stimmt. Aber wenn ich wieder nach Hause gehe, muss ich meinen Schwager heiraten. Ich aber will wie die heilige Elisabeth Gutes tun und nicht wie meine Schwester jedes Jahr ein Kind gebären und womöglich im Wochenbett sterben. Ich werde ganz bestimmt nicht zurückkehren – jedenfalls nicht jetzt.« Trotzig reckte sie das Kinn in die Höhe.
Johann stöhnte laut auf und sagte: »Lasst uns schlafen gehen. Ich bin müde, und mir ist nicht mehr nach Grübeln. Da wir hier weder Verwandte noch Freunde haben, müssen wir überlegen, wie es weitergeht. Aber erst morgen.« Während er sich vom Stuhl erhob, reckte er sich und gähnte laut. Nacheinander verließen sie den Raum und gingen in die Mehlkammer, die ihnen die Müllerin für die Nacht zugewiesen hatte.
Kapitel 2
Barnabas wurde Servatius’ Gesellschaft von Tag zu Tag lästiger. »Ich kann ihn nicht mehr riechen!«, murmelte der Magier leise vor sich hin, als ein Windhauch wieder einmal den durchdringenden Körpergeruch seines Weggefährten zu ihm herüberwehte.
Servatius gehörte zu den Menschen, die nur badeten, wenn ein besonderer Feiertag bevorstand. Kamen jedoch der Herbst und die Kälte, wurde die Körperpflege gänzlich vernachlässigt. Der Mönch war der Ansicht, dass eine Schmutzschicht auf der Haut ihn vor Krankheit und Ungeziefer schützen würde. Deshalb diente ihm Wasser nur dazu, seinen Durst zu stillen.
Als Barnabas den Franziskaner und seinen Mitbruder Burghard vor vielen Monaten kennengelernt hatte, hatte er versucht, sie davon zu überzeugen, dass regelmäßige Körperpflege sehr wichtig war. Dabei war sich der Magier durchaus bewusst, dass er selbst eine Ausnahme war und dass seine tägliche Körperreinigung oft auf Unverständnis stieß. Doch er selbst war der beste Beweis dafür, dass das tägliche Bad nicht schadete, sondern Läuse und Flöhe fernhielt. Servatius allerdings schrieb dies eher den magischen Kräften des Zauberers und dessen Tinkturen und Salben zu.
Irgendwann hatte der Magier es aufgegeben, den Mönch von der Heilkraft des Bades zu überzeugen. Er wich Servatius’ Gestank aus, indem er stets so marschierte, dass der Wind den Mief von ihm wegwehte.
Zu Barnabas’ Freude aber hatte sich der junge Burghard seine Lehre von der Körperpflege zu Herzen genommen und damit begonnen, sich regelmäßig zu waschen – einerlei, wie das Wetter war. Sobald er einen Teich, Bach oder See entdeckte, hatte Burghard den Magier um ein Stück Seife gebeten und seinen Körper von Schmutz und Schweiß gereinigt. Sogar seinen Habit wusch der junge Mönch in regelmäßigen Abständen. Wenn der braune Umhang dann einen angenehmen Duft verströmte, hielt Burghard ihn mit einem breiten Lächeln seinem Lehrmeister Servatius unter die Nase, der sich angewidert abwandte.
In Gedanken seufzte der Magier leise. Er hätte es nie für möglich gehalten, dass er Burghard vermissen würde. Selten nur hatte jemand seinen Weg gekreuzt, der so begabt und wissbegierig wie dieser Bursche war. Alles, was der Magier dem jungen Mann erklärt oder erzählt hatte, sog dieser wie ein Schwamm in sich auf. Deshalb beantwortete er dem Jungen unermüdlich all seine Fragen. Doch jedes Mal, wenn Barnabas glaubte, dass der Wissensdurst des jungen Franziskaners nun gestillt sein müsste, stellte er ihm bereits die nächste Frage.
Begeistert von Burghards Neugierde, hatte Barnabas den Entschluss gefasst, den Jungen zu seinem Nachfolger auszubilden, denn schließlich war er nicht mehr Jüngste.
Es wäre eine Schande, wenn mein Wissen eines Tages verloren ginge!, dachte Barnabas und schielte vorsichtig zu Servatius. Du bist schuld, dass der Junge weggelaufen ist. Ich hätte besser dich fortgejagt, denn dich kann man zu nichts gebrauchen!, grollte er in Gedanken.
Monatelang waren der Magier und die zwei Mönche durch Thüringen gezogen, hatten Kranke behandelt und guten Lohn dafür eingenommen. Sicherlich wären die drei so unterschiedlichen Männer noch lange zusammen durchs Land gereist, hätte der Magier nicht einen folgenschweren Zwist herausgefordert. Wenn Barnabas damals geahnt hätte, was der Diebstahl von wenigen Kreuzern auslösen würde, hätte er Servatius das Geld niemals entwendet.
Während ihrer gemeinsamen Reise durchs Eichsfeld war es Barnabas nicht entgangen, dass der ältere Mönch Geld zur Seite geschafft hatte. Servatius war ein Gauner, der den Familien der Kranken, die Barnabas heilte, mehr Münzen abnahm, als der Magier verlangt hatte. Der Besitz der Münzen ließ Servatius hochmütig werden. Immer häufiger widersetzte er sich den Befehlen des Magiers und drohte, mit Burghard allein weiterzuziehen. Er schien zu glauben, dass das entwendete Geld ihn unabhängig machte, und da er keine Angst vor den Kräften des Zauberers hatte, lehnte er sich immer wieder gegen den Magier auf.
Barnabas hatte keine Bedenken, dem Mönch das unterschlagene Geld heimlich zu entwenden, um ihn von seinem hohen Ross herunterzuholen. Da sie ihr Zelt zu dieser Zeit vor der Stadtmauer von Worbis auf dem Eichsfeld zwischen vielen anderen Reisenden aufgeschlagen hatten, war Barnabas der festen Ansicht gewesen, dass Servatius einen der Fremden des Diebstahls bezichtigen würde.
Doch der Mönch hatte sofort seinen Klosterbruder Burghard beschuldigt und mörderische Rache geschworen. Außer sich vor Wut war Servatius über den Platz gelaufen auf der Suche nach dem Jungen. Doch Burghard war längst in höchster Angst geflohen.
Da der Magier Burghard schützen wollte, versuchte er Servatius zu beruhigen und gab ihm sogar einen Teil des gestohlenen Geldes zurück. Als Gegenleistung musste Servatius schwören, Burghard nicht weiter zu verfolgen. Er stimmte der Forderung zu, nicht ahnend, dass es das unterschlagene Geld war, das der Magier ihm theatralisch in die Handfläche legte.
Nach Burghards Flucht hatten der Magier und Servatius die Reise durchs Eichsfeld allein fortgesetzt. Ihr Weg führte beide nach Heiligenstadt, wo sie den Händler Albert Jacobi von einem schweren Leiden heilen konnten und deshalb das Vertrauen und die Gastfreundschaft seiner Familie genießen durften. Als die Eheleute Jacobi Barnabas und Servatius baten, ihre Tochter Katharina auf ihrer Wallfahrt zum Hülfensberg zu begleiten, stimmte Barnabas sogleich zu.
Nie und nimmer hätte der Magier geglaubt, dass sie ausgerechnet Burghard auf dem Hülfensberg wiedersehen würden. Servatius konnte vor Zorn kaum an sich halten, als er den Jungen erblickte. Doch er war machtlos, als er ihn gemeinsam mit Katharina Hand in Hand im Wald verschwinden sah. Da Barnabas Katharinas Eltern versprochen hatte, ihre Tochter unversehrt zurück nach Hause zu bringen, blieb ihm nun nichts anderes übrig, als die beiden zusammen mit Servatius zu verfolgen.
Ihre Suche führte sie nach Eschwege an der Werra, wo sie von dem Diebstahl eines Kahns hörten. Beide hatten nun keinen Zweifel mehr daran, dass Burghard und das Mädchen über die Werra ins Hessenland geflohen waren. Und so durchstreiften die beiden Männer seitdem diese Region, doch sie fanden keine Spur von den Flüchtigen.
Mittlerweile waren mehrere Monate vergangen, und Barnabas hatte die Hoffnung aufgegeben, Burghard oder Katharina zu finden. »Das Land ist einfach zu groß!«, versuchte er seinen Weggefährten umzustimmen. »Burghard wird das Geld in der Zwischenzeit ausgegeben haben.«
Servatius strafte ihn mit einem bitterbösen Blick. »Das ist mir einerlei. Ich will diese Ratte winseln hören, wenn ich ihm alle Knochen breche.«
Du bist und bleibst ein Dummkopf!, höhnte Barnabas im Stillen. Dumm, aber brutal. Und das ist eine gefährliche Mischung!
Der Magier hatte oft erlebt, wie unbarmherzig Servatius bei Hexenprozessen sein konnte. Es war dem Berufsstand der Zauberer vorbehalten, vermeintliche Hexen zu erkennen und ihren Schadenszauber aufzuheben. Barnabas war einer der Besten seines Standes und weit über alle Grenzen hinaus bekannt. Die Menschen erwarteten ihn mit Ehrfurcht und empfingen ihn mit Achtung – erst recht, seit er in Begleitung zweier Franziskanermönche reiste. Anfangs war Barnabas von der Gewissenlosigkeit des älteren Mönchs angetan gewesen, denn auch er war nicht zimperlich beim Verhör der Frauen, die er als Hexen erkannt hatte. Doch bald beobachtete der Magier, wie die Qual der Frauen unter der Folter den Franziskaner erregte, und Barnabas verlor jegliche Achtung vor dem Mönch. Zwar hegte der Magier keinen Zweifel an der Notwendigkeit der Tortur, gehörte Folter doch zur Wahrheitsfindung. Doch seine Würde verbot ihm, die Hilflosigkeit der Frauen auszunutzen.
Angewidert schüttelte sich der Magier, als er an den Gesichtsausdruck von Servatius dachte, wenn dieser sich an dem Elend der Frauen ergötzte. Jedes Mal biss sich der Mönch dann vor Erregung so lange in die Faust, bis er Blut schmeckte. Da er dabei seine Zähne stets tief ins eigene Fleisch grub, war seine rechte Hand stark vernarbt.
Barnabas’ Blick streifte den Mönch erneut. Servatius’ Gesicht und Hals waren übersät von entzündeten Flohstichen, auf denen sich kleine gelbe Köpfchen gebildet hatten, da er sich ständig kratzte. Selbst auf der Tonsur, der ausrasierten Stelle am Hinterkopf, waren entzündete Pusteln zu erkennen. Angeekelt schaute der Magier wieder vor sich auf den Weg. Nur zu gerne hätte er den Mönch davongejagt.
Barnabas war jahrelang allein durch die Lande gezogen und hatte nichts und niemanden vermisst. Als sich jedoch die beiden Mönche ihm vor vielen Monaten anschlossen, gewöhnte er sich rasch an ihre Gesellschaft, die ihm auch Sicherheit in unruhigen Zeiten verschaffte. Denn es herrschte Unruhe im Land, und unterwegs hörte der Magier immer wieder von anderen Reisenden, dass es in Böhmen Auseinandersetzungen zwischen Lutheranern und Katholiken gab.
Die katholischen und evangelischen Fürsten, die seit der christlichen Erneuerung ein friedliches Miteinander angestrebt hatten, waren mittlerweile verstorben, und die jungen Herrscher strebten die Ausdehnung ihres Machtbereichs an. Dazu gehörte, dass Katholiken von den Evangelischen die Besitztümer zurückforderten, die man der Kirche abgenommen hatte. Sie drohten, ihre Forderungen auch mit Gewalt und auf Kosten der Gegner durchzusetzen.
Barnabas war sich sicher, dass Böhmen kurz vor einem Krieg stand. »Lutheraner gegen Katholiken – wir wissen, was das bedeutet!«, hatte ihm ein Reisender, der ihm auf dem Weg begegnet war, zugeflüstert. Und der Heiler wusste, dass das nur bedeuten konnte, dass es auch bald im Reich brodeln würde.
Zudem war die wirtschaftliche Lage im Reich angespannt und viele Menschen verarmt. Seit Jahren schon herrschten ungewöhnlich lange und harte Wintermonate, und selbst der Sommer war meist verregnet. Das Korn verfaulte auf den Feldern, bevor es geerntet werden konnte, und das Vieh fand kaum genug zu fressen. Viele Menschen starben. Andere verloren ihr Dach über dem Kopf. Die Not machte einst brave Bürger zu Landstreichern und Dieben, die auch vor Mord nicht zurückschreckten. Ein Menschenleben zählte nichts mehr.
Barnabas konnte nicht leugnen, dass er sich sicherer fühlte, wenn jemand an seiner Seite reiste, auch wenn er dessen Gesellschaft verabscheute. Zwar hätte er sich einen anderen Weggefährten suchen können. Doch Servatius konnte er einschätzen, er kannte seine Schwächen, seine Stärken. Barnabas wusste, dass der Mönch ihn nicht fürchtete, aber er war sich sicher, dass Servatius sich nicht trauen würde, ihm Böses anzutun.
Barnabas seufzte leise. Vielleicht meint das Schicksal es erneut gut mit mir, und ich treffe auf einen Menschen, der wie der junge Burghard ist, dachte er. Tief in seinem Inneren aber hoffte er, dass er eines Tages den Franziskanermönch wiedersehen würde.
Bei dem Gedanken glitt ein Lächeln über sein Gesicht.
Kapitel 3
Hundeshagen auf dem Eichsfeld im Juli 1617
Als in der Ferne die Kirchturmuhr sieben Mal schlug, betrat Bauer Bonner das Wirtshaus »Zum Blembel«. Er blieb im Türrahmen stehen, den seine massige Gestalt fast vollkommen ausfüllte. Nickend begrüßte er die anderen Gäste, die den Gruß kaum erwiderten. Mit finsterer Miene setzte sich Bonner an den Tisch, der seinem Stand vorbehalten war, und bestellte ein Bier. Bevor die Magd den Krug auf dem Tisch abstellen konnte, nahm er ihn ihr schon aus der Hand und leerte ihn in einem Zug.
»Bring mir noch eins!«, brummte er mit glasigen Augen. Bereits zu Hause hatte er einige Krüge getrunken und daneben schon mehrere Gläser Branntwein gekippt.
Mit unruhiger Hand führte Bonner den gefüllten Krug an die Lippen, wobei das Bier über den Rand auf seine Hose schwappte. Missmutig wischte er den dünnen weißen Schaum von seinem Beinkleid. Er wusste, dass seine Hände nicht zitterten, weil er schon reichlich getrunken hatte, sondern weil er innerlich vor Wut kochte. In Gedanken verfluchte er seinen Sohn Johann und seine Frau Annerose, denn sie waren schuld daran, dass die Leute ihn, den Großbauern, kaum noch beachteten. Seine Frau wie auch sein Sohn hatten sich ihm auf unterschiedliche Weise widersetzt und ihn zum Gespött der Leute gemacht. Johann, weil er mit einer Hexe durchgebrannt war, und Annerose, weil sie selbst Hand an sich gelegt hatte. Zwar hatte Anneroses Bruder, der Pfarrer Lutz Lambrecht, versucht nichts von ihrem Selbstmord nach außen dringen zu lassen, doch rasch war ihr Freitod zum Dorfgespräch geworden. Erst recht nachdem der Pfarrer seine Schwester mitten auf dem Kirchhof und nicht wie bei Selbstmördern üblich am Rand beerdigt hatte.
Bonners Blick verfinsterte sich. Er hatte gehofft, dass man seinen Schwager Lambrecht deshalb zurechtweisen würde. Doch der Pfarrer wusste, wie er seine Schäfchen beruhigen konnte, und predigte so manches Gleichnis über Nächstenliebe von der Kanzel herunter. Da er zudem der einzige Pfarrer der Umgebung war und in der Gunst des Grafen Adolph Ernst von Wintzingerode stand, wusste jeder, dass das für eine Selbstmörderin unangemessene Begräbnis keine Folgen für den Geistlichen haben würde.
Auch Bonner war sich darüber im Klaren, und diese Gewissheit nährte seinen Zorn. Nur zu gerne hätte er seinen Schwager davongejagt, um wenigstens ein bisschen Genugtuung zu verspüren. Schließlich musste irgendjemand dafür büßen, dass Annerose sich mit Bonners Schützengürtel erhängt hatte.
Dreimal hintereinander musste man beim Wettschießen gewinnen! Dreimal! Erst dann durfte man diesen wertvollen Preis mit nach Hause nehmen: einen Gürtel aus feinstem Leder, dessen Schnalle ein Fachmann mit einem Hämmerchen kunstvoll bearbeitet hatte. Auch war der Verschluss mit kleinen Halbedelsteinen verziert, so dass der Träger des Gürtels sich wie ein Edelmann fühlte.
Dieser Gürtel war auf dem Eichsfeld einmalig, und dieses Miststück erhängte sich einfach damit! Wenn sie dafür wenigstens ein wertloses Stück Seil genommen hätte! Doch dieses Luder muss mich selbst nach ihrem Tod noch ärgern, schimpfte der Großbauer in Gedanken und hieb den Krug mit lautem Knall auf den Tisch. Erschrocken blickten die übrigen Gäste zu ihm herüber, doch Bonner beachtete sie nicht weiter. Wütend schweiften seine Gedanken wieder zu der Toten.
Um das Weibsstück von der Türklinke losmachen zu können, war ihm nichts anderes übrig geblieben, als das edle Leder zu zerschneiden. Nie würde Bonner den Anblick des durchschnittenen Gürtels vergessen, der in diesem Moment unbrauchbar und wertlos geworden war. Wäre seine Frau nicht schon tot gewesen, er hätte sie eigenhändig in die Hölle befördert.
Zwar hatte Bauer Bonner wenige Tage später einen neuen Gürtel für die Schnalle in Auftrag gegeben, doch der Gerber hatte kein vergleichbares Leder auftreiben können. Das Ziegenleder war zu dünn und das Schweinsleder zu grobporig. Erst nach Wochen hatte er Rossleder beschaffen können, das dem zerschnittenen am ähnlichsten war. Obwohl Bonner den Gürtel nun wieder nutzen konnte, war ihm doch die Freude an dem wertvollen Stück vergangen.
Der Bauer schnaubte ungeduldig. Wo blieb nur Harßdörfer? Punkt sieben waren sie hier verabredet gewesen. Was Albrecht wohl von mir will?, überlegte Bonner gereizt. Mit den Fingerspitzen schnippte er in Richtung Wirtsfrau, und als sie endlich zu ihm blickte, zeigte er auf seinen leeren Krug und schimpfte: »Willst mich wohl verdursten lassen!«
»Das kann dir heute nicht mehr passieren, Großbauer«, erwiderte sie spitz.
In dem Augenblick öffnete sich die Wirtshaustür, und der Bürgermeister von Duderstadt betrat den Schankraum. Sofort wurde er von allen laut begrüßt. Nur Bonner sagte keinen Ton, sondern sah dem Mann gereizt entgegen.
Kaum saß Harßdörfer am runden Tisch, brachte der Wirt persönlich ihm einen Krug Bier und erkundigte sich nach seinem Befinden. Aus geröteten Augen blickte Bonner ungeduldig von einem zum anderen. Endlich ging der Gastwirt zurück hinter den Tresen.
»Du siehst schlecht aus, Casper!«, spöttelte der Bürgermeister zwischen zwei Schlucken. »Vielleicht solltest du öfter Wasser statt Bier trinken!«
»Kümmere du dich um deine eigenen Angelegenheiten, Albrecht! Warum willst du mich sprechen? Doch nicht nur, um mich zu verhöhnen.«
»Nun sei nicht so empfindlich, mein Lieber. Ich meine es nur gut mit dir. Schließlich sind deine Freunde rar geworden.«
Während der Bürgermeister den Krug erneut an die Lippen setzte, konnte er sich ein leises Lachen kaum verkneifen.
Bonner schluckte und fragte erneut: »Was willst du von mir?«
Plötzlich wich aus Harßdörfers Blick jegliche Freundlichkeit, und seine Züge wurden hart. Sein Gesicht näherte sich Bonners, so dass die übrigen Gäste seine Worte nicht verstehen konnten. »Ich habe dich immer wieder gewarnt, Casper! Wenn du das Gerücht in die Welt setzt, dass eine Hexe unter deinem Dach wohnt, dann musst du sie anklagen, damit wir sie verurteilen und brennen lassen können. Aber es geht nicht, dass du sie laufen oder gar verschwinden lässt.«
»Was kann ich dafür? Graf von Wintzingerode ...«
»Du allein trägst die Schuld!«, wurde er von dem Bürgermeister unterbrochen. »Nur du!«
»Johann kann mit dem Weibsbild sonst wo sein!«
Harßdörfer nahm erneut einen Schluck Bier und fuhr fort: »Heute kam der Ausrufer von Duderstadt in mein Haus.«
Fragend blickte Bonner auf.
»Josef ist der Neffe meiner Frau«, erklärte Harßdörfer. »Er gibt bekannt, wann Bier gebraut wird, damit niemand in die Brehme pinkelt.«
»Mich interessiert nicht, wann Bier gebraut wird, sondern nur, wann es getrunken werden kann«, brummte der Bauer mit schwerer Zunge. Kaum merklich schüttelte der Bürgermeister den Kopf. So viel Dummheit war nur schwer zu ertragen. »Halt’s Maul, Casper, und höre mir zu! Josef war auf dem Hülfensberg. Dort hat er deinen Sohn und das Liebchen erkannt.« Erwartungsvoll blickte der Bürgermeister in das aufgedunsene Gesicht des Großbauern, dessen Augen sich ungläubig weiteten.
»Das kann ich mir nicht vorstellen!«, flüsterte Bonner mit heiserer Stimme. Mehrmals musste er sich räuspern. Um abzulenken, fragte er: »Was macht der Neffe deiner Frau auf dem Hülfensberg? Da gehen doch nur die Katholischen hin.«
»Er hat an die Pilger Bier verkauft«, antwortete Harßdörfer gereizt.
»Und er will das Miststück erkannt haben? Doch woher kennt er das Mädchen? War es etwa auch sein Liebchen?«
»Im Gegensatz zu dir will nicht jeder andere Mann unter den Rock dieses Weibstücks!«
»Ach, dummes Zeug!«, begehrte Bonner auf, doch seine Abwehr war nur gespielt.
»Ich kenne dich, Casper! Also halte mich nicht für dumm.«
Als Bonner schwieg, fuhr der Bürgermeister fort: »Josef hat die Frau das erste Mal gesehen, als sie auf einem Pferd aus Duderstadt geritten kam. Er sagte, dass sich ihre Blicke zwar nur für einen kurzen Moment gekreuzt hätten, er aber diese Augen nie vergessen würde. Er schwor, dass ihre Augen wie die des leibhaftigen Teufels geglüht hätten. Deshalb ist er sich auch sicher, dass es sich bei der Frau auf dem Hülfensberg um die Hexe handelt.«
»Haben ihre Augen dort auch geglüht?«, fragte Bonner und erschauerte. Harßdörfer zuckte mit den Schultern. »Das sagte er nicht, aber der Junge war kreidebleich, als er mir davon berichtete.«
»Sie sind fort und sollen es auch bleiben!«, schimpfte Bonner und bestellte zwei weitere Krüge Bier.
Harßdörfer musste an sich halten, um den Bauern nicht am Kragen zu packen. Der Depp verstand anscheinend nicht, um was es ging. Mit unterdrückter Wut versuchte er es dem Bauern zu erklären: »Als du mir das erste Mal von deinem Verdacht erzähltest, sagte ich, dass, wenn du diesen Weg wählst, du ihn auch zu Ende gehen musst. In dieser Gegend hat es seit Jahren keinen Hexenprozess gegeben. Alles war still und friedlich. Doch kaum beschuldigst du deine Magd der Hexerei, geben die Kühe weniger Milch, und die Leute verdächtigen sich gegenseitig.«
»Aber ...«, versuchte Bonner aufzubegehren.
»Nichts aber!«, unterbrach der Bürgermeister ihn ungehalten. »Du wirst die Hexe nach Duderstadt zurückbringen, bevor dort mehr als nur ein Scheiterhaufen brennen wird. In der Zwischenzeit werde ich einen anderen Notar beschaffen, denn Wilhelm Münzbacher ist auf dem Hülfensberg auf tragische Weise zu Tode gekommen.« Harßdörfer überlegte. »Vielleicht hat die Hexe auch mit seinem Tod etwas zu tun. Nun, das werden wir unter der Folter aus ihr herauspressen.« Lachend hob er seinen Krug und prostete Bonner zu. »Herauspressen! Was für ein schönes Wortspiel.« Doch dann wurde er wieder ernst. »Casper, wenn du die Hexe nicht zurück nach Duderstadt bringst, dann ...«
Erschrocken blickte der Großbauer den Bürgermeister an.
»Ich habe dir bereits vor Wochen erklärt: Entweder brennt die Hexe oder du! Und dann, mein Lieber, fällt der Bonnersche Besitz an die Stadt, und deine Tochter wird man davonjagen.«
Bonners Herzschlag beschleunigte sich. »Aber wo soll ich die beiden suchen? Vom Hülfensberg aus können sie überallhin geflüchtet sein!«
»Jaul nicht, Casper! Du bist ein Jäger, und ein Jäger stöbert das Wild auf. Genauso musst du die Hexe aufspüren. Doch du musst dich eilen, Casper, denn so wie eine Meute Bluthunde kaum zu bändigen ist, wenn sie erst eine Fährte gewittert hat, ebenso wenig kann ich die Ratsmitglieder noch viel länger hinhalten. Dein Besitz ist groß, und du hast so manchen Neider unter ihnen, der nur darauf lauert, dir alles zu nehmen.«
Bonner lehnte sich in seinem Stuhl zurück. Wie zur Abwehr verschränkte er die Arme vor seiner breiten Brust, die sich heftig hob und senkte.
»Bevor mein Hab und Gut an diese Futterneider fällt, laufe ich lieber bis ans Ende der Welt, um diese elende Hexe zu finden.«
Erfreut führte der Bürgermeister seinen Krug an die Lippen und murmelte: »So ist es recht, Casper! So ist es recht!«
Bonner blickte Harßdörfer nachdenklich an. »Warum erzählst du mir das? Schließlich würdest auch du etwas von meinem Land abbekommen!«
Mit dieser Frage hatte der Bürgermeister gerechnet, er war vorbereitet: »Wir kennen uns schon eine Ewigkeit und haben so manches Wildschwein zusammen gejagt. Wäre meine Christel damals nicht schwanger geworden, hätte ich deine Schwester geheiratet, und du wärst mein Schwager geworden. Ich fühle mich dir verbunden, mein Freund. Deshalb bin ich heute hier. Außerdem brauche ich keinen weiteren Besitz. Ich bin reich genug!«
Hastig prostete Harßdörfer dem Bauern zu und senkte den Blick. Bonner sollte in seinen Augen weder erkennen, dass er log, noch, dass er Angst hatte.
Bonner bemerkte nichts. Ihm standen vor Angst Schweißperlen auf der Stirn, und seine Wangen waren derart gerötet, als plage ihn Fieber. Keuchend bat er Harßdörfer um ein Versprechen: »Wenn ich fort bin, musst du auf mein Karolinchen aufpassen! Gib acht, dass sie niemand vorzeitig vom Hof verjagt oder ihr Leid zufügt! Versprich mir das, Albrecht. Ich werde noch vor Jahresende die Hexe nach Duderstadt zurückbringen. Kannst du die Ratsmitglieder so lange hinhalten?«
»Ich werde alles versuchen, was in meiner Macht steht, Casper. Und auf deine Tochter werde ich aufpassen, als wäre sie meine eigene. Das verspreche ich dir bei meiner Ehre, alter Freund.«
***
Zu Hause begab sich Bonner sofort in die Küche, wo seine Tochter Karoline am Tisch saß und einen Läufer bestickte. Als er eintrat, blickte sie auf und schenkte ihm ein Lächeln.
»Ich habe auf dich gewartet, Vater! Sicher hast du Hunger. Soll ich dir das Essen aufwärmen?«
Der Bauer strich der Vierzehnjährigen mit seiner Pranke zärtlich über den Scheitel. »Du warst mir schon immer die Liebste, mein Kind!« Fragend blickte Karoline den Vater an.
»Brot und Feldkieker reichen mir«, lenkte er das Mädchen ab, obwohl er keinen Hunger verspürte. Er wollte seine Tochter nicht mit seinen Sorgen belasten – jedenfalls nicht heute. Da er jedoch schnellstmöglich aufbrechen musste, würde er ihr schon morgen alles erzählen. Bei dem Gedanken, seine Tochter allein zurücklassen zu müssen, wurde ihm schwer ums Herz. Karoline bemerkte davon nichts. Eifrig schnitt sie zwei Scheiben Brot und ein dickes Stück von der Hartwurst ab. Beides legte sie auf ein Holzbrett, das sie vor dem Vater auf den Tisch stellte.
»Soll ich dir einen Becher Würzwein wärmen, Vater?«
Der Bauer schüttelte sich. »Um Himmels willen, Kind! Nur nichts Warmes. Ein Bier wäre mir recht.«
***
Nachdem Bonner das Gasthaus verlassen hatte, blieb Harßdörfer noch eine Weile sitzen. Nachdenklich starrte er auf einen dunklen Punkt im Tischholz, der langsam vor seinen Augen verschwamm.