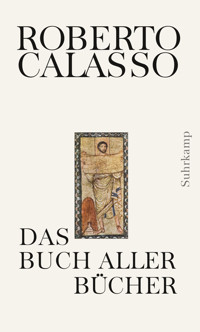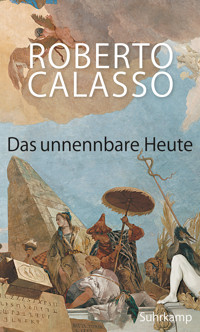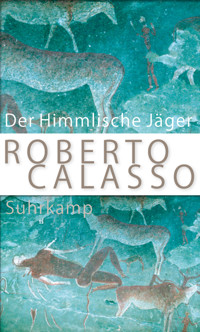
32,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Suhrkamp Verlag
- Kategorie: Wissenschaft und neue Technologien
- Sprache: Deutsch
Es gab eine Epoche, in der man, wenn verschiedene Lebewesen aufeinander trafen, nicht genau wusste, ob es sich um Tiere oder Götter, Dämonen oder Ahnen handelte. Oder einfach um Menschen. Eines Tages, der viele tausend Jahre dauerte, machte Homo etwas, das noch keiner versucht hatte: Er begann die Tiere nachzuahmen, die ihn jagten, die Raubtiere. Er wurde zum Jäger. Es war ein langer und schwieriger Prozess, der Spuren und Narben in Riten und Mythen und im Verhalten hinterließ.
Zahlreiche Kulturen, räumlich und zeitlich weit voneinander entfernt, brachten einige dieser dramatischen und erotischen Geschehnisse in Verbindung mit der Himmelsregion zwischen Sirius und Orion: dem Ort des Himmlischen Jägers. Dessen Geschichten, in dieses Buch hineingeflochten, greifen in viele Richtungen aus, reichen vom Paläolithikum über Ägypten und das alte Griechenland bis zur Turingmaschine. Sie erkunden die verborgenen Verbindungen innerhalb dieses einen, nicht einzugrenzenden Territoriums, das der Geist ist.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 725
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Roberto Calasso
Der Himmlische Jäger
Aus dem Italienischen von Reimar Klein und Marianne Schneider
Suhrkamp
Was ist Gott oder nicht Gott oder das dazwischen?
Euripides, Helena
Übersicht
Cover
Titel
Inhalt
Informationen zum Buch
Impressum
Hinweise zum eBook
Inhalt
Cover
Titel
Motto
Inhalt
I
Zur Zeit des Großen Raben
II
Die Herrin der Tiere
III
Der Speer mit der goldenen Spitze
IV
Die kurze Zeit der Heroen
V
Weise und Räuber
VI
Zeus' letzte Nacht auf der Erde
VII
Schaum bin ich gewesen
VIII
Nächtliche Versammlung
IX
Die Nacht der Hermenverstümmler
X
Der Betrachtende
XI
Statuen
XII
O Ägypten, Ägypten …
XIII
Das Göttliche vor den Göttern
XIV
Die Rückkehr nach Eleusis
Quellen
Register
Informationen zum Buch
Impressum
Hinweise zum eBook
IZur Zeit des Großen Raben
Zur Zeit des Großen Raben war auch das Unsichtbare sichtbar. Und verwandelte sich unablässig. Die Tiere waren damals nicht unbedingt Tiere. Es konnte geschehen, dass sie Tiere waren, aber auch Menschen, Götter, Herren einer Spezies, Dämonen, Vorfahren. Und so waren auch die Menschen nicht unbedingt Menschen, sondern konnten auch die vorübergehende Form von etwas anderem sein. Es gab keine Mittel, um zu erkennen, wer erschien. Man musste ihn schon kennen, wie man einen Freund oder einen Gegner kennt. Alles geschah, von den Spinnen bis zu den Toten, innerhalb eines einzigen Flusses von Formen. Es war das Reich der Metamorphose.
Die Veränderung kannte keinen Stillstand – wie es später nur in der Höhle des Geistes der Fall war. Dinge, Tiere, Menschen: niemals klare, stets provisorische Unterscheidungen. Als sich ein großer Teil des Existierenden ins Unsichtbare zurückzog, hörte er deshalb doch nicht auf zu geschehen. Aber man konnte leichter denken, er geschehe nicht.
Wie konnte das Unsichtbare wieder sichtbar werden? Indem es die Trommel belebte. Dieses gespannte Fell eines toten Tieres war das Reittier, war die Reise, der goldene Wirbel. Es führte dorthin, wo die Gräser brüllen, wo die Binsen stöhnen, wo nicht einmal eine Nadel in die Dichte des Graus eindringen könnte.
Als die Jagd aufkam, war da nicht ein Mensch, der ein Tier verfolgte. Da war ein Lebewesen, das ein anderes Lebewesen verfolgte. Niemand hätte mit Sicherheit sagen können, wer der eine und wer der andere war. Das verfolgte Tier konnte ein verwandelter Mensch oder ein Gott oder einfach ein Tier oder ein Geist oder ein Toter sein. Und eines Tages fügten die Menschen ihren vielen Erfindungen eine weitere hinzu: Sie begannen sich mit Tieren zu umgeben, die sich den Menschen anpassten, während es unendlich lange die Menschen gewesen waren, die die Tiere nachahmten. Sie wurden sesshaft – und schon etwas weniger lebhaft.
Warum zögert man so lange, ehe man die Jagd auf den Bären beginnt? Weil der Bär auch ein Mensch sein könnte. Vorsicht war geboten beim Sprechen, denn der Bär konnte alles hören, was man über ihn sagte, so weit man auch entfernt war. Auch wenn er sich in seine Höhle zurückzog, auch wenn er schlief, verfolgte er weiter die Ereignisse der Welt. »Die Erde ist das Ohr des Bären«, hieß es. Wenn man zusammenkam, um sich zur Jagd zu verabreden, wurde der Bär nie genannt. Ja, er wurde überhaupt, wenn von ihm die Rede war, nie beim Namen genannt: Er war »der Alte«, »der Schwarze Alte«, »der Großvater«, »der Cousin«, »der Ehrwürdige«, »das Schwarze Tier«, »der Onkel«. Wer sich auf die Jagd vorbereitete, tat den Mund nicht auf. Vorsichtig, konzentriert, wussten sie, dass der geringste Laut genügen würde, das Unternehmen scheitern zu lassen. Wenn der Bär unerwartet im Wald auftaucht, ist es ratsam, beiseitezutreten, den Kopf zu entblößen und zu sagen: »Geh deiner Wege, Ehrenwertester.« Oder aber man versucht ihn zu töten. Alles am Bären ist wertvoll. Sein Körper ist ein Heilmittel. Wenn es ihnen gelang, ihn zu erlegen, machten sie sich schnellstens aus dem Staub. Dann erschienen sie wie zufällig wieder an derselben Stelle, als wären sie auf einem Spaziergang. Und entdeckten zu ihrer großen Verwunderung, dass Unbekannte den Bären getötet hatten.
Das erste göttliche Wesen, dessen Namen man nicht aussprechen durfte, war der Bär. Darin war der Monotheismus keine Neuerung, sondern eine Wiederaufnahme, eine Verschärfung. Neu war das Bilderverbot.
Sie sprachen mit dem Bären, ehe sie auf ihn losgingen – oder gleich danach –, wohl wissend, dass der Bär jedes Wort verstand. »Wir sind es nicht gewesen«, sagten einige. Sie dankten dem Bären, weil er sich töten ließ. Oft entschuldigten sie sich. Einige gingen so weit zu sagen: »Ich bin arm, darum mache ich Jagd auf dich.« Einige sangen, während sie den Bären töteten, sodass der Bär im Sterben sagen konnte: »Mir gefällt dieses Lied.«
Sie hängten den Schädel des Bären zwischen die Äste eines Baumes, manchmal mit Tabak zwischen den Zähnen. Manchmal mit roten Streifen verziert. Sie hängten Bänder an ihn, packten die Knochen in ein Bündel und hängten sie an einen anderen Baum. Wenn ein Knochen verlorenging, gab der Geist des Bären dem Jäger die Schuld. Die Nase landete an irgendeinem geheimen Ort in den Wäldern.
Wenn sie ein Bärenjunges fingen, steckten sie es in einen Käfig. Oft gab die Frau des Jägers ihm von ihrer Muttermilch. So wuchs es heran, bis eines Tages, nach der Öffnung des Käfigs, »das liebe kleine göttliche Wesen« zu dem Fest eingeladen wurde, auf dem es geopfert werden sollte. Alle tanzten unter Händeklatschen um den Bären. Die Frau, die ihn mit ihrer Milch genährt hatte, weinte. Dann richtete ein Jäger ein paar Worte an den Bären: »O du Göttlicher, du bist in die Welt geschickt worden, damit wir dich jagen. O du teure kleine Gottheit, wir verehren dich; hör unser Gebet. Wir haben dich genährt und wir haben dich aufgezogen mit vieler Mühe, da wir dich lieben. Jetzt, wo du groß geworden bist, schicken wir dich zu deinem Vater und deiner Mutter. Wenn du zu ihnen kommst, sprich gut von uns und sage ihnen, wie freundlich wir gewesen sind; bitte, komm wieder zu uns, wir werden dich dann opfern.« Dann töteten sie ihn.
Das älteste Denken, dasjenige, das zum ersten Mal nicht das Bedürfnis verspürte, als Erzählung aufzutreten, zeigte sich in der Form der Aphorismen über die Jagd. Wie ein Flüstern, zwischen Zelten und Feuern, wie Kinderreime sind sie weitergegeben worden:
»Das Wild ist den Menschen ähnlich, nur ist es heiliger.«
»Die Jagd ist etwas Reines. Das Wild liebt die reinen Menschen.«
»Wie könnte ich auf die Jagd gehen, wenn ich vorher nicht zeichnete?«
»Die größte Gefahr im Leben ist, dass die Speise der Menschen ganz aus Seelen besteht.«
»Die Seele des Bären ist ein Bär in klein, der sich in seinem Kopf befindet.«
»Der Bär könnte sprechen, doch vermeidet er es lieber.«
»Wer mit dem Bären spricht und ihn beim Namen nennt, macht, dass er freundlich und ungefährlich wird.«
»Ein Stümper, der opfert, fängt mehr Wild als ein tüchtiger Jäger, der nicht opfert.«
»Die Tiere, die man jagt, sind wie Frauen, die kokettieren.«
»Die Weibchen der Tiere verführen die Jäger.«
»Jede Jagd ist Jagd auf Seelen.«
Am Anfang war nicht einmal klar, wozu die Jagd diente. Wie ein Schauspieler auf der Bühne, der sich in eine Figur hineinzuversetzen sucht, probierten sie, Raubtiere zu werden. Bestimmte Tiere aber konnten schneller laufen. Andere waren imposant und vorsichtig. Und Töten, was war das eigentlich? Kaum etwas anderes als sich töten. Wenn der Mensch zum Bären wurde, erschlug er, wenn er ihn tötete, sich selbst. Und noch dunkler war die Beziehung zwischen Töten und Essen. Wer isst, lässt etwas verschwinden. Das war sogar noch geheimnisvoller als das Töten. Wohin verschwindet das, was verschwindet? Im Unsichtbaren. Das am Ende von Anwesendem wimmelt. Es gibt nichts Belebteres als die Abwesenheit. Was war also zu tun im Hinblick auf all jene Wesen? Vielleicht sollte man ihnen den Übergang in die Abwesenheit erleichtern und sie auf einem Abschnitt ihrer Reise begleiten. Die Tötung war wie ein Gruß. Und wie jede Begrüßung verlangte sie bestimmte Gesten, bestimmte Worte. Sie begannen, Opfer zu zelebrieren.
Am Anfang ist die Jagd eine unumgängliche Handlung, am Ende ein willkürlicher Akt. Sie bildet eine Folge von rituellen Praktiken aus, die dem Akt (der Tötung) vorausgehen und auf ihn folgen. Der Akt kann zeitlich eingekreist werden, mehr nicht, so wie die Beute im Raum. Aber der Verlauf der Jagd selber ist unnennbar und unbeherrschbar, wie der Koitus. Man weiß nicht, was zwischen dem Jäger und der Beute geschieht, wenn sie aneinandergeraten. Gewiss ist allerdings, dass der Jäger vor der Jagd Demutsgesten vollzieht. Und nach der Jagd fühlt er das Bedürfnis, sich von einer Schuld zu befreien. Er nimmt das getötete Tier wie einen vornehmen Gast in seine Hütte auf. Vor dem soeben erschlagenen Bären murmelt er ein zuckersüßes, schwindelerregendes Gebet: »Erlaube mir auch in Zukunft, dass ich dich töte.«
Die Beute verlangt die Fokussierung: den Blick, der isoliert und das Gesichtsfeld auf einen Punkt zusammenzieht. Es ist eine Erkenntnis, die durch aufeinanderfolgende Zäsuren – indem sie Gestalten aus einem Hintergrund heraushebt – fortschreitet. Sie umgrenzt sie und isoliert sie so als Ziel. Ja, das Herauslösen selbst ist schon der Schlag, der sie trifft. Andernfalls kommt es zu keiner Gestalt. Die Mythen sind jeweils ein Sichüberlagern von ausgeschnittenen Profilen. Wenn diese Art der Erkenntnis ins Extrem getrieben wird und die Profile sich häufen, schließt sich das Gewebe des Hintergrunds, dem sie entrissen wurden, wieder zusammen. Das ist die Erkenntnis des Jägers.
Bei der Viehzucht und beim Ackerbau war das Tier nur Tier, für immer vom Menschen getrennt. Für die Jäger dagegen war das Tier noch ein anderes Wesen, weder Tier noch Mensch, von Wesen gejagt, die weder Tiere noch Menschen waren. Als es zu jenem Ereignis kam, welches das Ereignis aller Geschichte vor der Geschichte war, als die Trennung von etwas, was Tier heißen würde, durch etwas, was Mensch heißen würde, vollzogen wurde, konnte niemand sich vorstellen, dass die Weisheit – die alte und die neue Weisheit – sich bei jemandem finden ließe, der nicht an den beiden Formen des Lebens teilhatte. Inmitten der Höhlen und Wälder des Pelions wurde der Kentaur Cheiron zur Quelle der Weisheit, derjenige, der besser als jeder andere die Gerechtigkeit, die Astronomie, die Heilkunst und die Jagd lehren konnte. Und das war fast alles, was es damals zu lehren gab.
Für die von Cheiron erzogenen Heroen war die Jagd das erste Element der paideía. Doch diese »Erziehung«, diese erste Probe der aretḗ, jener »Vortrefflichkeit«, die dann so oft beschworen werden sollte, fand von Anfang bis Ende außerhalb der Grenzen der Gesellschaft statt. Und sie war nicht nützlich. Die Jagd, die die Heroen ausübten, diente nicht dazu, die Gemeinschaft zu ernähren. Sie war eine blutige und einsame Übung, die keinen anderen Zweck verfolgte. Bei der Jagd wendet sich das Tier gegen sich und versucht, sich zu töten. Ehe sie zu Helden so vieler Verwandlungsgeschichten wurden, waren die großen Jäger selbst das Ergebnis einer Verwandlung. Ehe Apollo den Wolf oder die Mäuse tötete, war er Wolf oder Maus. Ehe Artemis die Bärinnen tötete, war sie Bärin gewesen. Das Pathos der Jagd, die Komplizität zwischen Jäger und Beute geht auf den Ursprung zurück, als der Jäger selber das Tier war, als Apollo der General eines Mäuseheeres und der Anführer eines Wolfsrudels war. Das Fundament der Jagd war eine Entdeckung der Logik: das Wirken der Negation. Diese grundlegende und berauschende Entdeckung musste immer wieder neu erprobt und bestätigt werden. Parallel zum pulsierenden Leben der Stadt war in den Bergen ein anderes Leben zu Hause. Unermüdlich setzten Apollo und Artemis, und auch Dionysos, ihre einsame Jagd fort. Die Energie, die von ihren Taten ausging, war das notwendige Ungenannte, der verborgene Rahmen hinter dem Tauschverkehr des Marktes, der Ruhe der Familien, der Mühe auf den Feldern. Nichts von all dem, was das städtische Leben ausmachte, hätte bestehen können ohne diese Streifzüge, diese Hinterhalte in den Bergen, ohne diese abgeschnellten Pfeile und dieses Blut. Man könnte meinen, dass die Gesellschaft sich ohne dieses parallele und unnütze, umherschweifende Leben der in den Wäldern versprengten Jäger-Götter nie als genügend lebendig, vielleicht auch nicht als genügend real, empfunden hat. Wie das Gebet des Mönchs, so hielt der stille Lauf der Jäger-Götter die Mauern, die die Stadt umschlossen, aufrecht: Ja, es war dieser Lauf, der sie umschloss, als ob er ständig um sie kreiste.
Die Menschen wurden auf der Jagd zu metaphysischen Tieren. Der Ackerbau hätte dem Denken nur ein wesentliches Element hinzugefügt: den Rhythmus, den Wechsel von Blühen und Welken. Viel hätte er dagegen zu dem Gewicht beigetragen, mit dem die Gesellschaft auf dem Menschen lastet. Die großen Städte sind Erben jener Orte, wo zum ersten Mal in hohen Krügen Lebensmittelvorräte aufbewahrt wurden. Die Jäger konnten von den Vorräten nichts wissen. Sie hatten weder Inventare noch Annalen.
In Rocky Hill, im Zentrum Kaliforniens, stand der Paläoanthropologe Jean Clottes vor einer Felsenwand, die mit Malereien geschmückt war. Sein Führer war Hector, ein Yokut-Indianer, der Wächter des Ortes. Clottes konzentrierte sich auf eine Figur, die ihm wie ein Schamane mit seiner Trommel vorkam. »Es ist ein Bär«, sagte Hector. Überrascht erwiderte der Paläoanthropologe: »Ich hätte geglaubt, dass es sich um einen Menschen handelt.« »Das ist dasselbe«, sagte Hector – und schwieg.
Eines der Signale der Trennung vom Tier war die Verkleidung einer Bande von Menschen in ein Wolfsrudel: Endlich war man austauschbar, gleich, wie die Speichen eines Rades. Es war ein doppelter und gleichzeitiger Rausch: der des gejagten Tieres, das sich in ein Raubtier verwandelt – ein Rausch der Stärke und der Verwandlung, die freilich im Umkreis der Tiere verblieb; und der Rausch des Lebewesens, das das Gleiche, die Ersetzung, die Äquivalenz entdeckt – ein Rausch des Erkennens, der keinen sichtbaren Ausdruck findet, sondern eine Zäsur setzt, hinter die man dann nicht mehr zurückkann. Die ersten Gleichen waren die Wölfe und die Toten. Jenes Rudel von Lebewesen, deren jedes wie eine Verdopplung des anderen erschien, vollzog einen entscheidenden Schritt hin zur Abstraktion: Von da an wurde der Welt der Stempel der Identität aufgedrückt. Als unsichtbares Banner schwebte sie über ihnen – Banner eines Imperiums, das sich in einer multiplen, umherschweifenden, allgegenwärtigen Gestalt offenbarte.
Der erste Kunstgriff, um sich aus der tierischen Kontinuität zu lösen, ist die Maske, die Verkleidung. Jenes Wolfsrudel, das den Wald durchstreifte, bestand aus den ersten Menschen, den Ersten, die sich so unwiderruflich als Menschen fühlten, dass sie sich als Wölfe verkleiden wollten. Als der Mensch ein bloßer Menschen geworden war, konnte ihn ein letzter Vorhang vor der Welt verbergen: eine Maske aus Seide oder Samt, die den Mund freiließ. Auf Französisch heißt sie loup – denn bei bestimmten Wölfen trägt die Schnauze die Zeichnung einer Maske, als wollten sie den Menschen auffordern, sie nachzuahmen, indem er sich als Wolf maskiert.
Ohne Trommel gibt es keinen Schamanen. Doch nur der Schamane kann die Trommel beleben. Anfänglich ist die Trommel nackt, ein in einen Holzring eingespanntes Tierfell. Mit der Zeit kommen Metallteile hinzu, kleine Figuren, die angehängt werden und Resonanz erzeugen. Sie wird immer mehr mit Schmuck überladen. Der hölzerne Teil wird aus einem Birken- oder Lärchenstamm geschnitten. Die Metallteile sollten, wenn möglich, alt sein. Noch besser ist es, wenn sie von anderen Schamanen stammen. Der erste Ton der Trommel ähnelt dem Summen einer Wolke von Insekten und einem fernen Donnergrollen. Wenn sie sich belebt, wird sie ein Pferd, dann ein Adler. Wenn zwei Schamanen sich schlagen, tropft aus der Trommel des Besiegten Blut. Beim Tod eines Schamanen hängen sie seine Trommel an die Zweige des nächsten Baumes.
Der Schamane war gezwungen, in einer Welt zu agieren, zu der die anderen keinen Zugang hatten. Wenn er sich dort mit einem anderen Schamanen schlug, rief er Scharen von Geistern zu Hilfe. Er hatte einen glühenden Blick, den er oft hinter den Fransen seiner Mütze versteckte. Was der Bogen für den Jäger, das war die Trommel für den Schamanen. Der Bogen erlaubte es dem Jäger, sich in ein Tier zu verwandeln, das blitzschnell aufspringt und tödlich zubeißt. Die Trommel war der See, in dem der Schamane versank, um in eine Welt einzutreten, die die anderen nicht sehen konnten. Als Erstes galt es, den Stamm wiederzufinden, aus dem der Ring der Trommel herausgeschnitten worden war. Und der Schamane belebte die Trommel, indem er die Geschichte dieses Baumes erzählte. Auch das Fell der Trommel sprach. Es erzählte, wie es gelebt hatte, bis ein Jäger es durchbohrt hatte. Die Trommel ist der Baum und das Tier, die getötet wurden. Der Schamane wurde dieser Baum und dieses Tier. An diesem Punkt begann die Trommel den Schamanen zu führen. Sie war eine Feder, ein Reittier. Der Schamane klammerte sich an die Trommel wie an die Mähne eines Pferdes.
Drei Welten gibt es, und die Menschen leben normalerweise in der mittleren. Die Schamanen dagegen in allen dreien. Manchmal ragen sie mit dem Kopf in eine Welt hinein, haben aber die Füße in einer anderen. In allen drei Welten gibt es die gleiche Menge Leben, Gras, Wild und Blätter. Die Geister sind manchmal kleiner als Mücken. Andere Male sehen sie aus der Ferne wie Gebirge aus.
Um zu jagen, musste man zuerst einmal nachahmen. Den Rebhuhn-, Bären-, Leoparden-, Kranich- und Zobelschritt tanzen. Um ein Raubtier zu werden, musste man sich in die Gesten des Raubtiers und der Beute hineinfinden. So wies die Nachahmung den Weg zur Tötung. Und in der Tötung versteckt fand sich die Nachahmung. Die Beute wurde angelockt und in Bann geschlagen, denn sie hörte, dass man sie in ihrer Sprache rief. In diesem Moment traf sie der Jäger. Jäger und Schamane sind die am engsten verwandten Wesen. Oft sprechen sie dieselbe geheime Sprache, eben die der Tiere. Der Schamane beschwört sie, damit sie ihm Schutz und Hilfe gewähren, der Jäger, um sich ihnen zu nähern und sie zu töten. Beider Tun ist heilig – und erhellt sich gegenseitig. Wo ihr Wirken aufeinanderstößt, findet eine gründliche Vermischung statt. Éveline Lot-Falck blieb hier stehen: »In welchem Maß sich die Sprache des Jägers mit der des Schamanen vermischt, ist schwer zu sagen. Einen Teil des Vokabulars … haben Jäger und Schamane wahrscheinlich gemeinsam – und jener mag ihn von diesem gelernt haben. Offen bleibt, bis zu welchem Punkt der Schamane das Monopol dieser Wissenschaft für sich beansprucht.« Auch wenn er für den Erfolg des Unternehmens unentbehrlich ist, nimmt der Schamane an der Jagd nicht teil, ja ist nicht einmal bei ihr zugegen. So wie er auch keinerlei Vorteil von ihr hat. Seine Rolle ist die Erkenntnis.
Das Wort »Schamane« erschien zum ersten Mal, auf Russisch, in der 1672-73 verfassten Schrift Das Leben des Protopopen Avvakum. Doch es ist ein tungusisches Wort – und stammt aus einem riesigen, öden und isolierten Gebiet Sibiriens. Der Ursprung des Wortes ist höchst umstritten. »Einige haben das Wort auf das chinesische sha-men zurückzuführen versucht, andere auf samana aus dem Pali, eine Transkription des sanskritischen śramaṇa.« Laufer schließlich führte das Wort auf das türkische kam zurück. Éveline Lot-Falck hat daran erinnert, dass Paul Pelliot das Wort in einem Dokument der Jurchen aus dem Jahr 1130 angetroffen hatte (und die Jurchen waren die Vorfahren der Tungusen). Außerdem hatte er bei seinen Forschungen entdeckt, dass »es im Tungusischen drei weitere Reihen von Termini gibt, die die Handlung des Schamanisierens ausdrücken. Die erste ist mit der Idee des Gebets an das Feuer verbunden, die zweite mit der Idee des Wortes und die dritte mit der von heiliger Kraft.« Éveline Lot-Falck hat dann in anderen türkischen, altaischen und mongolischen Sprachen verschiedene Termini für den Akt des Schamanisierens ausfindig gemacht. Häufig gab es Verbindungen mit ganz anderen Bedeutungen. Doch das nüchterne Fazit der Untersuchung lautete folgendermaßen: »Die Etymologie, die sich für die tungusischen und jakutischen Worte ergab, hebt die Idee der Bewegung, der körperlichen Unruhe hervor. Mit gutem Grund sind daher alle Beobachter des Schamanismus von dieser gestischen Aktivität beeindruckt gewesen, die dem Schamanismus seinen Namen gibt.«
Habent sua fata verba, hätte Brichot sagen können. Aufgekommen in einer winzigen Völkerschaft, ist das Wort »Schamane« zur Zauberformel einer Art von religiösem Esperanto geworden. Und dies im Verlauf weniger Jahrzehnte, seit 1951 Eliades Buch über Schamanismus erschienen war. Offenbar fehlten der Welt mittlerweile die Worte, die eine zugleich physische und psychische Reise bezeichneten, einen Zustand – der dann »schamanisieren« genannt werden wird –, wo die Grenzen zwischen dem Sichtbaren und dem Unsichtbaren verblassen, wo Wort und Trommelklang, die Bewegung des Körpers und das Wagnis des Geistes sich überlagern und miteinander verschmelzen. So stark musste das Bedürfnis nach diesem Wort, so stark sein Fehlen empfunden worden sein, dass es sich ungehindert und undifferenziert ausbreiten konnte. Vor ein paar Jahren zirkulierte in Kalifornien ein Flugblatt, auf dem zu lesen war: »Schamanische Finanz heißt: Geld und Geist integrieren.« Zuletzt ist es schwierig geworden zu definieren, was nicht schamanisch ist. Was die Schamanen angeht, so sind sie entweder verschwunden oder sie geben sich nicht zu erkennen.
Manche hielten die sibirischen Schamanen für arme Geisteskranke, Opfer jenes mysteriösen Leidens, das man »arktische Hysterie« nennt und das umso schwerer ausfällt, je höher man nach Norden kommt. Andere meinten, dass nur sie fähig seien, die Kranken zu heilen, weil sie wüssten und weil sie die andere Welt gesehen hätten, die sich hinter derjenigen auftut, die für die Übrigen die allein existierende Welt ist, und auch weil sie die Einzigen seien, die mit den Geistern und den Toten umgehen könnten. Für dergleichen Bedenken kamen nicht nur die sibirischen Schamanen infrage. Mit den gebotenen Abwandlungen und Anpassungen ließen sie sich auch auf Empedokles oder Paulus anwenden. Oder auf Nietzsche.
Die siberischen Schamanen unterscheiden sich von den anderen, die wissen, in anderen Teilen der Welt, vor allem dadurch, dass ihre sichtbare Welt auf ein Minimum reduziert ist. Es gibt darin weder Städte noch Reiche, weder Reichtümer noch Handelsverkehr. Bloß die Taiga, die Tiere, den Frost. Um Zugang zu erhalten zum Unsichtbaren, musste man sich vor allem ankleiden, sich mit all dem wenigen Handgreiflichen beladen, das eine Macht haben kann. Die Gewänder der sibirischen Schamanen konnten bis zu dreißig Kilo wiegen. Doch die, die sie trugen, wussten sich leichten Schrittes darin zu bewegen.
Im Ṛgveda ist die Rede von den munis mit den langen Haaren, die, eingehüllt in »schmutzige rote Lappen«, auf dem Wind reiten. Sie ließen »die Götter in sich hereinkommen«, blickten von oben auf zwei Ozeane, im Osten und im Westen, und verstanden den Geist der Nymphen, der Genien und der wilden Tiere. Sie tranken aus einem Kelch ein Getränk, über das wir nichts wissen, außer dass es eine Droge oder ein Gift sein konnte. Es wurde visá genannt, stammte von dem Gott Rudra, und Rudra übergaben sie es. Sie bildeten die erste Erscheinung der Asketen, der yogin, der sādhus, deren Reihe in Indien, von den vedischen Zeiten bis heute, niemals abgerissen ist.
Ekstase, Besessenheit: Zwei Worte, die – je nach Orten und Zeiten mit positiven oder negativen Konnotationen behaftet – die metamorphische Erkenntnis bezeichnen, jene Erkenntnis, die den, der erkennt, in dem Augenblick, wo er erkennt, verwandelt. Die gemeinsame Voraussetzung: ein durchlässiger Geist, der empfänglich ist für die an- und abschwellenden Ströme von Elementen, die am Anfang fremd erscheinen mögen, aber auch fähig sein können, sich aber auch als Dauergäste festsetzen können. Wo sich hingegen ein abgeschottetes Ich zu Wort meldet und als Herr im eigenen Gehege ausgibt, ist für Ekstase oder Besessenheit kein Platz mehr. Zugleich aber verengt sich enorm der Bereich des Erkennbaren – ja selbst des Erfahrbaren. Viele waren darauf stolz, doch man weiß nicht, warum. Es sei denn aus dem folgenden Grund: Ihr Leben verlief ruhiger, ohne große Erschütterungen, als hätten sie sich Scheuklappen angelegt – und als gehörte dies für sie zur natürlichen Ordnung der Dinge.
Apollo fliegt, von weißen Schwänen getragen, zu den Hyperboreern, so wie Abaris, rittlings auf einem goldenen Pfeil, von den Hyperboreern nach Griechenland kommt. Schamanische Reisen. Gott des Lichts, des Metrums, der Wölfe und der Mäuse, Apollo.
Der Himmel war der Ort der Vergangenheit. Während sie in der Nacht, auf dem Rücken liegend, jene zitternden Nadelspitzen fixierten, fanden sie das wieder, was geschehen war: ein dunkles und indifferentes Tuch, durchsetzt mit winzigen Ritzen von Licht. Nur dies blieb zurück von Unmengen von Ereignissen, Taten, Lebewesen. Nur dies war auserwählt worden, eine Bedeutung, eine Form zu bewahren, die jede Nacht sich neu entzündeten. Von wo auch immer sie den Himmel beobachteten, sie trafen dort auf den Jäger. Die Jagd war das Ordal der Erinnerung. Der Himmel die erste mnemotechnische Ordnung. Das Gewölbe wurde das Haus der Vergangenheit, ein intaktes Museum. Die unentbehrlichen Geschichten leuchteten jede Nacht auf – oder blieben vorübergehend hinter einem Wolkenvorhang verborgen. Und ein anderer Himmel war die Oberfläche der Höhle, so wie der Himmel selber die Innenseite der immensen kosmischen Höhle war. Um jagen zu können, muss man zeichnen.
Eines Tages – und dieser Tag dauerte nicht weniger als 25 000 Jahre – begannen die Menschen des Jungpaläolithikums zu zeichnen. Was? Die Frage stellte sich gar nicht: Der einzig mögliche Gegenstand waren die Tiere. Die Tiere waren die Macht in Bewegung, die zum Schlag ausholte oder gegen die man zum Schlag ausholen musste. Es handelte sich nicht um Magie, wie man in der plumpen Moderne dann annehmen würde. Ins Tier verwandelte man sich, vorm Tier floh man, indem man sich verwandelte. Das Tier und der, der es zeichnete, gehörten demselben Kontinuum der Formen an. Dies war der Moment, wo der Druck der Mächte die strengste ästhetische Disziplin verlangte: Um wirksam zu sein, musste die Linie stimmen. Ingres hätte dem zugestimmt. Wenn die Linie nicht richtig war, wurde die Macht nicht beschworen. Wenn einer tief in einem Felsenwinkel, wo sich ein Mensch nur mit Mühe hineinzwängen konnte, zeichnete, war es bisweilen, als befände er sich in der ersten Camera obscura und beobachte das Wunder der Form, die aus seinen kaum sichtbaren Händen zutage trat.
Lange zeichneten sie vor allem gewaltige, furchterregende Tiere, die nur selten gejagt wurden. Sie zu zeichnen, war die Vorbedingung, um sie nachahmen und ihre Macht einschränken zu können. Dagegen blieben die menschlichen Gestalten, die auf den Fels gezeichnet wurden, lange Zeit nur marginale und zufällige Elemente. Die gebräuchlichste, direkteste und verständlichste Art, sich selbst darzustellen, bestand für die Menschen darin, sich als tierische Mischwesen zu zeichnen, umgeben von anderen Tieren. Viele Jahre waren nötig, damit die griechische Plastik, auf gewundenen und verborgenen Wegen, dazu gelangte, die menschliche Gestalt allein darzustellen – und überdies nackt.
Zusammen mit den Tieren war die Geometrie erschienen. Zahllose Figuren, die sich zu den Tieren gesellten oder sich gesondert auf den Felswänden zeigten. Alle haben ihr Geheimnis bewahrt. Aber alle hatten ein Merkmal gemeinsam: Sie waren die Negation der Welt, so wie sie sich darbot – nicht anders als die erste vollkommen lotrecht auf dem Boden stehende Mauer. Sie waren eine andere Welt, auf die man nur dann hätte kommen können, wenn man einige kleine leuchtende Punkte am Himmel mit ein paar Strichen verbunden hätte.
Von denen, die während des Magdalénien lebten und in der Dordogne Felswände bemalten, können wir nicht viel Gewisses sagen. Eines aber doch: Zeichnen konnten sie mit einer erstaunlichen, über Jahrtausende nur selten wieder erreichten Sicherheit. Wie aus heiterem Himmel – und überall: in Ägypten, in Nordspanien, in Frankreich, in England: im Creswellien, ganz in der Nähe des Eises. Warum kam es dazu? Jede Antwort wäre übereilt. Doch wenn die Zeichnung ein Akt der Intelligenz ist, musste die Intelligenz der Menschen des Magdalénien sehr hoch gewesen sein. Vielleicht hatten sie auch etwas mit den Walfängern gemein, die, ehe sie ausfahren, darauf warten, dass sie einen Wal im Traum sehen. Erschiene er ihnen nicht, könnten sie in der Wirklichkeit nie auf ihn stoßen.
Über Jahrtausende machte der Mensch des Magdalénien beständig Gebrauch von zwei elementaren Zeichen, einem vertikalen und einem gebogenen: dem Speer und der Wunde. Der Speer war die Waffe, mit der die Welt getroffen wurde, ohne berührt zu werden: ein Stab, das einfachste Zeichen. Die Wunde war ein Kreis, ein blutiger Ring.
Wenn das Sternbild ein arbiträrer Ort ist, an den man Geschichten knüpft, nicht anders als man Bedeutungen an Laute knüpft, fällt es nicht leicht zu erklären, warum im selben Himmelsausschnitt, nicht nur in Griechenland, sondern auch in Persien, in Mesopotamien, in Indien, in China, in Australien und selbst in Surinam, jahrtausendelang jedes Mal die Taten eines Himmlischen Jägers zu sehen waren, die zu betrachten man nicht müde wurde.
Das Unsichtbare ist der Ort der Götter, der Toten, der Vorfahren, der gesamten Vergangenheit. Es verlangt nicht notwendig einen Kult, dringt jedoch in jede Spalte des Geistes ein. Einer Metallsaite ähnlich, kann es, statt zu schwingen, auch reglos bleiben. Wenn es aber schwingt, kann die Intensität überwältigend werden. Das Unsichtbare ist nicht in der Ferne zu finden. Im Gegenteil, man kann es verfehlen, gerade weil es zu nah ist. Das Unsichtbare landet im Kopf eines jeden.
Wo es noch schwerer zu erkennen ist, geschützt von einem Käfig aus Knochen. Und es vermengt sich mit allem Übrigen zu einem Gemisch, das es womöglich erstickt.
Bevor die Schrift erfunden wurde, war es nicht möglich, das, was geschah, in Form von Geschichte festzuhalten. Doch »von allen Bedürfnissen der menschlichen Seele ist keines vitaler als die Vergangenheit«. So diente das Opfer, wenigsten in einigen seiner Formen (den Athener Buphonien, den soma-Zeremonien im vedischen Indien), auch dazu, die Vergangenheit in Erinnerung zu rufen und wiederaufleben zu lassen. Einige Jahrtausende lang haben diese Riten das, was zwischen dem Menschen und den Tieren geschehen war – und das, was zwischen dem Menschen und dem Unsichtbaren weiterhin geschah –, in der Vielfalt seiner Formen zusammengefasst. Keine Geschichte hätte so wirkungsvoll, so bedeutsam sein können wie diese Abfolge von Handlungen. Töter und Anbeter: Diese beiden Charaktere waren als Ergebnis dessen, was sich über Hunderttausende von Jahren zugetragen hatte, nicht aus der Welt zu schaffen. Mit diesen Charakteren galt es eine Form aufzubauen – und diese Form war das Opfer. Auch der Gottesdienst ist die Erinnerung an einen Tag der Vergangenheit. Und jedes Opfer ist die Erinnerung an einen Tag, der so lange gedauert hat wie ferne Zeitalter. Töten war nicht genug, man musste anbeten. Anbeten war nicht genug, man musste sich daran erinnern, dass man tötete.
Aua, der Eskimo, erzählte Knud Rasmussen Folgendes: »Obwohl schon zu der Zeit, als ich noch im Mutterleibe war, alles für mich bereit war, versuchte ich doch vergebens, ein Geisterbeschwörer mit Hilfe anderer zu werden. Aber das wollte niemals glücken. Ich suchte viele berühmte Schamanen auf und gab ihnen große Geschenke, welche sie augenblicklich an andere weitergaben. Denn wenn sie sie selber behalten hätten, wären ihre Kinder gestorben. Dann suchte ich die Einsamkeit und wurde bald sehr schwermütig. Auf eine mystische Art und Weise konnte ich in Klagen ausbrechen und unglücklich werden, ohne den Grund zu begreifen. Dann wurde manchmal plötzlich alles ganz anders und ich fühlte eine große und unerklärliche Freude, eine Freude so stark, dass ich sie nicht beherrschen konnte. Ich musste in einen Gesang ausbrechen, in einen gewaltigen Gesang, der nur Raum für dies eine Wort hatte: Freude! Freude! Freude! Und mitten in dieser rätselhaften, überwältigenden Wonne wurde ich Schamane, ohne selbst zu wissen wie. Aber ich war es, ich konnte auf eine ganz neue Weise sehen und hören. Jeder wirkliche Geisterbeschwörer muss ein Leuchten in seinem Körper fühlen, im Innern seines Kopfes oder in seinem Gehirn, etwas, das wie Feuer leuchtet, das ihm die Kraft gibt, mit geschlossenen Augen in die Dunkelheit, in die verborgenen Dinge oder in die Zukunft zu sehen oder auch in die Geheimnisse anderer Menschen. Ich fühlte, dass ich im Besitz dieser wunderbaren Fähigkeit war.«
Die Berufung des Mannes der Erkenntnis war ein Ruf. Er kam aus einer Welt mächtiger Wesen, die die anderen nicht wahrnehmen konnten. Dieser Ruf wirkte wie eine Verführung, ein Sog ins Unsichtbare – und zugleich wie eine Aufforderung zum Kampf. Der Mann der Erkenntnis erwarb im Verlauf dieses Kampfes das Wissen, oder er unterlag. Dann war er nichts weiter als ein armer Kranker. Der zudem wusste, dass fast alle Krankheiten ein Seelenraub waren. Wenn er aber siegreich aus dem unsichtbaren Kampf hervorging, dann war es an ihm, die Geister zu beschwören, so wie einst er von ihnen gerufen worden war. Er würde sie in die Einsamkeit locken, sie um sich versammeln, er würde sie tätig werden lassen. Dies war die Umkehrung, die in seinem Leben vollzogen werden musste. Zuvor aber musste sein Körper erneuert werden. Organ für Organ wurde die physische Einheit aufgelöst. Das Herz, die Lunge, die Leber, die Augen: Nichts war so zu gebrauchen, wie es war. Die Erkenntnis impliziert eine Zerteilung, ein Auseinandernehmen der Elemente, eine Veränderung in ihrer Substanz. Quarzkristalle setzten sich an dominierenden Stellen ab, die Gelenke bewegten sich wieder, nachdem die aufgehäuften Knochen eine Zeitlang in Birkenrinde eingehüllt gewesen waren. Es war eine Tortur, die sich, für die Welt, in Einsamkeit vollzog. Doch auf dem Schauplatz herrschte Gedränge: Die toten Schamanen eilten herbei und umringten den, der einer von ihnen werden sollte. Mit langen Messern lösten sie sein Fleisch von den Knochen. Aber das war nicht alles. Das Fleisch musste gekocht werden, damit es reif, damit es vollkommen würde. Die toten Schamanen gingen schweigend, hektisch vor. Mitunter stellten sie den Neuerwählten auf die Füße wie einen Pfahl, dann nahmen sie Abstand und durchbohrten ihn mit Pfeilen. Dann traten sie wieder heran, zogen die Knochen aus seinem Körper und begannen sie zu zählen, wie Wucherer. Kamen sie nicht auf die richtige Zahl, wurde der Erwählte ein Lumpen für den Abfall. Es war keine wahre Berufung. Er war ein Elender. Oft wurde der Kopf des Kandidaten oben auf eine Hütte gespießt. Von dort konnte er zuschauen, wie der übrige Körper zerstückelt wurde. Es war unerlässlich, dass der künftige Schamane bei Bewusstsein blieb und Moment für Moment beobachten konnte, was geschah. Nur wenn er in der Lage war, sich zu betrachten, konnte der Aspirant eines Tages ein Schamane werden. Es hieß weiter, dass ein wahrer Schamane sich mindestens dreimal zerstückeln lassen müsse. Auch musste er zusehen, wie seine Knochen gesäubert und geputzt wurden. Die toten Schamanen waren habgierig. Manchmal, wenn sie irgendein Organ des Schamanen-Anwärters auf die Wege der Übel geworfen hatten, die zahlreich und voller Gabelungen sind, verlangten sie, damit das Organ zurückkehren konnte, ein Lösegeld und verstanden darunter den Tod oder auch bloß eine schwere Krankheit eines Verwandten. Es war eine gefährliche Zeit für jeden, der mit dem Schamanen-Anwärter, der schweigend litt, Beziehungen hatte. Einmal starben zehn Menschen, um die Schädelknochen eines Schamanen-Anwärters freizubekommen. Mitunter wurden die Schamanen der Geister überdrüssig. Und die Geister wurden der Schamanen überdrüssig. Dann schlugen sie andere Wege ein, und es konnte geschehen, dass sie sich nicht mehr begegneten.
Schamane sein war ein anderes Leben, das die Hingabe des eigenen Körpers und seine Zergliederung voraussetzte, ganz ähnlich wie die geopferten Tiere sie erlitten. Tatsächlich waren die Schamanen lediglich die letzten dieser Tiere. Jeder Schamane hatte ein Muttertier, das zwei oder drei Tage vor dem Tod erneut erschien und sich ihm näherte. Wenn der Schamane es zuließ, dass bestimmte Geister sein Fleisch kauten, dann waren diese Geister in Zukunft verpflichtet, ihm zu antworten. Sie konnten nicht mehr taub sein. Der Schamane war Fleisch von ihrem Fleisch geworden. Einzig unter den Modernen, hat Artaud ersonnen und erzählt, was in diesen Fällen geschah.
Jedes Denken misst sich mit den Toten. Der Altar der Toten entstand aus einer »kleinen Phantasie« von Henry James: Er dachte sich »einen Mann, dessen edle und schöne Religion der Kult der Toten ist«. Ihn »beeindruckt die Art und Weise, wie sie vergessen, wie sie entweiht werden – ungeehrt, vernachlässigt, aus dem Blickfeld verbannt; einem noch größeren Tod ausgeliefert als dem vom Schicksal überraschend über sie verhängten. Ihn beeindruckt das eisige, brutale Klima, das ihr Gedächtnis umgibt.«
In Sungir, etwa 180 Kilometer östlich von Moskau, haben Ausgrabungen Funde zutage gefördert, die 27 000 Jahre zurückreichen. Darunter ein Grab mit zwei Kindern: einem Jungen, der mit insgesamt 4903 kleinen, auf Schnüre gezogenen Perlen bedeckt war und um die Taille einen Gürtel mit über 250 Eckzähnen des Polarfuchses trug. Neben dem Körper verschiedene Gegenstände aus Elfenbein, zu denen eine Lanze gehörte, die zu schwer war, um sie benutzen zu können. Das Mädchen war mit 5274 kleinen Perlen bedeckt.
Nach Adolf Loos ging die Architektur von den Gräbern aus. Auch das Ornament, das Loos missbilligte, erschien neben den Toten. Zumindest treffen wir es zum ersten Mal bei den Toten an. Es war nicht dazu da, gesehen zu werden. Sondern es sollte sie in jenes »eisige, brutale Klima« begleiten, das sonst ihr Gedächtnis umgeben würde. Das wussten jene Unbekannten sehr wohl, die einige Jahrzehntausende vor Henry James in Sungir lebten.
Simulakren, Amulette, Götzenbilder, Fetische in allen Formen und Materialien: Zwischen Taiga und Tundra nannten sie sie šajtan. Dasselbe Wort bedeutete »Dämon« für die Moslems und »Satan« für die Christen. Sie transportierten sie aufgehäuft auf großen Schlitten. Frauen durften ihnen nicht nahekommen. Die Rentiere, die die Schlitten zogen, waren heilig. Sie durften für keinerlei Arbeit benutzt, weder verkauft noch getötet werden. Andere Rentiere wurden dagegen getötet, und mit ihrem Blut bestrich man die šajtan.
Die sowjetischen Behörden verlangten die Herausgabe der Trommeln. Als sie sie übergaben, fühlten sie sich wehrlos, den Angriffen der Geister ausgesetzt. Sie fürchteten, erwürgt zu werden. Einige versuchten, die Trommeln durch Zweige, Pfeil und Bogen, Peitschen oder Mützen zu ersetzen. Auch durch Topfdeckel und Schöpflöffel. Andere zeichneten Trommeln auf Stoffstücke und handhabten sie schweigend. Oder nahmen Stoffreste ohne Zeichnung und ließen sie in der Luft flattern.
Éveline Lot-Falck, die die Geschichte der sibirischen Jäger am besten zu erfassen vermochte, achtete beim Schreiben auf Nüchternheit und Präzision. Nicht weniger als jene hatte sie das Ziel, das Wesentliche im Auge: »Nichts darf an das Alltagsleben erinnern, mit dem der Jäger gebrochen hat. Im Wald ist kein Platz für irgendwelches Hausgerät. Dank eines Kunstgriffs der Sprache passt es sich den Orten an, verschmilzt mit der Umwelt. Die Absichten des Jägers sind eingehüllt ins Geheimnis, das unentbehrlich ist für das Gelingen seiner Pläne. … Derart durch vielfache Verbote abgesichert, macht sich der Jäger mit seiner verborgenen Identität, geschützt von seiner Anonymität wie von einem Schild, nachdem er seine Verbindungen zum gewöhnlichen Leben, zum profanen Leben abgebrochen hat, auf den Weg, um ins Reich der Jagd einzudringen und den geheimnisvollen Kräften des Waldes entgegenzutreten. … Wenn er im Wald ist, im Gebiet der alten, atavistischen Kräfte, entzieht sich der Jäger der Gerichtsbarkeit der offiziellen Kirche und vermeidet es, sich als Orthodoxer, Buddhist oder Moslem zu erkennen zu geben.« Im Vergleich zum Wald sind alle anderen Formen des Glaubens jüngsten Datums, unecht. Ihre obsessiven, summenden Liturgien haben zu schweigen, wo der Wald beginnt – und seine Stille.
Schwierig war es, aus der Jagd hinauszukommen. Wie der Körper der Frau eine Geruchsspur auf dem Mann hinterlässt, so der Wald auf dem Jäger. Darum kauten manche Erlenrinden, sonst wären sie mit der Krankheit des Waldes infiziert worden. Wer einen Bären erlegt hatte, konnte für sein Unternehmen erst dann geehrt werden, wenn er drei Tage in einem eigens hierfür errichteten Zelt verbracht hatte. Langsam und vorsichtig gelang es den Jägern, »die Bindungen zu lösen, die sie selber geschaffen hatten, und sich von jenem Reich zu trennen, in das sie eingedrungen waren, wo sie zu bleiben vermocht hatten und aus dem sie herauskommen wie aus einer anderen Welt, mit der Furcht, verfolgt zu werden.« Diese Furcht vor einer Repressalie war nicht nur das hartnäckige Gefühl bestimmter sibirischer Jäger. Wer immer die Grenze zum Unsichtbaren überschritten hat oder sie weiterhin überschreitet, befindet sich – auch, ja vor allem wenn das Unsichtbare nicht als solches anerkannt wird – in der Verfassung dessen, der jeden Augenblick erwartet, angegriffen zu werden. Und sehr wohl weiß, woher der Angriff kommt – auch wenn er manchmal der Einzige ist, der es weiß.
Der Jäger bereitete sich auf sein Unternehmen vor wie für einen Ball. Der Körper musste rein sein und duften. Für jedes Tier, das gejagt werden sollte, gab es einen entsprechenden Duft. Sich vor der Jagd sexuell betätigt zu haben, war verboten. Denn die Jagd war der Sex. Und die Tiere waren eifersüchtig, sie merkten es sofort. Wenn er die ersten Schritte tat, war der Jäger bereit, lange um sie zu werben.
Wenn zwei Schamanen sich trafen, wusste man nie, was geschehen würde. Sie konnten nebeneinander auf einer Bank sitzen, mit leiser Stimme Worte wechseln oder auch schweigend ins Leere blicken. Doch war der Sache nicht zu trauen. Jeder der beiden war mit einer unsichtbaren Lederschnur an ein – oft sehr weit entferntes – Rentier gebunden. Und wenn das Rentier durch die Tundra streifte, spannte sich die Schnur immer weiter, über Meilen und Meilen. Nicht ausgeschlossen, dass die Rentiere der beiden Schamanen sich trafen – und sich wilde Duelle lieferten, ohne Zeugen. Derweilen kauten die beiden Schamanen auf ihrer Bank Tabak und wechselten hin und wieder ein Wort. Die Rentiere setzten ihren Kampf fort. Wenn eines stürzte, fühlte einer der Schamanen einen Ruck an seiner Schnur. Darauf erhob er sich und ging schweigend fort. Bald würde er sterben. Es war auch die Rede von einem »Fluss des Elends und des Unheils«, dessen Dämme mit den Leichen der Verwandten des Schamanen als Pfählen verstärkt werden mussten. »Denn das Leben des Schamanen wird von seinen Verwandten losgekauft.«
Um einen Kranken zu heilen, nahm der Schamane Narzalé die Krankheit in sich auf. Um sie zu durchbohren, durchbohrte er sich. Der Kranke wurde gesund. Dann nahm der Schamane Abschied, ganz so, wie er angekommen war. Bald hörte man von ihm. Es hieß, Narzalé sei in den Wald Holz sammeln gegangen und ein Bär habe ihn zerrissen. Und man erklärte sich den Vorfall so: »Der Bär hat ihn zerrissen, weil er seine Seele für den Kranken hingegeben hatte. Er hatte gesagt: Du, katcha [Geist der Krankheit], nimm meine Seele anstelle des Kranken. Ebendarum ist er gestorben. Warum hätte denn sonst ein Bär im Winter seine Höhle verlassen, um ihn zu zerreißen?« Éveline Lot-Falck bemerkt zum Schluss, dass »der Erzähler und die Betroffenen sich vor allem deshalb nicht besonders erstaunt oder erkenntlich zeigen, weil man bei jenen Völkerschaften mit Worten und Bekundungen sparsam ist, und dann, weil Narzalé, wenn er getan hat, was wenige Schamanen tun, bloß seine Verpflichtungen und seine Mission erfüllt hat«.
Es gab einen Nervenkranken, der in einem zugesperrten Zimmer lebte. Fünf Jahre lang suchten seine Angehörigen einen Schamanen, der imstande wäre, ihn zu heilen. Am Ende kam der Schamane Küstäch. Ein Betrunkener ging ein und aus und beleidigte ihn. Der Schamane ließ sich nicht beirren und kümmerte sich nur um seine Hilfsgeister. An einem gewissen Punkt sagte er: »Wenn mein stärkster Hilfsgeist auf mich heruntersteigt, dann öffnet möglichst schnell die Riegel.« So geschah es. Gleich stürzte der Kranke sich auf den Schamanen, der die Brust rausstreckte, sich zurückbog und ihm ins Gesicht blies. Der Kranke wurde ohnmächtig. Der Schamane fuhr ihm mit den Trommelschlägeln über die Stirn und sagte: »Steh auf. Nun, willst du Tee trinken? Wollen wir uns an den Tisch setzen?« Sie setzten sich und tranken Tee.
Die Schamanen leben auf einem großen Baum, einer Lärche mit vielen Etagen. Auf den obersten nisten die mächtigsten Schamanen, die anderen weiter unten. Auf diesem Baum werden die Schamanen der ganzen Welt großgezogen. Ihr Erzieher ist der Rabe, der von einem Ast zum anderen fliegt. Wenn ein Schamane von einem anderen Schamanen besiegt worden ist, sucht er wieder Zuflucht auf dem Baum, auf dem er heranwuchs. Manchmal versucht ein Schamane, der mit einem anderen Schamanen kämpft, das Nest seines Gegners zu zerstören. Schamanen sterben nie eines natürlichen Todes, sondern immer im Kampf mit einem anderen Schamanen, der sie verschlingt.
Der Khan Ögödei befahl, dass man ihm auf dem höchsten Punkt des Hügels einen Sitz aufstelle. Von dort konnte er eine weite Fläche überblicken, die sich im dunstigen Okzident verlor. Ein unermessliches Jagdgebiet. Und während er den Blick in die Ferne richtete, kamen die Tiere aller Arten aus ihren Höhlen und Schlupfwinkeln hervor, schauten nach oben, zum Thron Ögödeis, und zogen zum Fuße des Hügels. Da hörte man, wie von der Erde eine Klage aufstieg. Alle Stimmen der Tiere vereinigten sich, ähnlich den Stimmen derer, die um Gerechtigkeit flehen.
Sie sagten, dass die Welt im Wesentlichen aus sechseckigen Felskristallen besteht, auch – ja vor allem – dort, wo sie am dunkelsten und gestaltlosesten ist, in den Räumen, die sich jenseits der Milchstraße auftun. Ebendiese sechseckigen Kristalle sind Alveolen im Gehirn, wo Bilder aufkeimen. Und die zentrale Kommissur des Gehirns, die beiden ineinander verschlungenen Schlangen, findet sich in der Milchstraße wieder.
Andere sagen, dass die Milchstraße der Ort der Visionen und die Verbindungsstraße zwischen Himmel und Erde ist, aber auch ein furchtbarer Ort, weil sich dort alle Krankheiten vereinen. Und sie ist wie eine große Masse von Abfall. Dort verbergen sich die Geier, denn sie finden darin Nahrung. Darum ist die Milchstraße ein höchst gefährlicher Ort. Wer sich dorthin wagt, muss dies wissen.
»Todos los adornos son escrituras«, sagte Bonifacio Bautista Aragón, Führer in Mitla, nicht weit von Oaxaca. Sein Haus, eine kleine dunkle Höhle, lag seitlich von den Ruinen. Er verließ es, wenn irgendeiner der Besucher, die vor einer rosa, mit Dekorationen übersäten Wand standen, ihn darum bat. Die Dekorationen befanden sich »im Innern der Mauer«, setzte Bonifacio hinzu. Doch dann fand er zu seinem Satz über die »adornos« zurück. Nur wenige unter den Besuchern verstanden ihn, für sich selbst fügte er hinzu: »Los modernos se creen …« Die Modernen dachten, es handele sich um Dekorationen nach Art der Kotillongeschenke im Karneval. Die Modernen glauben viele Dinge, die nicht zutreffen. So wiederholte Bonifacio seinen Satz: »Todos los adornos son escrituras.« Es war nicht wichtig, dass er diese Schriften nie entziffert hatte. Seine Aufgabe war es, diesen Satz zu wiederholen.
Der Herr der Tiere ist boshaft und lüstern. Er belauert die Frauen, geht längs des Flusses den Mädchen hinterher, in Gestalt einer Eidechse. Während er sie betrachtet, peitscht er die Luft mit dem Schwanz. Wenn es ihm gelingt, sie im Schlaf zu besitzen, sind sie beim Aufwachen häufig benommen – und sterben bald an Auszehrung. Dann bemerkt man ringsumher eine Zeitlang einen ungewöhnlichen Wirrwarr.
Der Herr der Tiere ist neugierig und eifersüchtig auf alles, was mit Sexualität zu tun hat. Aus Mauerspalten hält er Ausschau. Er verhandelt mit den Jägern über die Zahl der Tiere, die mit seiner Erlaubnis getötet werden dürfen. Und verlangt dafür Seelen von Toten, die er in großen Speichern im Innern der Berge unterbringen will.
Der Herr der Tiere folgt den Jägern auf Schritt und Tritt, so sind sie niemals unter sich. Sie wissen, dass sie überwacht werden. Manchmal bleiben sie vor der Rinde eines Baumes stehen und schneiden Bilder darin ein. Eine Schnecke, eine Flöte. Stets zu dem Zweck, den Herrn der Tiere abzulenken, der sich in den Anblick dieser Zeichen verliert. Dann kann der Jäger seinen Weg fortsetzen, frei für einen Moment.
Es gab nicht nur einen Herrn der Tiere. Man kannte verschiedene, die über unterschiedliche Teile des Waldes herrschten. Sie hatten das Aussehen von »aus Tier und Mensch, Raub und Räuber zusammengesetzten Bildern«, ähnelten manchmal gefiederten Menschen, ominösen Papagenos. Wurden zu viele Tiere bei der Jagd getötet und die Regeln nicht befolgt, gaben sie ihren Zorn durch bestimmte gelbliche Lichter bei Sonnenuntergang und andauerndes Donnergrollen zu erkennen. Es war unerlässlich, die Köpfe der bei der Jagd getöteten Tiere an den Bäumen des Waldes aufzuhängen. Sonst würde es der Herr der Tiere sein, der auf Menschenjagd ging. In der Erzählung Patakurus hörte sich das so an: »Das Wild, das der Herr des Waldes jagt, sind die Menschen. Äußerlich gleicht er den Menschen. Er ist wie wir. Groß wie wir. Einige sind männlich, andere weiblich. Der männliche Herr des Waldes vögelt Frauen und vögelt Männer. Denn er erscheint auf trügerische Weise als Mann oder als Frau. Er oder sie erscheint als unser Mann oder als unsere Frau, wie die bösen Falken. Wenn wir die Frau vögeln oder der Mann uns vögelt, sind wir so gut wie tot. Nachdem du gevögelt hast / worden bist, weißt du es nicht mehr. Du vergisst, was geschehen ist, doch dann stirbst du. Nur bestimmte Hilfsgeister der Schamanen können herausfinden, was passiert ist, und uns kurieren, sodass wir nicht sterben.«
Töten war mit einer ständigen Gefahr von Repressalien verbunden. Der Herr der Tiere konnte stets die Menschen erbeuten, so wie die Menschen in seinem Reich auf Beutezug gegangen waren. Es genügte, ihren Geist zu treffen, an bestimmten verwundbaren Punkten. Dann führte der Herr der Tiere die Jagd an, mit einem Gefolge von wilden Schweinen und Kasuaren, so wie die Menschen mit ihren Hunden auf die Jagd gingen. Das war das Gleichgewicht, das war das Gesetz. Deshalb genügte es nicht zu jagen, man musste opfern.
Mit wem konnte der Jäger Freundschaft schließen? Zum Beispiel mit Mai-kaffo. In den alten Zeiten war Mai-kaffo der Anführer der Büffel. Aber er war kein Büffel. Mai-kaffo hatte etwas vom Büffel und etwas vom Menschen. Er hatte etwas von einem Vogel und etwas von einer Antilope. Er hatte Hörner. Er lebte im Dickicht, auf einem Tamarindenbaum. Ein Jäger begegnete ihm, und sie kamen ins Gespräch. Der Jäger sagte: »Wir haben keine Arzneien gegen die Geister.« Mai-kaffo sagte: »Mach dir keine Sorge. Mir gehören die Büffel.« Einmal brachte der Jäger Mai-kaffo Honig. »Seltsam, mir gehört das Dickicht, niemand darf ohne mein Wissen Honig mitnehmen«, sagte Mai-kaffo. Der Jäger erzählte eine Geschichte, wie er zu dem Honig gekommen war. »Er ist schon gut«, sagte Mai-kaffo, den Mund voller Honig. »Du hast mir etwas Gutes gebracht. Du bist ein Freund. Ich schenke dir einen Büffel. Du kannst ihn töten.« So tötete der Jäger den Büffel und trug ihn ins Dorf. Nun stand der Jäger in Ehren. Ab und zu rief er nach Mai-kaffo, indem er ein Tier mit schwarzem Fell opferte, wie es seinem Freund gefiel. Dann stellte sich Mai-kaffo im Dorf ein, mit seinem Sohn Mekirabo. Mai-kaffo und der Jäger unterhielten sich lange, vor allem über Arzneien. Unterdessen zog sich Mekirabo mit der Frau des Jägers ins Zelt zurück und umschmeichelte sie.
Plötzlich erschien eine Hirschkuh. Hinter ihr erstreckte sich der Sumpf, die unermessliche Palude Meotide, die sich bis dahin wie ein Ozean ausgenommen hatte. Die Hirschkuh blickte die Jäger ruhig an. Dann wandte sie sich dem Sumpf zu und begann zu laufen. Wenn der Abstand zu den Jägern zu groß wurde, blieb sie stehen. Mit dem Maul streifte sie die Büsche und den gefrorenen Schlamm. So holten die Jäger sie mehrmals ein. Und jedes Mal, kaum waren sie heran, begann die Hirschkuh ihren leichten Lauf von neuem und wandte sich, wie um sie aufzufordern, einen Moment lang nach ihnen um. Hunor und Magor ritten und ritten, mit den Gedanken nur bei der Hirschkuh. Sie vergaßen die anderen. Wenn sie zurückblickten, sahen sie, dass sie allein waren. Sie wechselten kein Wort und ritten weiter. Dieser Sumpf, von dem sie als Kinder hatten sagen hören, er habe kein Ende und reiche bis in den Himmel, erschien ihnen nun wie eine vereiste, bläuliche und mit dem Horizont verschwimmende Ebene. Mitunter war die Hirschkuh ein kleiner, schwarzer und beweglicher Punkt, mitunter aber war sie so nah, dass sie meinten, sie könnten sie streicheln. Sie verloren sie nie aus dem Blick. Sie merkten nicht einmal, dass sie nicht mehr auf Eis ritten, sondern auf einer neuen, weichen Erde, die anders war als die Steppe, wo sie gelebt hatten. Die Nacht brach herein, und die Hirschkuh hielt sie immer mehr auf Distanz. Sie sahen, wie sich der schwarze Punkt mit der unermesslichen Schwärze ringsumher verband. Die Hirschkuh war verschwunden. Doch sie ritten immer weiter. Und bald glaubten sie, in einem Traum gelandet zu sein. Sie erkannten einen Feuerschein in der Dunkelheit. Sie sahen Schatten, die sich bewegten. Hinter einem Zelt verborgen und immer noch an ihre Pferde geklammert, beobachteten sie die Szene. Männer und Frauen tanzten um Feuer, hingerissen vom Lärm der Musik. Zwei Alte standen reglos in der Mitte. Die Augen von Hunor und Magor hefteten sich auf zwei Mädchen, die sich schnellend wie Eidechsen bewegten, Frauen einer anderen Rasse, größer und weißer als die, die sie bis dahin gekannt hatten. Anscheinend führten die beiden Mädchen den Tanz an. Sie folgten ihnen lange mit den Blicken, wie sie der Hirschkuh gefolgt waren. Das Feuer leuchtete auf ihren schmalen Fesseln und nackten Füßen, wenn sie von Zeit zu Zeit aus den langen, dunklen und gefältelten Kleidern hervorlugten.
Dann brachen Hunor und Magor in den Kreis ein, und die Tänzer sahen zwei Dämonen, die die beiden Mädchen an der Taille packten. Sie verschwanden in der Nacht, die zwei schweißgebadeten Körper hielten sie an ihre Jacken aus Mäusefell gedrückt. Als sie zu ihren Leuten zurückkamen, nachdem sie den grenzenlosen Sumpf durchquert hatten, als wäre er ein letzter Zipfel der Steppe, sagten sie, sie hätten endlich das Land gefunden, das von jeher gesuchte Land, von dem sie seit ihrer Kindheit mit leiser Stimme hätten reden hören, das Land, das gut sei für die Tiere und die Nahrung. So geschah es, dass die Hunnen gen Europa vorrückten.
Gleich der Hirschkuh der Hunnen ist das Tier Beute und Führer. Indem der Jäger mit dem Blick, der sich auf einen einzigen Punkt zu heften versucht, das Tier verfolgt, bemerkt er nicht, dass er dabei ins Unbekannte eindringt. So kommt es zur Entdeckung: Man folgt dem Ruf eines anderen Wesens, hat es vor Augen, während es beständig flieht, und kann es nie einholen. Wohingegen man das, was sich enthüllt, schon um sich hat, schon hinter sich hat – fast ist es nicht mehr zu sehen.
Es gibt zwei Arten von Beute: die, die getötet wird (und der Ort der Tötung wird zum Ort der Gründung), und die, die verschwindet (und die Tötung der Jäger bewirkt). Manchmal will das Führer-Tier eingeholt werden, ist bereit, Beute zu werden. Das ist nötig, wenn man die Stadt gründen will. Die Stadt ist der Ort, wo das Führer-Tier getötet wird. Ephesos wurde von dem gegründet, der diesem Orakelwort gehorcht hatte: »Ein Wildschwein wird den Weg weisen«. Und dort, wo das Wildschwein, von einem Speer durchbohrt, stürzte, »erhebt sich heute der Athenatempel«. Dort liegt heute Ephesos.
Wer schreibt, folgt dem Führer-Tier. Im Werk trifft er es – und tötet es: Wo es getötet wurde, erhebt sich das Werk. Oder aber er entdeckt, dass das Führer-Tier verschwunden ist. Dieses wird dann ins Feldzeichen versetzt. Werke, in denen das Führer-Tier getötet wird, und solche, in denen es verschwindet, sind verschieden. Bei Balzac wird das Tier getötet. Bei Baudelaire wandert es ins Feldzeichen. Man schreibt ein Buch, wenn sich etwas abgezeichnet hat, was man entdecken muss. Man weiß nicht, was es ist, noch, wo es ist, aber man weiß, dass man es finden muss. Also beginnt die Jagd. Man beginnt zu schreiben.
Die Feldzeichen kamen in Ägypten auf, dem Ort der fernen Dinge. Nachdem die Ägypter mehrmals wegen eines gewissen Ordnungsmangels bei den Truppen besiegt worden waren, kamen sie »auf die Idee, vor den verschiedenen Abteilungen Feldzeichen vorauszutragen. Folglich, so heißt es, gestalteten die Befehlshaber Bilder der Tiere, die sie heute verehren, und führten sie, an Lanzen befestigt, mit sich, so wusste ein jeder, wo sein Platz war«. Die Tiere dienen dazu, die »gehörige Ordnung« sicherzustellen, die sich im Kampf als nützlich erweist. Aber das ist nicht alles. Die Menschen blickten auf die Tiere wie auf die Ordnung, die sie verletzt hatten – und zu der sie manchmal, wenn die Angst sie packte, gern zurückgekehrt wären. Oder die sie zumindest gern zu Hilfe gerufen hätten, damit sie ihnen Schutz gewähre.
So »führten sie, um ihre Dankbarkeit zu bekunden, die Sitte ein, keines der Tiere, deren Bild sie gestaltet hatten, zu töten, sondern ihnen als Kultobjekten Achtung und Verehrung zu erweisen«. Daher waren die Tiere auf den Feldzeichen häufig wilde Tiere, ausgenommen von Opfern und vom Verzehr.
Die Picener hießen so, weil »ein Specht [picchio] ihren Vorfahren den Weg gezeigt hat«. Wenn sie in den Krieg zogen, sah man, dass »der Specht sich auf ihrem Feldzeichen niedergelassen hat«. Sie waren durchaus nicht die Einzigen. Auf den Feldzeichen der römischen Truppen zu Zeiten der Republik waren Adler, Wölfe, Stiere, Pferde und Wildschweine zu sehen. Dann setzte Marius während seines zweiten Konsulats eine Reform durch: Als einziges Tier durfte nur noch der Adler den Legionen voranziehen. »Die anderen Feldzeichen wurden in den Lagern zurückgelassen.« Man könnte meinen, Marius habe auf das Kaiserreich vorausweisen wollen, das ebendies ist: ein einziges Tier. Zuvor aber waren es viele Tiere gewesen – und viele würden es wieder sein. Der Zerfall des Kaiserreichs wurde angekündigt, begleitet und quittiert vom Erscheinen anderer Tiere auf den Feldzeichen der Barbaren: Wildschweine für die Gallier, Raben für die Normannen, Schlangen für die Langobarden, Drachen für die Franken, Löwen für die Sachsen, Stiere für die Kimbern. Feldzeichen ist das, was voraus ist, sei es auch nur einen Schritt. Die Truppen, die ihm folgen, seine Getreuen, sind die Jäger, die einst den Spuren des Führer-Tieres folgten, ohne es jemals einzuholen. Aber diese Verfolgung gab ihrem Leben Form, verlieh ihm Zusammenhang. Es gibt keine engere Beziehung als die zwischen dem Feldzeichen und dem Krieger. Die Verfolgung geht nun weiter, auch wenn das Feldzeichen nur wenig voraus ist und seine Getreuen nicht mehr Jäger, sondern Soldaten sind. Wenn sie besiegt wurden, bot sich das Tier des Feldzeichens »quietissimus totoque corpore demissus«, »vollkommen reglos und mit dem ganzen Körper zusammengesunken«, dar. Siegten sie aber, knatterte das Feldzeichen im Wind. Der Rabe spannte erneut die Flügel aus und schwebte in der Luft.
IIDie Herrin der Tiere
Die Herrin der Tiere, von der man quer durch Europa zahlreiche Statuetten ausgegraben hat, beeindruckte durch Unbeweglichkeit. Ihre großen Hinterbacken, die schwere Brust, die geschlossenen Beine verbargen nur mühsam, dass sie einst ein Baum gewesen war. Während sie jetzt, Fuß an Fuß, bloß in die Höhlung eines Stammes gesteckt werden konnte. Die Tiere, alle Tiere, alles, was geboren wird: das waren ihre Anhänger. Die Göttin beobachtete sie unbeweglich. Sie erhielt die Geschöpfe, wie ein mächtiger Stamm auch die entferntesten Blätter erhält. Alles war ein dröhnender Kreis um sie her. Alle waren ein Zweig von ihr.
Plötzlich streckte die Göttin einen Arm aus, dann den anderen. Die Hände schlossen sich mit festem Griff um den Nacken zweier Panther – oder zweier Wasservögel. Oder sie packte zwei Damhirsche an den Läufen und warf sie in die Luft – oder auch zwei Löwen. Sie bot sich als majestätische Vogelscheuche dar. Es folgte ein anderer Moment, der geheimnisvollste, der, den niemand zu erzählen wagte, die Zäsur im Leben der Göttin: als sie ihren ersten Schritt tat, der sogleich ein Lauf war. Sie mied die Städte und die Menschen. Es zog sie zu unwegsamen, einsamen, vom Himmel erdrückten Orten hin. Oder zu Sümpfen mit dem raschelnden Schilf. Oder zu Lichtungen, die sich im Wald öffneten und auf die sich kein Menschenfuß je verirrt hatte. Sie war die Göttin des Unberührten. Sie verfolgte auf ihrem Lauf das unsichtbare Tier. Auch der mächtige Stier verneigte sich vor der Göttin. Alle Tiere fürchteten ihren Lauf. Alle wussten, dass ihr Pfeil sie ereilen würde. Doch wenn sie sich ausruhte, kam das ein oder andere Hirschkalb aus der Tiefe des Waldes hervor und leckte ihr die Hände.
Die Herrin der Tiere trug eine mobile Garderobe: der Natur. Die Tiere klammerten sich an den Mantel der Göttin und blieben dort kleben. Das Simulakrum von Ephesos war derart mit Kleidern überladen, dass nur das Gesicht, die ausgestreckten Hände und die Fußspitzen frei blieben. Und die Haut war schwarz von Öl, das aus Öffnungen tropfte, die mit Narde gesalbt waren. Aus dieser erzwungenen Unbeweglichkeit, diesen schwerfälligen Figuren schlüpfte, als würde sie sich mit einer geschickten Geste entkleiden und eine Schutzhülle aufgeben, Artemis, die leichteste der Göttinnen, die läuft und trifft, währen ein kurzer Chiton über ihren Knien flattert.