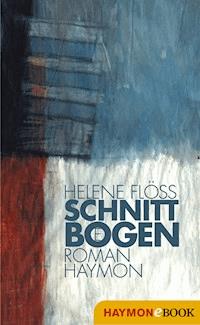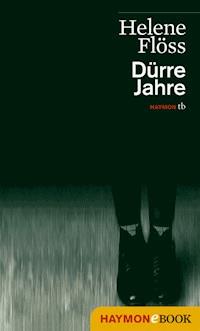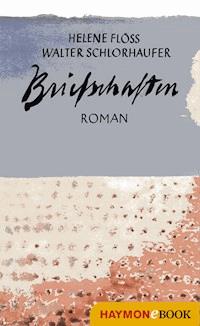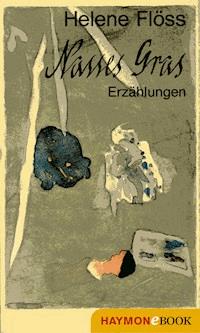Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Haymon Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Er ist Maler, lebt in der österreichischen Provinz und heißt Peter Franz. Wegen seiner Begeisterung für den italienischen Maler Piero della Francesca nennt sie ihn Piero. Sie heißt Magdalena und ist Kunstweberin, er sagt Penelope zu ihr. Doch sie vollendet ihre Bildeinfälle, während er über Skizzen nicht hinauskommt, zu sehr fürchtet er, seine Idealvorstellung eines Bildes nie zu erreichen. Ästhetik wird zum Zwang. Sein Schönheitsanspruch, der das ganze Leben umfasst, belastet auch das Liebesverhältnis, denn Piero will ihren mageren Körper runder, weiblicher, er soll seinem Ideal entsprechen. "Suchst Du eine Geliebte oder ein Modell?", fragt Penelope. Da stirbt Pieros alte Mutter, deren Pflege er sein Leben selbstquälerisch untergeordnet hat, und der Maler wird wegen "Sterbehilfe" verurteilt ... Helene Flöss erzählt die Geschichte des Malers, seiner Mutter und seiner Geliebten aus Magdalenas Perspektive. Der knappe Stil, der schon ihrem Bestseller Dürre Jahre zu beklemmender Eindringlichkeit verholfen hat, entspricht der geradezu asketischen Kürze des Textes, die es der Autorin trotzdem erlaubt, sich über die Geschichte einer missglückten Liebe hinaus mit einem breiten Spektrum von Themen, von Fragen alter und moderner Kunst bis zu gesellschaftlichen Problemen wie der Altenpflege, auseinanderzusetzen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 106
Veröffentlichungsjahr: 2013
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Helene Flöss
Der Hungermaler
Erzählung
Gefördert durch die Kulturabteilung des Landes Südtirol
© 2007HAYMON verlagInnsbruck-Wienwww.haymonverlag.at
Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form (Druck, Fotokopie, Mikrofilm oder in einem anderen Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung des Verlages reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
ISBN 978-3-7099-7734-7
Umschlaggestaltung: Michael Forcher unter Verwendung des Freskos„Santa Maddalena“ von Piero della Francesca im Dom von Arezzo
Dieses Buch erhalten Sie auch in gedruckter Form mit hochwertiger Ausstattung in IhrerBuchhandlung oder direkt unter www.haymonverlag.at.
Seit zwei Stunden wartet sie im Café, lässt das Haus schräg gegenüber nicht aus den Augen. Die Fassade grau, düster. Das Tor groß, schwer.
Wie oft ist sie in den vergangenen Jahren da ein- und ausgegangen.
Ein schwarzes Loch öffnet sich. Kurz nur. Ein Mann taucht darin auf. Das glatte braune Viereck schiebt sich wieder darüber.
Wie klein die Figur ist. Es war ihr bisher die Mächtigkeit des Tores nicht aufgefallen. Nur die Unheimlichkeit dahinter.
Der Mann schaut weder rechts noch links, auch nicht zurück. Geht geradeaus über den Platz, als ginge er auf sie zu. Über seiner linken Schulter hängt eine braune Ledertasche. Sackähnlich. Er trägt ein Viereck aus Karton unter den rechten Arm geklemmt. Unförmig. Die Hand um den unteren Rand der Mappe geschlossen. Schwarze Baumwollbänder halten Vorder- und Rückseite zusammen. Sie sind zu Schleifen verknotet. Die Kante des Kartons schneidet in die Achselhöhle. Die rechte, angehobene Schulter des Mannes steht schief.
Auf ihr lastet ein ganzes Leben in seiner schillernden Unwägbarkeit.
Was für ein trüber Tag. Als verschwinde die Sonne nicht hinter Wolken, sondern in sich selbst.
Sie legt mehr Geld auf den Tisch als eine Melange kostet. Nimmt die Jacke vom Garderobenständer. Geht auf den Platz hinaus. Sucht.
Dass einer so schnell verschwinden kann. Sich auflösen. Verschluckt werden. Sie hätte es ihm ankündigen sollen, dass sie auf ihn wartet. Er hätte ihr das Warten verwehrt.
Gefangenenbesuch.
Nein, sie ist nicht mit dem Häftling verwandt. Sie ist auch nicht mehr seine Geliebte. Seine Freundin? Eine Freundin.
Die Peinlichkeit in der Kabine. Die Wärterin nimmt Tasche und Mantel an sich. Tastet ihren Körper ab.
Im Besuchssaal fast nur Frauen. Sie warten. Lehnen sich an den hüfthohen Mauersockel. Auf dem Mauersockel eine Glaswand, die den Saal in Längsrichtung teilt und bis an die Decke reicht. Dahinter werden die Häftlinge einzeln hereingeführt. Im Zwei-Minuten-Abstand. Auf der Besucherseite fehlen die Stühle. Die Frauen drücken sich an die Scheibe. Sie reden schnell. Wie gegen die Zeit. Einige versuchen, die Finger unter den Spalt zwischen Mauer und Glas durchzuschieben. Berührung der Fingerkuppen des Gegenübers. Anderen steht der Ausdruck desjenigen im Gesicht, der sich an einen hoffnungslos Leidenden richtet. Der Wärter steht breitbeinig in der Tür. In der Hand einen Eisenring voller Schlüssel. Wie im Film.
Sie legt die flache Hand an die Scheibe. Auf der Hinterseite deckt Piero mit der seinen die ihre zu.
Diese absurde Gefängnisnähe, sagt er. Weil ein Glas zwischen ihnen beiden sei, dürfe er sich der Vorstellung hingeben, nein, der Vorstellung aufsitzen, es sei das Glas, nur das Glas, das nichts anderes zulasse.
Sie hebt zum Abschied die Hand. Er schaut zur Seite. Sie geht mit ihrem verhinderten Winken.
Gefangenenzyklus. Bilder aus fünf Jahren hinter Gittern.
Das werde er auf die Einladungskarte schreiben, sagt Piero: Gefangenenzyklus. Der Galerist erhoffe sich einen richtigen Besucheransturm.
Ja, einen Ansturm von Voyeuren, antwortet sie.
Ihr erster Besuch in seinem Atelier damals.
Bilder in Wechselrahmen. Sie lehnen in der Ecke wie Strafe stehende Kinder. Staffeleien recken die hölzernen Arme in die Höhe. Erinnern an den Gekreuzigten. Übereinander gestellte Sessel gleichen Insekten, die sich begatten. Auf der Lehne des Ohrensessels nach rechts und links ausgebreitet, die Ärmel eines weißen Malerkittels, wie ein in Ekstase flehender Mensch.
Tafeln mit den Gesichtern zur Wand.
Uraltes Zeug, sagt er, verstaubt. Bilder aus den Akademiejahren. Schülerarbeiten sozusagen. Überlebtes aus längst vergangenen Zeiten.
Stillleben.
Ein Korb mit Früchten auf einer Fensterbank. Zwei Äpfel, eine Birne, ein Granatapfel, ein Lorbeerzweig. Dahinter eine Landschaft. Das feine Geflecht des Strohkorbes wie von einem alten niederländischen Meister ausgeführt. In den Schalen der Früchte spiegeln sich Fensterrahmen und Landschaft. Der Bildraum harmonisch nach den Regeln des goldenen Schnittes aufgeteilt. Eine dunstige Atmosphäre mit zunehmend blasserer Färbung der entfernten Hügel. Naturgetreu, aber voller Magie. Die makellose Synthese von Licht, Farbe und Form.
Still-Leben. Die absolute Ruhe. Nur das Auge des Betrachters bewegt sich von innen nach außen. Es ist keine friedvollere Welt denkbar. Ein Reich der Unverdorbenheit und der jungfräulichen Schönheit. Die Barmherzigkeit der mitleidenden Landschaft. Einer lächelnden Landschaft. Aber die Landschaft tut nur so. Sie ist eine gehegte Wildnis.
Ein Stillleben, sagt er, das Verlegenheitsbild eines, der auch an verregneten Tagen malen will und der gerade keine wirksame Idee hat. Die Wiedergabe der Natur sei nicht seine Absicht. Auf die Komposition käme es an, darauf, dass jede Linie, jedes Zeichen seine Berechtigung habe, seine existenzielle Wurzel, seine tiefere Begründung.
Dann zeigt er auf die Wand gegenüber.
Dort sei seine wirkliche Arbeit.
Mein Gott, sagt sie vor den Schachteln.
Berge von Schachteln. Schachteln voller Skizzen. In Mappen, in Büchern, auf Blättern, Zetteln, Streifen. In kleine Rechtecke zerteilte Bögen. Mein Gott. Papierstücke, groß wie Diapositive. Daraus setzen sich die Bildszenen zusammen. Zu jedem Entwurf ein Gegenentwurf. In jedem Sinn ein Widersinn. Auf den Kopf gestellte Wirklichkeit. Zum Witz verkehrte Trauer. Ins Absurde verzerrte Angst. Ausgeschnittene Teile, auf- und in- und nebeneinander geklebt. Lange Streifen mit Farbflecken aus Buntstiften an die Seiten geheftet. Notizen zu Licht- und Schatteneinfall, zur Perspektive, zur Aufteilung der Leinwand. Beschreibung der Kleider der Figuren, des Dekors der Wände, der Fußböden.
Der versessene Tüftler.
Und die Bilder, fragt sie, die fertigen Bilder?
Außer diesen Relikten dort an der Wand gäbe es nichts, sagt er. Ob denn die Skizzen nicht genug seien. Es gäbe nichts Größeres als Leonardos Skizzenblätter.
Was für ein Anspruch.
Vielleicht sollte er seine Skizzen besser nicht herzeigen. Auch Michelangelo habe die Vorarbeiten für seine Werke versteckt gehalten.
Und dann musste er seine Notate mit in den Nacken zurückgelegtem Kopf anschauen, weil er nach all den Jahren, die er liegend in der Kuppel der Sixtina zugebracht hatte, gar nicht mehr anders lesen konnte.
Wo diese Kuriosa her seien, fragt er vergnügt. Er habe seine Bilder im Kopf. Das Licht. Die Schatten. Die Farben. In alten Zeiten, sagt er, habe man zur Ausführung der Skizzen gern einen Stift beschäftigt. Lehrlinge seien in diesem Gewerbe leider ausgestorben.
Sein ganzes Leben sei er immerzu mit jedem Entwurf unzufrieden. Sein ganzes Leben sei er immerzu auf der Suche. Immerzu gäbe es da etwas, das sich dem Entschluss widersetze, das der Festlegung entgegenlaufe. Die Selbstzufriedenheit des Ästheten sei ein Widerspruch in sich selbst. Und die Forderung, sich für eine Version entscheiden zu müssen, käme einer Vergewaltigung gleich.
Tausende von Proben. Unermüdliches Zeichnen. Gedankenverlorenes Träumen mit dem Bleistift. Endloses Monologisieren in der Stille seines Ateliers, seines Alchimistenlabors. Ein Künstler, sagt er, denke nicht in Gedanken. Seine Welt bestehe aus Symbolen, Zeichen, Allegorien.
Ich denke in Farben, antwortet sie.
In der Nacht träumt ihr von diesen Zettelkästen. Sie öffnen sich alle auf einmal. Blasen ihren Inhalt in die Luft. Aus den Zetteln werden Vogelfedern, die sie zudecken. Darunter ist sie am Ersticken.
Beim Aufwachen Pieros Satz im Kopf: Er sei hinter dem Bild her, hinter diesem einen Bild, das das Wesentliche der Existenz auszudrücken vermöge. Das, was hinter dem Augenschein liege. Was in Worten nicht gesagt werden könne. Das die Abwesenheit der Sprache brauche. Das Bild.
Sie sucht in ihrem Handwerk Zuflucht. Hinter ihrem Webstuhl. Der einzige sichere Ort für eine, die Zuflucht nötig hat. Das Sausen der Spindel. Das Auf und Ab der Schäfte. Das Anschlagen des Weberkammes. Vertraute Geräusche. Die immergleichen Bewegungen der Hände, der Füße. Absichtslos. Wie Gehen. Wie Schwimmen. Tausende Male wiederholt. Unnachgiebig, unermüdlich. Eigenschaften von Frauen. Arachnes. Athenes. Penelopes.
Ihr uraltes Handwerk.
Sie macht Muster. Ornamente. Abstraktes Spiel mit Formen.
Es stand am Beginn der Kunst.
Sie macht Bilder. Bilder nach Auftrag. Für eine Gelegenheit. Bilder für einen Zweck. Schöne Dinge für Menschen, die danach verlangen.
Nach dem Vortrag im Jüdischen Museum über Tiefenpsychologie und Religion geht der Maler auf dem Heimweg neben ihr her. Sie erzählt vom Altartuch, einer Auftragsarbeit für die Jubiläumsfeier des Eisenstädter Domes.
Wie ein modernes Altartuch aussehe, fragt er.
Wo es sich um Sakrales handelt, um Kult, gibt es kein Bedürfnis nach Neuerung, sagt sie. Rituelle Kunst will Bewahrung, Wiederholung. Modern? Modern ist nach Balthus, zu wissen, was bisher geschaffen wurde.
Dass ihre Stimme schön sei, antwortet er. Und lädt sie zum ersten Mal in sein Atelier ein.
In der Pause des Konzerts stehen sie nebeneinander im Hof des Esterházy’schen Schlosses. Von mittelalterlichem Gemäuer eingeschlossen. Blick auf den steinernen Brunnen.
Seit einer Stunde schaue er auf ihr Profil, sagt er, er wünsche sich, sie zu zeichnen. In seinem Atelier.
Sie antwortet auch auf die zweite Einladung nicht.
Für das Preisausschreiben des Jugendreferates sitzt sie mit dem Maler in der Jury. Sie bewerten Schülerzeichnungen.
Ob er sie ein drittes Mal einladen dürfe.
Wie beharrlich du bist.
Seine Beharrlichkeit, antwortet er, sei die eines Silberfischchens, das im Badezimmer aushält, allem Gift zum Trotz.
Die Drei ist eine gute Zahl, sagt sie und folgt ihm. Sie glaubt an den Zufall. Die Fügung. Das Zeichen.
Er sei nicht gern Lehrer, sagt er. Wie käme er dazu, jemandem etwas beizubringen, der es ihm nicht abverlangt. Und schließlich sei er Maler.
Dass der Professor für Kunstgeschichte dem Unernst der Schüler nichts entgegenzusetzen hat, geht von Klasse zu Klasse. Das weiß auch die Weberin schon. Die strapazierte Langmut dieses Lehrers. Die Gymnasiasten lassen sich von seiner traurigen Milde nicht beeindrucken. Auch von seiner verschämten Klugheit nicht.
Ob sie wiederkäme.
Lass das Künftige unbekannt sein, wie es sich gehört. Wenn wir es zur Unzeit befragen, müssen wir uns dann mit einem allzu bekannten Jetzt abfinden, antwortet die Weberin.
Die Neugier an jenem Nachmittag. Neugier auf den Maler. Auf den Mann nicht. Sie kennt Peter Franz seit jeher. Wie man einen kennen kann, der in der Kleinstadt, in der er wohnt, fast unbekannt ist. Sie grüßen einander seit jeher. Wie man sich grüßt unter Kollegen. Was man so über ihn sagt. Ein kauziger Mensch. Ein angenehmer, heißt es. Sanft. Ein Vorsichtiger. Jede Geste eine Zurückhaltung.
Er geht mit leicht zur Seite geneigtem Kopf über den Hyrtlplatz. Als sei ihm die Stirn zu schwer. Nachdenklich. Wiegender Schritt. Hager. Konzentrierte Augen.
Und überempfindlich, sagen seine Freunde.
Merkwürdige Freunde. Beinahe ehrfürchtig. Er ist nicht einer von ihnen. Das wissen sie bald. Er gehört nirgendwo dazu. Die Klassenbesten sind oft Außenseiter. Er aber sucht sich den Einzelgänger aus. Den Sonderling.
Eigentlich habe er sich im Leben nie mit jemandem beraten, sagt er. Eigentlich sei er nie etwas anderes als einsam gewesen. Nur wenn das Alleinsein ein zeitlicher Zustand sei, könne man etwas dagegen unternehmen, als Eigenschaft der Seele aber sei es ein chronisches Gebrechen. Die Einsamkeit sei sein Ausdruck für die niedergehaltene Auflehnung gegen alles.
Er weiß nichts von gemeinsamen Spielen. Von Streichen ganz zu schweigen. Er ist immer beim Malen. Beim Zeichnen. Beim Lesen. Und hört Bach.
Auch aus dem Radio, fragt sie.
Ihr Radio in der Küche daheim, sagt er, sei zufällig immer auf Volksmusik eingestellt gewesen.
Der Zufall ist seine Mutter.
Er habe diese Blechbläser gehasst, sagt er.
Ein unzugänglicher Bub ist dieses Kind. Seine Mitschüler haben den seltsamen Abstand zu ihm ins Erwachsenenalter mitgenommen. Ein besorgter Ton ist in ihrer Stimme, wenn sie nach seinem Befinden fragen. Gerade so, als könne einer wie er nicht hineinwachsen in eine heitere Zukunft.
Sie hätten es alle zu etwas gebracht, die Freunde von früher, sagt er. Sie solle sie sich anschauen, die Steuerberater, Rechtsanwälte, Primarii. Und alle seien sie Väter.
Wünscht du dir Kinder, fragt sie.
Das weiß er nicht. Er weiß nur, dass er ein Leben ohne Frau nicht denken will.
Vor Kindern, sagt er, befalle ihn eine furchtsame Andacht.
Da kommt Piero, ruft der Psychiater in der Haydngasse.
Sándor Jahn, Gerichtspsychiater sei er auch, weiht Peter sie hinterher ein. Er lege dem Straftäter aus, warum er die Straftat begangen habe.
Ich mache dich mit Piero bekannt, sagt der Psychiater zu seiner Frau, Piero della Francesca, den Zweiten. Und stell dir nur vor, in Wirklichkeit heißt er Peter Franz. Was für ein Zufall.
Der Zufall ist dort, wo der liebe Gott anonym bleiben will, antwortet die Weberin.
Wo sie das denn schon wieder aufgeklaubt habe, fragt Peter.
Sie hat es vergessen. Aber der Gedanke gefällt ihr.
Was das für eine seltsame Gläubigkeit sei, die ihre, sagt er.
Piero della Francesca. Sein Lieblingsmaler.
Wie kommt einer auf Piero della Francesca.