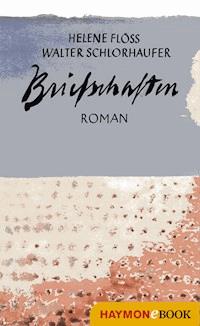Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Haymon Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Erste Buchveröffentlichung der mit dem Maria-Veronika-Rubatscher-Literaturpreis bedachten Südtiroler Autorin: "Der Blindenkeller", "Nasses Gras", "Nebeneinander" und "N.C.", eine sehr persönliche Erinnerung an den Dichter Norbert C. Kaser.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 151
Veröffentlichungsjahr: 2014
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Erste Buchveröffentlichung der Südtiroler Autorin: Vier Erzählungen, darunter eine sehr persönliche Erinnerung an den Dichter Norbert C. Kaser. Über Helene Flöss und die hier ausgewählten Texte schreibt Walter Methlagl:
Häufig herrscht – als hervorgeholte Erinnerung – die Perspektive der eigenen Kindheit und Jugend, so daß selbst in der abschließenden Reminiszenz an »N. C.« (zerstörender Konflikt eines jungen Mannes mit sich selbst – nur die Sprache überlebt) es schwer und freilich auch immer weniger nötig wird, Selbsterlebtes und Ausgedachtes auseinanderzuhalten.
Unmittelbar aus dem Leben gegriffen ist beides, feingezeichnet bis zur Verfremdung ins Überrealistische. Die Sicht auf Nahes und Nächstes ist durchgängig: Stoffreste, Hausgeräte, Schreibzubehör, Fahrzeuge – dies alles »in Funktion« gezeigt, aber auch die Gestalt des Menschen, sein Gesicht, seine Seele, alles in Nahsicht, bewegt und bewegend. Unbewußtes entwirrt sich wie ein Wollknäuel, spät erst wird man seiner gewahr im Eintauchen in eine neue Dimension des Wirklichen. Der Geruch aus Küche und Nähstube, der Waschküchendunst, das Schwanken eines Glasbildes vor dem Fenster setzt es frei; an leichten, nur scheinbar oberflächlichen Erschütterungen erkennt man es bestürzt.
Die Enge der Lebensverhältnisse teilt sich beklemmend mit, zu der altväterischen Selbstverständlichkeit aller Verrichtungen, an der nichts mehr stimmt, paßt gut der Anflug von »Gartenlaube«. Dennoch sind die aufwendig umschriebenen Alltagsereignisse »moderne Lebenswelt«, einbezogen in den weitausholenden Rhythmus anhebender und absteigender Perioden sprachlicher Fügung, aus denen Substantive wie Schiffsmaste ragen oder die sich runden wie die Kreise um einen ins Wasser geworfenen Stein. Im Hintergrund dieser Sprache klingelt es aber auch wie aus einer Registrierkasse, Teil für Teil wird erzähltes Leben abgebucht, Schicht um Schicht abgetragen, eingebracht, untergebracht, eingetragen.
Erst am Schluß gewahrt man, daß man sich durch allen Kleinkram hindurch entlang einer großen epischen Linie bewegt hat, die noch das Geringste auf sich bezieht. Herrschte zuvor durchwegs Verzicht auf große Übersichten und längere Gelegenheiten zum Verweilen: am Schluß findet man sich jedesmal über einem Abgrund, und wenn man hinunterschaut, schwindelt einen.
Helene Flöss ist 1954 in Brixen/Südtirol geboren und dort seit 1975 als Lehrerin tätig. Ab 1985 Veröffentlichung von Erzählungen in verschiedenen Literaturzeitschriften, Anthologien und im Rundfunk. 1988 Zuerkennung des Maria-Veronika-Rubatscher-Literaturpreises der Städte Hall und Brixen.
Umschlaggestaltung: Peter Prandstetter unter Verwendung eines seiner Aquarelle
Helene Flöss
Nasses Gras
Erzählungen
Ungekürzte E-Book Ausgabe 2014
© 1990HAYMON verlagInnsbruck-Wienwww.haymonverlag.at
Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form (Druck, Fotokopie, Mikrofilm oder in einem anderen Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung des Verlages reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
ISBN 978-3-7099-7736-1
Satz: RSM/ReutteCovergestaltung: Peter Prandstetter unter Verwendung eines seiner Aquarelle
Dieses Buch erhalten Sie auch in gedruckter Form mit hochwertiger Ausstattung in Ihrer Buchhandlung oder direkt unter www.haymonverlag.at.
INHALT
Der Blindenkeller
Nasses Gras
Nebeneinander
N. C.
DER BLINDENKELLER
Auch von mir, als der redegewandtesten ihrer Töchter, wird sie es sich nicht einreden lassen, den Mietzins als unrechtmäßig zu empfinden, den sie der Musikerin abverlangt im Dachgeschoß für die drei möblierten Zimmer, die abschätzig als mit Möbeln angestellt bezeichnet werden von der mit den raffinierten Wohnansprüchen, und wo ich die nur herhabe.
Zu ihrer Verteidigung zählt Mutter die Preise aller umliegenden Altstadtbauten auf, beschreibt anschaulich deren tanzende Bodendielen, Gangtoiletten für mehrköpfige Familien, schlechtschließende Türen und klappernde Fensterrahmen und besteht darauf, daß das, was sie anbietet, ein wohlfeiler Palast sei, vergleichsweise. Da werden auch Zettel und Bleistift überflüssig, womit ich ihr die zu ersetzenden Dachplatten, zu erneuernden Balkongeländeranstriche und abzuschleifenden Treppenhausbeläge vorzurechnen gedenke über fünf Jahre aus geschätzten Mindestmieten; das tut sie kühl ab als sozialistische Großsprecherei und läßt den gegenwärtigen Betrag gerade reichen für eine Jause am Tag und, daß die ihr zusteht, daran läßt sie nicht rütteln, ob die zur Verfügung gestellten Wände nun ererbt oder erarbeitet sind, hat damit gar nichts zu tun.
Zu denen, die klug werden aus Erfahrung, gehöre ich nicht, ich hätte es lernen können mittlerweile, daß Überzeugenwollen erfolglos bleibt, aber die Absicht, das Thema zu wechseln so rasch wie möglich, will ich vertuschen und Mutter die Genugtuung nicht lassen des zur besseren Einsicht gekommenen Kindes.
Mit der Frage, wie die blinde Frau in unser Haus kam, die das Kellergeschoß bewohnt hatte, als ich Kind war, bringe ich das Gespräch in eine andere Richtung. Wie gewohnt war irgendeine Kundin im Spiel, weil in Mutters Schneiderei das Gerede zum Beruf gehört und unsere Stube auch ein Vermittlungsbüro sein könnte und der Gesprächsstoff so vielfältig und ausgiebig, daß er leicht abrutscht in Klatsch.
Daß man den Keller wohl nur an eine Blinde hätte loswerden können, klingt vorwurfsvoller als beabsichtigt, und ich handle mir Mutters scharfen Verweis ein, auch sie habe in den ersten Jahren ihrer Ehe dort unten gewohnt, genäht, gekocht und gegessen, und dies sollte reichen als Nachweis für Bewohnbarkeit.
Da hatte mein Ausweichen sich als Fehltritt erwiesen, und ich war in das alte Gespräch gerutscht und schließlich der erlösenden Klingel dankbar, die eine Kundin einläutete, weil ich Erinnerung selber hatte und mich Mutters unterstützende Beschreibung der Blinden, zu der sie ansetzte, nur stören konnte.
Den Steinbrunnen im Hausgang gibt es seit Jahren nicht mehr, doch ist es mir ein Leichtes, die kleine Frau auf dem ausgetretenen Lattenrost stehen und ihre Wäsche langsam über das geriffelte Brett reiben zu sehen mit den ausgewrungenen Stücken nahe an der Hand und ohne ausladende Bewegungen; vorsichtig und achtsam hielt sie mit beiden Händen den Holzstock, den sie in der heißen Lauge rührte, und zog die Wäsche nie am Stock nach oben wie Mutter, um sie wieder in den Kupferkessel zu stoßen; sie stocherte bedächtig darin herum, regelmäßig zweimal nach rechts und links und bewegte das Wasser nur leise und steckte nie mehr als ein Holzscheit ins Feuer und ließ den Kessel nicht brodeln und hielt die Lauge niedrig und stand dafür doppelt solange davor wie Mutter, um durch Zeit wettzumachen, was sie an Hitze einsparte. Immer wieder griff sie zählend über die abgelegten Wäschestücke, wechselte sie umständlich in drei Holzbütten, weil sie dort vorgewaschene, Koch- und Spülwäsche gesondert hielt.
Die monatlichen Waschtage gehörten zu den Lieblingstagen meiner Kindheit; ich genoß den Seifengeruch im Haus, die neblige Luft im dampfgesättigten Flur, die feuchte Wärme neben dem großen Feuerloch und klatschte genußvoll nasse Wäschestücke auf den Steinbrunnenrand.
Dienten die Holzbütten an waschfreien Tagen als Wiegen für Puppen und kleine Nachbarskinder, wollte ich später meine Kraft daran messen, wenn ich mitanpacken durfte am unförmigen Griff über unzählige Stufen bis zum Dachboden und die heimliche Angst verscheuchte um den schwachen Arm, der aus der Schulter reißen könnte.
Das Glattziehen der Leintücher vor dem Aufhängen wurde mir erst zugetraut, als ich im Schwimmbad der Stadt über den Strich hinausragte, den man als Maß angebracht hatte zur Anhebung des Eintrittspreises, und durch erreichte Körperlänge sicherstellte, daß ich die Wäsche auch hoch genug über dem Boden zu halten imstande war.
Nur allmählich begann ich daran zu zweifeln, ob die Länge im Wuchs das zu halten vermochte, was sie versprochen hatte, als es mir nicht schnell genug hatte gehen können mit dem Großwerden und die Erwachsenengebühr die Fünfzig-Lire-Münzen verschluckte, die, als Herausgabe gesammelt, alle drei Tage eine Salzstange abgegeben hatten, und mit dem Verlust des Reizes, den alles Neue hat, war schließlich das Planenziehen nur mehr Pflicht.
Frau Pichler tappte vorsichtig über die letzten Stufen zum Dachbalkon, wo die Geländestange fehlte und kein Anstoßen mit dem Kübel erlaubt war ohne Gefahr für das Gleichgewicht. Die Wäschestücke hängte sie mit einer gemeinsamen Klammer paarweise zusammen, geordnet nach Art und Verwendung, und steckte nie ein Küchentuch zwischen die Handtücher, obwohl beide aus grober Baumwolle waren und sich kaum unterschieden in der Griffigkeit. Aus einem um die Körpermitte gebundenen Stoffsäckchen fingerte sie die Wäscheklammern, und es hätte mich kaum verwundert, wenn sie diese nach Farben gesondert angebracht hätte, weil sie auch hängengelassene Klammern meiner Mutter nie miteinsammelte. Waren es nicht die knarrenden Holzstufen, die sich unter ihrem Tritt bewegten, hörte man ihren Schritt nicht. Sie ging auf Filzsohlenpantoffeln mit leicht federndem Gang und mir schien, als höbe sie die Füße um ein Merkbares zu hoch im Gehen, was beinahe tapsend aussah, nur waren die Schritte leicht gesetzt und gaben nicht den Eindruck von Schwerfälligkeit ab. Großmutter, die für alles eine Erklärung hatte, wußte, daß Blinde alle übrigen Sinne besonders ausgeprägt hätten und geschärft und folglich auch besser hören könnten als unsereiner und Lärm deshalb unangenehmer empfänden, und manchmal kam mir ein kleiner Zweifel, wenn wir uns in der Stube tollten, wem eigentlich besonders gelegen war an der Ruhe, zu der Großmutter uns ihretwegen nie anhielt, sondern der armen Frau Pichler wegen, die unter uns wohnte und leider ein so feines Gehör hatte.
Ich rief deshalb auch nur leise, schickte Mutter mich mit einem Teller voller Krapfen in den Keller; Frau Pichler bekochte sich zwar selbst, wagte sich nur ans Fettgebackene nicht wegen des heißen Schmalzes, das ihr hätte aus der Pfanne spritzen können. Daß der Teller heiß wäre, beeilte ich mich anzubringen vor einer Begrüßung aus Furcht, sie könnte die Hände zu rasch vorstrecken und neben das untergeschobene Tuch fassen, das ich schlecht freigeben konnte, aber vorerst bog Frau Pichler sich etwas zurück, lachte laut und trällernd und gab damit zu verstehen, daß sie mich erkannt hatte und meinen Auftrag. Irgendwie befremdete mich ihr Lachen, es klang mir übertrieben fröhlich und war eher als Antwort zu deuten auf einen Scherz denn als Begrüßung, und den Mund machte sie weit auf und man konnte ihre Zunge ganz schnell gegen den Gaumen zittern sehen.
Frau Pichler zog den Krapfengeruch durch die Nase und bedankte sich herzlich, und ich war stolz auf meine großzügige Mutter, die dem Idealbild der Lehrerin derart nahekam, die uns vom Hungerndenspeisen und Dürstendentränken eindringlich redete, und nur das Nacktebekleiden wollte ich nicht mehr erinnern wegen der weihnachtlichen Enttäuschung; ich hatte im Advent einen kardinalroten Mantel zur Halbprobe überziehen müssen, den Mutter angeblich einem armen Kind als Geschenk nähte, und begeistert hatte ich meiner Lehrerin von der Mutter selbstlosen Güte erzählt und den Mantel geschildert in allen Einzelheiten von aufgestelltem Kragen bis tellergroßen Knöpfen und Mutters Näharbeit in der Stunde vor Mitternacht und wie sie sich die Zeit für Extraarbeiten geradezu stehlen müßte, und dann hatte ein kardinalroter Mantel für mich als Weihnachtsgeschenk am Fenstergriff gehangen, und Mutters Zuspruch zu meinen unverständlichen Tränen, ich sei auch ein armes Kind gewesen ohne Mantel über den halben Winter, hatte meiner Weigerung keinen Abbruch tun können, diesen an Schultagen zu tragen.
Obwohl Frau Pichler das eigentlich nicht wissen konnte, sagte sie regelmäßig »und so viele«, als sie die Krapfen in Empfang nahm, und einmal war mir die Unrechtmäßigkeit aufgegangen, die in meinem Hinweis gelegen hatte, daß links die roten, rechts die grünen Krapfen lägen, und sprach im folgenden von den marmelade- und spinatgefüllten, nur blieb das Rechts und Links zweifelhaft, weil unausgemacht, ob die Richtung von meiner Seite ausging oder der ihren. Nein, arm sei Frau Pichler eigentlich nicht, jedenfalls nicht so arm wie die St. Peterer Kleinhäusler, von denen Großmutter erzählte, sie hätten im Teller aus den Schwarzpolentaknödeln die Speckwürfel wieder herausgestochert, um sie ein zweites Mal in den Teig zu rollen, aber einen Kostbissen nähme sie gerne an.
Frau Pichler schubste die heißen Krapfen vorsichtig mit einem Löffel von meinem Teller auf den ihren, vergaß es aber nicht, mich rasch zu bitten, den Hund nur einmal zu plagen, als hätte sie meine Absicht gespürt, die schon an der Strickmaschine angelangt war, auf der die handgeschnitzte Spieluhr lag, die es mir angetan hatte. Die Drehwalze im hölzernen Kästchen deckte ein liegender Hundekörper ab, der beim Hochheben die Melodie ankurbelte, an der ich mich nicht satthören konnte, und das Besondere daran war, sie nach Wunsch und Bedarf immer wieder wie auf Bestellung ablaufen lassen zu können.
Als Vater später einmal unter den Wochenendgeschenken einen Schallplattenspieler mitgebracht hatte, verpfändet von einem in Geldnot geratenen Hotelgast, konnte ich seine Kränkung nicht verstehen, als ich begeistert ausrief, das sei ja wie mit Frau Pichlers Spieluhr, dabei aber die Wiederholbarkeit bestaunte, die nun für eine ganze Schallplattensammlung gelten sollte, Vaters Wundergerät aber anscheinend durch den Vergleich entwertet hatte.
Von der Strickmaschine ließ ich die Finger, wenn auch die aufgesteckten farbigen Spindeln in ihrer eleganten Trichterform reizten, aber wie Mutters Nähmaschine gehörte sie zur geheiligten Gerätschaft und war unberührbar.
Frauen hatten für mich von Natur aus mit Bekleiden und Bestricken zu tun, und bis zum Märchen mit dem Schneiderlein waren mir männliche Schneider kaum vorstellbar gewesen, und die Ausdauer am Faden und die endlose Wiederholung immer gleichbleibender Stiche oder Maschen und das fast nicht sichtbare Fortschreiten der Arbeit und die Unmerklichkeit der Bewegung und die stundenlange Vertiefung mit kaum wechselnder Kopfhaltung traute ich Männern nur ungern zu. Geheimnisvoll blieb dennoch für lange Zeit eine strickende Blinde, trotz der drei Strumpfhosenpaare in unseren Kinderschubladen, Wolleibchen und Unterhosen mit Bein und sämtlich handgefertigt.
Damit konnte ich selbst Großmutter etwas in Verlegenheit bringen, die auf kindliche Forderungen, die ihr unerfüllbar schienen, zu antworten pflegte, daß bestimmte Dinge eben nicht gingen, genausowenig wie ein Einbeiniger zum Briefträger werden könne und ich gern um den Gegenbeweis herumfragte mit der strickenden Blinden.
Heimlich fürchtete ich lange, es könnte einmal ein roter Faden in die graue Stumpfhose rutschen oder zweifarbige Fersen an den Röhren baumeln, aber Mutter vertraute genausoblind auf Frau Pichlers Geschicklichkeit, wie diese arbeitete.
An ihren Wollknäuelschrank durfte ich nicht, da hatte jedes Strähnchen eine Schleife umgebunden oder ein Band, eine Kordel oder einen Sisalfaden und war dadurch kenntlich gemacht. Die Stricknadelstärken stellte sie mittels eines gelochten Kartonstreifens fest, der unterschiedlich große Löcher hatte, in die sie die Nadeln steckte und die Löcher anschließend durchzählte in halben Zentimeterabständen.
Gern hätte ich Großmutter geraten, sich mit Frau Pichlers Haspel einzulassen; die netzförmig ausgespannten Greifer drehten sich reibungslos mit den Wollsträhnen und hätten meine auseinandergespannten Arme überflüssig gemacht und die endlos ein- und ausgedrehten Hände ersetzt, von denen ich den Faden nach und nach rutschen ließ; mit dem Vorschlag hielt ich aber der Geschichten wegen zurück, die Großmutter während des Knäuelwickelns erzählte, wo sie uns ohne Ungeduld zugestand, bei besonderer Spannung im Verlauf der Geschichte die Arme sinken und die Wollkugel im Schoß ruhen zu lassen; die kreiselnde Haspel anzuhalten, hätte sie möglicherweise als störenden Eingriff empfunden.
Frau Pichler war Großmutters Gelassenheit fremd, sie schien sich ständig bewahren zu müssen vor allem Möglichen und auf Unvorhergesehenes zu lauern, und da es Vorhersehbares für sie nicht gab, hatte ich meinen Reim auf ihre Verunsicherung in Anwesenheit von Kindern. In Gesellschaft von Frau Pichler empfand ich manchmal die gewagtesten Träume fast verwirklicht, die mich eine Tarnkappe finden ließen aus irgendeiner Heldensage; nur wurde mein befreites Gefühl bei dem Gedanken getrübt, Frau Pichler befände sich eigentlich unter lauter tamkappentragenden Wesen und sie wäre der einzige Außenseiter ohne Deckung, der von allen gesehen werden könnte, und weil mir meine eigene Verlegenheit verhaßt war, wenn ich mir den lieben Gott vorstellte, der kein Verstecken und Verheimlichen zuließ und in Gedanken sehen konnte und Sehnsüchte, malte ich mir Frau Pichlers Lage ähnlich aus und verabscheute schließlich meinen Tarnkappenwunsch als einen unrechtmäßigen, und der Verzicht war eine Entscheidung und allgemein gültig.
Meistens bemühte ich mich, gesittet und ruhig in der dämmrigen Küche zu sitzen und den Fortsetzungsfolgen der Wochenschauromane zuzuhören, die Mutter vorlas und denen ich wohl noch schlechter folgen konnte als Frau Pichler, die unter der Geschwindigkeit seufzte, mit der Mutter las, und ab und zu nachfragte, weil sie den Lesefaden verlor, den sie weniger geschickt in der Hand hatte als den zu verstrickenden.
Ich unterhielt mich währenddessen mit dem Erraten der Personen, zu denen die Beine gehörten, die ich bis etwas unter die Knie sehen konnte, wie sie am Kellerfenster vorbeigingen, und begutachtete die mehr oder weniger stark abgetretenen Stöckel der Damenschuhe und verachtete verschlampte Sohlenleder als Geschmacklosigkeiten, weil nach Mutters Losung das beste Kleid nichtssagend wirkte durch unpassendes Schuhwerk. Manchmal staunte ich über die Häßlichkeit von Zehen und Füßen, die mir erst auffiel im Absehen von allem Übrigen, und manche Hammerzehen und Überbeine sahen aus wie Wurzelwerk und es gab sichere Schritte und das Aufsetzen auf platten Sohlen wie wankende Gangarten und abrollende Bewegungen von Ferse zu Ballen oder tippendes Geradeberühren mit den Fußspitzen, und fast immer geriet mir das Vorübergehen zu rasch und die Versuchung war groß, mit einer Stricknadel zwischen die Fenstergitter zu langen und Geschwindigkeit wegzunehmen für ausgiebigeres Beschauen.
Obwohl ich keinen ähnlich ungnädigen Beobachter vermuten konnte hinter dem Kellerfenster, wurde mein eigener Schritt unsicher im Vorübergehen und ab und zu hockte ich mich davor und wartete, bis Frau Pichler sich mir zuwendete, weil sie meinen Schatten spüren konnte; daß sie im Lesen innehielt und meine Gegenwart ahnte, wußte ich, sobald ihre Finger sich nicht mehr über die Zeilen bewegten, und dann sagte ich ihr, wie gern ich lesen würde und zugleich zum Fenster hinausschauen, weil einem so nichts entgehen könnte und das Buch bald zugeklappt wäre, wenn draußen sich Interessantes täte.