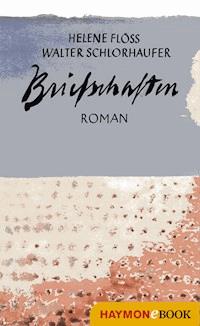Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Haymon Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Sechs Jahre wartete die Lena auf ihren Fidl, der 1915 in russische Kriegsgefangenschaft geraten war. Seine Briefe und die Erzählungen ihrer Großmutter verdichtet die Autorin zu einem Panorama unterschiedlichster Gefühle und Ereignisse. Was Krieg, Kampf und das massenhafte Sterben für den einzelnen Soldaten bedeutet, wie Tiroler bei ukrainischen Bauern arbeiten und russische Gefangene beim Grödner Bahnbau helfen, warum ein Welschtiroler zuerst für den österreichischen Kaiser und dann für Italien kämpfen muß, Helene Flöss weiß es anschaulich und spannend niederzuschreiben, wobei nicht nur die große Politik eine Rolle spielt, sondern vor allem Traditionen und Lebensart der kleinen Leute, die ihre Folgen tragen müssen. Bevor Lena stirbt, hinterläßt sie ihrer Enkelin die Gewißheit, daß es mit dem Sterben wie mit dem Einschlafen sei: man merke den Augenblick nicht, in dem man vom einen Zustand in den anderen tritt. Man wache eben dann in einer anderen Welt auf. Es ist auch eine andere Welt, von der sich "das Kind" im Roman von der "Großmutter" erzählen läßt. Es ist eine vergangene Welt, mit der uns aber immer noch viel und Entscheidendes verbindet. Es ist nicht Nostalgie, die Helene Flöss bewegt, sondern der Wunsch zu verstehen, wie alles geworden ist. Daß darüber ein Hauch Wehmut weht, wen wundert's?
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 289
Veröffentlichungsjahr: 2014
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Sechs Jahre wartete die Lena auf ihren Fidl, der 1914 in russische Kriegsgefangenschaft geraten war. Seine Briefe und die Erzählungen ihrer Großmutter verdichtet die Autorin nicht nur zu einem berührenden Porträt zweier außergewöhnlicher Menschen, sondern zu einem Panorama unterschiedlichster Gefühle und Ereignisse.
Was Krieg, Kampf und das massenhafte Sterben für den einzelnen Soldaten bedeutet, wie Tiroler bei ukrainischen Bauern arbeiten und russische Gefangene beim Grödner Bahnbau helfen, was nacheinander Faschisten und Nazis bei den Bewohnern des kleinen Bergtales anrichten, Helene Flöss weiß es anschaulich und spannend niederzuschreiben, wobei es nicht um die sogenannte „große Politik“ geht, sondern um Leben, Lieben und Leiden der kleinen Leute, die ihre Folgen tragen müssen, um Alltag und Feste in einer vergangenen Welt.
Es ist aber eine Welt, mit der uns noch viel und Entscheidendes verbindet. Es ist auch nicht Nostalgie, die Helene Flöss bewegt, sondern der Wunsch zu verstehen, wie alles geworden ist. Daß darüber ein Hauch Wehmut weht, wen wundert’s?
Helene Flöss
LÖWEN IM HOLZ
Roman
Für Theresia Überbacher-Ploner (1891-1970)
Zum Verständnis von Dialektausdrücken und Wörtern aus dem Italienischen oder Russischen gibt es am Ende des E-Books ein Glossar.
© 2003HAYMON verlagInnsbruck-Wienwww.haymonverlag.at
Ungekürzte E-Book Ausgabe 2014.
Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form (Druck, Fotokopie, Mikrofilm oder in einem anderen Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung des Verlages reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
ISBN 978-3-7099-7735-4
Cover: Benno PeterSatz: Haymon Verlag
Dieses Buch erhalten Sie auch in gedruckter Form mit hochwertiger Ausstattung in Ihrer Buchhandlung oder direkt unter www.haymonverlag.at.
Inhalt
Inhalt
Glossar
Eine Art „Nachwort“
Weitere E-Books aus dem Haymon Verlag
Unzählige Male wiederholte Geschichte, beharrlich, ausdauernd, in der immer gleichen Wahl der Worte, im immer gleichen Ablauf der Handlung, der Personen, des Ausgangs.
Die heimliche Hoffnung des Kindes, diesmal, vielleicht bleibt diesmal der mittlere der drei Soldaten nicht im Krieg.
Der hölzerne Stuhl mit den gedrechselten Beinen, mit der geschnitzten Lehne, der ausgekerbten Löwenmähne, leicht nach hinten geneigt, das obere Ende abgerundet, dunkles Holz; in der Mitte der Lehne eine Aussparung. Die Aussparung ist ein Löwenmaul. Da hinein steckt man die flache Hand, um den Stuhl zu verschieben, ihn aufzuheben.
Die Angst des Kindes vor diesem Löwenkopf, dem Löwenmaul; das Sitzen auf dem äußeren Rand, aufrecht. Die Füße baumeln über dem Boden. Kein Anlehnen, keine Berührung der Schulterblätter mit diesem aufgerissenen Maul.
Onkel Lenz steht vom Stuhl auf, gebückt langt er mit der Rechten in den Rücken. Seine behaarte, langfingrige Hand packt die Luft, gleicht einer Spinne, die das Löwenmaul demnächst verschlingen wird.
Die hohen Betten in Großmutters Schlafzimmer, schwer, mit dicken Matratzen und metallenen Federn. Der Genuß, in der Sommerfrische auf Großmutters leerer Ehebettseite schlafen zu dürfen. Und neben dem Bett zwei dieser geschnitzten Stühle. Abend für Abend an die freie Bettkante des Kindes geschoben. Auf daß es nicht herausfalle. Auf daß die Löwen die Träume des Kindes bewachten.
Das Kind fällt in all den Sommern kein einziges Mal aus dem Bett, weil es sich weit in die Bettmitte hineinlegt. Weil es sich auch im Schlaf vor den hölzernen Wächtern fürchtet.
Drei Generationen von Kindern haben sie schon bewacht. Einmal wird das Kind von seiner Mutter einen dieser Stühle erben. Den Stuhl der Mutter der Mutter.
Das Kind greift an die vordere Kante des Sitzes und zieht den Stuhl nahe an die Wand heran. Die Wand mit den drei Tafeln. Silbergrau gerahmte, vergrößerte Photographien dreier Soldaten. Alle drei mit derselben schiffchenförmigen Kappe. Alle drei mit denselben schlecht erkennbaren Zeichen auf den Schultern. Alle drei in Brusthöhe abgeschnitten, alle drei ernst, alle drei mit demselben Vornamen, demselben Nachnamen, alle drei tot, gefallen; zwei an der Ostfront, einer am Balkan.
Der Mittige trägt eine Nickelbrille. Der Mittige der drei Soldaten ist Onkel Clemens. Clemens Federspiel, Student.
„Unteroffizier“, sagt die Großmutter.
Seitlich, wie rechter und linker Schächer, Clemens Federspiel, Eichholz. Clemens Federspiel, Kronenwirt. Sie gehören zusammen, die drei Vettern.
Das Kind steht auf dem Stuhl, damit es den Bildern ganz nahe ist.
„Der Fidl“, sagt die Großmutter, „ist schwer über die Stiege heraufgestapft, langsam. Er ist immer schwer und langsam über die Stiege gegangen, der Fidl mit seinem Asthma.“
Sie hat die Krapfen im heißen Fett, ruft aus der Küche, komm, Fidl, es gibt Krapfen.
Sie hat ihn heute nicht aus der Gemeindestube abgeholt. Krapfen sind nur dann köstlich, wenn der Esser auf den Krapfen wartet, nicht umgekehrt. Gewöhnlich geht sie am mittleren Vormittag mit einer entkernten, halbierten Birne über den Dorfplatz in Fidls Schreibstube. Gemeindeschreiber ist ihr Fidl, ein Hungerleiderberuf.
Die Lona ist ans Sparen gewöhnt. Seit sie mit dem Fidl verheiratet ist, kennt sie die Not. Nicht die ganz große, nicht den Hunger, aber die Knappheit. Und doch findet sie immer etwas, was ihren Fidl freut. Wenn es nicht die vollkommenste Birne ist, dann ein paar Nüsse oder Dörrzwetschgen. Die Birne reibt sie mit einem leinenen Tuch ab, bis die Schale glänzt, legt die Frucht für ihren Fidl auf einen ihrer schönen Teller.
Noch nie hat es in der Gemeindestube von Innerwiesen so viel Schreibarbeit gegeben. Einberufungen müssen über den Tisch des Fidl, Urlaubsbescheinigungen, Gefallenenmeldungen, Vermißtenanzeigen; dazu noch die Anträge derer, die sich zur Umsiedlung nach Deutschland entschlossen haben, auch die Gesuche der Rückwanderer in dieser bewegten Zeit.
Eine Handschrift wie ein Studierter, heißt es im Dorf. Das wäre er gern geworden, der Fidl, ein Studierter. Es ist bei der schönen Handschrift geblieben.
Der Fidl steht in der Küchentür, atmet schwer. „Wir brauchen heute keine Krapfen, Lona“, sagt er.
Die Lona bekreuzigt sich. „Jessis Marria.“ Sie weiß Bescheid.
Vor zwei Jahren die Nachricht auf Fidls Schreibtisch. Da sitzt er noch in Moosbruck, im Amt für Aus- und Rückwanderer, in der Zweigstelle des Kreises 3. Clemens Federspiel, Kronenwirt, gefallen, Ostfront 1941. Es ist der Sohn von Fidls ältestem Bruder. Sein eigener Sohn ist es nicht. Noch nicht. Was ist das für ein Trost.
Die zweite Nachricht ein Jahr später. Clemens Federspiel, Eichholz, gefallen, Bosnien 1942. Herzrasen. Der zweite Clemens Federspiel. Es ist der Sohn von Fidls zweitältestem Bruder. Sein eigener Sohn ist es nicht. Noch nicht. Was ist das für ein Aufschub.
Die dritte Nachricht. Clemens Federspiel, Dorf 22, gefallen, Ostfront 1943. Das wäre nicht nötig gewesen: Dorf 22. Es gibt nur mehr diesen einen Clemens Federspiel, seinen Sohn.
Wie lang der Weg bis zum Festenegg ist. Wie steil der Hügel, auf dem der Hof thront. Der Fels ist ein gutes Fundament für das mächtige Anwesen. Noch nie ist ihm der Aufstieg derart schwer angekommen. Wie feindlich die Mauer mit den zwei Toren mit einem Mal ausschaut. Und der Fidl trägt das Unglück hinein.
Jetzt müßte ihn die Lona doch schon hören, ihm entgegengehen. Wie immer ist die außenliegende Stiege blitzblank, als könnte es gar nicht hineinregnen und hineinwinden unter das Vordach bis auf die Stufen.
Was dieser Mensch für einen Beruf hat! Schreiber von Gefallenenmeldungen … Wie viele Briefvorlagen hat er zur Auswahl …, eine erlesene Handschrift: Ihr geliebter Sohn, woher hat er das. Sofort tot …, woher weiß er das.
Die Großmutter hebt das Kind vom Stuhl, weg von diesen drei Tafeln. Aber noch ist die Geschichte nicht zu Ende. Das Kind hockt sich auf den Fußschemel vor Großmutters Beinen.
„Damals dachte ich, die Sonne würde nie mehr aufgehen“, sagt sie.
Sie weint nicht. Sie weint auch nicht, wenn sie die Feldpost ihres Sohnes nachliest, Brief für Brief bis zur Gefallenenmeldung.
„Das Alter macht hart“, sagt sie, wenn das Kind wissen will, warum sie nicht mehr weint.
Und die Sonne ist doch wieder aufgegangen.
Tagelang sitzt sie dem Fenster gegenüber, zählt die Regentropfen. Nachts geht sie in der Stube auf und ab, hin und her.
„Wie eine Löwin im Käfig“, sagt der Fidl, „leg dich hin.“
Sie sieht ihren Buben hinter dem Haus sitzen. Er sitzt mit aufgestützten Armen da, Kopf in den Händen. „Was ist dir, Clemens.“
„Ich muß nachdenken“, sagt er.
Ein grüblerischer Mensch, so jung und so grüblerisch, still, ein hellwacher Schlafwandler in seiner abweisenden, erbitterten Ruhe, die wie ein verschlossenes Tor ist.
Er geht am Abend nicht auf den Dorfplatz hinunter. Er mischt sich nicht unter die übermütigen Gleichaltrigen. „Sie lachen über jede Dummheit“, sagt er.
Vom Franziskanergymnasium der Brief des Präfekten: Frau Federspiel möge ihren Sohn verwarnen. Wenn die Gymnasiasten in geschlossener Reihe durch die Stadt gingen, hätte keiner die Hand zum Hitlergruß zu heben. Auch nicht zu patrouillierenden Soldaten hinüber.
„Ich habe nicht gegrüßt“, sagt der Clemens, „weder mit der Hand noch mit den Augen.“
Vor dem Einrücken wird er zu seinem Vater sagen, daß er nicht für Führer, Volk und Vaterland kämpft – oder fällt; er nicht.
Die Schule ist teuer.
„Was soll ich denn werden“, fragt der Clemens, „als Pfarrer gehen mir die Frauen ab, als Lehrer fehlt mir die Geduld, zum Doktorsein die Liebe zu den Menschen, Advokat ist nicht vornehm.“
Er hat sich nicht mehr entscheiden müssen. Zweiundzwanzig ist er beim Granatangriff in Witebsk.
Witebsk – wie vertraut das dem Fidl klingt, Witebsk. Keine dreißig Jahre ist es her, da ist er ganz in der Nähe gewesen. Ja, das kann man schon so sagen, ganz in der Nähe, bei einem Riesenland wie der Ukraine. Und Soldat war er auch, der Fidl, gefangen von den Russen.
Kühl sind die Abende in der Sommerfrische. Hat Onkel Clemens in Rußland gefroren? Das Kind kriecht auch in Augustnächten unter das wärmende Federbett.
Ein halbes Leben lang gestrickt, Strümpfe, Socken, Schwetter, Kappen. Die Stricknadeln klappern, als zitterten sie in einer Kälte.
Das Kind hat seine Großmutter nie mit Stricknadeln in der Hand gesehen, nur mit Büchern.
„Genug“, sagt Großmutter. Vom Stricken habe sie genug.
Warum mußte sie ihre Buben auch in knielangen Hosen herumlaufen lassen, unter denen die gestrickten Röhren der Wollstrümpfe herauswuchsen. Auf keinem der alten Photos, die das Kind zu sehen bekommt, trägt außer ihren Onkeln ein Dorfbub knielange Hosen und gestrickte Strümpfe.
„Und die Röhren sind immer länger geworden“, sagt die Großmutter, „die wachsenden Buben und die immer länger werdenden, gestrickten Röhren. Und die Hosenböden so oft geflickt, daß der ursprüngliche Stoff kaum mehr ausgemacht werden kann, Polster, richtige Polster auf den Hosenböden von all den unter- und aufgenähten Flicken.“
Schön sind diese pfeifensaftfarbenen Bilder. So viele Kinder in einer Schulklasse, Buben mit klobigen Schuhen, dunkelgrauen Hosen und Jankern, gezopfte Mädchen, scheu, Pfarrer und Lehrer wie Posten links und rechts aufgestellt.
„Aus dem Lehrer Alois Reden ist 1924 ein Luigi geworden. Da hat Südtirol schon sechs Jahre zu Italien gehört. Ein Beamter ist dem Umtaufen nicht ausgekommen. Ein Glück, daß er nicht auch Parlare heißen mußte. Genützt hat das alles wenig; seinen Posten hat er doch verloren. Die Faschisten haben richtige Walsche aus uns Tirolern machen wollen. Mit den anderen Namen war es aber nicht getan“, sagt die Großmutter.
Sie legt den Finger auf zwei Frauen, kleine, schmale Figürchen, verschreckt. Die Schwestern Trombetta, die Maestrine Ada und Rosa Trombetta, die ersten italienischen Lehrerinnen im Dorf. „Arm, mit ihren roten Fingernägeln und den Schülern als Feinde. Dieses Herumschreien …, sie schreien immer, in der Klasse, bei den Feiern auf dem Platz; diese zittrigen, schrillen Stimmchen, und keiner, der sie versteht.“
„Da, schau“, sagt die Großmutter, „große faschistische Jugendfeier.“
Wo sind die Onkel?
„Die sind nicht dabei, Kind. Die beiden Buben heben im Hof ein Loch aus und graben die Mussolinibilder ein. Und der Fidl ist bei der STE: Società Tridentina di Elettricità. Wenn er den Posten verliert, verhungern wir. Diese großkopferten Bauern im Dorf bilden sich ein, sie müssen ein Elektrizitätswerk erschaffen. Ein Verlustgeschäft, bis dann die Trentiner einspringen. Dreißig Jahre lang stottert das Dorf Schulden ab. Aber wie am Heiligen Abend ’21 das erste Licht brennt, das ist schön.“
Auch Fidls Bruder ist unter den Stromunternehmern; einer der dreizehn Großbauern. 1928 übernehmen die Italiener den Fidl. Er wird Stromgeldeintreiber und kann in der neuen Sprache kein Wort richtig schreiben.
„Und dann steinigen unsre Buben das Fasciozeichen auf dem Schulhaus. Das können wir uns nicht leisten. – Die Kinder da, die kleinen Balilla, die essen gratis in der Schulausspeisung. Ganz verrückt sind sie nach den roten Nudeln und dem gelben Reis. Essen gratis, Schulzeug gratis, der Mitgliedsausweis, nein: die Tessera fascista kostet fünf Lire, das zahlt sich aus mit der Uniform dazu. – Ich hab sie noch im Ohr, diese angestrengten Stimmchen, die ihr Evviva! schreien.“
Schön sind die Hände der Großmutter. Das Kind muß immer wieder die papierene Haut streicheln, über die dünnen Falten fahren. Sie überziehen Handrücken und Finger mit feinen Strichen. Lange, vollkommene Finger, zwei Daumen wie zu- und abnehmende Mondsicheln; Hände, ganz ohne Knochen, ohne Altersflecken. Und so beweglich. Großmutter spielt mit ihren Händen, unterstreicht ihre Rede mit Gesten. Wenn sie „vergiß das“, sagt oder „nebensächlich“, flattern ihre Finger rechts an ihrem Ohr vorbei, als spielte sie auf Tasten in der Luft.
„Aus einer mit Händen wie den deinen wird nie eine Bäuerin“, weiß der Fidl.
Aber das schlägt er auch gar nicht vor. Seine Lona ist ihm für jede Arbeit zu schade. Einen Palast möchte er ihr bauen, sie verwöhnen ein Leben lang.
Aus dem Palast wird nichts. Sie ziehen in das Buchenhaus als junges Paar. Sie wohnen zur Miete. Feucht ist es da, ein Geruch nach sauren Herbstäckern, nach Totensonntag, geschmolzenem Wachs in stillen Kapellen.
Sie werden noch viermal umziehen, beinahe im Kreis herum, im inneren Kreis des Dorfes.
Das Kind stellt sich ab und zu vor dieses alte, hölzerne Tor am Buchenhaus. Ein Tor in einem Rundbogen, niedrig, eigentlich zu niedrig für einen erwachsenen Menschen, ein Haus aus dem großen Grimmschen Märchenbuch.
Alle sechs Kinder kommen da zur Welt, die vier Buben, die zwei Mädchen. Das Gretele wird den Keuchhusten nicht überleben. Er plagt die vier Kinder in der Stube, die ein Krankenlager wird. Von einem Bettchen zum nächsten, heraus unter der Tuchent beim Hustenanfall, damit die kleinen Geschöpfe nicht im Liegen ersticken. Zwei trägt der Fidl auf den Armen, zwei trägt die Lona. Bis sie ausgehustet haben und ausgewürgt, die armen Körper. Gretl hält das nicht aus. Gretl bekommt zu lange keine Luft mehr. Ein weißer Sarg.
Ob Großmutter immer so schöne Hände gehabt hat? Auch wie sie Wäsche für fünf Kinder gewaschen, das Weiße im Anger auf dem Gras ausgebreitet hat, in der Sonne gebleicht, immer wieder abgespritzt, gewendet?
„Alle drei Monate ein großer Waschtag, mit Aschenlauge, im Selchkessel. Der Fidl hat mitgewaschen; und hinterher immer ein Auge durchs Küchenfenster hinaus, zur Wäsche hinaus. Es hat viele arme Schlucker gegeben damals. Gestohlen haben die nicht, die haben nur der Not abgeholfen“, sagt die Großmutter.
Die schönen Hände sind ein Erbstück. Auch auf die Mutter des Kindes sind sie übergegangen.
Hände für Bücher, Hände zum Seitenumblättern.
In einer Mistpenne hätten sie nicht Platz, sagt Großmutter, all die gelesenen Bücher in ihrem Leben. Am liebsten sind ihr die Russen. Aber da läßt sie sich die Romane schon aus der städtischen Leihbücherei bringen. Wenn sie laut vorliest, ihrem kranken Mann, ihrer schneidernden Tochter, memoriert sie vorher die russischen Namen, damit sie über Rasumichin und Newylytschki nicht dauernd ins Stocken gerät.
Im Dorf tauscht sie die Bücher mit Frau Reden, mit der Frau des Lehrers. Beide leihen sich die Bücher vom Herrn Pfarrer. Der Herr Pfarrer holt sie aus der Stadt. Ein kluger Herr, der Pfarrer Vaneller, ein guter Beichtvater, ein Musikliebhaber, wie die Lona; und Asthmatiker, wie die Lona.
„Wir machen auch beim Atmen Töne“, sagt sie zum Herrn Pfarrer. Wenn Asthmatiker die Luft durch die Lungen ziehen, gibt es sirrende, pfeifende Laute ab, beim Ausatmen tiefe, brodelnde.
Asthmatiker erkennen einander.
„Dieser fahle, abgespannte, zögerliche Blick“, sagt der Fidl, „es hat sich mir kein Asthmatiker erklären müssen; nicht in Galizien, nicht in der Ukraine. Wir haben voneinander gewußt, wortlos. Ich habe sie hinter mir gehen hören, oder vor mir. Wer in so einem Zustand ist, dem geht es nur noch um den nächsten Schnaufer.“
Frau Reden, das versteht das Kind. Eine Lehrersfrau ist im Dorf die Frau Reden. Alle anderen tragen zum Vornamen den Hofnamen und davor nichts: die Turmmüller-Kathl, die Kirchsteig-Barba, die Festenegg-Angela. Es gibt nur zwei Frauen im Dorf, Frau Reden und Frau Federspiel, die übrigen sind Weiber.
Die Auswärtige, die der Fidl als Frau Federspiel ins Dorf bringt, hat reich geerbt. Sie geht keiner Arbeit nach. Sie ist Hausfrau. Aber das sind die Bäuerinnen und Handwerkersfrauen auch; das sind sie zusätzlich. Frau Federspiel versorgt ihre sechs Kinder und den Mann; das tun die übrigen Frauen im Dorf auch. Frau Federspiel und Frau Reden gehören als Auswärtige zusammen. Es gibt noch ein paar Zugezogene, nur sind die keine Frauen.
„Reserviert“, sagt Großmutter, „ja, ein bißchen reserviert bin ich gewesen; nicht hochnäsig, für Hochnäsigkeit hat es keinen Grund gegeben.“
Das Kind versteht nicht, warum es nach dem Nachtmahl nicht mehr auf den Dorfplatz hinuntergehen soll. Die Abende sind lange hell. Großmutter kann durch die Lattenschlitze der geschlossenen Jalousien das Kind beobachten.
Dünne Streifen Sommer fallen durch die winzigen Latten und ein sanftes, gestricheltes Dämmerlicht. Von außen scheint das Fenster zu und blinzelt doch aus schmalen Ritzen.
Die Bäuerinnen aus dem Dorf sitzen am Feierabend auf den steinernen Bänken vor ihren Häusern und unterhalten sich. Frau Federspiel ist nie dabei. Sie ist auch früher nie dabeigewesen.
„Sie unterhalten sich über alle, die nicht um den Platz herumsitzen“, sagt Großmutter, „sie horchen dich aus.“
Das Kind weiß nicht, was es den Weibern nicht erzählen sollte.
„Eben“, sagt Großmutter, „eben.“
Sie ruft das Kind aber nicht ins Haus wie die übrigen Mütter, die aus den Fenstern über den Dorfplatz schreien. Großmutter macht nicht einmal die hölzernen Läden auf. Sie hat in ihrem ganzen Leben kein einziges Mal zu den Dörflerinnen hinuntergerufen. Sie fragt nur etwas vorwurfsvoll, ob es nicht wisse, wann es nach Hause zu kommen habe, wenn sich das Kind verspätet.
Sie hat auch ihre Buben damals dasselbe gefragt.
Ihr Fidl schätzt das, dieses Sich-nicht-gemein-Machen mit jedem. Er ist immer ein Einzelner gewesen, ein Alleingeher. Er genießt es, daß sein heimatlicher Hof über dem Dorfplatz steht, von einer Steinmauer eingegrenzt, von einem schweren zweiflügeligen Tor abgeschlossen; dunkelbraun wölbt es sich unter dem gemauerten Sturz. In einen der Flügel ist eine nach oben gerundete Tür eingelassen, die bescheidene Öffnung für Werktage.
Ein Paarhof ist das Festenegg wie alle Höfe der größeren Bauern, ein Schafferhof seit Jahrhunderten. Der freie Blick auf den Dorfplatz, ungehindert, Zeichen des Herrschaftsanspruchs.
Der Fidl hat nie geherrscht. Weder als Festeneggsohn noch sonst im Leben. Das ist ihm zuwider. Aber es ist ihm auch zuwider, wenn andere in sein Leben schauen; die es nichts angeht, die mit der ungesunden Neugier. Er holt sich seine Braut aus dem Nachbarsdorf, die Bergegger Wirtstochter. Im eigenen Dorf meidet er die Wirtshäuser.
„Wie hat dich Großvater zur guten Nacht geküßt mit diesem Stoff auf dem Mund?“
Das Kind verwendet den seltsamen Leinenstreifen als Windel für seine Puppe. Es ist die Schnurrbartbinde für Großvaters Kaiser-Franz-Joseph-Schnauzer.
„Er hat sie erst hinterher umgebunden.“ Großmutter lächelt wehmütig, wehmütig der Schnurrbartbinde wegen und wegen des Kaisers, ihres Kaisers.
18. August, Sommerfrischzeit. Nie erinnert sich das Kind an einen verregneten 18. August, einen verregneten Namenstag. Nie vergißt die Großmutter darauf, das Kaiserwetter mit Franz Josephs Geburtstag zusammenzubringen. Ob es denn deshalb so heiße, wie es heißt, fragt das Kind. Die Großmutter wartet ein bißchen, läßt das verschüttete Grübchen in ihrer Wange aufleuchten, das sich dort verspätet hat, ein Überbleibsel ihrer Jugend.
„Ja, wenn du das gern so hättest … Der Kaiser Franz Joseph selig, Fürst unserer beiden Tiroler Städte war er auch“, sagt die Großmutter. „Die Ehrfurcht vor der Tradition gehört sich, Kind. Die Herkunft hat zumindest eine Vergangenheit.“
Da ist das Kind stolz; auf des Kaisers Geburtstag, auf den eigenen Namenstag, auf die alten Zeiten, die Stadt, in der es zu Hause ist. Was für ein Tag!
„Armer Kaiser, eine tragische Gestalt. Der Friede, dieser Friede, der die Monarchie begraben hat, ist ihm erspart geblieben, sonst nichts. Es sind nicht die Österreicher gewesen, zu denen wir gehalten haben“, sagt sie, „wer waren das denn, die Österreicher. Wir haben zum Kaiserhaus gehalten. Wir Tiroler sind immer eine Welt für sich gewesen, eine abgesonderte, abgeschlossene: geschlossener Erbhof, geschlossene Gesellschaft, geschlossene Bergketten. Von Österreich haben wir nicht viel gewußt. Wir haben zu Tirol gehört, zum Kaiser, und fertig. Das hat mir schon mein Vater erklärt, daß es im Tiroler Freiheitskampf gegen die Bayern gegangen ist und nicht um Österreich. Nach dem Frieden von Wien hat dieses Österreich dann mit Napoleon Hochzeit gefeiert. Zuerst zündeln, aufwiegeln, dann keine Hand mehr rühren, um Tirol zu schützen und den Hofer zu retten. Österreich hat sich damals schändlich verhalten, hat mein Vater gesagt.“
Zwanzig ist die Großmutter beim Tod des Kaisers. Und es ist ihr, als sei ein Vater gestorben.
„Es ist kein Besserer nachgekommen“, sagt sie, „nur Schlechtere, nach und nach der Schlechtere. – Und die Vetsera, vielleicht hat die Vetsera den armen Rudolf getröstet. Ein unseliges Haus, das Kaiserhaus.“
Da ist das Kind schon groß, als es von der Geliebten des Kaisersohnes liest, von Vetsera und dem Rudolf und den sitzenden Leichen in der Kutsche, gestützt von zwei Gendarmen, die den Selbstmord des Liebespaares zu verheimlichen haben.
Der Fidl zieht die Vorhänge zu. Es muß niemand wissen, daß er beim Abendrosenkranz über die betende, linke Hand seiner Lona streicht, mit zwei Fingern, vom Handgelenk über den Handrücken nach vor und wieder zurück. Und die Lona lächelt ihm zwischen einem Avemaria und dem nächsten zu.
Auch beim Rosenkranzbeten gehört eine von Lonas Händen dem Fidl. Die Rechte liegt im Schoß, hält zwischen Zeige- und Mittelfinger die perlmutternen Grallen und zählt sie mit dem Daumen weg; die Linke liegt auf der Tischplatte.
Der Rosenkranz ist Großmutters Begleiter nach überall hin und über den Tag. „Die Bete“, sagt sie, „gib mir die Bete, Kind!“ Die Kapuziner in Moosbruck fassen die hölzernen, beinernen oder perlmutternen Kugeln zu Ketten. Sie reparieren auch kaputte. Sie reihen mit winzigen Spitz- und Flachzangen fünf mal zehn Perlen eng aneinander, lassen einen, von einer eingelassenen, einzelnen Perle gebildeten Abstand zwischen den Zehnereinheiten, zur Besinnung auf das wechselnde Geheimnis und das Ehresei. Der Kette fügen sie ein kleines Kreuz, eine Gralle für den GlaubenanGott und eine Dreierreihe für das DerunsdenGlaubenerhalte, DerunsdieHoffnungstärke, DerunsdieLiebeentzünde an.
Je schwerer der Rosenkranz, umso lieber ist er der Großmutter. Sie spürt das gern, sagt sie, wenn die Bete im Kittelsack nach unten zieht und bei jedem Schritt scheppert.
„Wäre der Himmel offengestanden“, sagt die Großmutter, „dreiundzwanzig Jahre lang wären der Fidl und ich nicht hineingestiegen, Kind.“
Und im vierundzwanzigsten Jahr?
Das vierundzwanzigste Jahr ist das Jahr der mittigen Tafel an der Stubenwand; das Jahr des Clemens Federspiel, des dritten gefallenen Clemens Federspiel.
Traktoren rattern am Haus vorbei, laut, störend, in aller Herrgottsfrüh. Sie fahren auf die Felder rings ums Dorf. Das Kind wartet auf den großen grünen Fendt. Da springt es auf. Hoch oben neben der Cousine, auf diesem Sitz, der viel zu groß ist für das winzige Hinterteil, ist das Kind eine Königin.
Großmutter ist nie auf die Felder gefahren, hat nie einen Rechen gezogen, nie eine Sichel in die Hand genommen. Und doch kennt sie die Arbeit der Bauern, jede einzelne, in Stall und Acker und Feld.
„Grummetzeit“, sagt sie und betet, daß es nicht aufs ausgebreitete Gras regnen möge.
Kürzer ist ihr Gebet allmählich geworden, weil auch ein Regen zur Unzeit für den Bauern kein Unglück mehr ist; weil die Schnitter mit dem zur Erde gedrückten Korn keine große Plage mehr haben; weil die Rücken der Erdäpfel hackenden Weiber nicht mehr geschont werden müssen; weil die gefrorenen Schollen einer Traktoregge nichts mehr ausmachen.
Am Abend aber wird sie das Kind fragen, wie viele Fuder Heu vom Außerfeld in die Dille gefahren sind. Wie viele Schober Gerste auf dem Burgetacker stehen. Dann wird sie dem Kind von früher erzählen, bis es einnickt.
Dem Fidl ist es zeitlebens eine Gewohnheit geblieben, in der Früh als erstes zum Festeneggstall hinüberzuschauen. Es geht immer später das Licht an. Es gibt weniger Rösser und Ochsen zu versorgen als in seiner Jugendzeit.
Seine Rösser, sein Lieblingsvieh. Aus den Ochsen hat er sich nie viel gemacht. Pferde werfen zwischendurch ein Fohlen. Pferde haben ein Gemüt. Ochsen sind immer nur Ochsen. Aber er versorgt auch diese schweren, dumpfen Tiere mit Hingabe.
Auf dem Moosbrucker Markt verkauft er mit Gewinn. Man kennt den Festenegg-Fidl. Man vertraut ihm. Er ist ein Redlicher. Er bleibt bis zuletzt auf dem Marktplatz, weil er weiß, kein Händler fährt gern mit seinem Vieh wieder heim. Da kauft der Fidl dann günstig. Er ist ein Stiller. Den Vormittag über schaut er sich um. Aufs Gerede hört er nicht. Er macht sich vom Angebot sein eigenes Bild.
Er hat ein, zwei Kinder aus dem Dorf mitgenommen auf den Markt. Sie begleiten ihn gern. Sie freuen sich auf das Treiben in Moosbruck und auf das Würstl in der Suppe, das ihnen der Fidl zahlt. Vorher aber haben sie die Tiere festzuhalten, die der Fidl feilbietet. Stangen zum Anbinden gibt es in Moosbruck keine. Die Kinder hoffen, daß die Moosbrucker noch lange keine Stangen auf dem Marktgelände aufstellen mögen; zumindest so lange nicht, wie sie klein sind. Sie möchten noch nicht überflüssig werden.
Die Bauern von Korint herauf sind eine Konkurrenz hier. Sie haben die schönsten Ochsen. Ochsen sind gefragter als Rösser. Ochsen ziehen ausdauernder. Der Fidl hält seine Aufmerksamkeit zusammen. Er handelt, feilscht. Der Fidl ist für seine schönen Tiere bekannt. Er weiß, schöne Rösser brauchen nur die wohlhabenden Bauern, die anderen brauchen Zugrösser. Es wird nicht lange dauern, bis die Bauern ihre Rösser nicht mehr kaufen, tauschen, nicht mehr mit ihnen handeln werden, sondern Füchse und Rappen und Schimmel stellen. Was für ein Wort: stellen! Abgeben heißt das, weggeben für ein Heer, das mit ihnen Krieg führt, das sie schinden und am Ende halb verhungern lassen wird.
Noch aber ist der Fidl auf seine schönen Rösser stolz. Den Klösterern kauft er zuerst etwas ab. Die Klösterer haben bessere Äcker, besseres Futter, besseres Vieh. Auf der linken Marktseite stehen die Kornanbieter. Der schräg aufgesetzte Hut weist sie als solche aus. Der Fidl grüßt nur kurz hinüber. Er handelt mit Vieh, nicht mit Roggen und Weizen.
Müde machen die Markttage, und spät dann der Fußweg zurück ins Dorf. Da ist der Fidl noch ein Bursch, aber er spürt schon, daß er zwar nicht länger gehen muß als die Gleichaltrigen, aber hinterher länger schnaufen.
Der Fidl wählt sich die Kinder der Ärmsten aus dem Dorf, die mit ihm und seinem Vieh nach Moosbruck gehen dürfen. Die Auswahl ist groß. Es gibt zu viele Kleinhäusler, die höchstens eine Geiß halten, aber zehn Kinder und mehr. Auf dem Heimweg vom Markt greifen die Buben immer wieder nach den paar Kreuzern im Hosensack und dem Stanitzel voller Mohnzucker, das sie vom Fidl bekommen haben. Mohnzucker kauft der Fidl auch für seine Rösser und verfüttert ihn dann heimlich, und schlägt vor Verlegenheit die Augen gar nicht richtig auf, wenn er an den ganz armen Weibern vorbeigeht, die die Ackerränder vom Festenegghof mähen dürfen oder die Erdäpfeläcker jäten. Das minderwertige Grünzeug trocknen sie vor ihren Hütten, bei Schlechtwetter in der engen Laube, aus der bei jedem Türschlag Gerüche von Strohsack, Rüben, Arbeit und Leuten herauswehen.
Die Berta ist keine Diebin, nur findig. Sie streicht beim Vorbeigehen den Hafer von den Ähren in ihren Kittelsack. Wieviel wird sie jedesmal in ihrer Hütte ausleeren? Sie klaubt ein paar Scheiter von fremden Holzstapeln, versteckt sie unter ihrem Fürtuch. Wie viele wird sie daheim unter den Herd legen? Die Berta geht flink durchs Dorf, fast im Laufschritt. „Das Huschen der Not“, sagt die Großmutter, „ängstlich, leise, mit einem ganz eigenen Geräusch, dem Geräusch der Not.“
Die Kinder der Taglöhner haben keine Schuhe. Ohne Schuhe kann man nicht auf den Markt gehen. Die Taglöhnerinnen sind um das Kandele Milch froh, das sie zur Tagschicht dazubekommen. Sie sind besonders froh, wenn der Fidl das Kandele füllt. Da geht es fast über.
Zwanzig Schnitterinnen und mehr arbeiten Ellbogen an Ellbogen auf dem Festeneggacker. Und bei der einen die Not daheim größer als bei der anderen. Zu Mittag essen sie auf dem Feld, unter einer Granelle, unter einem Nußbaum, je zwei und zwei aus einem Teller, Knödel und Krapfen; und endlich einmal satt. Sie sitzen eng beieinander, ihre Schultern führen gegeneinander Krieg. Mit einer mechanischen Bewegung drücken sie herausrutschende Haarnadeln wie Pfeile in ihre um den Kopf geschlungenen Zöpfe zurück. Die Furchen in ihren Händen sind Brachfelder von Plagen, die Stirnen Wegmarken von Gram, ihre Münder verhärmte Schlitze.
Nach dem Schnitt knien sie sich auf eine Korngarbe und beten den Englischen Gruß. Die dankbare Andacht gilt mehr dem eigenen vollen Magen als der vollen Dille des Festeneggbauern.
Die Mutter des Fidl geht nach dem Nachtmahl von Hütte zu Hütte mit dem bißchen Lohn. Zu Weihnachten wird sie die Kinder der Schnitterinnen zum Mittagessen einladen und ihnen sechs Hefekrapfen, einen Knollen Schweinefett und ein paar Würstln für die Mutter mitgeben.
In den armen Stuben der Schnitterinnen hängt der Mahlzeitengeruch der vergangenen Tage. Er steigt aus den hölzernen, gefurchten Tischplatten, wenn die dampfende Suppenschüssel den alten, eingesogenen Geruch aufwärmt.
Zwanzig Sommer lang arbeitet der Fidl als Senner auf der heimischen Alm. Es gibt nicht wenig Bauern im Dorf, die hoffen, ihre Kühe mögen nicht in den Sommermonaten kalben. Dem Geschick des Fidl vertrauen sie mehr als dem des Doktors. Der Fidl heilt auch ohne Medizin. Auf Murmeltierfett schwört er und auf das rechte Futter aus Gsott und Abgebrühtem, auf eingeweichte Haarlinsen für die Kälber. Allen übrigen Übeln helfen Fidls Hände ab; daß die dreieutrige Kuh wieder aus allen vier Zitzen Milch gibt zum Beispiel oder ein Eiterbatzen verschwindet.
Einsam ist es auf der Alm. Da wird der Fidl zum Schweiger. Wenn einer für ein Viertel des Jahres nicht unter die Leute kommt, verlernt er das Reden. Ab und zu ein Hirte, der Schafe dahertreibt, Wolken aus weißer Wolle, wenige Wanderer, die für eine Schale Milch bleiben, für ein Stück Käse. Sie sind selten gesprächig.
Der abendliche Himmel trübt sich ein. Der Mond jagt die Wolken auseinander. Sie kommen wieder, wenn es tagt. Die Sonne plagt sich daraus hervor, in Weiches gebettet, wie sie ist. Und dann nichts mehr als Felswände aus einem gleißenden Grau, Weiden aus behäbigem Grün, ein glatter Himmel, vom einen zum anderen Gipfel straffgezogen.
Vom Georgitag bis zum ersten Sonntag im Oktober ist die Zeit in dieser alltäglichen Verlassenheit lang.
Der Weg vom Hochhöhltal übers Eissteinjoch bis zur Ahornalm zieht sich mit der langsam dahintrottenden Herde unter diesem fast noch winterlichen, metallenen Blau; die Ränder des Himmels blasser, licht, wie angefroren. Auf den Schneefeldern ringsum bräunen einzelne, zackig zerfranste Erdflecken. Die Thorwände sind steil und steinig; dahinter der Wald, unheimlich wie einer bösen Seele Fluch; von dort weht der Sommer zögerlich herüber. Die Thorwände sind voller Marterln und Votivtafeln. Geschichten gibt es dazu, abergläubische Reden.
Der Weibelesitz soll der Muttergottes zum Rasten gedient haben, und die versteinerte Hufspur eines Ochsen stammt von unserem Herrn Jesus persönlich. Wenn unterm Eissteinjoch die Hexen ihr Haar kämmen, ist das Gewitter schon hinter der Wand. Hinterhältig ist das Hexenwerk und auszuweichen ist ihm nicht. Da hat die Samteralm noch zum Festenegghof gehört, als es als ausgemacht galt, daß, sobald in Samt ein Rind eingeht, im Dorf eine Henne verreckt. Die Weiber wissen unzählige Geschichten. Sie fürchten sich gern.
In der russischen Gefangenschaft wird der Fidl an die Bäuerinnen daheim denken und an ihren wohligen Aberglauben und wie sich die Welten gleichen. Da erzählt ihm Halja, die ukrainische Bäuerin, sie habe zweimal – man bedenke, zwei Nächte hintereinander – im Traum drei blaue Gänse mit Roßköpfen gesehen, bevor das große Unglück gekommen sei. „Und da sage einer noch, Träume und Ahnungen sind Weibergespinst“, die Ukrainerin bläst die Luft durch ihre gespitzten Lippen.
Es geht mir vor, sagen die Innerwiesener Weiber dazu. Der Fidl würde das nie bestreiten. Er erinnert sich an die saligen Frauen, die abtrünnigen Engel, die auf dem Weg in die Hölle in den Bäumen hängenbleiben. Sie sind ihren Männern liebevolle Ehefrauen, arbeitsam auch. Und von keinem einzigen Mann einer Saligen wird erzählt, daß er sich an die drei Bedingungen gehalten hätte, sondern irgendwann doch das Wort Sonne in den Mund nimmt, oder seiner Liebsten über die Wange streichelt oder ihren Namen ausspricht – und damit die Salige verliert.
Am frühen Morgen sieht der Fidl den anbrechenden Tag durch eine Ritze in der Almhütte, ein paar vergessene Sterne, hingetupft wie Blütenblätter eines Apfelbaumes. Hinter zerrissenen Wolken spürt er noch den Mond.
Nur während der Bergwoche geht es hoch her auf der Alm. Da ist es dem Fidl aber schon zu laut. Die Bandi lachen und kuttern ausgelassen. Die Mohder und die Tschogge scherzen derb. Der Fidl ist froh, wenn der Rosarisonntag da ist. Da putzt und striegelt er seine Kühe, legt ihnen die Glocken an federkielbestickten Riemen um, wählt die Kranzkuh aus, die dann stolz vorausgehen darf in ihrem Schmuck aus Federn, Perlen und buntem Glas. Den Almabtrieb begeht der Fidl als würdigen Heimweg. Erst am späten Nachmittag gibt es auf dem Dorfplatz wieder Radau. Da ist der Fidl aber schon in seiner Kammer. Den Rasierertanz muß er nicht erleben. Da brüllt das Dorf den Lehrling zum Gehilfen hinauf, den Stallbuben zum Fütterer oder den Hirten zum Senner. Grob sind die Späße.
Viel später werden die Nazi dann diesen Rasierertanz filmen, dieses bäuerlich-bodenständige Bauerntum, mit dem sie sich wichtig machen. Dafür muß das Schauspiel für den Mann mit dem Filmapparat auf dem Dorfplatz extra nachgestellt werden.
Der Fidl wird allein bleiben, fürchtet seine Mutter. Er denkt sich das in seiner Abgeschiedenheit oft selbst. Aus dem Dorf fällt ihm keine ein, die er zur Frau möchte. Auf dem Moosbrucker Markt stehen nur Männer neben dem Vieh.
Es ist nicht die kleine Auswahl, die ihn in Bergegg nicht mehr von der Lona wegschauen läßt. Er ist schon öfter auf dem Bergegger Kirchtag gewesen. Er ist auch schon länger im heiratsfähigen Alter. Später wird er es oft bedauern, daß sie ihm nicht früher aufgefallen ist, die Lona.
Die Lona sieht ihn aber auch diesmal nicht. Sie ist beschäftigt. Eine Kellnerin kann sich am Kirchtag nicht mit den Gästen aufhalten. Auch dann nicht, wenn die Kellnerin die Wirtstochter ist. Dafür darf der Fidl der jungen Frau so lange zu- und nachschauen, wie er will. Es gefällt ihm ihr leises, verschmitztes Lächeln, das ihm wie eine überlegene Freundlichkeit vorkommt. Kein einziges Mal hört er ein plumpes Wort, das man ihr nachzurufen wagt, auch von Betrunkenen nicht, und von denen gibt es genug. Flink ist die Lona, viel beweglicher, als man es ihrer Rundlichkeit zutrauen würde.