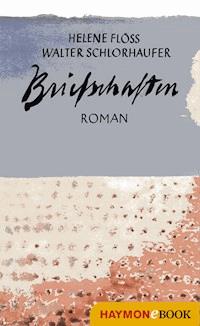Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Haymon Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Zwei Liebesgeschichten, in ein dichtes Netz von Politik, Krieg, Alltagsereignissen und Bräuchen in einer Kleinstadt und am Dorf verwoben, wie die Punkte, Striche und Linien der Schnittmuster, auf die die Schneiderin Elsa ihre Notizen schreibt. Verwoben auch in die Briefe, die Matti seiner Verlobten Olga schreibt, zuerst aus Berlin, später von der russischen Front. Schauplätze der Geschichte: eine Kleinstadt und ein Dorf in Südtirol. Zeitlicher Hintergrund sind die dreißiger und vierziger Jahre: Südtirol unter Mussolini, die Südtiroler im Dilemma zwischen Auswandern und Dableiben, der Terror von NS-Dorfgrößen nach dem Einmarsch der Deutschen 1943, Desertion, Sippenhaftung, Ernüchterung. Kaum je wurde über dieses Stück Zeitgeschichte so knapp und doch so eindringlich geschrieben.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 259
Veröffentlichungsjahr: 2014
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Zwei Liebesgeschichten, in ein dichtes Netz von Politik, Krieg, Alltagsereignissen und Bräuchen verwoben, wie die Punkte, Striche und Linien der Schnittmuster, auf die die Schneiderin Elsa ihre tagebuchartigen Notizen schreibt. Verwoben auch in die Briefe, die Matti seiner Verlobten Olga schickt, zuerst aus Berlin, später von der russischen Front. Bögen der Erinnerung, Einschnitte, Schnitte ...
Schauplätze der Geschichte: eine Kleinstadt und ein Dorf in Südtirol. Zeitlicher Hintergrund sind die dreißiger und vierziger Jahre: Südtirol unter Mussolini, die Südtiroler im Dilemma zwischen Auswandern und Dableiben, der Terror von NS-Dorfgrößen nach dem Einmarsch der Deutschen 1943, Desertion, Sippenhaftung und die Ernüchterung, als 1945 wieder alles anders ist. Kaum je wurde über dieses Stück Zeitgeschichte so knapp und doch so eindringlich geschrieben. Dabei macht gerade die private Perspektive den Sonderfall Südtirol zum Exempel: der kleine Mann, hier vor allem die Frau, in den Zwängen der Konvention und zugleich hineingestoßen in die Mühlen der „großen“ Politik, die auch ganz klein werden kann ...
Helene Flöss
SCHNITTBÖGEN
Roman
Eine kurze Erklärung zum zeitgeschichtlichen Hintergrund des Romans finden im Kapitel „Zum historischen Hintergrund des Romans und zur Sprache von Helene Flöss“, außerdem ein Glossar zu politischen Bezeichnungen und Abkürzungen; es enthält auch die Übersetzung von Dialektausdrücken und italienischen bzw. ladinischen Wörtern und Sätzen.
Für die Transkription und Übersetzung der ladinischen Texte gilt der Dank der Autorin ihrer Cousine Dr. Erna Flöss.
© 2000
HAYMON verlag
Innsbruck-Wien
www.haymonverlag.at
Ungekürzte E-Book Ausgabe 2014.
Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form (Druck, Fotokopie, Mikrofilm oder in einem anderen Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung des Verlages reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
ISBN 978-3-7099-7737-8
Cover: Benno Peter
Satz: Haymon Verlag
Dieses Buch erhalten Sie auch in gedruckter Form mit hochwertiger Ausstattung in Ihrer Buchhandlung oder direkt unter www.haymonverlag.at.
Inhalt
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Zum historischen Hintergrund des Romans
Glossar
Kleine Auswahl an Literatur zur Situation Südtirols von 1920 bis 1950
Weitere E-Books aus dem Haymon Verlag
Por mi pere
Wie auf den Messias, ich habe für alle dieselbe Antwort gehabt.
„Wartest du noch immer?“
„Wie auf den Messias.“
Kopfschütteln. Ein Frauenleben lang warten.
Ufficio anagrafico del Comune di Paola, steht auf dem Brief. Den Poststempel kenne ich auswendig, den Briefkopf, die Mitteilung, die Unterschrift. Il sindaco del Comune di Paola. Provincia di Catanzaro.
Die amtliche Bestätigung meiner Witwenschaft. Eine späte Erlösung, vielleicht. Sie hat in meinem Leben nichts mehr verändert.
„Ma chi mai era costui?“ hat der kalabresische Bürgermeister gefragt.
„Wer er war? Chissà.“
„Dopo la morte del fratello, l’altro santo ha continuato a vivere in questa brutta stalla ...“ Der andere Heilige. Nach dem Tod des Bruders. In diesem häßlichen Stall ... wie Josef und Maria, mit Ochs und Esel.
Was ich hierlassen werde, habe ich im Probierzimmer zusammengestellt. Wandspiegel, Drehspiegel, Rückspiegel. Maßbänder, Maßstäbe, Maßbücher. Schneiderkreiden, Schneiderpuppen, Stecknadelpölster. Papierschere, Stoffschere, Knopflochschere. Bügelhansel, Frisiertisch, Kleiderständer.
Der Brief des kalabresischen Bürgermeisters kommt in die Truhe zu den Zuschneidepapieren.
Jedesmal, wenn ich durch das Probierzimmer gehe, muß ich einen Blick in den Spiegel werfen. Eine Gewohnheit. Es kommt kein angenehmes Bild mehr zurück. Wieviel kleiner ich doch geworden bin. Einmal habe ich alle meine Kundinnen im Spiegel überragt.
Seit drei Jahren nähe ich nun schon nicht mehr. Der Brief hat mich auch von der Schneiderei befreit, dieser Verbindung zur Welt, die bis dahin nicht hatte abreißen dürfen. Geblieben sind diese papierenen Schnitteile, ineinandergerollt, mit einem Stoffstreifen verknotet. Von jedem einzelnen Bündel weiß ich bis heute, was ich daraus geschneidert habe und für wen. Rücken- und Vorderteile, Ärmel und Krägen, alles mit Anmerkungen beschrieben. Die fasrigen Bögen der dreißiger Jahre, das Makulaturpapier während des Krieges, das durchscheinende Seidenpapier und ein wechselndes Schriftbild; brav die Sechzehnjährige, streng die erwachsene Frau. Ich hätte mir auch Hefte leisten können.
Ich habe beschlossen, da noch einmal hineinzulesen. Rollen mit Jahreszahlen, andere mit Namen. Es raschelt beim Aufwickeln. Die glattgestrichenen Blätter drehen sich wieder in ihre alte Form zurück. Kleine Besatzstücke fallen heraus, Stulpen, Manschetten, Zettel mit Maßangaben, Modellskizzen.
Nein, Tagebücher sind das keine. Schneiderinnen schreiben keine Tagebücher. Sie schreiben Maßbücher, höchstens noch Hausbücher.
Gestern ist Olga dagewesen. Wir sind auf meine Schnittbögen zu reden gekommen. Und auf ihre Briefe. Die Briefe von Mati.
Ob Olga sich an Ansgar erinnert? ’43 muß es gewesen sein oder ’44 ... Mati ist im Krieg geblieben. Den Heldentod gestorben, hieß das. Ansgar ist desertiert.
Gehütet habe sie Matis Briefe, sagt Olga, aber nachgelesen?
„Nachgelesen nie mehr.“
Olga und ich werden in ein paar Tagen ins Bürgerheim übersiedeln, was nichts anderes ist als ein Altersheim. Sie mit ihren Briefen, ich mit meinen Schnittbögen.
Befreundet waren wir eigentlich nicht. Wir kannten einander. Wie sich beinahe Gleichaltrige eben kennen in einer Kleinstadt. Nach der gemeinsamen Volksschule bei den Englischen Fräulein ist Olga in die Handelsschule gegangen – richtig hat das damals ja Scuola materna und Avviamento geheißen. Dann hat sie den Betrieb ihres Vaters übernommen. Später ist sie meine Kundin geworden. Eine von vielen.
Zwei alte Frauen, sechsundsiebzig und achtundsiebzig, rüstig, bis auf die gewöhnlichen kleinen Gebrechen. Ein schmerzendes Kreuz, Bluthochdruck, nicht aufregend. Wir teilen uns den Tag ein, das heißt, was vom Tag nicht schon eingeteilt ist. Nach dem Mittagessen sitzen wir ab und zu beisammen, entweder in einem Café in der Stadt, in meinem oder in Olgas Zimmer. Wir halten unsere Erinnerung gegeneinander. Später werden wir in den Garten gehen.
In Matis Briefebündel hat Olga damals mit einer Ahle zehn Löcher gestochen und doppelten Spagat durchgefädelt mit Knopflochknoten zwischen dem einen und dem anderen. Kinokarten stecken zwischen den Bögen, Fortsetzungsromane aus den Dolomiten, Photos.
Mati ist unter den ersten gewesen, die gegangen sind. Nach Berlin, im Winter 1940. Zusammen mit seinem Bruder.
Als der Hitler zwar nicht grad das ganze Landl in Bausch und Bogen, aber jeden einzelnen Südtiroler heim ins Reich holen will, optiert Matis Familie für Deutschland, Olgas Familie für Italien. Beide halbherzig. Walsche wollen weder die einen sein noch die anderen.
„Die Armut im Gadertal kann sich keiner mehr vorstellen“, sagt Olga, und dann: „Reich werden will ich nicht, hat Mati gemeint, arm bleiben auch nicht. Würdig leben halt ... oder hat er anständig gesagt?“
Olga versteht nicht, wie eine derart versessen in diesem alten Leben herumsuchen kann. Es ist so lange her, meint sie, und daß man Gewesenes besser ruhen lassen sollte, auch daß es in unserem Alter nichts Intimes mehr gäbe, nur mehr viel Überflüssiges.
Dann gibt sie mir die zusammengeknoteten Briefe als Krücke beim Zurückschauen.
1
Berlin, 4. Jänner 1941. ... Hier im „Hegelhaus“ ist es jetzt lebendiger geworden und ich bin wieder besserer Laune. Es ist eine große Gruppe Studenten zu diesem Matura=Kurs gekommen. Ein Brunecker ist auch darunter ... Weißt Du, wenn ich allein bin, mache ich mir tausend Gedanken, ich spüre Heimweh und alles verdrießt mich. Am Abend finde ich keinen Schlaf. Ich meine, das macht die zuviele freie Zeit ... Mit meinem Bruder Jan bin ich so alle vierzehn Tage einmal beisammen. Von daheim bekomme ich viel Post. Meine Schwester Zilia schreibt nur auf italienisch; macht nichts, ich lese ja italienisch genauso gern ...
Ja, ja, die Ladiner ... für die Faschisten sind die Ladiner seit jeher halbe Walsche gewesen. Eine Woche nach Dreikönig hat der Vater den neuen Gesellen eingestellt. Jetzt hole ich mir noch einen Badioten ins Haus, hat er gesagt. Die Mamma hat immer dann ladinisch mit dem Mati geredet, wenn der Vater sie nicht gehört hat. Ein schneidiger Bursch ist er gewesen und ein feiner dazu. Bevor er sich selbst bedient hat, hat er bei Tisch die Suppe in meinen Teller geschöpft. Das war bisher noch keinem Lehrbuben und keinem Gesellen eingefallen. Die Mamma ist mit dem Mati wie mit ihrem eigenen Buben umgegangen. Der Vater ist reserviert geblieben. Er hat überhaupt vor allen gern den Meister herausgekehrt, ist schroff zu den Leuten gewesen. Schlecht gezahlt hat er auch. Verliebt? Ich weiß nicht, Elsa, ob ich in den Mati verliebt gewesen bin. Er in mich schon. Einmal sind wir in die Fischzucht hinuntergegangen, auf den Eislaufplatz vom Unterfrauner Oskar, du weißt ja. Da hat mir der Mati etwas Warmes zu trinken gekauft. Es hat Musik aus einem Grammophon gegeben, und der Mati ist mit mir Schlittschuh gelaufen. Ja, ein paar Mal sind wir noch auf den zugefrorenen Eisack gegangen, weil wir da allein gewesen sind. Zum Rodeln ist es nicht gekommen. Schnee ist in diesem Winter ’39 keiner mehr gefallen. Enttäuscht bin ich schon gewesen, wie der Mati nach Berlin gegangen ist. Die Seinen haben alle für Deutschland gestimmt. Ausgewandert sind sie nur zu dritt, Mati, Jan und Sefl. So ist es überhaupt gewesen im Tal. Ein Drittel der Badioten hat für Deutschland optiert, ein Drittel der Optanten ist dann auch wirklich gegangen. Sobald er es zu etwas gebracht hat, holt er mich, hat er versprochen. Dafür habe ich dich nicht in die Avviamento geschickt, daß du doch wieder nur einem Gesellen Seine wirst, hat der Vater gesagt. Daß es den Habenichtsen ein Leichtes sei, zu gehen, hat nicht nur er behauptet. Um dieses mindere Mischbrot zu backen, müssen wir niemanden anstellen, hat er gemeint und sich nach keinem Gesellen mehr umgeschaut. In Berlin hat es Bäcker genug gegeben, und der Mati hat einen Hausmeisterposten bekommen. Das „Hegelhaus“ ist so etwas wie ein Internat gewesen, in dem Studenten gewohnt haben, die zu strammen Deutschen ausgebildet worden sind. Stramme Offiziere, stramme Lehrer. Der Mati wäre auch immer gern ein Student gewesen, aber sein Vater hat das Kostgeld im Vinzentinum nicht zahlen können. Neun Geschwister sind sie beim Mati daheim gewesen. In den Dreißigerjahren hat sein Vater alles verloren, was er zu verlieren gehabt hat; das Wirtshaus, den Laden, das Holz, das er schlägern mußte und das keinen Wert mehr gehabt hat im Verkauf. Die Felder hat er versteigert. Die „schöne Krämerin“ ist eine Kleinhäuslerin geworden. Matis Mutter hat auf dem Stegener Markt ein Standl gehabt. Was man bei ihr erworben hat, das hat man der schönen Krämerin abgekauft. Aber warmherzig muß sie auch gewesen sein, nicht nur schön. Was hat der Mati diese Umma geliebt ... Geküßt und umarmt hat er sie. Das hat es sonst nicht gegeben. Bauern sind nicht zärtlich. Bauern schreiben auch keine Briefe. Aber ihre Feldpost ist ein Stoß gewesen, nicht viel kleiner als der meine. Sie hat Socken gestrickt mit diesem Spiel aus fünf dünnen, kurzen Nadeln. Flink. Wenn sich ihre Ränder am Augenlid mit Wasser gefüllt haben, hat sie auf ihr Strickzeug hinuntergeschaut. Da hat sie schon nur mehr die Briefe gehabt ... Was glaubst du denn, so viel Zeit habe ich gar nicht gehabt, als daß ich lange um den Mati hätte weinen können. Zwischen Backstube, Wiesen und Äckern in Villanders und Sarns hat wenig Sinnieren Patz gehabt.
MIT „NEUJAHR 1941“ ist die erste Rolle meiner Zuschneidepapiere überschrieben. Blaues Tüllband rundum. Da bin ich gerade siebzehn und im letzten Jahr meiner Schneiderlehre. Daheim im Wirtshaus ist nicht viel los. Seit Krieg ist, ist nie mehr viel los. Und Weihnachten ist auch im Frieden eine tote Zeit.
Betritt am Christtag zu Mittag ein Fremder die Stube, stirbt im kommenden Jahr einer aus dem Haus, heißt es. 1941 stirbt in vielen Häusern jemand.
An den Bakelitkasten auf der Stellage geht nur Vater. Er schaltet ein und aus, laut oder leise. Ist die Wirtsstube leer, spielt er sein Programm, stellt auf sehr leise und hört den Feindsender.
Seit drei Jahren hat der Sternwirt einen anderen Namen. Die Dableiber, sagen die, die für Deutschland gestimmt haben, die Dableiber trinken dem walschen Wirt seinen walschen Wein. Der Sternwirt lebt von der bischöflichen Kurie, heißt es in der Stadt auch, eine sichere Kundschaft.
Vor der Wahl – mein Gott, was ist das für eine Wahl, wenn einer nicht einmal weiß, welches das kleinere Übel ist – vor der Wahl zeigt man sich im schwarzen Hemd und streckt vor den walschen Beamten die Rechte mit dem eisernen Ring aus. Nach der Wahl hält man Walsche und Deutsche leichter auseinander. Viele Walsche aber wissen nicht einmal, wie sie zu solchen geworden sind.
„Der Faschismus hat den Model für den Hitler geschnitzt“, sagt der Sternwirt.
Meine Schneidermeisterin ist eine Nazi, weil ihr Sepp einer ist. Dem Vater verschweige ich, daß der Mann der Meisterin zur AdO gehört. Die Schneiderlehre habe ich gegen seinen Willen durchgesetzt.
„Und was werde ich“, frage ich, als Richard, mein älterer Bruder, ins Vinzentinum aufs Gymnasium kommt.
„Du wirst schön, Kind, das reicht für eine Frau.“
Ich bin die jüngste in der Schneiderei. Die Meisterin sagt, ich sei gut fürs Geschäft. Der Mann der Meisterin bringt deutsche Soldaten ins Haus und heimische Nazigrößen. Die Meisterin tischt groß auf. Sie handelt sich von den Bäuerinnen der Umgebung Butter und Speck ein. Und die Geschäftsfrauen aus der Stadt brechen für ein neues Kostüm ihre geheimen Vorräte an.
Der Mann der Meisterin gönnt dem schneidigen männlichen Besuch auch die Freundlichkeit der Schneidergehilfinnen. Frau Pichler schimpft mit den Mädchen in der Schneiderei. Mit mir schimpft sie nie. Was sich so tut um mich herum, schreibe ich im Bett auf ausgediente Papierschnitte.
„Daß mir auch nie eine Jungfrau unterkommt ...“
Herr Pichler breitet gern seine Liebesabenteuer aus. Es schert ihn nicht, daß seine Frau mithört oder zuschaut, wenn er den Lehrmädchen an den Busen greift.
„Herr Pichler, bitte!“
Ohne Kopftuch darf in der Schneiderei niemand an den Bügeltisch. Die Stoffe haben Kriegsqualität. Die Meisterin behauptet, der stinkende Nebel, der unter dem Eisen herausdampft, sei Schuld daran, daß zwischen ihren eingedrehten Locken weißliche Löcher durchschimmern.
„Sie werden Judenhäute in die Webe einarbeiten.“
„Ach, du mit deinen geschmacklosen Witzen, Sepp.“
Nach der Arbeitswoche nehme ich Stoffreste mit nach Hause und nähe in der freien Zeit, die in der Wirtsstube zwischen einem Achtel und dem anderen bleibt.
Vater ist seit einem halben Jahr tot. Mutter läßt als Witwe den Betrieb nicht verkommen. Sie hat schon zu Vaters Lebzeiten das Sagen im Haus gehabt.
Richards Militärdienst als Dableiber dauert sieben Monate. Die gleichaltrigen Optanten in der Gaststube schimpfen ihn einen Walschen und einen Davonstehler.
„Buona notte, walscher Totte!“ rufen die Kinder über den Domplatz.
„Buona sera, walscher Plärra“, kommt es zurück.
Großmutter steht seit drei Monaten nicht mehr vom Bett auf. Sie hat schweres Asthma und einen Roßhaarkeil im Rücken. „Solange die Augen mittun“, sagt sie und liest ein Buch nach dem anderen. Die bringen der Dompfarrer und der Herr Professor aus dem Vinzentinum. Sie hat mich gern neben sich. „Mein schöner Trost“, sagt sie.
Bis zur Sperrstunde hängt ein dumpfes Geraune über der Gaststube. Ab und zu dreht ein später Trinker sein Ohr zum Deckengetäfel und schüttelt den Kopf. Er hört der Sternwirtin lesende Altstimme. Es ist wie Rosenkranzbeten oder die Heiligenlitanei. Ich zeichne und nähe neben der Großmutter, fädle die winzigen Modellkleider mit zwei Ösen an den Schulterstücken auf eine Schnur, die quer durchs Zimmer geht.
An jedem ersten Freitag im Monat beichtet die Großmutter, an jedem Sonntag geht sie zur Kommunion. Was beichtet jemand, der zum Sündigen keine Gelegenheit hat?
„Der Gerechte, heißt es in der Bibel, der Gerechte fällt sieben Mal am Tag.“
Pater Augustin gehört als Mutters Cousin zu den Hausleuten. Er kehrt auch ohne Kommunion beim Sternwirt ein und lehnt zu keiner Tageszeit die Pastasciutta der Sternwirtin ab.
„Im Kloster schmeckt alles ein bißchen jungfräulich.“
Die Sternwirtin würzt gut. Ob sie nicht wieder heiraten möchte?
„Ich will keinen Stiefvater, Pater Augustin!“
„Du würdest auch einen Stiefvater einwickeln.“
Am Vorabend des Dreikönigsfestes holt die Sternwirtin die Rauchpfanne aus dem Unterdach. Aus den Häusern der Städter vertreiben die Kapuziner die bösen Geister. Der Bauer läßt sich die Segnung von Hof und Feld nicht abnehmen. Er geht selbst betend mit der Pfanne über Wiese und Acker, versprengt Weihwasser.
Pater Augustin wird die letzten Weihrauchkörner beim Sternwirt verglühen lassen und dann bis zur Sperrstunde sitzenbleiben.
BERLIN, 2. Februar 41. So allein wie ich jetzt bin, muß ich mich fest zusammennehmen, um mich nicht gehen zu lassen. Die Mutter schreibt, daß sie für mich betet. Tust Du es auch? ... Ich habe mir das Kartenspielen abgewöhnt. Und das Gasthausgehen. Nur ins Kino gehe ich noch. Einmal oder zwei Mal in der Woche. Ich will sparen, damit ich etwas habe, wenn ich einrücken muß ... Am 1. März hätte ich in Salzburg im „Österreichischhof“ einstehen sollen. Aber der Professor hat meine Kündigung nicht angenommen. Er sagt, wenn ich mich hier abmelde und an einem anderen Ort anmelde, dann kann es gut sein, daß sie mich packen. Ich soll mich nicht rühren, sagt der Professor, einfach nicht rühren. Ich könnte dann ja auch Glück haben und übersehen werden ... Am Samstag kommen 45 Studenten der deutschen Wehrmacht hierher zu einem Offizierskurs. Es geht mir eigentlich ganz gut da. Ich habe genug zu essen. Trotzdem danke ich Dir sehr für die Torten. Was von Dir ist, schmeckt doppelt gut ... Ja, kalt ist es in Berlin auch. Heute waren 20 Grad Kälte, in den letzten Tagen auch weniger. Und heute hat es einen mittleren Krach im Hause gegeben. Ich bin um zehn Uhr in die Kirche gegangen und wie ich zurückkomme, ist alles in heller Aufregung. In zwei Zimmern waren die Heizungsrohre geplatzt und ich war nicht da, um das Wasser aufzuwischen und alles wieder herzurichten. ... Liebe Olga, die Sonntage fallen mir besonders schwer. Es gibt nichts zu tun und niemanden zum Reden. Zum Ausgehen ist es zu kalt und allein freut es mich nicht. Zu den Mädchen ins Zimmer darf ich nicht, und sonst ist niemand da ... Gerade ist ein Telegramm eingetroffen, daß am 2. Jänner um 10 Uhr in Salzburg meine Nichte geboren ist ... Ein italienischer Gast soll gekommen sein. Darauf freue ich mich, da kann ich ein bißchen wallisch mit ihm plodern ... Wenn ich Dir schreibe, Liebste, kommt mir vor, ich bin in dieser Stunde bei Dir und erzähle Dir meine Erlebnisse ...
Diese dauernden Kontrollen damals ... Sie haben die Backstube auf den Kopf gestellt, um etwas zu finden, was mit den Eintragungen in die Fragebögen nicht übereinstimmen hätte können. Wir haben ja fast jedes einzelne Weizenkorn auflisten müssen. Der Vater hat getobt, wie sie die Eisengitter einsammeln gekommen sind, ich sehe ihn noch vor mir. Und für die Befanafeiern haben sie Geld genug, hat er geschrien. Hundert Pakete sind an die Kinder der Fasci und der Squadristi verteilt worden und ein Sparkassenbüchlein mit fünfzig Lire, wo eh kein Geld dagewesen ist bei den Leuten. Auch sonst nicht viel. Mein Onkel hat geweint wie ein kleiner Bub, wie sein Roß unter der Holzfuhre zusammengebrochen ist. Weder hat er sich ein neues Roß leisten können, noch ein neues finden. Aber die Schönheitswettbewerbe für die Haflinger in Meran sind die ganzen Kriegsjahre weitergegangen. Und die Pferderennen auch.
RICHARD HAT GROßMUTTER in die Gaststube getragen. Wie hart die Holzbank aufs Steißbein drückt. Und wie wenig Gäste da sind. Und der junge Kapuziner kommt schon zum dritten Mal, und wieder verschiebt sich die Aussegnung auf später.
„Ein Achtel Roten“, ruft einer mit dem Arm in der Schlinge von der Budel herüber.
„Wie feiert man walsche Weihnachten?“ fragt der Schreiner-Wastl spöttisch.
„Bei der deutschen Weihnacht hat der Hitler gepredigt, gell?“
Nie werde ich so schlagfertig werden wie Großmutter.
„Beim Traubenwirt ist der bessere Radio gestanden“, erzählt der Gast. „Die Stube ist voll gewesen wie eine Kirche. Bis auf die Lauben hinaus hat man Heil Hitler rufen gehört.“
„Lang feiert man mit dem Hitler nicht. Wann folgst du ihm eigentlich ins Reich, Wastl?“
Der Schreiner-Wastl hat eine Tischlerei in der Stadt. Er zahlt sein Viertel und schlägt die Tür hinter sich zu.
Die Sternwirtin führt die Prozession betend durchs Haus. Auf jeden Türrahmen schreibt der Frater mit geweihter Kreide 19-K-M-B-41.
Der Maresciallo wünscht Buona Befana und geht mit seinem Kollegen in den Winter hinaus. Buona Befana. Die Großmutter weiß gar nicht, was die Fremden da wünschen.
Ich habe immer gern italienisch geredet ... Die Lehrerin aus Messina hat rote Lippen und rotlackierte Fingernägel. „Spiega tu!“ sagt sie, wenn meine Mitschüler nicht verstehen wollen. Die Signorina ist eine nervöse Person und vergißt in ihrer Zerstreutheit oft etwas, das sie sich dann von mir aus der Kammer im Unterdach des Schulhauses holen läßt. Dort oben schlüpfe ich in die hohen Stöckelschuhe der Maestra und schaue in ihren Schminkbeutel. Die anderen sagen, die Elsa ist die Prediletta der Lehrerin, das Liebkind.
„Bevor sie den Luigi hierher versetzt haben“, erzählt die Großmutter, „hat er gar nicht gewußt, daß es in Italien Leute gibt, die deutsch reden. Aber Italien, hat er gesagt, Italien ist das hier nicht. Fremd sind die Walschen bei uns und fremd werden sie bleiben. Abgeben tut sich von den Unsrigen keiner gern mit ihnen, außer er braucht etwas. Wen wundert’s, daß die Carabinieri hier so gut wie nichts verstehen. Nicht was die Leute untereinander reden, nicht was sie denken, nicht wie sie leben, nicht was sie essen und wie sie feiern. Sie könnten einem leidtun, wenn sie keine Walschen wären.“
Die Sternwirtin will vom Mitleid mit den Dahergelaufenen nichts wissen. „Ihr verderbt mir noch die Kinder mit Eurer Rede, Mutter.“
Die Trentiner Lehrerin aus der zweiten Klasse hat so schöne Hände.
„Und ein böses Mundwerk“, ergänzt der Vater.
„Che cosa avete nella vostra zucca? Patate e crauti?“
„Ja, ja. Kraut und Erdäpfel habt ihr für die im Kürbis“, sagt der Vater. „Die walschen Lehrer benehmen sich wie die Missionare, die Wilde zu bekehren haben.“
Die gotischen Buchstaben, die ich in Kurrentschrift in mein geheimes Heft male, sind seiner Ansicht nach mit den lateinischen an Eleganz nicht zu vergleichen.
Vaters Finger auf der Datumangabe. E. F. steht am Kopf des Blattes, die Jahreszählung der Faschisten, daneben Tag und Monat.
„Das heißt Elsa Frener, Vater.“
Diese Angst, er könnte vor Wut über die „Era Fascista“ das Heft zerreißen.
DER JUNGE KLOSTERBRUDER ist während der Aussegnung nicht ganz bei der Sache. „Heiß!“ schreit Pater Augustin auf. Der Frater hat die glühenden Körner aus der Pfanne danebengelöffelt. Später zischt es laut, weil sich des Fraters Weihwasserwedel und das Rauchfaß nicht vertragen. In der Kammer vergißt er aufs Nachbeten. Mit schrägem Kopf schielt er auf die Buchrücken hinter dem Glas des Kastens.
Ich binde Großmutter die geschnürten Schuhe auf, ziehe die Strümpfe von ihren Beinen, umfasse ihre Knöchel und drehe den mageren Körper vom Sitzen ins Liegen. Ein geübter Schwung.
„Das arme Paterle. Viel zu jung fürs Kloster.“
„Im Kloster spürt er den Krieg nicht, Großmutter.“
Die Gaststube ist leer. Auf dem Türschild zur Kammer hinter der Küche steht Privat. Für einige Gäste wird das Privat nach der Sperrstunde aufgehoben. Die Schüssel mit den Nudeln steht schon auf dem Tisch. Ich hole den Brotkorb und setze mich auf den äußeren Rand der kurzen Eckbankseite. Mein angestammter Platz.
Frater Ansgar ist näher ans Getäfel gerückt. „Eigentlich heiße ich Ulrich.“
Aus dem deutschen Ansgar mache ich später vorsichtig einen lieblicheren Gari.
Die Tischgesellschaft ist laut. Pater Augustin ist angetrunken. Sein Lachen dröhnt bis in die Kammer der Großmutter hinauf.
Ich bringe einen frischen Krug Wein, fülle Brot auf. Frater Ansgar schaut mir gern nach. Aber das sagt er mir erst viel später. Auch, daß er seine Hand auf die warme Stelle neben sich auf die Bank gelegt und dem Augenblick nachgespürt hat, bis ich mich wieder neben ihn gesetzt habe.
„Man kann die Sünde nur fliehen“, sagt der Novizenmeister. „Man kann die Sinnenlust nur abtöten.“
Am Montag geißeln sich die Brüder nach der Matutin im Refektorium.
„Und diese dicken Bücher liest Ihre Großmutter?“
„Ja. Sie läßt mich beim Nähen mitlesen.“
Ich will den leeren Fleischteller aufheben.
„Bleiben Sie, wir haben ja alles.“ Frater Ansgar legt seine Hand auf die meine. Er zieht sie aber so schnell wieder zurück, daß es wie ein Blitz ist. Und ich lasse den Teller fallen.
„Ich sage Großmutter gute Nacht.“
Frater Ansgar wünscht sich, diesem Mädchen vorzulesen. Heloisa und Abaelard. Auf daß ich nicht in Versuchung falle ... Die Romane aus der geheimen Bibliothek von Pater Albuin verschlingt er genauso heimlich, wie er sie zugesteckt bekommt. Gegen das schlechte Gewissen ein Lesezeichen mit dem Aufdruck Gute Bücher sind Wegweiser zu Gott.
Ich bringe Irrungen und Wirrungen aus der Kammer mit. „Das ist unser letztes.“
„Lene ist Näherin ... wie Sie!“
„Ach, Sie haben das auch gelesen?“
Die lebhafte Unterhaltung bei Tisch. Der Übermut meiner Geschwister. Das laute Lachen der Mutter. Die Faust von Pater Augustin, die auf den Tisch schlägt. Ansgar und ich sind still. Wir lächeln zu den Sprüchen der anderen und einander zu.
Die Geschichte mit Lenes Haar um den Blumenstrauß ...
„Haar bindet, hat Großmutter beim Vorlesen gesagt, deshalb stricken unsere Frauen Haare in die Maschen der Janker ihrer Männer.“
Bis dahin bin ich noch keinem begegnet, den ich hätte binden wollen. Aus meinem Rocksack ist das Taschentuch herausgerutscht. Es liegt eine Weile zwischen uns beiden. Dann hebt es Ansgar auf. Ich ziehe ein Haar aus meinem Zopf, gebe es in das auseinandergefaltete Tuch und lege es wieder hin. Ansgar schiebt es in seinen Ärmel. Und wird rot.
„Auf, Ansgar, bevor es zum Angelus läutet!“
Richard bringt den Pfiati-Gott-Schnaps. Sobald wir einander Gesundheit wünschen, wissen wir beide, daß uns mit einem Mal die Liebe ausgebrochen ist.
BERLIN, Hegelhaus ... Ich freue mich wie ein kleines Kind, wenn ein Brief von Dir kommt. Ich lese ihn drei Mal, vier Mal und immer wieder. Am liebsten würde ich Dir jeden Tag schreiben, damit Du jeden Tag antworten mußt. Ich vermute, ich seufze laut beim Lesen und bin froh, daß ich allein in der Kammer bin. Die Kollegen würden mich auslachen. Deine Nachrichten tun mir so wohl, daß ich den ganzen Tag lang den viel besseren Mut habe. Und wie schön Du erzählen kannst. Manchmal denke ich, das Schlimme verheimlichst Du, um mich nicht zu betrüben ... Von den Mädchen hier im Haus habe ich zum Fest zwei schöne Bücher geschenkt bekommen. Eines heißt „Unter den Dolomiten“, und das andere „Alpentragödie“ ... Danke für das Paket! Aber Du brauchst mir nichts zu schicken, mir geht nichts ab. Ich habe mit Jan geteilt. Er hat es nicht zu gut. Er kommt oft erst spät nach Hause und bekommt nichts mehr zu essen. Er würde eine Frau brauchen ... Im nächsten Monat sollen 35 Mädchen aus Südtirol kommen, um hier im „Hegelhaus“ einen Kurs für Kindererzieherinnen zu besuchen ... Ja, weißt Du, wenn Dein Vater ein bißchen kulanter gewesen wäre, wäre ich vielleicht nicht gegangen. Aber gezahlt hat er fast nichts und haben hat er mich auch nicht wollen. Als Deinen Schani, mein ich. Da war ich ihm halt zu minder als Bäckergeselle ... Ich lege Dir ein Bild von mir bei. Erschrick nicht, es ist ein Blitzphoto. In Wirklichkeit bin ich viel schöner. Sei umarmt und geherzt!
Es ist recht kurzweilig gewesen in der Bäckerei. Die Leute haben viel erzählt. Bötinnen hat es auch noch gegeben. Diese Bötinnen mit ihren Geschichten... was ist eine Zeitung dagegen? Heimweh? Schon. Wie man sich halt so sehnt mit zwanzig. Manchmal habe ich sogar gefürchtet, er könnte vielleicht eine Berlinerin finden. Und schließlich ... leichter hätte ich es auch gehabt mit dem Mati im Haus. Den Vater hat es wohl oft gereut, daß er ihn hat gehen lassen. Ein Geselle ist in den Vierzigerjahren ein Hungerleider gewesen. Keine gute Partie, sozusagen. Die großen Reden über Sozial- und Altersversicherung hat den Faschisten niemand abgenommen. Ehe- und Geburtenzuschüsse haben sie versprochen, Krankenversicherung, Invalidenrenten. Ich habe anderes im Kopf gehabt als Heiraten. Ich habe mich um die Rationierungen gekümmert, um die Brotkarten, die Vor- und Nachanmeldungen. Dann haben uns auch die Zeremonien und Andachten zerstreut, die Ämter, Prozessionen. Das alles hat den Tag ausgefüllt. Da ist man nicht so angewiesen gewesen auf eine Liebschaft. Ins Kino bin ich besonders gern gegangen. Dafür bin ich mit der Herta sogar nach Bozen gefahren. Vittoria ad Occidente, La quinta Colonna, und wie das Zeug alles geheißen hat. Heil Hitler. „Heil Hitler“ hat der Mati unter seine Briefe geschrieben. Vier Mal. Gezählte vier Mal in zweiundvierzig Briefen. Das ist kein Schnitt, für den er sich schämen müßte.
Berlin, am 22. Mai 1941 ... Ganze 22 Tage ist Dein Brief unterwegs gewesen. Seit vier Stunden habe ich ihn nun ... Jan und ich reden viel darüber, wie wir von hier wegkommen könnten. Mein Bruder wird in der nächsten Zeit in die Ostmark fahren, um sich vielleicht einen Hof anzuschauen, damit meine Familie weiß, wohin, wenn sie von daheim fortgeht. Na vertora ... Bis zum 1. Oktober hat mich der Professor vom Militär freigemacht. Das ist schön von ihm, nicht? ... Lüca, mein Schwager, schreibt, Jan und ich sollen nach Salzburg kommen. Er würde das Nötige für uns in die Wege leiten. Da wäre ich dann viel näher bei Dir, Olga. Linêrt hat gemeint, Innsbruck wäre noch schöner. Alles bekannte Leute – vielleicht gar zu viele bekannte ... Am 13. Mai sind die Kameraden eingerückt. Diesmal ist das Alleinsein weniger schlimm. Ob ich ans Abschiednehmen schon gewöhnt bin? ... Wir erwarten eine Gruppe von 80 Leuten. Woher sie kommen, weiß ich nicht. Die Südtiroler Mädchen sind ausgeblieben. Also sind wir zur Zeit nur 20 Ausländer ... Die Tota schreibt, sie hat uns am Kassiansonntag vermißt. Als wenn man für die Kassiansprozession von Berlin nach Brixen fahren könnte ... da darf der Hl. Kassian für uns Badioten noch so eine Bedeutung haben. ... Chiló diji che i Ingleji vëgn a taché füch ai bosc y ales compagnes canche döt é bel sëch, spo ne n’unse nia plü da mangé por n’ater ann. I sun tan contënt che T’ess t’n post al sigü! ... Zum Glück hast Du wegen s un jì keine Sorgen ...
Wenn ich nur bei Dir sein könnte! Ich küsse Dich und umarme Dich, Dein Mati.
In meinen jungen Jahren bin ich fromm gewesen. Alle sind wir fromm gewesen. Richtig lau ist das jetzt im Vergleich, das Beten nachlässig. Was der Kassianssonntag für ein Erlebnis gewesen ist! Und diese Aufregung damals, als nur mehr die behördlich angemeldeten Musikkapellen bei der Prozession haben mitgehen dürfen. Der Mati hat immer viel gebetet. Die Badioten sind überhaupt feste Beter. Fast schon ein bißchen abergläubisch. Einmal hat er geschrieben, seine Kameraden würden groß schauen, wenn er sich in der Nacht bekreuzige. Aber sagen würden sie nichts, nur schauen. Da ist er schon an der Front gewesen.
ICH BIN BEI DEN PICCOLE ITALIANE, meine Brüder bei der Balilla. Bei der Einweihung des GIL-Gebäudes feiert die faschistische Jugendorganisation. Die Leute vom Völkischen Kampfring fluchen. Im Großen Graben stehen hier die Dableiber, dort die Optanten, hier die Verräter, dort die Nazi.
Ich fahre mit der Colonia Fascista ans Meer. Aufstehen und turnen, waschen und frühstücken, wandern und schwimmen und alles gemeinsam und dann, wenn es der Kapo will. Der Drill. Wie im katholischen Knabenseminar in Salern, wo alles der Zucht des Präfekten folgt.
Auch Mastromattei ist ein Präfekt. Diese fremde Macht, die auch fremd geheißen hat: Prefetto und Podestá und Commissario. Man hört den Präfekt vom Domplatz bis zum Sternwirt herüberschreien. Er will die Südtiroler im Land behalten – nicht alle zwar, aber das sagt er nicht. Da hat sich die Familie Frener schon lange fürs Dableiben entschieden.