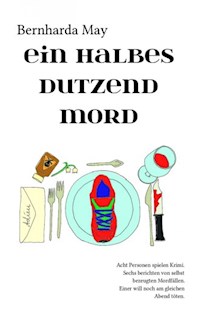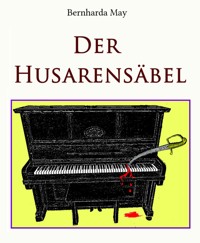
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
Die Frau des Bürgermeisters erbt einen goldenen Husarensäbel aus dem 18. Jahrhundert – das gilt in ihrem verschlafenen Nest bereits als kleine Sensation, und so ist es kein Wunder, dass sie plötzlich bei allen Nachbarn im Mittelpunkt steht. Als das kostbare Erbstück jedoch als Mordwaffe missbraucht und anschließend gestohlen wird, ist auch das Interesse der auswärtigen Kriminalpolizei geweckt. Die Ermittlungen enthüllen schonungslos, wie viel Neid, Misstrauen und Raffgier tatsächlich hinter den schmucken Kleinstadt-Fassaden verborgen sind…
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 231
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Bernharda May
Der Husarensäbel
Kriminalroman
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.dnb.de abrufbar.
Texte: © Copyright by Bernharda May
Umschlaggestaltung: © Copyright by Janne Gret
Verlag:
JanneGret Selbstverlag
Postfach 11 11 03
35390 Gießen
1
»Das Geheimnis des Husarensäbels« titelten vor einigen Jahren großspurig alle Zeitungen, als der Raub in Gooths Haus bekannt wurde und jeder in unserem Städtchen rätselte, wer wohl dahinterstecken mochte. »Riesenärger um den verfluchten Säbel« wäre meines Erachtens die bessere Überschrift gewesen, denn der Fall zog nicht nur eine Menge Verdruss mit sich, sondern sorgte in unserem Städtchen für allerhand falsche Verdächtigungen und böse Streitereien, sodass die vormals traute Ortsgemeinschaft beinahe völlig auseinandergebrochen wäre.
»Mit deiner langjährigen Erfahrung als Reporter kommst nur du infrage, die Story richtig zu erzählen, Martin«, bedrängen mich meine Freunde seitdem, »noch dazu, weil du der einzige Augenzeuge warst!«
»Augenzeuge ist Unsinn, was habe ich schon gesehen?«, pflege ich mich herauszureden. »Lass die Jungen berichten, die das Zeug dazu haben. Ich bin zu alt.«
Nachdem jedoch erst vor ein paar Tagen ein Freund unbeholfen versuchte, seiner Ehefrau die damaligen Ereignisse zu schildern, habe ich mich entschlossen, die Geschichte um den Husarensäbel ein für alle Mal so niederzuschreiben, wie sie tatsächlich passiert ist – ohne jene reißerische Sensationsgier des heutigen Journalismus, die jegliche Bemühung um Klarheit so erschwert.
Aber wo beginnen? Am besten fange ich mit jenem sonnigen Sommernachmittag an, als ich von dem unheilvollen Säbel zum ersten Mal hörte. Ich saß gerade mit meiner Schwiegertochter Margit in unserem Garten bei einem Glas frischen Orangensaft, während die Insekten um uns herumschwirrten, und stellte fest, wie Margit ihren Stuhl entgegen ihrer Gewohnheit recht nah an der Hausecke positioniert hatte und beständig nach hinten kippelte, um zur Straße zu sehen.
»Was äugst du denn immer zum Fußweg?«, fragte ich, nachdem ich ihr Verhalten mehrere Minuten lang stumm geduldet hatte. »Erwartest du noch Besuch?«
»Nein, nein«, antwortete Margit und lächelte unschuldig. »Ich schau mich eben gern in unserem Garten um.«
Ich glaubte ihr nicht und sagte das auch.
»Nach irgendjemandem hältst du Ausschau«, stellte ich fest. »Aber wenn es kein Besuch ist… Wer könnte um die Zeit denn alles die Straße entlangkommen?«
Ich zählte an den Fingern ab.
»Die Post war schon mittags da. Walther patrouilliert erst nach Sonnenuntergang hier herum. Und der Ausflug der Grundschulklasse ist vor einer Dreiviertelstunde lärmend hier vorbeigeradelt. Mehr dürfte nicht passieren, oder?«
»Du irrst«, entgegnete Margit und lächelte wieder, aber nicht mehr so unschuldig. »Eine Partei hat ihre Aufwartung noch nicht gemacht.«
»Und wer?«, fragte ich nun beharrlicher.
»Die Gooths wollen heute zurückkommen«, erklärte meine Schwiegertochter. »Nina Kowalski hat mir das verraten. Und da ich vorgestern verpasst habe, Griselda mein Beileid auszudrücken, warte ich nun auf ihre Rückkehr, um das nachzuholen.«
Griselda und Eduard Gooth wohnten in der großen Backsteinvilla direkt gegenüber und überdies waren unsere Häuser jeweils die letzten am Ortsausgang, bevor die Straße begann, sich durch Felder und Wiesen zu schlängeln. Aus unserer friedlichen Nachbarschaft hatte sich mit der Zeit eine gute Freundschaft entwickelt. Allerdings hatte sich vor fünf Tagen ein dunkler Schatten über das Verhältnis der Familien Gooth und Harbecke gelegt. Das war folgendermaßen gekommen:
Unvermittelt hatten Margit und ich beide Gooths vor ihrer Einfahrt angetroffen. Griselda war ganz in Schwarz gehüllt und hatte ihr braunes Haar zu einem strengen Dutt frisiert, ihr untersetzter Mann trug einen grauen Anzug mit dunkler Krawatte.
»Wir haben eine weite Strecke vor uns«, erklärte Eduard und wirkte kurz angebunden. »Mein Schwiegervater ist verstorben und wir müssen zur Beerdigung nach Nürnberg, wo wir bis zur Testamentseröffnung bleiben müssen.«
»Griselda stammt aus Bayern?«, war alles, was Margit in jenem Moment hervorbringen konnte, überrascht darüber, dass es Dinge zu geben schien, die wir trotz langjähriger Freundschaft nicht übereinander wussten. »Ich habe nie den leisesten Dialekt rausgehört!«
Hier in Mecklenburg gilt alles, was jenseits des Harzes liegt, als exotisch und fremd, jedenfalls teilen diese Ansicht alle Einheimischen unseres kleinen Städtchens mitten im Nirgendwo. Darum hatte meine Schwiegertochter etwas Zeit gebraucht, um die Neuigkeit zu erfassen, und selbst ich war nicht geistesgegenwärtig genug gewesen, um mich rechtzeitig vor Abfahrt der Gooths auf die Grundregeln des Anstands zu besinnen. Vielleicht war das der Grund, warum Griselda den Briefkastenschlüssel nicht, wie sonst üblich, uns überlassen hatte.
»Nina wird sich um die Leerung der Post kümmern«, war alles gewesen, was sie sagte.
Dann waren sie davongefahren und Margit wollte sich den Fauxpas nicht verzeihen.
»Heute fange ich Griselda ab, sobald sie aussteigt, und werde das Verpasste nachholen«, sagte sie und hielt triumphierend eine Trauerkarte in die Höhe, die sie vorbereitet hatte.
»Eine Karte halte ich für überflüssig, wo wir ihren Vater doch gar nicht kannten«, meinte ich.
Ehe Margit mit mir darüber streiten konnte, hörten wir den Motor eines Wagens, der sich unserem Haus näherte. Margit kippelte abermals nach hinten, lugte um die Ecke und wäre beinahe mit dem Stuhl umgefallen, wenn ich sie nicht rechtzeitig am Arm gepackt und zu mir gezogen hätte.
»Da sind sie«, sagte sie und erhob sich. »Lass uns hingehen.«
Sie löste sich aus meinem Rettungsgriff und nahm nun ihrerseits mich an den Arm, um gemeinsam mit gebotener Höflichkeit hinüberzuschreiten und feierlich die Beileidsbekundung zu überreichen. Doch erneut wurden wir überrascht: Statt mit ernsten Mienen und gedeckter Kleidung, sprangen Griselda und Eduard fröhlich aus ihrem Auto, sommerlich in ein geblümtes Kleid beziehungsweise ein hellblaues Polo-Shirt gehüllt.
»Schön, euch wiederzusehen«, rief Eduard. »Süddeutschland ist definitiv eine Reise wert, aber wie sagt man? Trautes Heim, Glück allein.«
»Das Wetter war fabelhaft«, fügte Griselda hinzu.
Angesichts solch guter Laune war uns sofort klar, dass jeglicher böser Schatten verflogen war. Margit schüttelte Griseldas Hand und murmelte leise »Mein herzliches Beileid nachträglich«, während sie die Karte übergab. Unsere Nachbarin stutzte kurz, steckte dann die Karte lachend in ihre Handtasche und sagte:
»Ach, meine Liebe, sehr aufmerksam. Auch dir, Martin, danke schön. Aber ihr kanntet meinen Vater ja gar nicht und auch ich hatte nur wenig mit ihm zu tun.«
»Ich hoffe, die Feier war trotzdem angemessen?«, erkundigte ich mich.
»Ein paar sonderbare Musikwünsche, wie ich fand«, berichtete Eduard. »Eher unbekannte Klavierwerke, die – gemessen an der kleinen Trauergemeinde – die Beisetzung sehr in die Länge zogen. Aber ansonsten war alles gut, das Essen war fabelhaft.«
Er öffnete den Kofferraum und zwinkerte uns zu.
»Das Highlight war ja später die Testamentseröffnung. Nicht, dass der gute Schwiegerpapa besonders reich gewesen wäre. Aber es ist da ein Schatz aus dem Besitz seines Großonkels aufgetaucht, mit dem wir nicht gerechnet haben!«
Er holte ein längliches Paket heraus und zwinkerte abermals.
»Ihr erratet nie, was sich hier drinnen befindet«, grinste er.
»Eduard, leg es wieder ins Auto«, bat Griselda. »Es soll doch eine Überraschung für alle werden! Außerdem lohnt es sich nicht, das Ding auszupacken. Wenn alles klappt, werden wir damit gleich morgen oder übermorgen wieder wegfahren! Ach, da fällt mir ein, ich muss telefonieren. Bis später, Margit! Mach’s gut, Martin!«
Sie eilte ins Haus. Eduard sah ihr nach, beugte sich dann verschwörerisch zu uns und raunte:
»Überraschung hin oder her, euch kann ich vertrauen. Sieh her, Martin, ist das nicht ein tolles Stück?«
Er öffnete das Paket und ließ mich zuerst hineinsehen. Dann war Margit dran. Meine Schwiegertochter und ich tauschten einen ratlosen Blick.
»Ein altes Schwert?«, fragte ich.
»Eher ein Degen, oder?«, mutmaßte Margit.
»Ein Säbel, um genau zu sein«, erläuterte Eduard mit sichtlichem Stolz. »Der ist geschichtsträchtig, glaubt mir. Griselda und ich haben bereits die ganze Autofahrt darüber gesprochen: Wir werden damit zum Fernsehen gehen!«
Mir fiel ein Werbespot ein, den ich unlängst gesehen hatte. Darin spießte ein alter Mann, als Pirat verkleidet, gefrorene Fischstäbchen mit seinem Säbel auf und knabberte sie anschließend gemeinsam mit einer Gruppe Kinder daran herum.
»Ah ja, die Tiefkühl-Fischspezialitäten von Frostkost & Co.«, nickte ich. »Das ist ja lieb von euch, den Säbel für deren Clips zur Verfügung zu stellen. Am Ende wird Griselda noch eine Fernsehpiratenbraut?«
Ich hatte das ehrlich und lobend gemeint und verstand zunächst nicht, warum Eduard plötzlich die Lippen kräuselte, abschätzig die linke Braue hob und das Paket samt Säbel wieder im Kofferraum verschwinden ließ.
»Du liegst leicht daneben, Martin«, sagte er und etwas Unwirsches schwang in seiner Stimme mit. »Um nicht zu sagen, gänzlich falsch! Vielleicht hat meine Frau recht und ich sollte nicht zu viel verraten? Lasst euch überraschen! In eins, zwei Wochen werdet ihr staunen!«
2
Bis wir den Säbel wiedersahen, dauerte es tatsächlich mehr als zwei Wochen. Allerdings redete Margit tagtäglich von kaum etwas anderem, woran ich allerdings selbst schuld war.
»Sieh, meine Gute, die Gooths wollen die Sache aus irgendeinem Grund geheim halten«, hatte ich zur ihr gesagt. »Das heißt, dass du weder deinen Kolleginnen noch deinen Freundinnen vom Kaffeekränzchen davon erzählen darfst, egal wie stark es dich danach drängt!«
Margit versprach mir, Stillschweigen zu bewahren. Ihrer üblichen Gesprächspartner beraubt, erkor sie nun dummerweise mich als den Auserwählten, dem sie all ihre Theorien anvertrauen konnte.
»›Geschichtsträchtig‹ hat Eduard gesagt«, wiederholte sie ständig. »Und vom Fernsehen hat er gesprochen. Am Ende gehörte der Säbel einst einem berühmten Seeräuber? Aber ein schwäbischer Seeräuber aus Nürnberg – kaum zu glauben.«
»Fränkischer Seeräuber«, berichtigte ich.
»Egal, das ist eher unwahrscheinlich. Obwohl, vielleicht gab es da früher Flusspiraten? Wie breit ist die Isar?«
»Die Pegnitz«, korrigierte ich abermals. »Meine Liebe, deine Geografiekenntnisse sind nicht die besten.«
Margit überhörte das.
»Ach, ich erinnere mich – die Piratensache hast du ja eingebracht, nicht Eduard. Der hat darüber nur die Nase gerümpft. Also nichts mit Seeräubern. Vielleicht hat sie der Säbel inspiriert und sie wollen einen Fechtkurs buchen? Und als Bürgermeister plant er, ein Turnier hierher in unser Städtchen zu holen! Das wäre was!«
»Margit, hör doch mit deinen neugierigen Nachforschungen auf, das gehört sich nicht«, versuchte ich sie zu stoppen, aber vergeblich.
»Oder am Ende wird gar ein Film gedreht?«, führte sie ihre Ideen weiter aus. »Stell dir vor, unser Örtchen wird ganz berühmt! Das würde auch erklären, weshalb die Gooths ständig wegfahren. Ist dir aufgefallen, wie oft sie neuerdings Tagesausflüge machen? Griselda ist kaum noch daheim. Ein Glück, dass sie Frau Kowalski haben, bei dem großen Haus!«
Frau Kowalski war die Haushaltshilfe, die mehrmals die Woche bei Gooths vorbeikam und Griselda beim Wischen und Waschen half. Als Filialleiter unserer hiesigen Bank und langjähriger Bürgermeister konnte es sich Eduard ohne Weiteres leisten, eine Hilfskraft anzustellen, um seine Gattin zu entlasten.
»Und für Nina ist es ein schönes Zubrot«, meinte Margit.
»Ihr Mann ist Polizist und dementsprechend verbeamtet«, entgegnete ich. »Ob sie angesichts seines sicheren Einkommens überhaupt ein Zubrot braucht?«
»Eine Frau will ihr eigenes Geld verdienen und nicht vom Ehemann abhängig sein«, meinte Margit.
»Warum gibt sie sich dann mit einer Stellung wie dieser zufrieden und macht nicht mehr draus?«, fragte ich.
»Wer ist jetzt von uns beiden der neugierige Nachforscher?«, unterbrach mich Margit und lächelte frech.
»Bei mir ist das was anderes«, behauptete ich. »Das ist das Reporterblut in mir. Da muss man einfach Fragen stellen. Was mich gleich auf eine Beobachtung bringt, die ich selber in den letzten Wochen gemacht habe.«
»Ja?«
Margits Augen leuchteten wissbegierig.
»Oh ja«, nickte ich und sprach betont langsam, um meine Schwiegertochter ein wenig zu necken. »Unser Kühlschrankinnenleben wandelt sich mit jedem Tag ein Stückchen mehr, und ebenso der Bestand der Speisekammer. Nicht nur, dass mehr als üblich in den Einkaufstüten steckt, die du nach der Arbeit mitbringst – immer häufiger lese ich ›bio‹, ›vegan‹ und ›fair trade‹ auf den Schachteln.«
Margit schwieg betreten.
»Ich kombiniere daraus, dass du nun doch in dem neuen Laden in der Siedlung einkaufst«, schloss ich meine Ausführungen. »Obwohl wir festgestellt haben, dass die Lebensmittel dort viel teurer sind als woanders.«
»Dafür sind sie auch gesünder und ökologisch nachhaltiger«, widersprach Margit. »Wir müssen mit der Zeit gehen. Junge Leute legen Wert auf solche Ernährung und außerdem ist es doch schön, wenn wir die neuen Geschäfte in der Siedlung unterstützen, oder nicht?«
Lassen Sie mich Ihnen, werte Leserschaft, an dieser Stelle eine kurze Beschreibung unseres Städtchens geben. Woanders würde man es wahrscheinlich nur als zu groß geratenes Dorf bezeichnen, aber es ist weit und breit die größte Ortschaft und wird nur von kleineren Gehöften umgeben. Die Landschaft drumherum ist verhältnismäßig flach, eben typisch für das westliche Mecklenburg. Neben Kirche, Grundschule, Bank und Gasthof (inklusive Festsaal!) gibt es hier die einzige Poststelle der Gegend. Jeder kennt jeden, viele Betriebe sind seit Jahrzehnten in Familienbesitz, man trifft sich sonntags in der Kirche oder im Gasthof und örtliche Feierlichkeiten sind terminlich an die Jahreszeiten und Arbeiten auf dem Felde gebunden.
Die neue Siedlung, von der Margit sprach, war erst in den letzten Jahren gewachsen. Sie diente vor allem Kleinfamilien und Rentnern aus der Großstadt als neuer Wohnsitz, die unbedingt ihren Traum vom Eigenheim verwirklichen wollten und sich nicht davon abschrecken ließen, bis ins nächste moderne Einkaufszentrum fast eine Stunde mit dem Auto fahren zu müssen. Diesen Mangel an Einkaufsmöglichkeiten wiederum hatte sich ein Geschäftsmann zunutze gemacht, der mit den neuesten Ernährungstrends vertraut war und in der Siedlung einen Laden mit teuren Bio-Lebensmitteln, Veggie-Food und ökologisch abbaubaren Produkten eröffnet hatte. Der lief meines Erachtens auch ohne Margits Hilfe ganz gut und ich für meinen Teil erledigte die Einkäufe lieber weiterhin auf dem Markt, wo es einen Bäcker, einen Metzger und einen Tante-Emma-Laden gab und jeden Mittwoch die Bauern Obst, Gemüse, Eier und Molkereiprodukte anboten.
»Glaub einem erfahrenen Journalisten, der schon über viele Modeerscheinungen in der Lebensmittelbranche berichten musste«, sagte ich zu Margit. »Erinnerst du dich noch an die Zeiten, als man vor Eiern warnte wegen des Cholesterins? Und irgendwann hieß es plötzlich, so schlimm sei es gar nicht? Ähnliches prophezeie ich dir hinsichtlich des fleischlosen Konsums, und was hinter den Fair-Trade-Siegeln für dunkle Geschäfte stecken mögen, will ich am besten gar nicht wissen. Zuletzt wollen unsere Alteingesessenen schließlich auch von ihrer Hände Arbeit leben. Wieso sollte man da extra bis in die Siedlung fahren für etwas Brot, Fleischimitat und Butter?«
Margit schwieg dazu, aber ich durchschaute sie, denn ihre Formulierung »junge Leute« hatte verraten, was in Wirklichkeit hinter den neuen Einkaufsgewohnheiten steckte.
»Michael kommt zu Besuch, habe ich recht?«
Margit schlug mit der flachen Hand auf die Sessellehne.
»Verflixt, es sollte doch eine Überraschung sein!«, rief sie.
Michael war mein Enkel, ein fleißiger Medizinstudent. Der legte wirklich großen Wert auf gesunde Ernährung, und wenn er auch nichts gegen das regionale Angebot unseres Städtchens einzuwenden hatte, bevorzugte er doch Waren, deren Nachhaltigkeit mit entsprechendem Siegel gesichert war. Diskussionen darüber, dass ein einfacher norddeutscher Bauer sich so ein Siegel erst einmal finanziell leisten können musste, war der Schlingel bisher erfolgreich aus dem Weg gegangen. Natürlich habe ich ihn trotzdem von Herzen gern und verstand nun Margits großzügige Bestückung des Kühlschranks. Wo ein Mutterherz waltet, ist keine Speise zu teuer!
»Michael will seine Semesterferien endlich mal wieder zu Hause verbringen«, erzählte sie. »Er wollte dich überraschen, also spiel den Ahnungslosen, wenn er nachher kommt.«
»Er trifft heute schon ein?«
Ich war verblüfft, wie lange Margit den Sachverhalt vor mir hatte verborgen halten können. Vielleicht war ihre ganze Säbel-Plauderei nur Ablenkung gewesen? Raffiniert!
»Wo wir gerade vom Einkaufen sprechen«, plauderte Margit sogleich weiter. »Ich habe heute Frauke Friedrichson beim Fleischer getroffen. Sie hat ihr blaues Kleid mit den weißen Blumen am Saum völlig verschmutzt, weil der Kettenschutz ihres Fahrrades abgegangen ist. Ob das je wieder rausgeht?«
Da ich mich mit den Möglichkeiten und Grenzen von Waschbelangen nur bedingt auskannte, antwortete ich bloß:
»Sie sollte eben lieber zu Fuß gehen.«
»Und die ganzen Einkäufe schleppen? Nein, das kannst du ihr nicht zumuten.«
Frauke Friedrichson kam mir mit ihrer gedrungenen Figur zwar kräftig genug vor, um ihre Einkaufstaschen selbst tragen zu können, aber ich schwieg. Margit fuhr fort:
»Sie hat schließlich einen Gast und darum mehr einzuholen als sonst. Eine gewisse Frau Appelhold, glaube ich.«
»Appelhoff«, berichtigte ich. »Ich habe sie vorgestern bei der Post getroffen.«
»Und?«, fragte Margit neugierig. Sie wollte über Fremde immer alles ganz genau wissen.
Ich muss an dieser Stelle zugeben, damals Frau Appelhoff meiner Schwiegertochter gegenüber als unmögliche Frau beschrieben zu haben. Sie kam direkt von der Küste, war verwitwet und hatte eine dunkle Stimme, deren Lautstärke sie offenbar nicht regulieren konnte. Außerdem wurde sie von einer Art »Aura der Unruhe« umgeben.
»Appelhoff, die Witwe Appelhoff«, murmelte Margit. Plötzlich erhellte sich ihr Gesicht und sie rief aus: »Aber natürlich, ich hab von ihr gelesen! Sie ist die Witwe eines Großunternehmers – oder war es Großgrundbesitzers? – und sie zeigt sich für eine Vielzahl von Wohltätigkeitsveranstaltungen verantwortlich.«
Diese Erklärung machte mich ihr gegenüber nicht wohlgesonnener.
»Bestimmt eine von diesen Personen, die nicht wissen, wohin mit ihrem Geld, und dann den Leuten ihr Gutmenschtum aufzwingen«, bemerkte ich. »Die kauft ganz bestimmt im Bioladen in der Siedlung ein, das glaub mir!«
Just hörten wir, wie ein Schlüssel sich in der Haustür drehte, und ein munteres »Hallo?« durch die Diele schallte. Margit sprang auf und lief ihrem Sohn entgegen, ich hingegen bereitete auf der Terrasse drei Gläser Orangensaft zur Erfrischung vor.
Nachdem Michael seine Mutter gebührend umarmt und auf die Wange geküsst hatte, kamen beide zu mir nach draußen und Michael warf auf dem Weg durchs Wohnzimmer seine Reisetasche schwungvoll neben das Sofa. Das war eine Angewohnheit, die er von seinem Vater geerbt hatte – der war auch nicht gerade der ordentlichste Mensch der Welt gewesen (was nicht gerade für meine Erziehungskünste spricht).
Überhaupt schlug Michael meinem verstorbenen Sohn in vielem nach: das dichte, dunkle Haar, die dunkelblauen Augen hinter der Brille, die leicht fliehende Stirn. Seine hochgewachsene, schlaksige Figur dagegen stammte von Margits Seite, deren Verwandte allesamt mit langen Beinen und flachen Bäuchen gesegnet waren. Während Michael mich begrüßte, legte er die Tageszeitung neben unsere Orangensaftgläser und sagte:
»Hier, die steckte im Briefkasten. Kann ich mir dein Rad ausleihen, Mama? Ich würde gern ein bisschen durch die alte Heimat touren.«
»Jetzt?«, mischte ich mich ein. »Du bist gerade erst angekommen!«
»Und zu Fuß vom Bahnhof bis hierher«, fügte Margit hinzu. »Ruh dich erst einmal aus.«
»Na, na«, lachte Michael, »ihr tut ja so, als ob ich schon so alt wäre wie…«
»Wie wir?«, beendete ich seinen Satz.
Michael schwieg. Ob aus Höflichkeit oder Betroffenheit, konnte ich nicht eindeutig erkennen.
»Setz dich und trink was«, bat ihn Margit. »Nachher kannst du natürlich das Rad haben. Aber pass in der neuen Siedlung auf. Letztens hätte ich mich dort beinahe verirrt! Diese neuen Eigenheime gleichen wie ein Ei dem anderen. Steingarten davor, Trampolin dahinter…«
»Nur der Bioladen sticht heraus«, stichelte ich, nahm die Zeitung und blätterte darin. Es war das Lokalblatt unserer Region.
»Schauspiel im Festsaal«, las ich laut. »Die Puppenspieltruppe ›Laterne‹ macht in zwei Tagen im Festsaal von Alberts Gasthof Halt und präsentiert die Sagen des Herakles. Zu sehen sind am Nachmittag eine Bearbeitung der zwölf Heldentaten als Kindervorstellung sowie abends eine düstere Bearbeitung des antiken Stoffes für Erwachsene.«
Margit wurde hellhörig.
»Klingt interessant«, meinte sie. »Ich hätte Lust auf einen Theaterbesuch, wie ist das mit euch?«
»Ich kann Puppenspiel nichts abgewinnen«, gab ich zu.
Während Margit mir die Zeitung abnahm und weiter die Neuigkeiten überflog, fragte ich meinen Enkel, wie viele Semester er eigentlich zu studieren hatte.
»Ach, Opa, das dauert noch. Ich habe ungefähr die Hälfte geschafft.«
»Die Hälfte erst… Was man euch Medizinstudenten zumutet! Die ganze Jugend verschwendet ihr an der Universität und eure Familie seht ihr auch kaum noch.«
»Man kann eine medizinische Ausbildung sicherlich nicht als Verschwendung betrachten«, warf Margit ein, ohne von der Zeitung aufzublicken.
»Außerdem kehre ich vielleicht nach dem Studium als Arzt hierher zurück, wer weiß?«, lächelte Michael gutmütig. »Wenn die Siedlung weiter so rasch wächst, werdet ihr hier einige zusätzliche Praxen brauchen.«
»Hast du dich schon für eine Fachrichtung entschieden?«, fragte Margit ihren Sohn. »Allgemeinmediziner? Chirurg?«
»Zahnarzt?«, witzelte ich, aber keiner ging auf meinen Scherz ein. »Du könntest mit Dr. Woszack sprechen, wenn du willst«, fügte ich hinzu, »sie ist die neue Ärztin hier.«
»Ich finde sie ja nicht sehr sympathisch«, entgegnete Margit. »Sie ist so reserviert.«
Dr. Woszack war in die neue Wohnsiedlung gezogen und hatte den alten Dr. Haan abgelöst. Sie war eine Frau von ungefähr Anfang vierzig. Die hiesigen Klatschbasen wunderten sich, wieso eine unverheiratete Ärztin aufs Land kam, sprachen sie aber darauf nicht an, weil sie froh waren, dass überhaupt jemand die Praxis übernommen hatte.
»Für all das ist noch Zeit, Mama«, gab Michael zurück, wandte aber seinen Blick von uns ab.
Irgendetwas schien ihn zu bedrücken. Bei seinem letzten Besuch hatte Margit ebenfalls wissen wollen, wie seine Pläne aussahen, und er hatte es absichtlich überhört. Er schien das Thema unbedingt vermeiden zu wollen. Ich überlegte, was der Grund dafür sein könnte, wurde aber aus meinen Gedanken gerissen, als Margit laut »Oh« rief.
»Die Gooths sind in der Zeitung abgebildet. Hört euch das an: Griselda Gooth, Ehefrau des hiesigen Bürgermeisters, wird morgen im Fernsehen zu bewundern sein, wo sie ein altes Erbstück ihres Vaters präsentieren wird. Es handelt sich um einen goldenen Säbel der Husarenkavallerie. ›Weitere Details werden erst in der Sendung verraten‹, äußerte die Besitzerin. Der Bürgermeister fügt hinzu: ›Wir sind sehr stolz darauf, ein so wertvolles und seltenes Erbstück in unserem Besitz zu wissen, und hoffen natürlich, dass die Bürgerinnen und Bürger morgen einschalten werden.‹ Tatsächlich, darunter stehen Sender und Uhrzeit. Wie aufregend, unsere Stadt kommt ins Fernsehen! Wusste ich’s doch!«
Sie zeigte uns das Foto neben dem Artikel. Darauf war unser amtierender Bürgermeister nebst seiner Frau zu sehen, wie sie beide vor ihrem Haus standen und lächelnd einen länglichen, goldenen Gegenstand in der Hand hielten, den wir als jenen Säbel identifizierten, den wir in Eduards Kofferraum bestaunt hatten.
»Das Foto ist etwas unscharf«, kritisierte ich, »und das Wort ›werden‹ kommt im Artikel ein bisschen zu oft vor.«
»Alexander ist noch Anfänger«, gab Margit zurück. »Mir gefällt der Artikel, er ist kurz und klar. Sei nicht immer so übergenau!«
Ich lenkte ein und sagte:
»Du hast recht. Vielleicht liegt es auch am Redakteur. Alexander gibt sich Mühe.«
Alexander Zimmermann war der neue Lokalreporter des Ortes, der mich abgelöst hatte, als meine Arbeit beim Kreisblatt beendet war. Ein einziger Journalist für unser Städtchen reichte aus, denn es war selten etwas los bei uns. Aber ich wusste, dass Alexander groß herauskommen wollte und eine Karriere bei einer »richtigen Zeitung«, wie er es nannte, anstrebte. Ich bezweifelte, dass er die Ausdauer dafür hatte, und auch sein Gespür für relevante Nachrichten schien nicht einwandfrei zu funktionieren. Einmal hatte er reißerisch über eine vermeintliche Serie von Fahrraddiebstählen berichtet; am Ende kam heraus, dass es sich nur um zwei Räder gehandelt hatte, von denen eines von einem betrunkenen Einwohner »ausgeliehen« worden war, um vom Gasthof zum eigenen Haus zu kommen, das andere hingegen dem Grundschuldirektor gehörte und anlässlich des 1. Aprils von Schülern der vierten Klasse versteckt worden war. Alexanders journalistische Integrität hatte durch diese anekdotische Begebenheit gelitten. Insgeheim war ich dankbar dafür, denn seine Artikel gestaltete er seitdem sachlicher und weniger überzogen, womit sie sich besser in den Ton einer seriösen Regionalzeitung einfügten.
Es klingelte an der Haustür. Margit und ich standen gleichzeitig auf, um hinzugehen. Meine Schwiegertochter war natürlich schneller, aber ich folgte ihr, weil die Sonne draußen langsam zu heiß wurde und unser altes Haus Abkühlung versprach.
»Na sowas, Eduard, komm rein«, begrüßte Margit den Bürgermeister. »Wir haben eben dein Foto in der Zeitung bewundert!«
»Nur ganz kurz«, erwiderte er, schüttelte mir die Hand und begann zu erklären. »Ihr habt also schon den Bericht im Kreisblatt gelesen? Jetzt wisst ihr, von welcher Überraschung ich sprach, als ich euch Griseldas Paket zeigte.«
»Ja«, seufzte ich mit gespieltem Gleichmut. »Doch keine Karriere bei Frostkost & Co. als Werbepirat.«
Eduard schmunzelte über meinen Scherz.
»Vielleicht später, wenn ich als Bürgermeister außer Amt und Würden bin«, räumte er ein und zwinkerte schelmisch, ehe er fortfuhr:
»Seht ihr, nachdem bekannt geworden ist, dass meine Frau im Nachlass ihres Vaters einen wertvollen Säbel gefunden hat und damit in einer Fernsehsendung auftrat, muss ich damit rechnen, dass alle Welt das Ding sehen will. Jeder in unserer Gegend wird die Sendung schauen und mich und meine Frau danach anrufen wollen.«
»Der Preis des Ruhmes«, philosophierte ich.
»Genau. Deshalb hatten Griselda und ich die Idee, aus dieser Sendung generell eine öffentliche Angelegenheit zu machen. Es ist das Einfachste, alle gemeinsam ins Fernsehgerät schauen zu lassen, die Lokalpresse hinzuzuziehen und so dem öffentlichen Interesse entgegenzukommen. Albert vom Gasthof wird den Fernseher für die dortigen Gäste anschalten, aber ich möchte euch für morgen Nachmittag zu mir nach Hause einladen. Wir werden eine kleine Feierlichkeit veranstalten und die wichtigsten Persönlichkeiten des Ortes dazu bitten, Doktor Woszack zum Beispiel und Frauke Friedrichson vom Heimatmuseum.«
»Und die Veranstaltung ist demnach die Überraschung, von der du damals gesprochen hast?«, fragte Margit und Eduard nickte.
»Dann gehören wir ab morgen zur gehobenen Gesellschaft, Margit«, rief ich fröhlich aus. »Endlich macht es sich bezahlt, so nah beim Bürgermeister zu wohnen!«
»Ihr seid immerhin unsere Freunde«, lächelte Gooth.
Mein Enkel, meine Schwiegertochter und ich waren natürlich nicht Teil der »wichtigsten Persönlichkeiten« des Städtchens, aber Eduards Einladung war nicht verwunderlich. Wie bereits erwähnt, pflegten wir schon lange vor seiner Karriere ein gutes, nachbarschaftliches Verhältnis.
»Wir kommen gerne«, versicherte Margit. »Was für eine Sendung ist das denn eigentlich? Der Titel in der Zeitung sagt mir nichts.«
»Weil du zu wenig fernsiehst, meine Gute«, sagte ich.
»Es handelt sich um ein Format, in dem Leute Gegenstände schätzen lassen können, die sich in ihrem Familienbesitz befinden und eventuell wertvoll sein könnten«, antwortete Gooth. »Die Aufzeichnung fand natürlich schon statt, aber die Ergebnisse dürfen wir vor der offiziellen Ausstrahlung nicht preisgeben. Griselda ist jedenfalls ganz aufgeregt. Scheucht Frau Kowalski durch alle Flure, damit alles für morgen picobello sauber ist.«
»Apropos picobello«, sagte Margit, »was ziehe ich zu einem Anlass wie diesen denn am besten an?«
»Jedenfalls kein Seeräuberkostüm«, witzelte ich.
Gleich darauf musste ich hoch und heilig schwören, dass dies mein letzter Piratenscherz gewesen war. Vorausgreifend will ich Ihnen, werte Leserschaft, versichern, dass ich meinen Eid nicht gebrochen habe.
3
Margit war anderntags ziemlich aufgeregt, denn die Vorfreude auf den Fernsehnachmittag bei Gooths machte sie regelrecht zappelig. Daher hielt ich es für ratsam, sie in die Stadt zu begleiten, wo sie zunächst die Karten für das Puppentheater kaufen und anschließend den hiesigen Frisör aufsuchen wollte.
Tickets für die Heraklesvorstellung wurden nicht im Gasthaus selbst, sondern im Rathaus verkauft, wo es ein winziges Tourismus-Schrägstrich-Reisebüro gab. Der Begriff »Rathaus« sollte dabei von Ihnen, werte Leserschaft, nur mit Vorsicht genossen werden, denn das Gebäude war ein schlichter Backsteinbau, gerade mal zwei Stockwerke hoch, aber immerhin mit Ost- und Westflügel ausgestattet. Weil die Büros der Stadtverwaltung und des Bürgermeisters die Räumlichkeiten nicht gänzlich füllen konnten, befand sich darin auch besagte Tourismus-Info. Ehe Margit die Eintrittskarten kaufen konnte, musste sie warten, bis Oliver, der heute dort Dienst hatte, mit seinem Telefongespräch fertig war.
»Ja, Frau Appelhoff, zwei Karten für die Abendvorstellung«, sprach er in die Hörmuschel (es handelte sich um ein uraltes Telefon mit Wählscheibe), und während seine Stimme freundlich und geduldig blieb, verriet uns sein Augenrollen, dass seine Gesprächspartnerin nicht so schnell abzuwimmeln war, wie er es gerne hätte. »Auf den Namen Appelhoff und Friedrichson, verstehe. Ja. Sie haben recht, man muss die Kleinkunst unterstützen, wo man nur kann. Aber selbstverständlich. Danke, Frau Appelhoff. Ja, Frau Appelhoff. Auf Wiederhören, Frau Appelhoff. Grüße an Frau Friedrichson!«
Endlich legte er auf und atmete tief durch.
»Anstrengende Dame, nicht wahr?«, grinste ich wissend. »Meine Schwiegertochter hier will mir das kaum glauben.«
»Wie das Frauke aushält, den lieben langen Tag«, wunderte sich Oliver, ließ den Gedanken jedoch zügig fallen und wandte sich an Margit. »Womit kann ich helfen?«