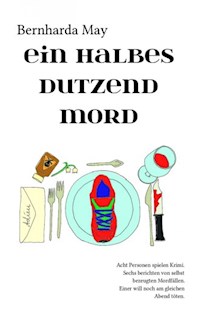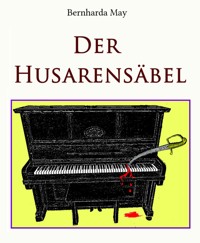Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
Wenn die eigene Patentante spurlos verschwindet, kann man nicht geduldig warten, bis die Polizei sich endlich genötigt sieht, einzugreifen. So jedenfalls denkt Florentine. Enttäuscht von Kommissar Tork, stellt sie Nachforschungen auf eigene Faust an. Zum Glück trifft sie auf den berühmten Privatdetektiv Camponelli, der ihr gern behilflich ist. Die Fährte führt schließlich zu einer exklusiven Schönheitsfarm – und zu einem Mord!
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 273
Veröffentlichungsjahr: 2020
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Liebreiz, Mord und Kaktusstiche
1. Drei verlorene Eier und eine verschwundene Patentante2. Die Polizei, kein Freund und Helfer3. Ein unverhofftes Wiedersehen4. Nur ein kleiner Lauschangriff5. Unser erster Kriegsrat6. Im Schloss der Schönheit7. Ein erhofftes Wiedersehen8. Ein Totschlagargument9. Geflüster unterm Mondenschein10. Post und Plauderei11. Wir tappen im Dunkeln12. Tony fliegt auf13. Dilemma hoch zwei14. Unser zweiter Kriegsrat15. Im Haus der Trauer16. Die Lage spitzt sich zu17. Nichts als die Wahrheit18. Schuldfragen19. Personalmangel20. Dein Retter in der Not21. NachholbedarfDanksagungImpressum1. Drei verlorene Eier und eine verschwundene Patentante
Wie freute ich mich, als ich letzten Sommer in Josés Bistro stürmte und sogleich erkannt wurde.
»Señorita Florentine«, begrüßte mich José höchstpersönlich und bot sich an, mich an meinen Platz zu führen – natürlich hatte Tante Mariebelle rechtzeitig reserviert.
Ich fühlte mich sehr geschmeichelt, dass José noch meinen Namen wusste, schließlich besuchte ich sein Bistro nur selten. Nicht, weil mir das Essen dort missfallen würde, im Gegenteil! Josés Küche weiß die einfachsten Gerichte ganz außergewöhnlich zuzubereiten. Das Bistro lag allerdings in einem von meiner Wohnung recht weit entfernten Stadtteil, wo ich mich sonst nie herumtrieb.
Nur einmal im Jahr, in jedem August, kam ich her, um mich mit meiner Patentante Mariebelle zu treffen. Diese Tradition pflegten wir seit meinem zwölften Geburtstag. Den Termin dafür hatte Tante Mariebelle von Beginn an auf den Feiertag Mariä Himmelfahrt festgelegt. Warum, weiß ich heute nicht mehr. Jedenfalls hatten wir noch nie irgendetwas dazwischenkommen lassen – bis auf letzten Sommer.
Als José mich an einen Zweiertisch brachte, wunderte ich mich, als ich beide Stühle unbesetzt vorfand. Normalerweise war ich diejenige, die jedes Mal zu spät kam. Wo war Tante Mariebelle?
»Wahrscheinlich zahlt sie mir all meine Verspätungen heim und kommt absichtlich unpünktlich«, vermutete ich. »José, Sie können schon mal zwei Gläser Prosecco bringen. Wenn meine Patentante kommt, werden wir auf unser Wiedersehen anstoßen. Wie immer.«
»Sehr wohl«, erwiderte José und verschwand an die Theke, wo er meine Bestellung an eine seiner Mitarbeiterinnen weitergab.
Ich legte mein Sommerjäckchen über die Stuhllehne, machte es mir bequem und blätterte in der Speisekarte, die bereits auf dem Tisch lag. Es gab nichts darin, was mich besonders ansprach, aber ich erinnerte mich an die Tagesempfehlung, die vor dem Bistro auf einer kleinen, schwarzen Tafel zu lesen war.
»Die drei verlorenen Eier Beaugency«, bestellte ich, als die Bedienung die zwei Proseccogläser brachte.
Ich ging immer noch davon aus, dass Tante Mariebelle bald kommen würde. Gewöhnlich aß sie einen Salat oder eine andere Kaltspeise, deren Zubereitung nur kurz dauerte. Darum hatte ich kein schlechtes Gewissen, meine Mahlzeit bereits bestellt zu haben. Als mir die Eier Beaugency serviert wurden und weit und breit immer noch keine Patentante zu sehen war, wurde ich doch langsam unruhig. Ich legte mein Handy neben den Teller, in der Erwartung, es würde gleich klingeln oder wenigstens blinken. Aber nichts in der Art geschah.
Das sah Tante Mariebelle wirklich nicht ähnlich! Im Falle einer Verspätung solchen Ausmaßes hätte sie definitiv angerufen, und dass sie unser Treffen ganz vergessen hätte, konnte ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Wer sonst hätte unseren Tisch reservieren sollen? Ich begann mir ernsthaft Sorgen zu machen und konnte weder die Eier, noch die Sauce béarnaise oder die Artischocken genießen.
»Na, wenn der Prophet nicht zum Berg kommt, muss der Berg eben zum Propheten«, zitierte ich einen Spruch meines Vaters und suchte in meinem Kontaktverzeichnis nach Tante Mariebelles Telefonnummer.
Eigentlich war das an dieser Stelle ein unpassender Spruch. Weder sah ich mich als Berg – zierlich und klein, wie ich war – noch war Tante Mariebelle in irgendeine Weise prophetisch veranlagt. Ganz im Gegenteil, all ihre Vorhersagungen hatten sich bisher mit verlässlicher Regelmäßigkeit als Irrtümer entpuppt, so gut sie auch gemeint gewesen sein mochten:
»Kindchen, mach deine Ausbildung doch in G., wie ich damals! Es wird deine schönste Zeit!«
Und ich langweilte mich dort zu Tode.
»Kindchen, lies unbedingt den neuen Roman von April Finger, der wird die Welt verändern!«
Und besagtes Buch entpuppte sich als dreistes Imitat von Lacols' Les Liaisons dangereuses.
»Kindchen, scharlachrot ist das neue Schwarz!«
Kein Kommentar. Sie merken sicherlich, was ich sagen will?
Nichtsdestotrotz mochte ich meine Patentante von Herzen, und unsere alljährlichen Treffen bedeuteten mir sehr viel. Überraschend auf eine Plauderei mit ihr verzichten zu müssen, drohte mir den restlichen Tag zu verderben. Hätte ich damals schon gewusst, dass mir nicht nur jener Augusttag, sondern der ganze Sommer verdorben werden würde, hätte ich Tante Mariebelles Proseccoglas bestimmt auf einen Zug leergetrunken, anstatt es unberührt auf dem Tisch stehen zu lassen. Aber ich greife zu weit vor.
Da saß ich also in Josés Bistro, kaute missmutig auf dem dritten pochierten Ei herum und versuchte, Tante Mariebelle anzurufen. Es tutete, aber sie nahm nicht ab. Also schrieb ich ihr eine Nachricht:
»Liebe Tante Mariebelle, dein Prosecco wird warm. Wann bist du im Bistro? Warte sehnsüchtig! LG, Flo.«
Ich schickte die Nachricht durchs Netz und die automatische Lesebestätigung zeigte mir, dass meine Worte Mariebelle erreicht hatten.
»Also muss ihr Handy Empfang haben«, dachte ich und wählte nochmal ihre Nummer.
Diesmal ertönte kein Tuten. Stattdessen wies mich eine sterile Computerstimme darauf hin, dass der gewünschte Gesprächsteilnehmer zurzeit nicht erreichbar sei. Irritiert darüber, schickte ich eine zweite Nachricht los.
»Ist dein Telefon kaputt? Ruf mich mal schnell an, falls nicht! Flo.«
Wieder schickte ich die Nachricht ab, doch keine Lesebestätigung erfolgte. Wie konnte das sein? Vor einer Minute war ihr Handy erreichbar gewesen, nun plötzlich nicht mehr. Das hieß, dass zwischenzeitlich etwas passiert sein musste!
»Sie wird doch nicht in ihrer Wohnung gestürzt sein«, murmelte ich.
Vor meinem inneren Auge entstanden Bilder von Tante Mariebelle, auf denen sie halb bewusstlos am unteren Ende einer steilen Treppe lag und vergeblich versuchte, nach dem Handy zu greifen – welches ihr dann zu allem Unglück aus den Fingern glitt, um in einen Gully zu fallen, wo es dann in seine Einzelteile zersprang.
»Man muss sofort nach dem Rechten sehen«, sprach ich fest, obwohl mir keiner zuhörte.
Ich wartete nicht erst auf die Bedienung, sondern ging direkt an die Theke und zahlte. Dann lief ich hinaus zur Straßenbahnhaltestelle um die Ecke und sprang, ohne an den Kauf eines Tickets zu denken, in die nächstbeste Linie, die auch nur halbwegs in Richtung Südviertel fuhr.
Ein bisschen beneidete ich meine Patentante ja schon um ihre Wohnung im ruhigen Süden der Stadt. Die Lage war vor allem für ältere Leute günstig: Es gab Straßenbahnanschluss, das Klinikum war nicht weit, ein Park lag in direkter Nähe. Tante Mariebelle hatte enormes Glück gehabt, dort eine Eigentumswohnung zu ergattern. Sie war alleinstehend und besaß demzufolge nur ein Einkommen. Zu wirtschaftlich unsicheren Zeiten hatte sie den richtigen Augenblick abgewartet und dann erfolgreich zugegriffen. Nun konnte sie drei Zimmer, eine Küche, ein Bad mit Wanne und einen Balkon ihr Eigen nennen. Von alldem wagte ich, Mieterin einer winzigen Einraumwohnung, nur zu träumen. Andererseits wäre es mir im Südviertel auf Dauer zu langweilig geworden, schließlich war die Innenstadt mit all ihren Szenekneipen meilenweit weg.
Ich sah an dem mehrgeschossigen Haus hinauf zu den Fenstern ihrer Wohnung. Die Rollläden waren halb heruntergelassen und die Gardinen zugezogen. Entweder hielt meine Patentante einen außergewöhnlich langen Mittagsschlaf oder sie war gar nicht zu Hause. Eine Nachfrage beim Nachbarn sollte Licht ins Dunkel bringen. Herr Ullmann, der ihr gegenüber wohnte, stand gerade auf seinem Balkon und schien mir gesprächsbereit.
»Huhu, Herr Ullmann«, winkte ich ihm zu. »Kennen Sie mich noch?«
»Ach, das ist ja die kleine Floriane, nicht wahr?«
»Florentine«, verbesserte ich. »Wissen Sie zufällig, ob meine Tante ausgegangen ist? Ich kann sie nicht erreichen.«
»Natürlich, Florentine«, bestätigte der alte Mann.
Er musste weit über 80 sein und war ein dünner, kahlköpfiger Greis. Von meiner Patentante wusste ich, dass er dreifacher Witwer war. Er rauchte wie ein Schlot und hatte auch jetzt eine Zigarette im Mund.
»Ich kannte mal eine Florentine«, erzählte er. »Sie war Dichterin in Wittgenstein. Ist lange her, lange her. Kennen Sie Wittgenstein?«
»Nein«, antwortete ich brav und versteckte meine Ungeduld.
»Schöne Gegend, schöne Gegend. Eine Floriane kannte ich auch mal. Schauspielerin bei einer Wanderbühne. Bildhübsches Ding.«
Er gab merkwürdige Laute von sich, die ich als eine Art sentimentales Kichern deutete – sollte es so etwas überhaupt geben.
»Herr Ullmann, was meine Tante angeht, Ihre Nachbarin?«, versuchte ich ihn zu erinnern.
»Wissen die jungen Leute heute eigentlich noch, was eine Wanderbühne ist? Gibt es das noch? Was war das aufregend für uns Kinder, wenn die Schauspieler ins Dorf kamen. Uns war es ja egal, welches Stück sie aufführten, Hauptsache es gab Abwechslung, nicht wahr?«
Gleich erzählt er mir noch, wie er als kleiner Junge mal heimlich mit der Wanderbühne aus seinem Dorf abhauen wollte, brummte ich innerlich. Aber ich biss die Zähne zusammen und wartete höflich, bis Herr Ullmann zum eigentlichen Gesprächsthema zurückfinden würde.
»Ihre Tante, die Frau Puttensen, ist vor zwei Wochen in den Urlaub gefahren«, sagte er endlich. »Ich gieße die Blumen, bis sie wiederkommt. Dachte eigentlich, dass sie vorgestern schon hätte eintreffen müssen, aber es kann sein, dass ich mit meinem Kalender durcheinander gekommen bin.«
»Im Urlaub?«, wiederholte ich. »Wissen Sie, wohin?«
»Ja, Frau Puttensen hat's mir gesagt. Mein Kalender, wissen Sie, der besteht ja nur aus losen Blättern. Die hab ich vielleicht falsch geordnet. Ich schau mir das am besten nochmal an, wenn ich aufgeraucht habe.«
Und er nahm einen langen Zug, unwissentlich meine Geduld strapazierend. Ich konnte es nicht haben, wenn man auf eindeutige Fragen nicht klar antwortete, sondern irgendeine langweilige Geschichte aus dem Leben erzählte.
»Wissen Sie, wohin?«, fragte ich auf gut Glück noch einmal.
»In den Urlaub ist sie gefahren«, antwortete Herr Ullmann und glaubte wohl, mir damit eine wertvolle Auskunft gegeben zu haben.
Da ich fürchtete, gleich würde meine Halsschlagader platzen, wandte ich mich ab. Den Anblick wollte ich dem alten Greis ersparen.
»Wahrscheinlich hat er auf diese Weise seine drei Frauen umgebracht«, knurrte ich leise, »nacheinander alle drei in den Wahnsinn getrieben.«
Ich rang mich zu einem kühlen »Danke, auf Wiedersehen« durch und ging. Meine Halsschlagader beruhigte sich und die Wut auf Ullmanns zeitraubendes Geschwätz machte der Sorge um meine Patentante Platz. Sie war also seit vierzehn Tagen in einem Urlaub, von dem ich gar nichts wusste, und hätte laut ihrem Nachbarn längst zurück sein müssen. Sie war nicht zu unserem traditionellen Treffen in Josés Bistro gekommen, obwohl sie persönlich den Tisch vorbestellt hatte. Und ihr eigentlich funktionstüchtiges Handy war plötzlich nicht mehr erreichbar. Angesichts dieser drei Punkte war mir klar: Tante Mariebelle war mehr zugestoßen als ein kleiner Unfall im Treppenhaus. Hier mussten Profis ran!
2. Die Polizei, kein Freund und Helfer
Da saß ich nun, keine halbe Stunde später, im Hauptgebäude der Polizeidirektion. In der Nähe von Tante Mariebelles Wohnung wäre zwar auch eine Wache gewesen, aber ich hielt mein Anliegen dafür zu wichtig, zu dringlich. Es sollte an der höchstmöglichen Stelle bearbeitet werden.
Gleich nach der Anmeldung, im großen Warteraum, wurde ich mehr oder weniger unfreundlich abgekanzelt, als ich mich nach dem Prozedere einer Vermisstenanzeige erkundigen wollte.
»Um wen handelt es sich denn bei dem Gesuchten?«, fragte der Wachtmeister am Schalter.
»Meine Patentante, Mariebelle Puttensen, ist unauffindbar. Allerdings bin ich keine direkte Angehörige. Ist das ein Problem?«
Der Wachtmeister schüttelte den Kopf.
»Sie hat nämlich keine direkten Angehörigen. Deshalb mache ich mir ja Sorgen.«
Ich schilderte ihm kurz die geplatzte Verabredung im Bistro und was später Herr Ullmann, ihr Nachbar, über ihr überfälliges Urlaubsende angedeutet hatte. Dass der Wachtmeister keines meiner Worte notierte und mir auch kein Papier zum Ausfüllen reichte, wunderte mich. Wollte der sich all diese Informationen merken? Ich sprach ihn darauf an.
»Das alles mag auf Sie nicht überzeugend wirken, trotzdem wäre ich Ihnen dankbar, wenn Sie mein Gesuch bearbeiten würden, statt nur dazustehen und zuzuhören. Oder müssen Sie 24 Stunden warten, ehe eine Person als vermisst gilt?«
»Die 24-Stunden-Regel gibt es bei uns nicht«, antwortete der Wachtmeister ungerührt. »Viele Leute denken das, weil sie es im Fernsehen so gehört haben. Ist aber Quatsch.«
»Na, dann tun Sie doch was!«
Ich spürte, wie meine Halsschlagader wieder anschwoll. Vor diesem Typen würde ich mich allerdings nicht wegdrehen, falls sie platzte! Wieso musste ich ausgerechnet an das lethargischste Exemplar eines Polizisten geraden, das jemals in diesem Revier tätig war?
»Sie verstehen nicht, Frau…?«
»Endesfelder.«
»Frau Endesfelder.«
Er wiederholte meinen Namen in einem Ton, als ob er zu einer Grundschülerin spräche, und faltete die Hände.
»Wir können eine Vermisstenanzeige nur entgegennehmen, wenn Gefahr für Leib und Leben besteht. Ist das denn bei Ihrer Patentante der Fall, Frau Endesfelder?«
»Das weiß ich doch nicht!«
Beinahe hätte ich hinzugefügt, welch blöde Frage das sei. Aber ich riss mich zusammen und sagte nur:
»Deshalb bin ich ja hier, damit Sie das herausfinden.«
Der Wachtmeister hob abwehrend die Hände.
»Sie verstehen mich nicht, Frau Endesfelder. Leidet Ihre Patentante an Demenz? Ist sie Diabetikerin und hat ihre Medikamente vergessen? Verfolgt sie möglicherweise eine Selbsttötungsabsicht?«
Ich schüttelte den Kopf. Nichts davon traf zu.
»Dann besteht auch keine Gefahr für Leib und Leben«, sagte der Wachtmeister, »und die Polizei darf nicht eingreifen. Erwachsenen Menschen, Frau Endesfelder, ist es nämlich durchaus erlaubt, ihren Aufenthaltsort ohne Nachricht an Freunde und Angehörige frei zu wählen. Vielleicht will Ihre Patentante zurzeit einfach in Ruhe gelassen werden?«
Er lächelte mich mitleidig an, als ob ich jetzt gefälligst erkennen sollte, wie dumm mein Anliegen wäre. Aber ich war noch nicht bereit, diesen Kampf mit der Behörde aufzugeben.
»Herr Wachtmeister«, sprach ich, »würde meine Tante in Ruhe gelassen werden wollen, hätte sie dann extra im Bistro einen Tisch für sie und mich reserviert? Bestimmt nicht. Es ist mit Sicherheit etwas passiert.«
Der Polizist runzelte für einen Augenblick die Stirn. Offenbar erkannte er die Stichhaltigkeit meines Arguments. Ein bisschen versöhnlicher fuhr ich fort:
»Ich wäre Ihnen ja schon sehr dankbar, wenn Sie mit Ihren polizeilichen Möglichkeiten mal kurz in Ihrem Computer nach ihr suchen würden. Sie kriegen da doch bestimmt heraus, ob es kürzlich einen Unfall gab, in den sie verwickelt war, oder ob sie in irgendein Krankenhaus aufgenommen wurde oder dergleichen.«
Ich setzte einen mädchenhaften Bettelblick auf. Ich fand, da er mit mir ohnehin wie mit einem Kind sprach, durfte ich diesen Trick anwenden. Und er wirkte!
»Na gut, Ihnen zuliebe«, sagte er und wandte sich an seinen PC. »Wie lautete der vollständige Name gleich noch?«
»Florentine Endesfelder.«
»Nicht Ihrer! Der von Ihrer Patentante.«
»Ach so, entschuldigen Sie. Mariebelle Puttensen.«
Ich buchstabierte, während er tippte, damit sich kein Fehler einschlich. Leider war der Bildschirm nur ihm zugedreht, sodass ich keinen Einblick auf das gewinnen konnte, was vor den Augen des Wachmeisters aufflimmerte. Er blieb auffallend still und begann, sein Kinn zu reiben. Kein gutes Zeichen, fürchtete ich, und meine Sorge wuchs erneut.
»Was ist los?«, fragte ich.
Statt mir direkt zu antworten, griff der Wachtmeister zum Telefon, wählte eine Nummer und sprach:
»Hallo Sieglinde? Hier ist Wolfgang… Ja, hallo… Geht so… Warum ich anrufe: Ist jemand vom Kommissariat zu sprechen? Tork oder Unger?«
Durch die Sprechmuschel konnte man eine laute Frauenstimme hören, die unentwegt zu schnattern schien.
»…Ah, gut. Würdest du mich durchstellen? Danke dir, Sieglinde…«
Es gab eine kleine Pause, in der er mich unverbindlich anlächelte. Dann redete er weiter in den Telefonhörer hinein. Diesmal konnte man den Sprecher am anderen Ende der Leitung nicht hören.
»Herr Kriminalhauptkommissar, ich habe hier eine junge Dame, die eine Vermisstenanzeige aufgeben will. Ich weiß, das gehört nicht in Ihren Zuständigkeitsbereich, aber… Genau, es gibt da eine Kleinigkeit… Mariebelle Puttensen. Vor mir sitzt ihr Patenkind. Ich würde Ihnen die Dame mal kurz raufschicken, ja? Und ich sende Ihnen gleich per Mail einen Screenshot… Danke, das ist sehr freundlich von Ihnen. Entschuldigen Sie bitte im Voraus, wenn sich das als Trugschluss meinerseits entpuppt… Danke, vielen Dank!«
Er legte auf.
»Kriminalhauptkommissar Tork möchte mit Ihnen sprechen.«
Er nannte mir die Zimmernummer seines Büros.
»Sie müssen in den Ostflügel, dann ins zweite Geschoss. Das Kommissariat 1 ist ausgeschildert. Falls jemand fragt, sagen Sie, zu wem Sie wollen und dass Wolfgang von der Anzeigenerstattung sie geschickt hat.«
Er reichte mir einen kleinen Notizzettel mit den wichtigsten Eckdaten, damit ich mich auf dem Weg durch das riesige Gebäude nicht verlaufen würde. Erschrocken darüber, plötzlich zu einem Kommissar von der Kripo geschickt zu werden, schlich ich durch die Gänge. Zwar hielt ich mein Haupt hoch, den Blicken der Beamten wich ich jedoch aus. Im Kommissariat 1 wurde ich von einer molligen Frau in schrillen Farben begrüßt, die wohl die Sekretärin war.
»Sie sind die Dame, die zu Kriminalhauptkommissar Tork will, stimmt's? Ich bringe Sie in sein Büro.«
Von wollen kann nicht die Rede sein, dachte ich im Stillen. Aber was blieb mir übrig?
Als ich schließlich Kommissar Tork gegenüber saß, beruhigte ich mich ein wenig. Er schaute mich freundlich an, die Arme auf seinen Schreibtisch gestützt. Neben seinem rechten Ellenbogen stand ein Flachbildschirm, der offensichtlich eingeschaltet war. Allerdings stand auch er mit der Rückseite zu mir, sodass mir ein Blick aufs Display erneut verwehrt blieb.
»Sie sind also auf der Suche nach Mariebelle Puttensen«, stellte er fest.
»Muss ich mit dem Ärgsten rechnen?«, fragte ich kleinlaut. »Ist sie etwa irgendwo tot aufgefunden worden?«
Tork lächelte und schüttelte mit dem Kopf.
»Uns liegen keine Auskünfte vor, die solch schreckliche Vermutung nahe legen«, sagte er.
Ich atmete erleichtert auf. Eine Pause entstand. Tork schien nach Worten zu suchen und fuhr erst nach einer Weile fort:
»Um genau zu sein, liegt uns überhaupt nichts vor, das Ihnen bei der Suche nach ihrer Patin helfen könnte. Freilich bedauern wir das sehr. Aber vielleicht können Sie uns noch ein paar weitere Angaben zu Frau Puttensen machen?«
»Was für Angaben?«
»Nun, was sie nach ihrem Urlaub vorhatte, zum Beispiel.«
»Ich wusste ja nicht einmal, dass sie verreist ist!«
»Oh«, machte Tork.
Er hatte wohl nicht mit dieser Aussage gerechnet.
»Dementsprechend kann ich Ihnen auch nicht sagen, was Tante Mariebelles Pläne für nach ihrem Urlaub waren«, fügte ich hinzu, vor Aufregung in schlechte Grammatik verfallend.
»Vielleicht wollte sie Freunde aufsuchen? War sie Mitglied in einem Reiseclub? Oder ging sie einer Vereinstätigkeit nach?«
Verdutzt fragte ich, was diese Nachforschungen zu bedeuten hätten. Sie schienen nichts mit Tante Mariebelles Verschwinden zu tun zu haben. Tork schielte kurz auf den Flachbildschirm, dann sah er wieder mich an.
»Es wäre ja möglich«, lenkte er ein, »dass Ihre Patin dringende Termine hatte, von denen Sie etwas wussten.«
»Hören Sie«, erwiderte ich und meine Ungeduld meldete sich zurück, »ich bin zur Polizei gekommen, um Antworten zu finden. Stattdessen fragt man mich hier Dinge, die ich gar nicht wissen kann – und würde ich sie wissen, bräuchte ich nicht erst zur Polizei gehen, sondern könnte selber nach Tante Mariebelle suchen. Verzeihen Sie, Herr Kriminalhauptkommissar, aber dieses Gespräch erscheint mir witzlos. Weshalb bin ich denn extra hierhergeschickt worden?«
Tork ließ sich von meiner Aufregung nicht anstecken, sondern antwortete gleichbleibend freundlich:
»Der Beamte, mit dem Sie unten sprachen, hat es nur gut gemeint. Er glaubte, über etwas gestolpert zu sein, was für die Kripo von Bedeutung sein könnte, aber dem ist nicht so. Sehen Sie es ihm bitte nach, Frau Endesfelder. Wir Polizisten führen eine Überprüfung lieber einmal zu viel als zu wenig durch.«
Anders als Wolfgang von der Anzeigenerstattung war Torks Ton nicht gönnerhaft. Er sprach ernsthaft und ich fühlte mich respektiert. Das beruhigte mich und ich erinnerte mich daran, dass vorhin von einem Screenshot die Rede gewesen war. Hatte der Wachtmeister auf der Suche nach Tante Mariebelles Namen etwas in den Polizeidaten entdeckt, das ihm verdächtig vorkam? Was könnte das gewesen sein? Ich sprach Tork darauf an, doch der schüttelte bedauernd den Kopf.
»Da war nichts von Belang, Frau Endesfelder.«
Na, das glaubte ich ihm nicht! In dem Fall würde ich ja nicht im Kommissariat sitzen.
Schneller, als Tork es erfassen konnte, sprang ich auf, beugte mich über seinen Schreibtisch und erhaschte einen Blick auf seinen Computerbildschirm. Was ich sah, ließ meinen Atem stocken.
»Ich glaube es nicht!«, rief ich aus.
»Frau Endesfelder, dieser Anblick war nicht für Sie bestimmt«, sagte Tork. »Setzen Sie sich bitte wieder hin!«
»Das ist mir klar, dass ich sowas nicht sehen soll!«, gab ich zurück. »Aber genauso wenig sollten Sie… In Ihrer Dienstzeit… Und überhaupt!«
Mir fehlten die Worte – beinahe.
»Ich werde Ihre Vorgesetzten von dieser Ungeheuerlichkeit unterrichten«, drohte ich. »Wer ist das in Ihrem Fall, na?«
»Das wäre Kriminaldirektor Hummel«, erwiderte Tork und sein Ton war plötzlich hart, »aber der…«
Doch ich hörte ihm nicht weiter zu, denn ich war viel zu empört, um mich auf weitere Diskussionen einzulassen. Von wegen, ich würde respektiert! Mit einem ebenso harten Ton wie dem seinen wünschte ich ihm einen guten Tag, stürmte aus seinem Büro und verließ augenblicklich die Polizeidirektion.
3. Ein unverhofftes Wiedersehen
Okay, eines muss ich zugeben: Ich habe die Polizeidirektion mitnichten »augenblicklich« verlassen. Das war nämlich gar nicht möglich, man musste ja zunächst all die Gänge vom Kommissariat 1 bis hin zum großen Warteraum bewältigen, und weil die alle gleich aussahen, benötigte ich eine Weile, bis ich mich zurechtfand. Den Kriminaldirektor Hummel aufzusuchen, gab ich während dieser Odyssee auf.
Als ich endlich draußen war, brauchte ich eine Minute, um zu verschnaufen. Die ganze Zeit über habe ich wohl unbewusst mit dem Kopf geschüttelt und vor mich hin geschimpft, denn auf einmal rief mir jemand zu:
»Flo Endesfelder! Wie immer in Selbstgespräche vertieft! Über wen motzt sie wohl heute?«
Ich sah auf und ein blonder Lockenkopf mit viel zu vielen Sommersprossen im Gesicht stand vor mir. Sein Grinsen war so breit, dass sich seine Augen zu engen Schlitzen verkleinert hatten. Wäre nicht ihr Funkeln gewesen, das durch die Wimpern glänzte, hätte man sie ohne Weiteres für verschlossen gehalten.
»Tony!«, rief ich überrascht aus.
Er war der letzte Mensch, mit dem ich vor dem Polizeigebäude gerechnet hätte.
»Was machst du denn hier?«
»Ich habe mein Fahrrad abgeholt«, erwiderte Tony und zeigte nicht ohne Stolz auf einen klapprigen Drahtesel, den er mit sich führte. »Es war mir vor einigen Wochen geklaut worden und ich hab auf dem Revier Anzeige gegen unbekannt erstattet. Viel Hoffnung hatte ich mir nicht gemacht, aber die Polizei hat mein Rad tatsächlich wiedergefunden. Der Dieb ist natürlich nicht zu ermitteln. Und du, was grummelst du hier vor dem Eingang vor dich hin?«
»Ich wollte ebenfalls eine Anzeige erstatten«, sagte ich missmutig.
»Ist dein Fahrrad auch weg? Diese dreisten Banditen!«
»Nein, ich besitze gar keines. Ich wollte eine Vermisstenanzeige aufgeben.«
»Scheint ja nicht geklappt zu haben«, bemerkte Tony. »Du schmollst wie damals, als du aus der mündlichen Prüfung rauskamst.«
Er lachte.
»Du hast mit einem ›sehr gut‹ gerechnet, aber nur ein ›gut‹ bekommen und konntest dich nicht freuen.«
»Anders als du, der schon froh war, überhaupt bestanden zu haben«, erinnerte ich mich.
Dieser Moment nach der mündlichen Prüfung, kurz vor unserem gemeinsamen Schulabschluss, war das letzte Mal gewesen, dass Tony und ich einander gesehen hatten. Für Jahre hatten wir die gleiche Klasse besucht und uns schon damals gut verstanden. Um den Kontakt über die Schulzeit hinaus aufrecht zu erhalten, waren wir jedoch nicht eng genug befreundet gewesen. Umso mehr erstaunte es mich, dass er mich so schnell wiedererkannt hatte.
»Leider ist mein Grund zum Schmollen heute ein ernsterer als damals«, sagte ich.
Tony hörte zu lachen auf und stimmte mir zu.
»Nicht zu wissen, wo ein geliebter Mensch steckt, ist bitter«, gab er zu. »Komm, lass uns spazieren gehen. Dann kannst du dir alles von der Seele reden.«
Dankbar nahm ich sein Angebot an. Weiterhin vor einer Polizeidirektion Selbstgespräche zu führen, schien mir nämlich keine gute Idee zu sein.
Wir schlenderten durch die Stadt und ich erklärte Tony in kurzen Stichpunkten, was mich zur Polizei geführt hatte.
»Das Aufgeben der Vermisstenanzeige hatte ich mir allerdings ganz anders vorgestellt«, schloss ich mürrisch meinen Bericht.
»Ja, jetzt kann ich verstehen, warum du sauer bist«, sagte Tony. »Da wird man sogar ins Kommissariat geschickt und am Ende war es pure Zeitverschwendung.«
»Du sagst es! Und rate mal, worauf dieser blöde Tork die ganze Zeit geschielt hat, während er mit mir sprach!«
Tony war entsetzt.
»Doch nicht etwa auf deine…?«
»Nein, viel schlimmer«, unterbrach ich ihn. »Auf seinen verflixten Computerbildschirm.«
»Vielleicht gab's dort Wichtiges zu lesen?«, meinte Tony. »Polizeiliche Infos, die er für euer Gespräch brauchte?«
»Von wegen! Ich hab ja auch draufgeguckt. Er hatte eine Internetseite geöffnet, einen Online-Spielwarenhandel. Nach ferngesteuerten Spielzeugautos hat er gesucht, statt nach meiner Tante! Das muss man sich mal vorstellen!«
Ich war wieder auf hundertachtzig. Zum Glück liefen wir durch einen Park, wo der Schatten der Bäume uns vor der Sommersonne schützte. Wer weiß, was meine hitzige Wut in Verbindung mit den hitzigen Strahlen sonst mit mir angerichtet hätte.
»Komm, lass uns ein Eis essen«, schlug er vor. »Dahinten ist ein Café.«
Wir setzten uns an einen Tisch im Außenbereich. Tony bestellte sich einen Eisbecher mit heißen Himbeeren, ich nahm mit einem Bananenmilchshake vorlieb. Das kalte Getränk dämpfte meine Erregung.
»Du hättest den Polizisten genauer schildern müssen, was es mit dem Handy deiner Tante auf sich hatte«, kam Tony schließlich auf unser Gesprächsthema zurück. »So exakt, wie du es mir eben erzählt hast – wie sie von einem Moment auf den anderen nicht mehr erreichbar war. Dann hätten sie für deine Sorge sicherlich mehr Verständnis gehabt.«
»Stimmt«, gestand ich ein, »für eine ausführliche Darstellung fehlte mir vorhin die Geduld. Aber die reagierten ja auf mein Argument hinsichtlich der Reservierung schon sehr verhalten.«
»Na ja, als Argument würde ich diesen Punkt nicht unbedingt bezeichnen«, entgegnete Tony. »Deine Tante hat euch vielleicht schon vor Wochen oder Monaten im Bistro angemeldet und im Nachhinein die Verabredung vergessen. Kann jedem passieren. Nicht nur älteren Herrschaften.«
Ich sagte dazu nichts und nippte an meinem Milchshake.
»Immerhin sind die Nachfragen von deinem Kommissar Tork sehr schlüssig gewesen«, meinte Tony. »Wenn du wüsstest, wo deine Patentante ihren Urlaub verbringen wollte oder was ihre Pläne für die kommenden Tage gewesen waren, könntest du ohne Weiteres auf die Suche nach ihr gehen.«
»Der Knackpunkt ist, dass ich das alles eben nicht weiß«, erwiderte ich und wollte zu mehr ansetzen, als mein Blick plötzlich auf die Eiskarte fiel. Ich stockte. »Café am Eck« stand da. Ich sah mich um und musste anfangen zu kichern.
»Was ist los?«, fragte Tony verunsichert.
Er fürchtete wohl, ich hätte einen hysterischen Anfall erlitten.
»Ich kriege jetzt erst mit, wo wir eigentlich sind, und muss über mich selber lachen«, beruhigte ich ihn. »Ganz unbewusst habe ich unseren Spaziergang zurück in die Südstadt gelenkt. Wir sind ganz in der Nähe von Tante Mariebelles Wohnung. Siehst du dort die beiden Eiben? Da geht es zur Querstraße, wo sie lebt. Wir haben sogar ab und zu dieses Café hier besucht.«
Ich schaute mich um und erkannte jetzt erst all die kleinen Details.
»Die Stühle mit weißem Holzrahmen und rotem Leder, die hellblauen Sonnenschirme mit den Fransen«, zählte ich auf, »das sieht alles schon seit Jahrzehnten so aus. Nur die Eiskarte hat ein neues Design.«
Ich wurde nachdenklich und trank weiter meinen Milchshake. Eine freche Wespe hatte sich an den Tisch gesellt und bestand hartnäckig auf ihren Anteil, egal wie sehr ich sie auch wegzuscheuchen versuchte. Tony kratzte genüsslich mit dem Löffel seinen Eisbecher leer; ihn belästigte die Wespe nicht.
»Wenn wir schon hier sind«, sagte ich, nachdem ich mein Glas zügig ausgeschlürft hatte, »können wir die Zeit sinnvoll nutzen und noch einmal genauer bei Herrn Ullmann fragen, was mit meiner Tante los ist.«
»Klaro, warum nicht?«, lautete Tonys Replik.
Keiner von uns beiden wunderte sich zu jenem Zeitpunkt auch nur ein Stückchen darüber, dass ich ihn seit unserem Wiedersehen automatisch in meine Suche nach Tante Mariebelle einbezog. Dies wiederum wundert mich heute, während ich rückblickend diese Zeilen schreibe, umso mehr.
Wie dem auch sei, wir zahlten zügig unsere Rechnung und fünf Minuten später standen wir vor Ullmanns Balkon. Leider machte er gerade eine Pause vom Rauchen und war nicht zu sehen.
»Dann klingeln wir eben«, entschied ich.
Der alte Mann ließ uns ins Haus, ohne über die Türsprechanlage überhaupt nach unseren Namen zu fragen. Als er uns auf dem Hausflur begrüßte, erkannte er mich gleich wieder und wusste diesmal meinen Namen.
»Die kleine Florentine! Hätte ich nicht gedacht, dass Sie heute noch ein zweites Mal herkommen. Was vergessen?«
»Sie hatten doch vorhin von einer Schriftstellerin gesprochen«, erinnerte ich ihn, »und mir ist eingefallen, dass bei Tante Mariebelle ein Buch von ihr liegen müsste.«
»Tatsächlich?«
»Ja, und ich würde es mir unheimlich gern ausleihen«, log ich weiter. »Haben Sie Blumendienst bei ihr? Dann müssen Sie doch auch den Schlüssel haben.«
»Den habe ich, ja«, sagte der Greis langsam und beäugte Tony argwöhnisch.
»Das ist ein guter Freund von mir«, erklärte ich. »Der tut nix.«
Ullmann blieb skeptisch, erklärte sich aber damit einverstanden, mich in Tante Mariebelles Wohnung zu lassen. Tony und ich mussten allerdings damit leben, dass er uns begleitete. Während ich so tat, als würde ich im Wohnzimmer nach dem Buch suchen, kam Ullmann mit Tony ins Gespräch. Er erzählte ihm von jener Schriftstellerin, über die er mit mir bereits gesprochen hatte, und weitete seine Geschichte auf seine Kindheit und Jugend in Wittgenstein aus. Tony hörte höflich zu, munterte den alten Mann mit einigen Sosos und Achjas sogar zum Weiterreden auf und konnte zu meinem großen Erstaunen selbst etwas zum Thema beisteuern.
»Der Name Wittgenstein findet sich ja mehrmals auf der deutschen Landkarte«, sagte er. »An der Lahn gibt es ein Schloss dieses Namens und in Thüringen soll es auch mal eine Burg Wittgenstein gegeben haben.«
»Oh ja«, stimmte Ullmann zu und zählte auf, wo überall dem Reisenden diese Bezeichnung begegnen könne.
Vor lauter Bewunderung für Tonys Geduld mit dem schwatzhaften Greis vergaß ich beinahe, nach Hinweisen für Tante Mariebelles Verbleib zu suchen. Auf einem Haushaltskalender an der Wand waren die letzten zwei Wochen eingekreist. »Niederfichtel« stand dort in der Handschrift meiner Patentante. Für heute hatte sie dort »Josés Bistro mit Flo« eingetragen. Ein Beweis dafür, dass sie mich nicht vergessen hatte! Die folgenden drei Tage waren leer, aber in der kommenden Woche wollte sie anscheinend nochmals verreisen. »Wandern mit Gitta und Fred«, stand da.
Ich kannte weder eine Gitta noch einen Fred, wusste aber, dass Tante Mariebelle einen kleinen Freundeskreis besaß, der regelmäßig Wandertouren unternahm. Dummerweise fand sich auf dem Kalender kein Hinweis darauf, wo sie diesmal auf Schusters Rappen unterwegs sein wollten.
»Nächste Woche fährt Tante Mariebelle wandern«, unterbrach ich das Gespräch der Männer, in der Hoffnung, Ullmann würde darauf reagieren.
Er tat es wirklich.
»Ja, sie erzählte mir davon. Der Hohe Meißner sollte es werden. Eigentlich wollte sie ja zwischendurch zurückkommen, damit ich dann ihre Pflanzen nicht mehr pflegen muss. Beim Hohen Meißner befindet sich übrigens der Frau-Holle-Teich, wussten Sie das?«
Ich ignorierte seine Frage und sah mich um. Die Zamioculcas auf dem Fensterbrett sah frisch aus, ebenso der Drachenbaum neben der Wohnzimmertür.
»Sie leisten gute Arbeit beim Gießen, Herr Ullmann«, lobte ich. »Aber wo ist Knut?«
»Den hat sie mitgenommen«, erwiderte der Nachbar.
»Wer ist Knut?«, wollte Tony wissen. »Ein Haustier?«
»Nein, ein Kaktus. Den habe ich Tante Mariebelle geschenkt, als er noch ganz klein war, und unter ihrer Pflege ist er groß und dick geworden. Als ich ihn das letzte Mal sah, war er mit einem Unterarm vergleichbar.«
»Knut, der Kaktus«, murmelte Tony. »Sehr einfallsreich.«
»Wahrscheinlich hat sie ihn mitgenommen, damit Ullmann ihn nicht überwässert«, erklärte ich ihm im Flüsterton, damit es der alte Greis nicht höre.
Der begann unvermittelt zu husten und sagte:
»Ich muss mich für einen Augenblick zurückziehen. Bin gleich wieder da.«
Er verschwand aus der Wohnung.
»Braucht wohl die nächste Zigarette«, vermutete Tony und rümpfte die Nase. »Er stank ja wie ein überfüllter Aschenbecher.«
Ich entsann mich, dass Tony während unserer Schulzeit selbst ein Raucher gewesen war. Offensichtlich hatte er damit aufgehört und war nun, wie viele ehemalige Tabakgenießer, zu diesem Thema besonders kritisch eingestellt. Ich hingegen war froh, dass Ullmann die Nikotinsucht forttrieb, sonst hätte er womöglich noch mehr seiner alten Geschichten ausgegraben.
»Ich gebe zu, ich bin verblüfft über deine Gesprächskultur bei alten Leuten«, lobte ich Tony.
»Ach, da ist nichts dabei. Habe mal ein Praktikum in einem Seniorenheim gemacht. Dort lernt man das.«
Wir nutzten die Gelegenheit, unbeobachtet die Sachen meiner Tante zu durchwühlen. Ich schaute im Schlafzimmer nach, welche Art von Kleidung vorhanden war und welche fehlte. Tony inspizierte derweil die Mülleimer in der Küche und fand schließlich einen Hinweis im Altpapier, der uns weiterhelfen konnte.
»Zwei Papierumschläge der Bahngesellschaft«, sagte er. »In solchen Umschlägen verschicken sie Zugtickets, das weiß ich.«
»Also ist Tante Mariebelle mit dem Zug nach Niederfichtel gefahren«, erriet ich. »Was sie da wohl wollte?«
Ich eiferte Tony nach und kramte ebenfalls im Altpapier, während Tony sein Handy hervorholte, sein Internet aktivierte und den Ortsnamen in eine Suchmaschine eintippte.
»Sieh an«, sagte er. »es handelt sich bei Niederfichtel um einen ganz kleinen Ort am Rande des Gebirges. Gilt als Kurort, weshalb er einen eigenen Bahnhof bekommen hat. Wenig Einwohner, kaum Sehenswürdigkeiten, aber immerhin ein Schloss. Nennt sich Liebreiz.«
Ich konnte mir die Bemerkung nicht verkneifen, dass »Schloss Liebreiz« ein alberner Name war.
»Es heißt erst seit Kurzem so«, las Tony weiter vor. »Seitdem es umgewandelt wurde in ein… oha!«
Er blickte auf.
»Flo, auf einer Skala von eins bis zehn, wie hoch würdest du die Attraktivität deiner Patentante einschätzen?«
»Was soll die dumme Frage?«
Tony hielt mir sein Handy-Display vor die Nase. Schloss Liebreiz war, wie es schien, nichts anderes als eine Schönheitsfarm.
»Mit Moorbädern, Diäten, Massagen, Gurkenmasken und allem«, grinste er.
Ich überlegte. Tante Mariebelle war für ihr Alter nicht hässlich, aber ein bisschen fülliger als der Durchschnitt. Es war ihr durchaus zuzutrauen, sich vor einem Wanderausflug zunächst einer Schlankheitskur zu unterziehen, zumal, wenn sie dort professionell betreut wurde. Und natürlich würde sie niemandem, auch nicht mir, verraten, was sie vorhatte. Dafür war sie zu eitel.
»Wir brauchen nur in Schloss Liebreiz anzurufen und nachzufragen«, meinte Tony.
Ich war dagegen.
»Am Telefon wird man uns nichts verraten. Tante Mariebelle könnte unter falschem Namen dort sein oder gewünscht haben, dass man keine Auskunft über sie gibt. Außerdem –«
Ich zeigte auf den zweiten leeren Umschlag der Zuggesellschaft.
»– fehlt ein weiteres Ticket. Es ist bestimmt das für die Fahrt zum Hohen Meißner. Im Schlafzimmer habe ich weder Wanderschuhe, noch ein Trekkingoutfit gefunden.«
»Das heißt, sie könnte von Niederfichtel aus direkt zum Meißner gefahren sein«, schlussfolgerte Tony.
»Und hat mich und das Bistro tatsächlich einfach nur vergessen«, seufzte ich.
»Aber die Sache mit dem plötzlichen Ausfall ihres Handys?«, gab Tony zu Bedenken.
Stimmt, das war nach wie vor merkwürdig. Ich wollte unbedingt herausfinden, was es damit auf sich hatte. Deshalb machte ich Tony folgenden Vorschlag:
»Wir teilen uns auf. Für den Fall, dass etwas Ernstes passiert ist, erhöht das die Chance, dass wir Tante Mariebelle helfen können.«
»Und für den Fall, dass du dir jedwede Gefahr nur einbildest, haben wir nicht allzu viel Zeit verschwendet«, fügte Tony hinzu. »Welchen Weg gebietest du mir also zu gehen?«
Ich staunte über Tonys Ausdrucksweise.
»›Jedwede Gefahr‹? ›Gebieten‹?«, äffte ich ihn nach und setzte noch eins drauf:
»Warum, so künde mir, befleißigst du dich derart ausgewählter Sprache?«
Tony lachte.
»Schloss Liebreiz hat mich inspiriert«, entschuldigte er sich. »Ich habe mal bei einer Gauklertruppe gearbeitet, die regelmäßig auf Mittelaltermärkten aufgetreten ist. Dort haben wir alle so geredet.«