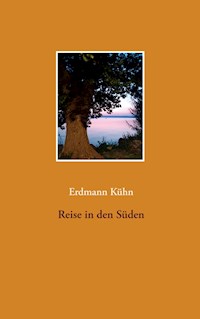Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Eine Berliner Kindheit in den Sechzigerjahren Friedel ist gerade sechs geworden und erforscht die Welt. Einer seiner Lieblingsplätze zum Nachdenken ist die Schaukel im Garten, so lange ihn dort niemand stört. Der Roman beschreibt Friedels Erkundungsgänge durch die elterliche Wohnung und die Umgebung im Berlin der frühen Sechzigerjahre. Berlin ist gerade durch eine Mauer geteilt worden, die Doppeldeckerbusse in Ostberlin haben vorne eine Schnauze, in West-Berlin fahren Ami-Schlitten und Ford 17M mit Eulenaugen durch die Straßen. Friedel beobachtet, wie Tanten kommen und gehen, vermisst überall seine Mutter, macht allein eine Reise in die Schweiz, träumt davon, seinen großen Bruder wenigstens einmal beim Fußball zu besiegen, schleicht mit ihm heimlich vor fremde Wohnzimmerfenster, um fernsehen zu können, verehrt seine Lehrerin und liefert sich einen Wettbewerb mit seinem Freund, wer es als erster schafft, das Mädchen seines Herzens auf sich aufmerksam zu machen. Auf der Schaukel sortiert er seine Eindrücke, versucht die Welt der Erwachsenen zu verstehen und herauszubekommen, was damals passiert ist, als seine Welt aus den Fugen geriet ...
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 240
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Der Junge auf der Schaukel
Der Junge auf der SchaukelDer Eismann kommtDie Reise in die SchweizMarianneTante AnnaFräulein HerrmannNorbert und HotteOma BiesdorfBewegte BilderUrlaub mit WasserleicheLichterfeldeDie HochzeitUmzugThomas und MariaSommer auf der InselLumumbaSchillerparkDie MauerWindeln, Altar und FlötentöneÜber die GrenzeApfelsaft, Argentinien und AbschiedImpressumDer Junge auf der Schaukel
Eine Berliner Kindheit in den Sechzigerjahren
Friedel ist gerade sechs geworden und erforscht die Welt. Einer seiner Lieblingsplätze zum Nachdenken ist die Schaukel im Garten, so lange ihn dort niemand stört. Der Roman beschreibt Friedels Erkundungsgänge durch die elterliche Wohnung und die Umgebung im Berlin der frühen Sechzigerjahre. Berlin ist gerade durch eine Mauer geteilt worden, die Doppeldeckerbusse in Ostberlin haben vorne eine Schnauze, in West-Berlin fahren Ami-Schlitten und Ford 17M mit Eulenaugen durch die Straßen. Friedel beobachtet, wie Tanten kommen und gehen, vermisst überall seine Mutter, macht allein eine Reise in die Schweiz, träumt davon, seinen großen Bruder wenigstens einmal beim Fußball zu besiegen, schleicht mit ihm heimlich vor fremde Wohnzimmerfenster, um fernsehen zu können, verehrt seine Lehrerin und liefert sich einen Wettbewerb mit seinem Freund, wer es als erster schafft, das Mädchen seines Herzens auf sich aufmerksam zu machen. Auf der Schaukel sortiert er seine Eindrücke, versucht die Welt der Erwachsenen zu verstehen und herauszubekommen, was damals passiert ist, als seine Welt aus den Fugen geriet ...
Erdmann Kühn
ist in Berlin geboren und aufgewachsen und hat in Köln Kunst und Musik studiert. Er lebt im Rheinland, arbeitet als Lehrer und in der Lehrerfortbildung. Er ist Musiker, Chorleiter, singt, komponiert, arrangiert und schreibt.
Neben Der Junge auf der Schaukel sind von Erdmann Kühn erschienen:Jascheks Reise – Ein Reisekrimi als Roadmovie,Himmel und Erde – Vaters Tagebücher 1926 – 1946 und die beiden Bücher, die Friedels Geschichte weitererzählen:Abschied von Berlin und Mein Kopf, der ist ein Zimmer. 2018 erscheint Am Tag, als er sein Spiegelbild grüßte – Ein Lehrer verschwindet.
Weitere Informationen zum Autor und zu den Bücher aufwww.ErdmannKuehn.jimdo.com
Die Nacht ist ein Fluss. Mein Bett ist ein Kahn. Vom alten Jahr stoße ich ab. Am neuen lege ich an.
Morgen spring ich an Land. Das Land, was ist’s für ein Ort? Es ist keiner, der’s weiß. Keiner, keiner war vor mir dort.Josef Guggenmos
Und jedem Anfang wohnt ein Zauber inne, der uns beschützt und der uns hilft zu leben.“Hermann Hesse
Die Geschichte vom kleinen Friedel ist gewidmet dem Zauber, der Neugier, der Freude, der Furcht und vor allem den guten Geistern der Kindheit.
Der Eismann kommt
Er lauscht dem gleichmäßigen Ticken des Weckers auf dem Nachtschränkchen. Ticktackticktack. Die blauen Gardinen sind zugezogen, aber blasses Tageslicht dringt durch die Lücken und taucht das Elternschlafzimmer in seltsam gestreiftes Zwielicht. Immer wieder geht sein Blick zur Holzmaserung der großen Kleiderschranktüren hinüber: Je länger er dorthin starrt, desto mehr verwandeln sich die gebogenen und gewundenen Linien mit den Astlöchern dazwischen zu unheimlichen Gesichtern und Tiergestalten. Er starrt so lange dort hinein, bis die Tiere und Gesichter lebendig werden und anfangen, sich zu bewegen. Das fasziniert ihn erst, dann wird es ihm unheimlich, so dass er seinen Kopf abwendet und die Augen fest zudrückt. Aber auch mit geschlossenen Augen bleibt das Gefühl, dass diese Gesichter und Gestalten ihn ansehen und beobachten. Ja es scheint ihm, als würden sie seine Blicke einsaugen und er hat Angst, er könne den Blick nicht mehr von ihnen abwenden.
Leise und vorsichtig gleitet er aus dem großen Doppelbett der Eltern und schleicht sich barfuß zur Tür, die nur angelehnt ist. Er mag keine verschlossenen Türen, nachts nicht und auch mittags im Elternschlafzimmer nicht. Vorsichtig tappst er barfuß durch den halbdunklen Flur zur Küche, um sich dort etwas zu trinken zu holen. Die Dielen knarren, ansonsten ist das Haus still. Auf dem Küchentisch steht die große Glaskaraffe mit dem selbst gemachten Holundersaft, von dem man immer eine ganz farbige Schnute und Zunge bekommt. Der dunkle Saft funkelt ihn an. Er kommt nicht so gut an die schwere Karaffe heran und klettert auf die Küchentruhe, um ein wenig Holundersaft in das große Glas zu kippen. Ganz vorsichtig, damit nichts verkleckert. Dann klettert er wieder herunter und geht zum Spülstein, um den dicken, süßen Saft mit Wasser zu verdünnen, wie die Mutter es immer getan hat. Er dreht den Wasserhahn stark auf, so bekommt er sogar Schaum. Er muss bloß aufpassen, dass der Saft nicht überläuft. Er schimmert so dunkel und geheimnisvoll. Friedel leert das Glas in einem langen Zug. Köstlich!
Als er zurück zum Flur schleicht, hört er es. Er bleibt stehen und lauscht, wo es herkommt. Auf Zehenspitzen tappst er zur Wohnzimmertür. Sie ist nur angelehnt. Er schiebt sie sachte auf, auch das Wohnzimmer ist leer. So leer, dass ihm das Ticken der Wanduhr viel lauter erscheint als sonst. Auf dem großen runden Esstisch steht eine blaue Vase mit traurigen Rosen. Er weiß nicht genau, was er tun soll und läuft erst einmal um den runden Tisch herum, so wie früher, wenn er mit seinen Geschwistern „Peter und der Wolf“ hörte und mitspielte. Sie stolzierten dabei um den Tisch herum wie Peter, hinkten mühsam hinterdrein wie der Großvater, watschelten wie die Ente oder schlichen auf leisen Pfoten wie die Katze.
Da ist es wieder, jetzt hört er es laut und deutlich. Es kommt aus dem Arbeitszimmer des Vaters. Ein Schluchzen, unterbrochen vom Naseputzen. Friedel schleicht zur Tür des Arbeitszimmers. Sie ist geschlossen. Jetzt setzt das Schluchzen wieder ein, geht in ein Weinen über, das überhaupt nicht mehr aufhören will und das ihn so traurig macht, dass er immer wieder schlucken muss. Wer ist das? Der Vater? Aber der weint doch nicht, oder? Die Stimme klingt fremd. Nicht wie die gewohnte Stimme des Vaters, tief und sanft und beruhigend, abends, wenn er eine Geschichte vorliest. Klingt es so, wenn der Vater weint? Unschlüssig steht er vor der Tür zum Arbeitszimmer und horcht. Die rechte Hand hat er schon auf der Klinke, aber er zögert. Er nimmt die Hand wieder fort. Der Kloß im Hals wird immer größer. Das Schluchzen hört nicht auf, aber es soll bitte endlich aufhören. Er traut sich nicht hineinzugehen. Er hat Angst vor dieser Stimme, vor dieser Traurigkeit. Er hat Angst, fortgeschwemmt zu werden von diesem Weinen.
Er schleicht zurück und zieht die Wohnzimmertür hinter sich zu, aber das Schluchzen bleibt in seinem Ohr und verfolgt ihn bis ins Elternschlafzimmer. Nein, hier kann er gar nicht bleiben, er geht wieder hinaus auf den Flur, weiter zur Toilette. Dort drückt er immer wieder auf den silbernen Spülknopf, damit die laute Wasserspülung das Schluchzen in seinem Ohr übertönt. Dann läuft er zur Garderobe, zieht sich seine Schuhe und seine dunkelblaue warme Wolljacke an, die er von der Großmutter zu Weihnachten bekommen hat, und geht hinaus. Er macht die Wohnungstür mit dem Briefschlitz leise hinter sich zu und tritt auf den Hausflur hinaus, geht die Steintreppe nach unten und stemmt sich gegen die schwere Haustür, um hinaus zu kommen an die frische Luft. Er hört die Krähen krächzen im großen Baum am Spielplatz, er hört ein Flugzeug in der Luft im Landeanflug auf den Tegeler Flughafen und läuft schnell auf die Straße, um es besser sehen zu können. Eine dicke Propellermaschine der PAN AM donnert wie ein großer, silberner Vogel über die Häuser hinweg.
Er geht zwar noch nicht zur Schule, aber lesen kann er schon. Mit den großen Buchstaben auf Schildern und Plakaten, auf Verpackungen und Flaschen hat es angefangen: AEG - die Fabrik direkt gegenüber auf der Baseler Straße, RAMA Margarine, ONKO Kaffee, BLUNA Limonade. Selbst schwierige Namen wie GRIENEISEN Bestattungen oder FLORIDA BOY Orangensaft sind für ihn inzwischen ein Kinderspiel, er erkennt sie sofort. Er braucht gar nicht mehr Buchstabe für Buchstabe zu entziffern. Bei kleinen Lettern und Schreibschrift muss er noch überlegen, aber den Geheimcode der großen Buchstaben hat er längst geknackt.
Er holt seinen grünen Roller aus dem Unterstand hinter dem Haus und rollert los, die Baseler Straße hinunter, biegt links am kleinen Eckladen in den Grindelwaldweg ein und fährt hinüber zur Aroser Allee. Die ist stark befahren, man muss gut aufpassen und gucken, ehe man sie überquert, sie hat aber einen schönen breiten Grünstreifen in der Mitte, auf dem man prima und ungestört Roller fahren kann. Man muss bloß achtgeben, dass man nicht in einen Hundehaufen fährt, auf dem Mittelstreifen werden nämlich immer die Hunde ausgeführt.
Da kommt schon der gelbe Doppeldeckerbus mit der Nummer 12: DOORNKAAT steht in großen Buchstaben auf der Seite und ein dicker Mann ist abgebildet, der ein kleines Glas in die Höhe hält. Doornkaat muss also irgendetwas zu trinken sein, etwas Leckeres, nach dem Gesichtsausdruck des dicken Mannes zu urteilen. Friedel rollert und probiert immer wieder die schicke Trittbremse aus: Wenn er sie mit der Hacke herunter tritt, stoppt der Roller sofort. Ein Superroller, er hat ihn zum Geburtstag bekommen. Außer der Trittbremse gibt es noch eine durchdringende Klingel und als I-Tüpfelchen ein in Plastik geschweißtes Fähnchen hinten am Gepäckträger, rot und weiß, mit dem Berliner Bären.
Er beobachtet einen Eiswagen, der große Eisblöcke aus der Eisfabrik Mudrack am Schäfersee in die Häuser bringt. In einigen Häusern gibt es schon Kühlschränke, aber die meisten haben große Holztruhen in der Küche, ausgekleidet mit Zinkblech. Dort hinein wird der Eisblock gelegt und hält dann ein paar Tage die Lebensmittel kühl. Er sieht, wie der Kleinlaster mit den drei Rädern in den Grindelwaldweg einbiegt und beeilt sich, über die Aroser Allee zu kommen, um dem Eiswagen zu folgen, denn er weiß, dass er danach die Baseler Straße entlang fahren wird. Er hat einmal beobachtet, wie solch ein Dreirad-Kleinlaster in der Kurve umgekippt ist. Der Fahrer ist herausgeklettert, hat gelacht und zusammen mit zwei Passanten das ganze Ding einfach wieder auf die drei Räder gestellt. Danach ist er mit „töff töff“ und „täng täng“ hupend und winkend weitergefahren.
Friedel überholt mit seinem Roller auf dem Bürgersteig den Eiswagen und biegt in die Baseler Straße ein. Dort wartet er ab, wohin der Laster fahren wird. Es dauert etwas, weil der Fahrer in manche Häuser mehrere Eisblöcke liefert, manchmal muss er auch mehrere Treppen hoch. Doch dann biegt der Eiswagen tatsächlich in die Baseler Straße ein und fährt geradewegs zum Tor des Gemeindehauses. Friedel wirft den Roller in die Ecke, rennt zur Haustür, stemmt sich dagegen, flitzt die Treppen hoch zur Wohnungstür, klingelt Sturm und ruft durch die Briefkastenklappe: „Der Eismann kommt!“
Er hört, wie der Vater den Flur entlang kommt, rasch, aber mit schweren Schritten. Der öffnet die Tür, sieht ihn erstaunt an und fragt: „Friedel, wo kommst du denn her? Ich dachte, du machst Mittagsschlaf?“ „Ich konnte nicht schlafen und dann hab ich den Eismann gehört!“
Der Vater guckt ihm prüfend ins Gesicht, gibt ihm einen leichten Klaps auf den Po und sagt: „Schnell, lauf in die Küche und klapp die Eistruhe schon mal auf!“
In diesem Moment kommt der Eismann mit seiner Lederschürze schon die Treppe hoch, das Eis hält er an einem Metallhaken. Friedel beobachtet genau, wie er den Block in das Zinkgehäuse legt. Als der Mann wieder gegangen ist, fragt er: „Wo ist denn eigentlich das alte Eis geblieben?“
Der Vater klappt die Truhe wieder zu und beugt sich hinunter: „Guck mal, hier unten ist eine Öffnung, da fließt das geschmolzene Eis ab. Deshalb steht da auch immer eine Emailleschüssel drunter, damit es keine Überschwemmung gibt in der Küche.“
Er nimmt die Schüssel hoch und zeigt sie ihm: „Ein wenig Wasser ist noch drin, das kannst du im Spülstein ausgießen!“
Friedel trägt die Schüssel vorsichtig zur Spüle und tunkt, bevor er das Wasser ausgießt, seine Finger hinein. „Es ist gar kein Eiswasser mehr!“
Der Vater lacht: „Nein, es ist ja schon geschmolzen!“ „Kann man es wieder zu Eis verwandeln?“ „Ja, im Winter, wenn du es vors Fenster stellst, dann wird es wieder zu Eis!“ „Im Sommer nicht?“ „Nein, da ist es draußen zu warm.“
Friedel denkt intensiv nach, dabei wickelt er seinen Zeigefinger in eine seiner vielen blonden Locken ein. „Aber wie macht das dann der Eismann im Sommer?“ „Ja, das ist eine gute Frage“ murmelt der Vater und winkt Friedel, ihm aus der Küche in sein Arbeitszimmer zu folgen.
Jetzt ist die Tür offen und der Junge schaut sich scheu um, als erwarte er, dass hier irgendwo noch die Person sei, die vorhin so geweint hat. Er kann aber nichts Auffälliges entdecken. Vaters dunkelbrauner Schreibtischstuhl mit dem geschnitzten Löwenkopf ist leer, der Sessel und das Chaiselong gegenüber ebenfalls, darauf liegt nur eine hingeworfene Wolldecke. Vater macht immer Mittagsschlaf in seinem Arbeitszimmer. Auf dem Schreibtisch steht ein großer Aschenbecher mit einer halb gerauchten Zigarre darin. Friedel kennt die Marke, die rote Banderole ist noch dran: HANDELSGOLD. Er hat vor längerer Zeit einmal heimlich probiert, wie solch ein Zigarrenstummel schmeckt. Da er das große Tischfeuerzeug seines Vaters nicht bedienen konnte, hat er den Stummel gegessen. Oder angefangen zu essen: Ihm ist so übel geworden, dass er schnell auf dem Klo verschwand und dort die eklige braune Brühe ausspuckte. Noch einen Tag später hat er Durchfall gehabt, die Mutter fragte ihn aus, ob er ungewaschenes Obst gegessen und womöglich dazu noch Leitungswasser getrunken hätte. Von der Zigarre hat er lieber nichts erzählt.
Jetzt stopft sich der Vater eine Pfeife. Das macht er immer nachmittags und Friedel freut sich, denn er riecht den würzig-süßlichen Duft des dänischen Pfeifentabaks, der durch die Tür des Arbeitszimmers manchmal bis ins Wohnzimmer dringt, sehr gerne. Ganz im Gegensatz zum herben Geruch kalter Handelsgold-Zigarren, von denen er ja nun auch weiß, wie sie schmecken: scheußlich! Er überlegt kurz, ob er den Vater fragen soll, wer da geweint hat. Nein, lieber nicht, stattdessen spielt er mit Vaters Briefwaage. Er probiert aus, wie weit die beiden Gewichte auseinandergehen, wenn er oben auf die goldglänzende Messingschale verschiedene Dinge legt: den großen Radiergummi, Vaters Füller, den Löschstempel, eine Büroklammer. Beim Tischfeuerzeug gehen die Gewichte ganz in die Knie und der Vater brummt mit der Pfeife im Mund: „Friedel, spiel nicht mit dem Feuerzeug. Du weißt doch: Messer, Gabel, Schere, Licht ...“ „... sind für kleine Kinder - doch!“ ergänzt Friedel und schaut frech durch seine Locken hindurch zum Vater, der schmunzelt. „Du wolltest wissen, wie das ist mit dem Eis im Sommer. Du weißt, wo die Eisfabrik ist?“ „Ja, ich war schon da, mit den Kindern vom Eisbärenweg. Wir spielen da manchmal Verstecken.“ „Aber ihr dürft nicht auf das Gelände der Fabrik, das ist verboten!“ „Es ist auch ein bisschen unheimlich da, so dunkel. Ich spiel lieber am Eisbärenweg!“ „Das ist auch besser so. Die Fabrik hatte früher ganz viele Teiche, in denen das Eis im Winter herausgebrochen wurde. Heute stellen sie das Eis künstlich her, mit riesigen Maschinen. Und dann wird es in großen, dunklen Lagerhallen aufbewahrt, wo es immer kalt bleibt. Deshalb kommt dir das Gelände so düster vor.“
Friedel schaut den Vater an und verzwirbelt dabei wieder eine Locke in seinem Finger. „Gab es denn da früher auch Eisbären?“ „Wieso denn das?“ „Im Eisbärenweg, mein ich.“ „Nein, nein,“ lacht der Vater und stößt kleine Rauchwölkchen aus „so heißt bloß die Straße, wahrscheinlich, weil sie dicht an der Eisfabrik liegt.“ „Aber es gibt da Eisbären!“ Friedel guckt schelmisch seinen Vater an, als habe er ihm ein Rätsel aufgegeben. „Tatsächlich? Hast du mal einen gesehen dort?“ „Ja! Ganz viele!“ „Jetzt willst du mir aber einen Bären aufbinden, Friedel. Du flunkerst!“ „Nein, ganz bestimmt! Aber sie bewegen sich nicht!“ „Ach, sie bewegen sich nicht. Dann sind sie wohl auch durchsichtig?“ „Nein, sie sind doch aus Stein!“
Der Vater schlägt sich mit der Hand an die Stirn und lacht: „Jetzt weiß ich, welche Eisbären du meinst. Die steinernen Bären an den Hauseingängen im Eisbärenweg! Dass ich darauf nicht gekommen bin!“
„Genau! Und jeder guckt anders!“
Nach einer kleinen Weile fügte er hinzu: „Nur der Hausmeister ist böse!“ „Der Hausmeister? Was hast du denn mit dem Hausmeister zu tun?“ „Immer wenn wir da Fangen spielen oder Verstecken, kommt der raus und schimpft ganz laut!“ „Warum denn?“ „Weil der böse ist. Der hat eine Glatze und hinten an seinem dicken Hals hat er zwei Knicke in der Haut! Und dann rennen alle Kinder um den Block, und der Hausmeister rennt hinterher!“
„Warum ist er denn böse?“ „Der will nicht, dass wir da spielen! Auf dem Rasen steht doch: SPIELEN VERBOTEN!“ „Das kannst du schon lesen? Ich glaube, es wird Zeit, dass du in die Schule kommst!“
Der Vater klopft seine Pfeife im Aschenbecher aus und schickt Friedel zur Wohnungstür, weil es geklingelt hat. Der flitzt wie ein geölter Blitz durch das Wohnzimmer und den Flur zur Tür und sieht, wie der Briefschlitz sich öffnet und eine Zeitung hindurch geschoben wird. Die bringt er dem Vater schnell ins Arbeitszimmer.
„Friedel, morgen früh fliegst du nach Hannover! Dort holt dich Tante Christel ab und fährt dann mit dir zusammen in den Urlaub! Freust du dich schon?“
Der Junge zieht die Nase kraus und guckt seinem Vater ins Gesicht: „Kannst du nicht mitfahren?“ „Leider nicht, ich muss arbeiten. Aber ich bringe dich zum Flughafen und gebe dich dort bei der netten Stewardess ab!“ „Kennst du die?“ „Nein, aber die ist bestimmt nett, warte mal ab, du wirst schon sehen!“ „PAN AM?“ „Pan Am!“ „Winkst du mir, wenn ich übers Haus fliege?“
Die Reise in die Schweiz
Als der Junge sich an der Hand der Stewardess noch einmal umschaut, sieht er, dass der Vater ein weißes Stofftaschentuch in der Hand hält, die schmalen Lippen aufeinander presst, und Tränen in den Augen hat. Friedel winkt kurz und dreht sich dann schnell wieder um. Die Stewardess drückt seine Hand etwas fester und sieht zu ihm hinunter. Sie ist wunderschön, trägt eine schicke blaue Uniform mit goldenen Knöpfen und lächelt ihn freundlich an: „Wir beide gehen als erste ins Flugzeug!“
Er marschiert an der Hand seiner Zauberfee stolz an den anderen Reisenden vorbei. Bestimmt schauen ihm alle hinterher, als sie die Gangway zum Flugzeug hinaufsteigen. Der Kapitän steht am Eingang und gibt ihm die Hand. Er hat ihn gleich an der Mütze erkannt. Der Junge bekommt einen Fensterplatz in der ersten Reihe, direkt beim Kapitän und bei der Stewardess. Sie gibt ihm zwei Biskuitkekse und sagt: „Ich muss mich jetzt ein wenig um die anderen Fluggäste kümmern, aber ich komme immer wieder hier bei dir vorbei. Wenn du eine Frage oder einen Wunsch hast, sagst du mir einfach Bescheid, ja?“
Jetzt füllt sich das Flugzeug, es wird laut und hektisch. Leute suchen ihre Sitzplätze, heben ihr Gepäck in die Höhe, schließlich beugt sich ein dicker Mann zu Friedel hinunter und fragt amüsiert: „Na, Kleiner, wo ist denn deine Mutter?“
Friedel tut so, als ob er nichts gehört hätte und schaut aus dem Fenster. Zum Glück setzt sich der dicke Mann nicht neben ihn. Er will nicht „Kleiner“ genannt werden, und das mit seiner Mutter geht den Dicken überhaupt nichts an. Jetzt fährt das Flugzeug los, Signallampen blinken über seinem Kopf, er sieht, wie es wendet und dann langsam auf die Piste rollt, immer entlang der kleinen roten Lämpchen. Jetzt steht es wieder und wartet. Dann wird es mit einem Mal richtig schnell und laut. In diesem Augenblick merkt er, dass die Stewardess sich neben ihn gesetzt hat. Sie nimmt seine kleine Hand und flüstert: „Jetzt heben wir gleich ab!“
In diesem Moment gibt es einen Ruck und Friedel kommt es vor, als ob sein Bauch sich selbständig macht. Er hält die Luft an und schaut ängstlich die Stewardess an. „Schön weiter atmen, gleich sind wir in den Wolken!“
Er schaut zum Fenster hinaus. Tatsächlich, sie fliegen direkt in die Wolken. Plötzlich gibt der Boden nach und Friedel hat ein Gefühl wie beim Schaukeln, wenn er zu hoch schaukelt und dann plötzlich nach unten sackt. Die Stewardess lächelt: „Das war ein Luftloch! Aber jetzt sind wir über den Wolken, jetzt wird es ganz ruhig! Alles in Ordnung mit dir?“
Der Junge nickt tapfer und sieht zum ersten Mal in seinem Leben Wolken von oben. Schön ist das, weiß und weich wie Watte. Die Sonne scheint warm auf diese weichen Wattebäusche. Der Himmel ist strahlend blau. Alles ist gut.
Die Stewardess muss jetzt zusammen mit ihrer Kollegin Essen verteilen. Als erstes bekommt Friedel eine Florida Boy mit Strohhalm und ein Sandwich. Stolz zieht er den zuckersüßen Orangensaft durch den gelben Strohhalm und blinzelt in die Sonne. Das Brot schmeckt nicht ganz so lecker wie das Leberwurstbrot bei seiner Großmutter, aber fast. Da fällt es ihm ein: Er wollte doch der Großmutter winken! Aber sie sind ja über den Wolken, da kann er gar nicht sehen, wo sie her fliegen. Nicht, dass Großmutter traurig vor ihrem Häuschen steht und ganz umsonst winkt! Als seine große Freundin das nächste Mal vorbeikommt mit einem Rollwagen, um die Flaschen und den Müll wieder einzusammeln, fragt er sie: „Sind wir schon über Lichterfelde?“
Sie lacht: „Wir sind schon im Landeanflug auf Hannover! Ich komm gleich noch einmal zu dir, wenn ich den Wagen ausgeräumt habe!“
Jetzt fliegen sie wieder in die Wolken, diesmal von oben, ab und zu schaukelt das Flugzeug hin und her, als tanze es ein wenig, und schließlich kann er winzig kleine Häuser, Straßen und ein blaues Band erkennen, das sich an der Straße entlang schlängelt. Der Vater hat Recht gehabt, es ist wirklich alles stecknadelklein. In der Ferne sind rote Lichter zu erkennen und ein graues Band, das jetzt immer näher kommt. Da spürt er wieder die Hand der Stewardess auf seiner. Während das graue Feld und die Lampen immer größer werden, fragt sie: „Na, wie fandest du deinen ersten Flug?“
Er strahlt: „Schön!“ „Hörst du das Geräusch? Jetzt werden die Räder ausgefahren! Und jetzt gleich setzen wir auf!“
Es ist, als ob das Flugzeug sich schüttelt wie ein großer, nasser Hund. Dem Jungen ist ein bisschen unheimlich. Aber er merkt den Boden unter den Füßen und das heftige Ruckeln, als ob der große Vogel noch nicht auf der Erde bleiben will. „Jetzt bremsen wir! Schau, da vorn ist das Flughafengebäude, da parken wir jetzt ein!“ Als das Flugzeug steht, dauert es noch eine Weile, bis die Luke sich öffnet. Dann nimmt die Stewardess den Jungen wieder an der Hand und geht mit ihm zur Tür, wo sich der Kapitän von ihm verabschiedet und ihm ein kleines Spielzeug-Flugzeug in die Hand drückt. PAN AM steht auf der Heckflosse. Stolz schreitet er mit seiner Zauberfee die Gangway hinunter.
Im Flughafengebäude übergibt sie ihn an eine Kollegin und verabschiedet sich von ihm. Die Kollegin findet er nicht halb so nett, sie wirkt strenger und scheint nicht so viel Zeit zu haben wie seine Zauberfee. Vielleicht hat sie auch nicht so große Lust, sich mit einem Sechsjährigen zu beschäftigen. Sie stellt ihn am Fließband ab und sagt: „Pass schön auf, wenn dein Koffer kommt!“
Dann ist sie verschwunden. Eine gemütlich aussehende dicke Frau hat das mitbekommen und spricht ihn an: „Du fliegst ganz alleine? Das ist aber mutig!“
Er fühlt sich gleich ein Stückchen größer und zeigt stolz auf seinen kleinen Koffer, der gerade in diesem Augenblick in Sichtweite kommt: „Da ist mein Koffer!“
Die Frau hilft ihm, den Koffer vom Gepäckband herunter zu bugsieren und sagt: „Ich hab meinen Koffer schon. Komm, ich zeig dir, wo der Ausgang ist! Wirst du dort erwartet?“ „Ja, von meiner Tante!“
Er ist sich gar nicht so sicher gewesen, ob er seine Patentante wirklich erkennen wird. Er hat sie noch gar nicht so oft gesehen, weil sie nicht in Berlin wohnt. Aber natürlich erkennt sie ihn sofort, wie er da neben einer korpulenten Dame durch die Sperre stolziert. Er verabschiedet sich höflich von der Dame und rennt auf sie zu. Tante Christel nimmt ihn in die Arme und sagt: „Da bin ich aber froh, dass du gut gelandet bist. Jetzt kann unsere Reise losgehen! Nein, vorher müssen wir noch zur Telefonzelle, um deinem Vater Bescheid zu geben, dass du gut gelandet bist! Willst du ihm das sagen?“
Er will. Er darf sogar die Groschen in den Schlitz stecken und die lange Nummer an der Wählscheibe wählen.
Die Stimme des Vaters klingt fremd am Telefon, nahe an seinem Ohr und trotzdem weit weg. Er versucht, sich den Vater vorzustellen, wie er in seinem Arbeitszimmer sitzt, in dem Stuhl mit dem geschnitzten Löwenkopf, aber ehe er das Bild richtig vor Augen hat, ist das Gespräch auch schon vorbei. Der letzte Groschen ist runtergerutscht und dann plötzlich ist die Verbindung unterbrochen. Als seine Tante nachfragt, merkt er, dass er gar nicht richtig auf die Worte seines Vaters geachtet hat, weil er damit beschäftigt gewesen ist, ihn sich vorzustellen. Tante Christel meint, das sei nicht so schlimm. „Wichtig ist, dass dein Papa weiß, dass du gut gelandet bist.“
Mit einem Bus fahren sie jetzt zum Hauptbahnhof, dort steigen sie in den Zug, der sie in die Schweiz bringen wird. Alles ist aufregend, alles ist anders als zu Hause in Berlin, das fängt schon bei dem Bus an: Das ist kein gelber Doppeldecker wie in Berlin, sondern fast ein Reisebus. Man steigt vorn beim Fahrer ein, dort wird auch bezahlt, die Sitze sind gepolstert, es gibt keine Treppen, keinen Schaffner und keinen Freiluft-Ausstieg hinten. Aber der Zug ist noch viel interessanter, ein D-Zug, schnell hat Friedel das ganze Abteil erkundet und schon verschiedene Bekanntschaften gemacht. Tante Christel hat ihn gebeten, das Abteil nicht zu verlassen, gucken muss er aber doch mal, wie es hinter der Schiebetür aussieht, die so schwer aufgeht. Aber das laute Rattern hinter der Tür und das Knirschen und Quietschen der aufeinanderliegenden Eisentritte, über die man gehen muss, wenn man in den nächsten Waggon will, schreckt ihn ab. Alles bewegt sich hier hin und her, man ist dicht über den Schienen. Er hat Angst, dazwischen zu rutschen, dreht schnell wieder um und flitzt zum bequemen großen Sitz neben seiner Tante.
Der Schaffner kommt und knipst mit der großen Zange ein kleines Loch in seine Fahrkarte. Auf der kleinen Karte aus brauner Pappe steht BERN, das ist der Zielbahnhof, erklärt ihm die Tante. „Gibt es da auch Bären?“ fragt er. Die Tante lacht und erzählt ihm von den Bären im Berner Zoo und von dem Bär im Stadtwappen von Bern und Friedel erzählt ihr von den steinernen Bären im Eisbärenweg und vom Berliner Bär. In Köln sieht er aus dem Abteilfenster zum ersten Mal den Kölner Dom und den Rhein, an dem sie später noch lange entlang fahren. Immer wieder gibt es etwas zu gucken: eine Burg, eine Brücke, Felsen ganz dicht am Fenster, ein entgegenkommender Zug, der das Fenster wackeln lässt.
Es wird schon langsam dämmerig, als sie in Basel ankommen. Dort steigen sie um in den Zug nach Bern. Schon auf dem Bahnsteig hört er viele Stimmen, die er gar nicht mehr versteht. Seine Tante hat ihm erzählt, dass in der Schweiz viele Sprachen gesprochen werden. Ein freundlicher, älterer Herr im Abteil fragt ihn etwas, das er nicht richtig versteht, hält ihm darauf eine Tüte mit Bonbons hin und fragt: „Zücki?“ Jetzt versteht Friedel, was der Mann will, schaut aber lieber vorher noch einmal herüber zur Tante. Die Tante nickt ihm aufmunternd zu, er nimmt sich ein Zücki, bedankt sich und setzt sich schnell wieder neben die Tante, um dort den quietschgelben Bonbon in Ruhe auszupacken und in den Mund zu schieben. So schmeckt also die Schweiz.
Wie sie aussieht? Dunkel, geheimnisvoll. Es ist mittlerweile Nacht geworden, ab und zu gibt es Lichter in der Ferne oder einen hell erleuchteten entgegenkommenden Zug, der in Sekundenschnelle schon wieder verschwunden ist. Mehrmals fahren sie durch Tunnel, dann ist es noch dunkler draußen. Der Zug sieht anders aus als der D-Zug. Überall sind kleine weiße Kreuze auf rotem Hintergrund zu sehen: auf den Mülleimern, den Wänden, den Fenstern. Tante Christel erklärt ihm, was das bedeutet, aber er weiß es schon. Er hat zu Hause ein Buch mit Flaggen, die Schweiz ist mit dabei. Einige Leute im Abteil schlafen im Sitzen. Auch der Tante klappen ein paar Mal die Augen zu. Den Schaffner kann er gar nicht verstehen, aber er weiß ja inzwischen, was der Schaffner sehen will und reicht ihm die Fahrkarte, auf der BERN steht.
Dann nimmt die Tante die beiden Koffer aus der Gepäckablage, er zieht sich den Anorak an, nimmt seinen kleinen Koffer und sie verlassen zusammen das Abteil. Draußen kann man schon die Lichter von Bern sehen, Straßen, Häuser, Plätze, Straßenbahnen, einen Fluss. Der Zug hält mit laut quietschenden Bremsen und sie steigen aus. Im Windschatten der Tante arbeitet er sich durch die Menschenmenge, am Ausgang werden sie schon erwartet: ein netter junger Mann und eine junge Frau begrüßen die Tante mit Umarmung und Küsschen und ihn mit Handschlag. Er versteht nichts, die Tante erklärt ihm, dass die beiden Französisch sprechen und bringt ihm Bonjour bei. Die beiden lachen freundlich, als er es versucht. Sie gehen zum Parkplatz, dort wartet das Auto, das sie nach Le Locle bringen wird. So ein Auto hat er noch nie gesehen: CITROËN buchstabiert er vorn am Kühler, wie Zitrone, auch die Scheinwerfer sind gelb und das Heckfenster steht wie ein spitzer Raubfisch-Zacken schräg nach außen.
„Komm rein, wir fahren los!“ Er klettert auf die Rückbank an die Innenseite der Raubfischflosse und genießt die Autofahrt in den weichen, roten Polstern. Schon bald sind sie aus der Stadt herausgefahren, es wird wieder dunkel, der Motor brummt gemütlich, das Auto wiegt sich hin und her in den Kurven der endlosen Landstraße. Die Unterhaltung der drei Erwachsenen auf Französisch verbindet sich mit dem gemütlichen Brummen des Motors nach und nach zu einer angenehmen, einschläfernden Melodie, die er auch beim Träumen noch als Hintergrundmusik wahrnimmt.
Als er wieder wach wird, steht das Zitronenfischauto schon auf einem Hof, Gepäck wird ausgeladen. Er hat das französische Wort wieder vergessen, das Guten Tag bedeutet, ist noch ganz verschlafen und sagt laut und deutlich, als er die Tür öffnet: „Zücki!“ zum Entzücken der versammelten Mannschaft. Das kennen auch die französischsprachigen Schweizer, und so bekommt er großes Gelächter und Hallo beim nächtlichen Empfang in Le Locle.
Die nächsten Tage sind sehr aufregend. Eine ganz andere Luft atmet er dort oben auf dem Bauernhof oberhalb der kleinen Stadt Le Locle: Würzig, frisch, warm, es duftet nach Wiese und frischem Heu, es weht immer ein leichter Wind, wenn er in seinen kurzen Lederhosen durch die Wiesen rennt. Auch die Sonne ist hier anders als zu Hause, schöner, größer, kräftiger, sie wärmt ihm Gesicht, Arme und Beine. Er legt sich in die duftende Wiese und schaut in den Himmel. Wolken ziehen vorbei, Wolkenbilder, Schafe, Hunde, Fabelwesen, wilde Tiere. So etwas hat er in Berlin noch nicht gesehen.