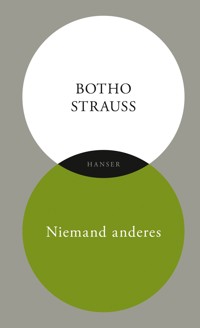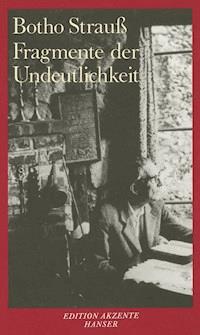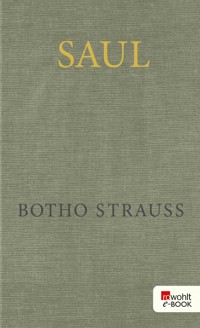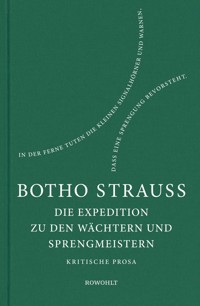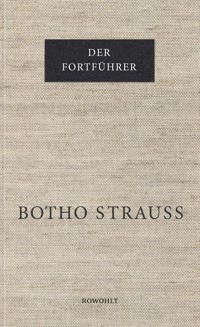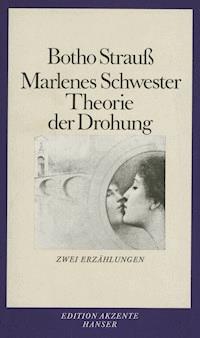Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Hanser, Carl
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Die Personen dieses Romans sind allesamt Grenzgänger, die sich bewußt in eine andere Zeit hinübergleiten lassen oder unbewußt hinübergezogen werden. In jedem Falle wachen sie in Räumen auf, wo die Gesetze der Zeit wechseln, wo sie Opfer erotischer Metamorphosen werden oder Zuschauer ihrer eigenen verdrängten Geschichte. Der junge Mann, von erzählerischer Schönheit und gedanklicher Schärfe, ist zugleich Bildungsroman, allegorischer Roman und romantische Phantasie.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 512
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Hanser E-Book
Botho Strauß
Der junge Mann
Carl Hanser Verlag
ISBN 978-3-446-25114-4
Alle Rechte vorbehalten
© 1984/2015 Carl Hanser Verlag München Wien
Umschlag: Christian Diener, unter Verwendung des Bildes
»Mon Portrait« von Felix Valloton;
Musée cantonal des Beaux-Arts, Lausanne
Satz: LibroSatz, Kriftel/Taunus
Unser gesamtes lieferbares Programm und viele andere Informationen
finden Sie unter www.hanser-literaturverlage.de
Erfahren Sie mehr über uns und unsere Autoren auf www.facebook.com/HanserLiteraturverlage oder folgen Sie uns auf Twitter: www.twitter.com/hanserliteratur
Datenkonvertierung: le-tex publishing services GmbH, Leipzig
Inhalt
Einleitung
Die Straße(Der junge Mann)
Der stehende Liebespfeil
Der Wald
Der zurück in sein Haus gestopfte Jäger
Die Siedlung(Die Gesellschaftslosen)
Die Händlerin auf der hohen Kante
Die Frau meines Bruders
Nur noch wenig lichte Momente
Die Terrasse(Belsazar. Fabeln am Morgen nach dem Fest)
Das Liebeslicht
Bernd und Bäumin
Die Frau auf der Fähre
Die Geschichte der Almut
Die beiden Talentsucher
Der Turm
Der Prinz und der Kojote(Aus Ossias Skizzenbuch)
Einleitung
Zeit Zeit Zeit. Wie oft fragen mich die Kinder auf der Straße nach der Uhrzeit! Dabei bin ich wie sie, lebe nicht nach der Uhr und trage auch keine bei mir. Sie halten mit ihren Fahrrädern am Bordstein, sie fragen mit artigem Befremden, mit abgewandtem Blick und so, als kämen sie aus einer fernen Gesellschaft und zögen nur eben an uns vorbei. Sie fragen auch aus einer Ungewißheit, die sich nicht allein auf den Stundenplan erstreckt. Die allgemeine Gewöhnung unter uns Städtern, dem anderen kaum mehr ins Auge zu blicken, ihn möglichst nicht zu beachten, scheint diese Kinder zu stören. Sie merken doch, wie die freundliche Neugier, ihr ureigenes Element, ohne das sie nichts werden können, ringsum wenig bedeutet. Dagegen regen sie sich und fragen an den Leuten entlang; es drängt sie, den Fremden kurz zu berühren, und sei es nur, um von ihm die Stunde zu hören. »Können Sie mir bitte sagen, wie spät es ist?«
Mit der Zeit kommen die Menschen immer noch am wenigsten zurecht. Den Raum haben sie sich leichter verfügbar gemacht, jedenfalls den ihnen zugemessenen, den erdumschließenden. Zeit aber bleibt Teil des kosmischen Überschwangs. Mit ihr können die Irdischen nicht nach ihrem Belieben umspringen, können sie weder erobern noch zerstören und nicht zu dem Ihren zählen. So mußten sie denn allerlei behelfsmäßige Uhren einrichten, die abergläubischen und die geschichtlichen, die biografischen und die ideologischen, so daß aus der unfaßlichen Zeit die mächtigsten Täuschungen und Stimmungen des Menschengeschlechts hervorgingen. Mal war es die Endzeit, mal die Neuzeit. Mal war die Vorzeit grau, mal war sie golden. Mal lebte man in der Heils-, dann wieder in der Katastrophen-Erwartung vom Ende aller Tage. Geschichtliche Schockwellen. Sehnsuchtswechsel. Nichts Reales dran. Und oft war dann nur eine Weltbildgefahr im Verzuge, wo man wie gebannt auf die Weltbrandgefahr gestarrt hatte.
Die Zeit ein Kind, sagt Heraklit, ein Kind beim Brettspiel, ein Kind auf dem Throne.
Die Welt ist jung, sagen uns die Physiker, unvorstellbar weit entfernt vom schrecklichen Gleichgewicht, dem zeitverschlingenden. Voll fruchtbarer Unordnung und ungetrübter Spielfreude geht sie wie die Kinder auf der Straße, denen es gefällt, Gebrechen nachzuahmen, zu hinken oder irgendwie auf verkehrten Beinen zu laufen. Unausgeprägt ist das Lebendige.
»Komm her! Erzähl uns was!« rufen die Büdchensteher, wenn ich morgens zum Kiosk komme, um mir die Zeitung zu holen. Da stehen sie von zehn Uhr früh bis weit nach Ladenschluß, draußen im Sommer und bei unfreundlichem Wetter auch drinnen im Warmen. Sie halten ihr buckliges Fläschchen in der Faust, junge Männer zum Teil, denen das Trinken und die Arbeitslosigkeit die Maske eines unkenntlichen Alters ins Gesicht gedrückt haben. Schmächtige, ausgezehrte Mittdreißiger, und mit ihrem dunklen, gefetteten Haar, der adrett gedrückten Fünfziger-Jahre-Tolle, aber auch mit ihren bevorzugten Scherz- und Schlagworten erinnern sie eigentümlich an eine ferne Borgward-Ära. Ihnen, den Trinkern und aus der Zeit Gerutschten, diesen einsamen, geschüttelten Männlein, die gar nichts wissen und stets behaupten, ihre besten Freunde seien alle bei Stalingrad gefallen, dreht sich ohnehin die Geschichte im Kopf herum, und sie sprechen einfach an einem deutschen Gemurmel mit, das, weit älter als sie selbst, ungestört unterhalb der Zeit dahinrinnt. Untereinander sind sie nämlich nicht Freund und haben nur ihren Hund. Hundehalter sind wohl die meisten von ihnen und klagen beständig über zu hohe Steuern. Nur Schäferhunde halten sie, oft alte verzottelte Tiere mit lahmender Pfote und schneeweißem Schnauzhaar.
Ihnen etwas erzählen? Aber sie können nicht eine Minute lang zuhören! Unablässig fallen sie sich gegenseitig ins Wort, und eine haltlose Behauptung will die andere übertrumpfen. Ihre Unterhaltungen irren dahin, sprunghaft und quer, voll fahriger Schnitte, wie ein Abend im TV. »Aber ihr seid ja schon genauso! Ihr, die ihr den ganzen Tag Zeit habt, unterbrecht euch immerzu und laßt niemanden ausreden. Könnt nicht einmal mehr einen einfachen Witz im Zusammenhang erzählen!«
Das große Medium und sein weltzerstückelndes Schalten und Walten hat es längst geschafft, daß wir Ideenflucht und leichten Wahn für unsere ganz normale Wahrnehmung halten. Hier fällt sich das Geschehen dauernd ins Wort. Eben noch sehen wir zwei Menschen ernstlich miteinander streiten, den jungen Professor für Agronomie und den Beamten einer landwirtschaftlichen Behörde, über Betablocker im Schweinefleisch und die Östrogensau, live in einer Hamburger Messehalle. Kaum haben wir sie näher ins Auge gefaßt und beginnen ihren Argumenten zu folgen, da fährt auch schon eine Blaskapelle dazwischen; wir befinden uns, ohne daß wir nur mit der Wimper hätten zucken können, in Soest, am Stammtisch eines Wirtshauses, und werden in die Geheimnisse westfälischer Wurstzubereitung eingeweiht. Schon vergessen der Betablocker, vorübergehuscht die vergiftete Nahrung. Ist das Information? Ist es nicht vielmehr ein einziges, riesiges Pacman-Spiel, ein unablässiges Aufleuchten und Abschießen von Menschen, Meinungen, Mentalitäten? Es ist genau das Spiel, das unser weiteres Bewußtsein beherrscht: die Wahnzeit wird nun bald zur Normalzeit werden.
Und das Gespräch, das wir über Jahre hin mit wenigen Menschen führen wollten, wird nicht durchgehalten. Es befremdet uns, privat zu sein und lange auszusprechen. Das Intime selbst gehört nach draußen, und Heimlichkeiten sind der Stoff für Talkshow oder Interview. Denn nur der helle Schein der Öffentlichkeit bringt uns den anderen Menschen wirklich nah. Wollen wir dagegen im Stillen zuhaus jemandem etwas sagen, so fühlen wir uns plötzlich in einer engen Höhle befangen, an einem Ort der Lähmung und der Dunkelheit. Man fürchtet sich vor dem anderen in dieser finsteren Unöffentlichkeit. Man hört nicht zu, man läßt nicht ausreden.
Daher macht den Erzähler seine Gabe verlegen. Keineswegs weil er nichts erlebt hätte – er kann schließlich aus dem Geringsten schöpfen –, sondern weil er die elementare Situation, jemandem etwas zu erzählen, nicht mehr vorfindet oder ihr nicht mehr trauen kann. Weil er zu tief schon daran gewöhnt ist, daß ihm ohnehin gleich das Wort abgeschnitten wird.
Was aber, wenn er dennoch ein empfindlicher Chronist bleiben möchte und dem Regime des totalen öffentlichen Bewußtseins, unter dem er seine Tage verbringt, weder entkommen noch gehorchen kann? Vielleicht wird er zunächst gut daran tun, sich in Form und Blick zunutze zu machen, worin ihn die Epoche erzogen hat, zum Beispiel in der Übung, die Dinge im Maß ihrer erhöhten Flüchtigkeit zu erwischen und erst recht scharfumrandet wahrzunehmen. Statt in gerader Fortsetzung zu erzählen, umschlossene Entwicklung anzustreben, wird er dem Diversen seine Zonen schaffen, statt Geschichte wird er den geschichteten Augenblick erfassen, die gleichzeitige Begebenheit. Er wird Schauplätze und Zeitwaben anlegen oder entstehen lassen anstelle von Epen und Novellen. Er wird sich also im Gegenteil der vorgegebenen Lage stärker noch anpassen, anstatt sich ihr verhalten entgegenzustellen. Er wird seine Mittel an ihr verbessern, denn nur die geglückte Anpassung verleiht ihm die nötige Souveränität und Freiheit, um den wahren Gestaltenreichtum, die Mannigfaltigkeit, das spielerische Vermögen seiner Realität zu erkennen. So arg es ihn auch in Bedrängnis bringt, so mächtig bewegt ihn zugleich das gesellschaftliche Pleroma, die Fülle des Wissens und Empfindens, der Begegnungen und der Lebensformen, der Pakte und der Unterschiede, wie er sie in einem politisch freien Gemeinwesen, in einer am Ende doch glücklichen Periode deutscher Geschichte vorfindet und miterlebt. Dies wird ihm bisweilen durch ein tiefes Gefühl von Genugtuung und Zugehörigkeit gewiß. Wo mancher nur den glitzernden Zerfall erkennt, da sieht er viele Übergänge und Verwandlungen, sieht er den verschwenderischen Markt der Differenz, der aus der wesentlichen Unsicherheit und Offenheit dieser Gesellschaft hervorgeht. Vielfalt und Differenz aber gewähren allem Seienden den besten Schutz vor Tod und Verwüstung.
Was nun das Element der Zeit betrifft, so muß uns auch hier eine weitere Wahrnehmung, ein mehrfaches Bewußtsein vor den einförmigen und zwanghaften Regimen des Fortschritts, der Utopie, vor jeder sogenannten ›Zukunft‹ schützen. Dazu brauchen wir andere Uhren, das ist wahr, Rückkoppelungswerke, welche uns befreien von dem alten sturen Vorwärts-Zeiger-Sinn. Wir brauchen Schaltkreise, die zwischen dem Einst und Jetzt geschlossen sind, wir brauchen schließlich die lebendige Eintracht von Tag und Traum, von adlergleichem Sachverstand und gefügigem Schlafwandel.
In einer Epoche, in der uns ein Erkenntnisreichtum ohnegleichen offenbart wird und in der jedermann Zugang haben könnte zu einer in tausend Richtungen interessanten Welt, werden wir immer noch einseitig dazu erzogen, die sozialen Belange des Menschen, die Gesellschaft in den Mittelpunkt des Interesses zu stellen. Man kann aber in dieser Gesellschaft nicht fruchtbar leben, wenn man unentwegt nur gesellschaftlich denkt! Man wird verrückt – oder flachköpfig, man vergeudet jedenfalls seine besten Kräfte! Ein solches Denken, wie es allgegenwärtig ist, macht uns nicht mutiger und beraubt uns womöglich der letzten Fähigkeiten, Gesellschaft gerade eben noch bilden zu können. Eines Tages wird sie’s halten wie die Carrollsche Katze und sich in ein durchsichtiges Lächeln auflösen – das jenen gilt, die sie zu lange zu besinnungslos angestarrt haben. »So etwas!« dachte Alice; »ich habe zwar schon oft eine Katze ohne Grinsen gesehen, aber ein Grinsen ohne Katze! Das ist doch das Allerseltsamste, was ich je gesehen habe!«
Nein, die Idee des Zerfalls ist nur ein Gesinnungstrug, der Kobold eines verbrauchten Fortschrittsglaubens. Wir verwandeln uns ja, und eins geht aus dem anderen an- oder gegenteilig hervor.
Ungeachtet dessen beklage ich den geschäftlichen Niedergang meiner Zeitungsfrau, wie mich auch ihr körperlicher Verfall im Herzen dauert. Sie, der Engel der Büdchensteher, die ihr über die schamlosen Auslagen gewisser Hefte hinweg stets einen züchtigen und hilfsbereiten Hof bildeten, war bis vor einem Jahr noch eine ansehnliche, muntere Person, eine kleine, rundliche Platinblonde mit perlmuttenem Lidschatten, immer gefällig und herzensgut. Inzwischen ist sie kaum wiederzuerkennen. Im Gesicht und an den Hüften breit angeschwollen, das steifgesprayte, toupierte Haar hängt schief am Kopf, mit beiden Fäusten stützt sie sich am Ladentisch, stemmt sich mühsam auf gegen ihre bleierne Betrunkenheit. Ihr Lächeln findet nun kaum noch aus dem gedunsenen, wie mit Asche geschminkten Gesicht heraus, überwindet die Wülste, Flecken und Rillen nicht, es wird zu einer blödsinnigen Grimasse. In diesen erbarmungswürdigen Zustand verfiel sie kurz nach dem Tod ihres Mannes, weniger wohl aus Trauer als aus einfacher Entkräftung, nach langer erschöpfender Sorge.
Der Gatte, alkoholkrank und unbeschäftigt, kam täglich gegen elf in unsere Straße, um sich im Kiosk seiner Frau die Tagesration zu holen. Oft blieb er unter meinem Fenster stehen und schnaufte mit hochrotem Kopf. Am späten Nachmittag kam er wieder, um leere Flaschen gegen die Abendration zu tauschen, die er in seiner Plastiktüte heimtrug. Still, aussichtslos und unbeirrt teilte er seinen Tageslauf in diese beiden Besorgungen auf. Eines Tages aber kam er nicht mehr, und am Kiosk blieb der Rolladen unten. ›Wegen eines traurigen Ereignisses bleibt mein Geschäft heute geschlossen‹ stand auf einem ausgehängten Pappschild. Seitdem hatte die Zeitungsfrau, die zu Lebzeiten des Mannes die Aufsicht behielt und selber nicht oder nicht bemerklich trank, der Nachlässigkeit und der Verwahrlosung Tor und Tür geöffnet. Ein furchtbares ›Alles egal!‹ fraß sich wie Gift durch ihre ordentliche Lebensführung, und ihr hübscher wohlsortierter Laden verwandelte sich binnen kurzem in ein stinkendes, verdrecktes Asyl. Ein stechender Mief von Urin, Hundefell und nie gewechselter Kleidung schlägt mir nun jeden Morgen entgegen, wenn ich mir die frischen Nachrichten hole. Viele ihrer treuen Kunden, vor allem ältere Frauen, kaufen ihre Illustrierten schon längst nicht mehr hier. Auf den Regalen und am Ladentisch entstehen immer neue Lücken, leere Flächen, wo Blätter nicht mehr bestellt oder nicht mehr geliefert werden, vermutlich höherer Zahlungsrückstände wegen. Nur ihr kleiner, verdunter erotischer Hof ist ihr geblieben, der Kreis der verschmitzten Elenden, der sich immer enger um sie schloß, bis sie selber in seinen Dunst überging.
Ich komme bloß vom Zeitungsholen, und doch scheint mir, bin ich lange aus gewesen. Ich habe auf meinem kurzen Weg in viele Gesichter geblickt. Ich kenne die Leute in meiner Straße vom Sehen. Jedes Gesicht die Verschlußkappe einer breitangelegten Familiensaga. Doch ich weiß nichts von ihnen. Gestalten des reinen Wiedererkennens, das sind sie. Ihr alltägliches Auftauchen und Verschwinden ist ein Maß wider die Fortbewegung. Es ist eine Bleibe.
Alle Welt spielt auf Zeitgewinn, ich aber verliere sie. Ich denke nur, daß aller Gewinn und Verlust der Stunden in der großen elektronischen Totale einem Ausgleich zustrebt. Ich denke, daß uns die neue Welt-Ein-Uhr auf wunderlichem Umweg dem ursprünglichen Äon näher bringt, in dem es nur Gleiche Zeit gab. Jeder Blick nahm sich ein Wort, jedes Ding fand seinen Dichter. Die Ereignisse kommen nicht, schrieb der Physiker Eddington, sie sind da, und wir begegnen ihnen auf unserem Weg. Das Stattfinden ist bloß eine äußerliche Formalität. Der Unfall, der Lottogewinn, der Liebesbetrug, sie sind alle schon da. Sie warten nur darauf, daß wir ihnen zustoßen.
Unterdessen hat der strebsame Evolutionsgedanke auch den stillen Geist der Physik aufgestört, und der allesdurchbohrende Zeit-Pfeil hat ihn getroffen. Die neuere Physik entzog unserem Traum von der Welt den letzten Gehalt an Statik und Symmetrie. Nun können wir nur noch Werden denken. Diese Welt also ist von A bis Omega, durch Leben und durch Unbelebtes an die Unumkehrbarkeit allen Geschehens gefesselt, an das Nicht-Gleichgewicht, an die Dynamik von Unordnung und verschwenderischer Struktur. Sie hat offenbar für ein Sein keinen Platz. Nur der sich selbst bewußte Menschen-Geist, um seiner angeborenen Verzweiflung Herr zu werden, bedurfte der jahrtausendewährenden ›Lebenslüge‹ und – von Platons Ideen bis zur Quantenmechanik – immer neuer Trostbeweise, daß etwas universal und zeitlos gültig sei.
Nun spielt unser Geist mit den unwandelbaren Ideen, und sei es nur, um sich bei ihnen auszuruhen von der Erkenntnis des allumfassenden Werdens. Zumal der Erzähler wird sich dies Spielzeug nicht nehmen lassen, wird weiterhin schalten und walten mit verlorener und wiederkehrender Zeit und auch die kostbaren Kristalle des Stillstands nicht in die Asche werfen. Er wird, wenn auch auf verlorenem Posten, bis zuletzt dem Zeit-Pfeil trotzen und den Schild der Poesie gegen ihn erheben.
Frühling am Himmel und Rostlaub noch an den Bäumen! Ein Mai, ein feiner Wolkenwirbel, ein Hellblau mit dünnen weißen Schleiertänzen … welch zwiefache Jahreszeit! Doch nun an die Arbeit. Zurück in den Winter. Zurück zu meinen Schneefeldern von leerem Papier.
Aber daß ich jetzt immerzu aus dem Haus tretende Menschen sehe! Die gehen in geselligen Gruppen oder allein zu gemeinsamen Orten. Sehen sich beim Einkauf wieder, in Bürgermärschen oder im Sonnenlicht auf einer Flußbrücke. Die schwerelos Heraustretenden, die auf der Straße, sie sind es doch, welche der Herrschaft der Ämter trotzen. Die Straße, der Platz, der Wind bieten ihnen Schutz und Waffe.
Ihnen etwas erzählen? Ach, sie sind guten Muts, haben ein klares Fortkommen, sie sind ja beschäftigt.
So will ich denn in aller Stille, wie Schritte in den Schnee, meine Spuren machen und von vornherein einen solch abgeschiedenen Ton wählen, mit dem man durchaus niemandem in den Ohren liegen kann. Vielleicht gelingt es, zu jenen lautlosen und ruhenden Ereignissen zurückzufinden, die lange darauf warten müssen, daß jemand zu ihnen stößt und sie zum Leben erweckt. Allegorien. Initiationsgeschichten. RomantischerReflexionsRoman. Ein wenig hergebracht, ein wenig fortgetragen.
»Es sind abgehauene Wurzeln, die von neuem ausschlagen, alte Sachen, die wiederkehren, verkannte Wahrheiten, die sich wieder zur Geltung bringen, es ist ein neues Licht, das nach langer Nacht am Horizont unserer Erkenntnis wieder aufgeht und sich allmählich der Mittagshöhe nähert.« Giordano Bruno, Vom unendlichen All und den Welten, Fünfter Dialog.
Die Straße(Der junge Mann)
»Nach einer solchen Arbeit wirst du erst einmal in ein tiefes Loch fallen.« Man hatte mich gewarnt. Es war dann auch genauso gekommen. Ich wußte nichts mit mir anzufangen. Tagsüber lief ich in der Stadt herum, suchte mir die Zeit in Cafés und Spielhallen zu vertreiben, in Kinos, Parks und Kaufhäusern. Am Abend dann, ganz zufällig und doch unvermeidlich, fand ich mich in der Nähe des Theaters ein. Ich erkundigte mich nach dem Kartenverkauf, ich beobachtete den Zulauf des Publikums, ich besuchte die Schauspieler in ihren Garderoben, ich saß in der Kantine mit den Bühnenarbeitern beim Kartenspiel, oft bis in den frühen Morgen.
Aber irgendwie gehörte ich nicht mehr dazu. Meine Inszenierung war nun in den gewöhnlichen Betrieb des Theaters übergegangen. Was auf der Bühne geschah, erschien durchaus als das eigene Werk der Schauspieler, kaum ein Zuschauer hätte hier nach dem Regisseur gefragt. Die neuen Wagnisse, die die Schauspieler Abend für Abend mit guten oder weniger guten Vorstellungen, mit wachem oder stumpfem Publikum bestehen mußten, hatten längst das intime Abenteuer verdrängt, das uns über sechs Probenwochen so eng und schonungslos zusammengeführt hatte. Zwar empfingen mich die Schauspieler gern und behandelten mich freundlich – schließlich hatte unsere Aufführung wider Erwarten doch noch einen mittleren Erfolg erzielt –, aber ich spürte wohl, wie unsere Fühlung bald nachließ und vager wurde. Schon waren sie in neue Proben eingespannt und hatten sich einem anderen Seelenführer anvertraut.
Zwei- oder dreimal hatte ich mir die Vorstellung noch angesehen, aber es hatte mich nur gequält. Ich war nicht imstande, eine nützliche Abendkritik zu machen. Ja, es fiel mir sehr schwer, aus dieser engen, bewegten Gemeinschaft, in die ich mich begeben hatte, so plötzlich wieder ausgeschieden zu sein und vollkommen alleine zurückzubleiben. Ich fühlte mich hundeeinsam. Von bitterer Enttäuschung, von süchtiger Anhänglichkeit gleich stark geplagt, verfolgte mich meine erste größere Theaterarbeit mit den zwiespältigsten Nachwirkungen. Immer, wenn ich unterwegs war und ringsum die blöde Gegenwart erblickte, kamen mir in dichten, abgerissenen Schwaden die dunkelsten und schwierigsten Tage der langen Proben in den Sinn, und es regnete dann noch einmal all die schreckenerregenden Vorzeichen, die tausend Widrigkeiten, Infamien und Wechselfälle auf mich hernieder, die ich hatte ertragen müssen, und jedesmal war es so, als stünde mir das Ganze erst noch bevor. An die spätere, dann doch eher sieghafte Schlußphase erinnerte ich mich dagegen sehr viel seltener. Nein, Erinnerung war es ja nicht, meine Nerven käuten wieder, es war die reine Vergegenwärtigung. Oder um es mit einem Lieblingswort der Theaterleute zu sagen: Zustände ließen mich Furcht und Krise dieser Tage in ungemilderter Augenblicklichkeit noch einmal erleben. Gewiß war auch dies eine Spätfolge des ungewohnten und absonderlichen Zeitmaßes der Wiederholung, welches das Theater beherrscht und dem ich mich wochenlang unterworfen hatte. Diese beschwörenden Wiederholungen, die gleichwohl Stück um Stück etwas zutage befördern, entstehen lassen oder auch nur etwas zurückgewinnen wollen, das vielleicht ganz zu Anfang, auf den ersten Proben bereits ›da war‹, zum Greifen nahe, , jedoch nur im glücklichen Vorschein. Oft genug sorgt ja eine ganze langwierige Inszenierung einzig dafür, daß am Ende die überraschende Höhe des , der Anfang selber wiedergefunden, erfüllt und festgehalten wird. Das klingt wahrhaftig leichter als es ist. Ich kann es bezeugen. Mir jedenfalls fiel es sehr schwer, mich in der nötigen Geduld zu üben und in die runde Zeit hineinzufinden, oder sagen wir: in die spiralförmige, die keinen unumwundenen Fortschritt kennt und gegen die gerichtet am Theater selbst der heftigste Überschwang, die erhellendste Idee, der eisernste Wille nicht das geringste vermögen.
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!