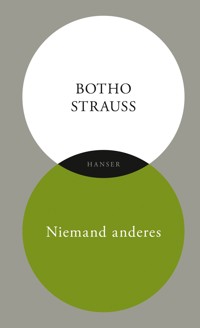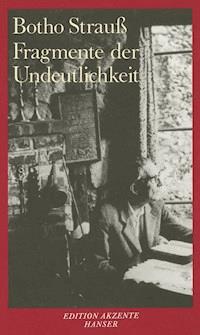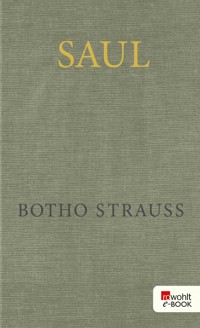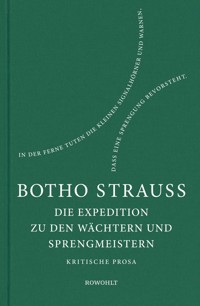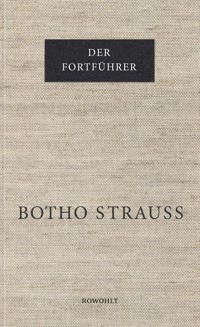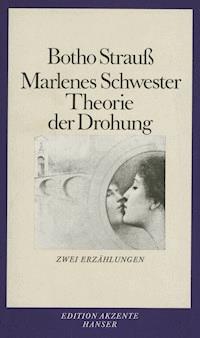Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Hanser, Carl
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Botho Strauß erzählt, wovon er noch nie erzählt hat: von seiner Kindheit und Jugend in den 40er und 50er Jahren, von Naumburg und Bad Ems, den Orten, in denen er aufgewachsen ist, von seinen frühen, prägenden Erinnerungen. Mit diesem Buch findet er noch einmal zu einer ganz neuen Seite seines Schreibens: zum Ton des Erinnerns, der Vergewisserung über die eigenen Ursprünge. Die Jugend ist die Zeit, da die Zukunft einem noch bevorsteht; jetzt lässt Strauß eine lang zurückliegende Gegenwart wiedererstehen. Vor allem ist es der Vater, dessen Bild immer deutlicher hervortritt, liebevoll gezeichnet, doch ohne Selbsttäuschung. Botho Strauß‘ "Herkunft" ist das konzentrierte, reiche Werk eines großen Erzählers aus Deutschland.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 100
Veröffentlichungsjahr: 2014
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Hanser E-Book
Botho Strauß
HERKUNFT
Carl Hanser Verlag
ISBN 978-3-446-24789-5
Alle Rechte vorbehalten
© 2014 Carl Hanser Verlag München
Satz im Verlag
Einband: Peter-Andreas Hassiepen, München
Unser gesamtes lieferbares Programm
und viele andere Informationen finden Sie unter:
www.hanser-literaturverlage.de
Erfahren Sie mehr über uns und unsere Autoren auf www.facebook.com/HanserLiteraturverlage oder folgen Sie uns auf Twitter: www.twitter.com/hanserliteratur
Datenkonvertierung E-Book:
Kreutzfeldt digital, Hamburg
Kapitel I
Der Vater sitzt an seinem Schreibtisch, sieht hinunter auf den Fluß, den Kurgarten, ist immer zuhaus von früh bis spät, unterbricht die Tagesarbeit nur zu den Mahlzeiten und zum Mittagsschlaf. Natürlich, das Kind darf oder soll ihn nicht stören, aber dafür ist er auch immer da, immer in der Nähe, man hört seine Schritte im Flur, man wird mitgetragen von seinem akkuraten Regelwerk. Er ist kein Schriftsteller. Er erstellt Gutachten für die pharmazeutische Industrie, prüft, ob dieses oder jenes Präparat, das eine Firma auf den Markt zu bringen wünscht, den Gesetzen der Gesundheitsbehörde entspricht. Auch entwickelt er selbst Arzeneien, kosmetische und medizinische, Tinkturen und Dragees. Stellt Rezepturen zusammen (er ist approbierter Apotheker und promoviert in Chemie), die er dann an kleinere Arzneimittelfirmen verkauft. Er möchte am liebsten »auf Lizenzbasis« bezahlt werden. Aber das gelingt ihm nur selten, und meist wird schlecht oder betrügerisch abgerechnet.
Es schwebt ihm vor: Lizenzbasis, das ist etwas Ähnliches wie Tantieme, denn er verehrt die Schriftsteller und schreibt selbst ein ausgefeiltes, zuweilen etwas überschmücktes Deutsch. Und wenn das »Werk«, das neue Arzneimittel, einschlägt, erfolgreich ist, dann kann die Familie später einmal davon leben. Denn dem galt seine tägliche Mühe: Ich Alter, Freier und Unabhängiger, wie versorg ich Frau und Kind?
Was sollte älter und gültiger sein als Pflanzenheilkunde? Mein Vater hätte sich darauf verlassen können, selbst in einer Zeit, da jedermann nur zu den allopathischen Heilmitteln griff, die in den fünfziger Jahren den Markt überschwemmten. Trotz des zutiefst Hergebrachten und der beständigen Weisheit seiner Materie kamen ihm laufend Neuerungen in die Quere, aktuelle Entwicklungen, vor allem, seiner Meinung nach, unbotmäßige, absurde Gesetze des Gesundheitsministeriums.
Von seinem Schreibtisch aufschauend, begegnete ihm zuerst die Kuppel des Kursaalbaus, in der die Lesehalle untergebracht war. Dann drüben auf der anderen Lahnseite der Wasserturm mit seiner schiefergedeckten Spitze und dem vergoldeten Wetterhahn. Dahin wird sich sein Blick jedesmal verloren haben beim Nachsinnen. Und unten immer der Fluß, davor die gestutzten Platanen im Kurpark. Wie schön gewohnt, wie gut geschaut! Beiseite der großen Verkehrsadern des Landes zwischen Köln und Frankfurt, in einer kleinen Stadt, einem historischen Badeort, Ems.
Ich beobachtete die Morgentoilette meines Vaters, wenn ich ausnahmsweise im elterlichen Schlafzimmer übernachtet hatte, vielleicht weil die Mutter verreist war und Verwandte besuchte. Lindgrüne Voluten rahmten den Kleiderschrank, das Bettgestell und den Spiegel. Die ganze Einrichtung war Mitte der dreißiger Jahre von einem Naumburger Schreiner zur Hochzeit meiner Eltern angefertigt worden. Der Vater stand vor dem hohen drehbaren Ankleidespiegel und band die Krawatte, mühte sich mit den Manschettenknöpfen, oft unter Flüchen. Dabei rauchte er seine Morgenzigarette der Marke »Finas«. Auf einem Fußschemel wurde der Strumpf mit einem Halteriemen befestigt. In den Krawattenknoten wurde eine Nadel mit Perle gesteckt. Dies war damals schon aus der Mode, und ich fand es so affig und eitel, daß ich häufig gegen diese Marotte protestierte. Ich wollte meinen Vater gewöhnlicher haben, er sollte nicht auffallen, nicht vornehm sein, sondern ein schmuckloser Mensch von heute. Die Väter aller meiner Kameraden waren so viel normaler als der meine, der sich in Kleidung und Körperpflege hervortat und die meisten seiner Mitmenschen der Ungepflegtheit zieh. Am Leben in der Gegenwart, nicht zuletzt weil sie ihm berufliche Erfolge versagte, konnte er wenig Gefallen finden. Die Morgentoilette war das unverzichtbare Zeremoniell einer häuslich-heroischen Selbstbehauptung. Es ging darum, Figur zu machen, sich abzuheben von den gewöhnlichen Zeitgenossen, die sich vernachlässigten. Er arbeitete, solange ich ihn wahrnahm, in der eigenen Wohnung und setzte sich stets sorgfältig gekleidet an den Schreibtisch. Jeden Morgen folgten auf das ausgiebige Bad mit Kopfwäsche die Naßrasur und das Beschneiden von Fuß- und Fingernägeln. Vor dem Bad wurden zehn Minuten lang am offenen Fenster gymnastische Übungen gemacht. Die Haare wurden mit Brisk leicht gefettet und glatt gebürstet sowie mit einem rechten Scheitel geteilt. (Er mußte zu seinem Verdruß zum Frisör gehen, denn dieser kam nicht mehr wie zu besseren Zeiten ins Haus.) Der Tageslauf war streng geregelt und der Uhr unterworfen. Kurz nachdem ich aus dem Bett geholt wurde und ins Bad durfte, begann sein Morgenspaziergang. Darauf folgte das Frühstück, dann der Arbeitstisch. Noch heute fühle ich oft seine von der frischen Luft gekühlte Haut an meinem schlafwarmen Gesicht bei der Morgenbegrüßung, wenn ich einmal später zur Schule mußte und er schon vom Spaziergang zurückkam. Und wenn es kalt draußen war, dann tränte sein Auge stark.
Die Behausung und die bergenden Zeremonien, sie sind für den einzelnen zuweilen das, was die Institutionen für die Gemeinschaft bedeuten; diese Regeln, die man durchaus nicht als leer ansehen mag, da sie offenkundig die Selbsterhaltungskräfte stärken. Gegen halb eins das Mittagessen. Häufiges Nörgeln über die Eintönigkeit des Wochenspeiseplans. Anschließend Lektüre der Tageszeitung (»Die Welt«, weil dort im Feuilleton regelmäßig »Caliban« alias Willy Haas schrieb), Einnicken auf dem Sofa, sitzender Mittagsschlaf. Niemand durfte zwischen eins und drei anrufen. Telefon und Türklingel wurden abgestellt, und an die Wohnungstür wurde ein kleines Schild gehängt: »Von eins bis drei wird nicht geöffnet.«
Gegen halb drei, manchmal um drei, höre ich Geschirr in der Küche klappern: der Vater bereitet sich den Kaffee (die Mutter ruht zu dieser Stunde noch im Bett, sie hat sich, solange die Haushaltshilfe fehlte, erst nach dem Küchenabwasch hinlegen können). Der Vater bringt, sofern wir uns gut verstanden, den Kaffee nach vorn zu mir ins Zimmer. Ich unterbreche die Schularbeiten oder die Lektüre, und er trinkt, an meinem Fenster sitzend, seine Tasse. Wir sprachen dann miteinander über alles, was uns gerade beschäftigte. Er gab seine Meinungen oder kritischen Kommentare zu meiner Lektüre oder den von mir bevorzugten Musikstücken. Es war die Tageszeit, nach dem Mittagsschlaf, in der er am mildesten gestimmt war. Viele Fragen habe ich meinem Vater gestellt und habe immer gute Antworten bekommen. Obwohl ich als Heranwachsender für ihn kein Verständnis aufbrachte und er für meine Zeit nicht, habe ich immer versucht, bedürftig, begierig versucht, ihn zu einer Übereinstimmung wenigstens mit einigen der Bücher zu bewegen, an denen mein Herz hing. Wenn mir dies hin und wieder gelang, wenn zum Beispiel ein Stück von Brecht seine Anerkennung fand, kamen mir die Tränen vor Glück, vor sieghafter Harmonie. Als ließe sich doch zwischen uns alles einen …!
Thomas Mann war nicht nur sein bevorzugter Autor (namentlich der frühe der monarchistischen Phase), sondern auch ein Stimmungsverwandter in der Betrachtung geschichtlichen Lebens, das im Falle meines Vaters an Aufstieg und Niedergang von Reichen mehr aufwendete, als gewöhnlich einer Generation zugemutet wird. Er belieh ihn auch stilistisch. Andererseits zeigte kürzlich die Lektüre einiger Briefe, die er der Mutter und mir 1964 nach Pontresina schickte – die Reise war ein Geschenk für mich zum bestandenen Abitur –, daß er auch ein sehr sicheres, gewandtes und unmanieriertes, sehr ansprechendes Deutsch schreiben konnte. Daneben verriet er eine fatale Neigung zu harmloser Heiterkeit in der Literatur. Immer wieder hat er mir die Schnurren eines Rudolf Presber ans Herz gelegt, mit denen ich aber zu keiner Zeit irgend etwas anfangen konnte.
Die Schriften des Vaters habe ich nie lesen wollen. Weder sein einziges Buch mit dem Titel »Nicht so früh sterben!« noch die polemischen Aufsätze in seiner »kritisch-satirischen Monatsschrift«, die erst »Der Kompaß«, später »Enthüllungen« hieß und die er nach Krausschem Vorbild allein verfaßte, herausgab und an seine interessierte Klientel versandte. Es waren zweihundert bis dreihundert Stück im Monat, die meine Mutter eintüten und frankieren mußte. Später wurden die Interessierten immer weniger, die satirische Feder des Vaters bekam eine splittrige Spitze, das Heftchen wurde mit Artikeln aus alten Nummern gefüllt.
Er las mir hin und wieder etwas daraus vor und mußte ertragen, daß ich mich von seinen reaktionären Bosheiten abgestoßen fühlte. Daß ich auf seine schriftstellerische Tätigkeit nichts gab, wird ihn besonders gekränkt haben. Denn ich war schließlich durch ihn zum Leser erzogen worden.
Der Philosoph, dem er am meisten folgen konnte, war – damals weiß Gott nicht außergewöhnlich – Ortega y Gasset. »Li, hör mal zu«, sagte er zu meiner Mutter abends, wenn sie nebeneinander auf dem Eßzimmersofa saßen, sie mit einer Illustrierten, der Vater mit dem »Aufstand der Massen«. Dann las er eine Seite vor und versuchte die Mutter mit etwas anspruchsvolleren Gedanken zu beschäftigen. Darüber kamen sie beide in ein Sinnieren und Vermuten über allerlei berufliche und familiäre Dinge.
Ich wundere mich, wie diese frühe Prägung nun, da ich längst selber ins »Alter des Vaters« eintrat, langsam, aber unerbittlich ihre Wirksamkeit entfaltet. Die Strenge des Vaters, sogar einzelne seiner Ansichten steigen wie eigner Erfahrungsbestand ins Bewußtsein. Man altert, trotz der sozialen Bedeutungslosigkeit von Tradition, immer noch geradewegs in das hinein, was man einst als rettungslos veraltet empfand. Vielleicht sucht man auch nur die letzten Spuren einer Überlieferung für sich selbst zu sichern, und dann tut sich auf einmal unter dem klapprigen, zugigen Verschlag einer deutschen Nachkriegsherkunft ein festerer Boden auf, als man ihn bei den späteren geistigen Landnahmen je unter die Füße bekam.
Heute, am 9. April 1990, hätte der Vater seinen hundertsten Geburtstag gefeiert.
Hundert Jahre ist es nun her, daß mir dies Schicksal entstand. Was hätte ich ihm diesmal geschenkt? Eine Schachtel Zigarren der Marke »Europa«. (Jetzt steht noch eine bei mir, gefüllt mit Wäscheklammern.) Was werden wir tun, heute an deinem Ehrentag? Nun, Hundertjähriger, du wirst deine Geschenke betrachten, die Blumen bewundern, die zwei Gratulantenbriefe lesen, der eine von der Schwester Martha und der andere vom Schwager aus Gladbach. Die übrigen beruflich, Klientengrüße, aber auch regelmäßig Präsente darunter, ein Baumkuchen wie jedes Jahr aus dem Schwarzwald. Dann gehst du wie alle Tage an deinen Tisch und nimmst die Arbeit auf. Zu Mittag dein Lieblingsessen, Pfannkuchenrollen mit Fleischfarce und grünem Salat. Vielleicht nach dem Mittagsschlaf ein wenig länger in die Sonne blinzeln. Später gibt es Kuchen, und Frau Landes, die Nachbarin vom Modehaus Landes, schenkt eine Garnitur Taschentücher aus dem besseren Sortiment.
Ein geschliffener Stein, ein Achat stand die letzten Jahre auf seinem Tisch, ein Geburtstagsgeschenk meiner Mutter. Eingelassen darin das Geschoß, das Projektil mit der abgebogenen Spitze, das in einer Gefechtsnacht 1916 oberhalb der Nasenwurzel die Stirnwand des Vaters durchschlug und das linke Auge zerstörte. Sein Verwundungstag wurde in der Familie jährlich mit Blumen und einem guten Essen begangen. Unter dem Stein, dem Andenken, liegt jetzt ein Zettel mit seinen letzten handschriftlichen Zeilen. Der zittrige Titel-Entwurf zu einem volksmedizinischen Nachschlagewerk: »Der große Schwindel mit den Arzneimitteln«. Ein Aufklärungsbuch für die Massen, an deren Wohlergehen ihm in Wahrheit wenig lag.
Ich habe deinen Tod nicht zu mir genommen damals, im Jahr des Aufbruchs, 1971. Ich war zum Vorwärtsblicken unterwegs, und die Trauer beugte mich nicht. Ich dachte auch, er käme dir recht. Ich sah, daß du zuletzt genug hattest und dir das Leben zu schwer wurde. Sicher, nur um mich vor dem Angriff des Schmerzes abzuschirmen, habe ich dich für erlöst erklärt. Erst langsam bin ich dann hineingewachsen in deinen Tod und diesen umfassenden Sinn für Vermissen. Er wurde der eherne Ring, der mein Bewußtsein umschloß. Wenn ich dich sehe in all deinem Tod, nur noch erschöpfte Seele und gutmütig, als hätte die Unterwelt dir den Verstand und die Bosheit geraubt. Du einzige Quelle meiner Erinnerung! Nie hätte ich mich irgendeines Geschehens erinnert ohne deine Schule der Erinnerung. Alles, was war, wurde überhaupt Gewesenes durch dich. Aber an deinem Geburtstag laß uns nicht weiter vom Tod reden, sondern von den fröhlichen Tagen, als du ein Junge warst und mit deinen Brüdern im Vierer auf der Saar gerudert bist. Denn an Flüssen und mit den Flüssen haben wir immer gelebt, Saar und Saale und später gemeinsam die Lahn. Sie sind es, die uns das Leben an Ort und Stelle so schwer machten.