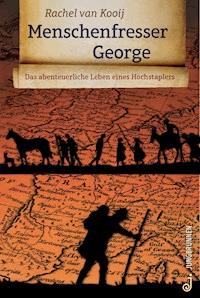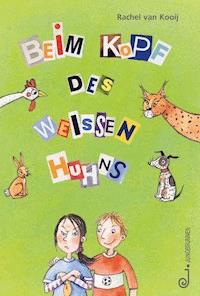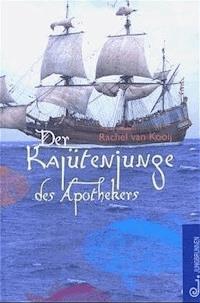
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Jungbrunnen
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2005
Im Herbst 1628 segelt eine Flotte der Vereinigten Ostindien Kompanie von Holland aus zu den Ostindischen Inseln. Die Batavia, das Flaggschiff, erreicht ihr Ziel nicht. Vor der australischen Küste läuft sie auf ein Riff und sinkt. Mit an Bord ist der 16-jährige Kajütenjunge Jan, der vom gerissenen Unterkaufmann Cornelis subtil unter Druck gesetzt wird. Als die Batavia sinkt, segeln der Kapitän und der Oberkaufmann Fransisco Pelsaert in einem Rettungsboot weiter, um Hilfe zu holen. Die anderen Schiffbrüchigen retten sich auf eine kleine Inselgruppe. Doch die neu gewonnene Sicherheit ist trügerisch. Cornelis reißt die Macht an sich und errichtet eine Schreckensherrschaft, der niemand entkommen kann. Auch Jan wird in den Strudel aus Unterdrückung und Gewalt hineingezogen. Am Ende kämpft er nur mehr darum, am Leben bleiben zu dürfen. Der Roman beruht auf einer wahren Begebenheit.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 364
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Rachel van Kooij
Der Kajütenjunge des Apothekers
Rachel van Kooij wurde 1968 in Wageningen in den Niederlanden geboren. Im Alter von zehn Jahren übersiedelte sie nach Österreich. Nach der Matura studierte sie Pädagogik und Heil- und Sonderpädagogik an der Universität Wien. Rachel van Kooij lebt in der Nähe von Wien und arbeitet als Behindertenbetreuerin.
Bei Jungbrunnen sind folgende Titel erschienen: Das Vermächtnis der Gartenhexe (2002), Kein Hundeleben für Bartolomé (2003), Nora aus dem Baumhaus (2007), Klaras Kiste (2008) und Eine Handvoll Karten (2010).
Rachel van Kooij
Der Kajütenjunge des Apothekers
Jungbrunnen
ISBN 978-3-7026-5823-6
Covergestaltung: Maria Blazejovsky
Coverfoto: Jaap Th. Roskam
© Copyright 2005 by Verlag Jungbrunnen Wien
Alle Rechte vorbehalten
Ebook: Satzweiss.com Print, web, Software GmbH
Vorwort
Im Herbst 1628 segelte die Flotte der Vereinigten Ostindischen Kompanie von Holland aus zu den Ostindischen Inseln (Indonesien), um dort Gewürze einzukaufen. Die Batavia, das Flaggschiff, erreichte nie ihr Ziel. Die Ereignisse rund um den Schiffbruch wurden schon wenige Jahre später bekannt als die „Unglückliche Reise der Batavia“.
Dieses Buch erzählt die Geschichte von Jan, der als Kajütenjunge mitfuhr. Seine Erlebnisse beruhen weitgehend auf den historischen Fakten, wie sie in Batavias Graveyard (Der Untergang der Batavia) von Mike Dash und Voyage to Disaster von H. Drake-Brockman recherchiert wurden. Diesen zwei Autoren bin ich zu großem Dank verpflichtet. Ebenso waren mir die Bücher Die Reise nach Batavia von Peter Kirsch, Leven, werk en rebellie aan boord van Oost-Indievaarders (Leben, Arbeit und Rebellion an Bord der Ostindienfahrer) von Herman Ketting und Zwarte Peper, Scheurbuik (Schwarzer Pfeffer, Skorbut) von Vibeke Roeper eine große Hilfe bei der Beschreibung des Lebens an Bord.
Vieles an Bord eines historischen Segelschiffes ist heutzutage nur mehr in Fachkreisen bekannt. Um die Geschichte leichter lesbar zu machen, sind am Ende des Buches die wichtigsten Begriffe erklärt.
Personen am Schiff und ihre Aufgaben
(soweit sie im Buch genannt werden)
Personen am Achterdeck
(sie wohnten in der Regel in Hütten und bekamen besseres Essen)
Oberkaufmann (Francisco Pelsaert): Er hatte den höchsten Rang am Schiff und war für alles verantwortlich
Unterkaufmann (Jeronimus Cornelis): Stellvertreter des Oberkaufmannes
Assistenten (u. a. Andries de Vries, Gisbert Bastiaen, David Zevanck) und Sekretär (Salomon Deschamps): Sie unterstützten die Kaufmänner bei der Arbeit als Schreiber und Buchhalter
Kapitän Jakobs: war für das Schiff (Steuerung, Mannschaft) zuständig
Steuermänner: Stellvertreter des Kapitäns
Prediger (Hendrick Bastiaen): war für die Seelsorge an Bord zuständig
Passagiere
Maria Bastiaen: Frau des Predigers
Judith: älteste Tochter des Predigers
Wilhelmine, Agnes, Hannes, Peter und Roland: Kinder des Predigers
Wibrecht: Dienstmagd des Predigers
Käthe Jans: wohlhabende Dame, die nach Ostindien zu ihrem Mann fuhr
Schwänchen: Dienstmagd von Käthe Jans
Personen am Orlopdeck
Hochbootsmann: war für die Matrosen verantwortlich
Profos: Polizist
Kadetten (u. a. Gisbert von Welderen, Konrad von Hüsen): unterstützten den Profos, bewachten die Kisten mit Geld und Juwelen, „Leibwächter“ für die Kaufmänner
Chirurg: behandelte die Kranken
Handwerker: An Bord gab es Zimmermänner, Segelmacher, Schmiede, Fassbinder ...
Matrosen (Bootsmänner): verrichteten die Arbeiten an Deck. Je nach Ausbildung und Erfahrung waren sie für verschiedene Bereiche zuständig: Rudergänger für die Bedienung des Ruders, Schiemänner für den Mast (Segel und Taue), Kanoniere für die Geschütze
Schiffsjungen (u. a. Abraham): mussten die niedrigsten Arbeiten machen (Deck schrubben etc.)
Bottelier: verwaltete die Vorräte auf dem Schiff
Koch: bereitete in der Kombüse (Küche) die Mahlzeiten zu
Kajütenjungen (Rogier und Jan): waren für die Bedienung der Kaufmänner, Assistenten, des Kapitäns und der Passagiere zuständig
Personen auf der Kuhbrücke
Korporal: beaufsichtigte die Soldaten
Unterkorporal: Stellvertreter des Korporals
Soldaten (Wiebbe, Walter, Mattis u. a.): Sie fuhren auf der Batavia mit, um in Ostindien die Handelsstützpunkte zu verteidigen
Passagiere
Anna (Soldatenfrau) und ihre Tochter Hilde
Ausgestoßen
Es klopfte an der Tür. Jan schaute fragend von seinen Studierbüchern auf. Onkel Wilhelm nickte ihm zu. Jan sprang auf. Er war erleichtert, das schmale Wohnzimmer verlassen zu können und der Gegenwart des Onkels zu entkommen, auch wenn es nur für ein paar Augenblicke war.
Vor der Tür stand ein junger Mann, der ein Bündel Briefe in der Hand hielt.
„Wohnt hier Herr Berend?“ Er hatte einen flämischen Akzent. Jan nickte.
„Möchten Sie etwas übersetzen lassen?“, fragte er höflich.
„Nein. Ich hätte eine Bitte vorzutragen“, antwortete der junge Mann ein wenig verlegen.
„Ein Bittsteller“, dachte Jan. Der Onkel würde ihn abweisen. Er musterte den Fremden genauer. Obwohl es Herbst war, trug dieser keinen Mantel, sondern nur ein fleckiges Wams über dem Hemd. Der Fremde musste frieren. Jan hatte Mitleid.
„Ich werde fragen, ob er Sie empfangen kann“, sagte er. Vielleicht würde Onkel Wilhelm dieses Mal eine Ausnahme machen. Arbeit gab es genug.
„Ich werde warten.“ Der junge Mann lächelte ihn dankbar an. Jan rannte ins Wohnzimmer zurück. Onkel Wilhelm zog die Augenbrauen hoch.
„Wer ist es?“, fragte er. „Ein Kunde?“
„Ich weiß es nicht“, antwortete Jan, und sein Gesicht glühte, wie immer, wenn er eine Lüge erzählte. „Er hat Briefe in der Hand.“
„Eigentlich habe ich genug zu tun“, murmelte Onkel Wilhelm und erhob sich behäbig von seinem Lehnstuhl.
„Andries, Andries de Vries“, stellte sich der junge Mann vor.
„Ich habe in Brüssel studiert. Ich beherrsche Latein, Spanisch, Französisch und sogar ein wenig Portugiesisch und Englisch.“ Jan sah, wie Onkel Wilhelm geringschätzig seine fleischigen Lippen zu einem dünnen, harten Strich zusammenpresste.
„Und ich habe Referenzen aus Brüssel, Gent und Antwerpen.“ Der junge Mann streckte Herrn Berend eifrig die Briefe entgegen. Onkel Wilhelm nahm sie nicht in die Hand.
„Herr von Holt schickt mich zu Ihnen. Er meint, Sie hätten gewiss Arbeit für einen fleißigen, verlässlichen Übersetzer“, versuchte Andries de Vries es nochmals.
„Herr von Holt ist Onkels bester Kunde. Er wird ihn nicht verärgern wollen. Wenn der Onkel den Fremden nun anstellt“, dachte Jan aufgeregt, „dann könnte er für mich eine Lehrstelle bei einem Kaufmann finden. Das hat er mir doch versprochen.“ Aber Onkel Wilhelm schüttelte entschieden den Kopf.
„Herr von Holt ist zwar ein guter Kunde, nein ein Freund, aber er ist wohl noch nicht informiert, dass ich seit einigen Wochen meinen Neffen als Gehilfen bei mir aufgenommen habe.“
„Vielleicht nur für ein paar Stunden gegen Kost und Unterkunft?“ Der junge Mann blickte Herrn Berend flehentlich an. „Ich weiß nicht mehr wohin. Überall habe ich es bereits versucht. Ich habe mein letztes Geld ausgegeben“, gestand er verschämt.
„Onkel, damit machst du doch ein gutes Geschäft“, mischte sich Jan ein. „Herr de Vries könnte bei mir im Dachzimmer schlafen.“
„Es tut mir Leid, junger Mann. Ich kann Ihnen keine Stellung anbieten“, erwiderte Onkel Wilhelm förmlich.
Jan blickte dem Bittsteller nach, als dieser im kalten Nieselregen langsam den Kanal entlangging.
„Steh nicht herum. Mach die Tür zu und komm zurück zu deinen Studien, Junge. Wir haben zu tun“, rügte ihn Onkel Wilhelm. „Und beim nächsten Mal kannst du so jemanden gleich fortschicken.“
„Aber du hast doch genug Arbeit, und ich bin dir keine Hilfe.“
„Noch nicht, Jan. Aber das wird werden“, antwortete Onkel Wilhelm selbstgefällig.
„Aber bis dahin“, drängte Jan. „Ich könnte ihm nachlaufen.“
„Dieser Habenichts soll sein Glück woanders versuchen. Ich lass mir nicht die Butter vom Brot stehlen“, brummte Onkel Wilhelm.
„Er war doch schon überall“, beharrte Jan.
„Dann soll er zur Kompanie gehen. Wer ein wenig Bildung hat und bereit ist, nach Ostindien zu fahren, findet dort Unterschlupf als Sekretär oder Kaufmannsassistent. Und jetzt komm ins Zimmer und beuge deine Nase über die Bücher! Du kannst mir dankbar sein, dass ich mir die Mühe nehme, dein Lehrmeister zu sein, und dir das erspart bleibt“, schnauzte er Jan an.
„Dankbar!“, empörte sich Jan. Niemals würde er seinem Onkel dankbar sein.
Bis vor vier Wochen hatte er nicht einmal gewusst, dass es diesen Herrn Berend, einen selbst ernannten Privatgelehrten aus Amsterdam, gab. Jan beugte sich widerwillig über die Wörter, die er abschreiben sollte.
„Wie in einem Gefängnis lebe ich, mit Büchern als Mauern und Onkel Wilhelm als Kerkermeister“, dachte er verbittert.
Die einzigen Augenblicke der Freiheit waren kurze Ausflüge in die Stadt, wenn er die Übersetzungen von Onkel Wilhelm bei den Kaufmännern abliefern musste. Dann strolchte Jan, die Schriftstücke in einer Mappe unter dem Arm, durch die vollen Gassen, in denen sich Menschen, Handkarren und Kutschen stauten. Auf den Märkten herrschte ein Durcheinander von Sprachen. Die Stadt schien überzugehen vor Menschen aus den verschiedensten Ländern. Auf den Kanälen fuhr ein unablässiger Strom von Treidelschuten, Leichtern, Jollen und Ruderbooten, beladen mit Menschen und Gütern. Am Stadtrand wurden im Eiltempo neue Kanäle gegraben, das sumpfige Gelände dazwischen wurde trocken gepumpt und mit Erdreich und Kies, in den Hunderte Holzpfähle eingelassen waren, aufgefüllt. Auf diesen Stützen wurden Straßen und Gebäude errichtet. Jan konnte stundenlang am Rand eines Kanals stehen und zusehen, wie ein ganzes Stadtviertel mit prächtigen Herrenhäusern für reiche Bürger auf diese Weise neu entstand.
Es störte ihn nicht, wenn er viel zu spät in das kleine Haus am stillen Kanal zurückkehrte und mit Vorwürfen überhäuft wurde. Er hörte kaum hin und setzte sich, als ob nichts gewesen wäre, an den Tisch, schlug eines der Bücher auf und las dort weiter, wo er aufgehört hatte.
Im stillen Zimmer schienen auch an diesem Tag die Stunden endlos. Verstohlen blickte Jan von Zeit zu Zeit zu seinem Onkel hinüber. Dieser saß regungslos in seinem bequemen Sessel, die Hände über dem dicken Bauch gefaltet.
„Worüber er wohl nachdenkt?“, überlegte Jan.
Endlich läuteten die Abendglocken. Sofort schlug Jan die Bücher zu. „Soll ich den Tisch für das Nachtmahl decken?“, fragte er.
„Noch nicht.“ Onkel Wilhelm stand auf und ging im Zimmer auf und ab. Dann blieb er vor Jan stehen.
„Ich bin zu einem Entschluss gekommen. Dieser Bittsteller hat es mir wieder bewusst gemacht, dass ich mein Leben nicht an Kaufmannsbriefen vergeuden möchte“, verkündete er pompös. „Ich habe ein wenig Geld gespart und kann es mir leisten, die nächsten Monate nur mehr der Wissenschaft zu dienen.“
„Mein Geld“, schoss es Jan durch den Kopf, und in seinem Bauch brodelte wieder die aufgestaute Wut.
„Ab heute nehme ich keine neuen Aufträge mehr an“, fuhr Onkel Wilhelm fort.
Er zeigte auf einige Akten auf dem Tisch.
„Das sind die letzten Stücke. Wenn ich sie übersetzt habe, und du sie ausgeliefert hast, zieht in diese Stube die Philosophie ein.“ Er rieb sich vergnügt die Hände.
„Schrecklich“, dachte Jan. Er konnte sich nicht vorstellen, Onkel Wilhelm den ganzen Tag gegenüber zu sitzen.
Am Abend, in seinem kleinen Zimmer, traf Jan ebenfalls eine Entscheidung. Wenn Onkel Wilhelm ihm die letzten Briefe gab, würde er davonlaufen. Das Geld, das die Kaufleute ihm für die Übersetzungen gaben, würde er nicht mehr bei Onkel Wilhelm abliefern. Nein, er würde es einstecken, um seine eigene Zukunft zu beginnen.
„Schließlich“, dachte er bockig, „steht es mir zu!“
Seine Gedanken schweiften zurück zu jenem entsetzlichen Tag im September, als weit weg, in Utrecht, sein Vater begraben worden war.
Jan sah sich wieder in der kleinen Dachkammer sitzen. Die Mutter hatte ihn hinaufgeschickt, wie immer wegen einer Kleinigkeit. Jan schluckte das traurige, wütende Gefühl hinunter. Er schloss die Augen und beschwor die Erlebnisse noch einmal herauf. Er hörte die Stimmen der Begräbnisgäste in der Halle. Nur einige wenige hatte Mutter zu sich nach Hause geladen: ihre Verwandten aus Den Haag, Herrn Berend, den Cousin des Vaters, und den Prediger, Herrn von Daalder. Die Mutter hatte sie mit selbstsicherer Stimme in das Wohnzimmer gebeten. Auch die Geschwister durften unten bleiben und mit den Erwachsenen essen. Nur er selbst saß oben, allein und traurig.
In seinen Händen hielt er das verschlossene Kuvert. Der Vater hatte es ihm gegeben, als Jan ihn das letzte Mal am Krankenbett besucht hatte.
„Für dich, mein Junge. Deine Zukunft“, hatte der Vater gekeucht. „Mach es erst auf, wenn es notwendig ist.“
Jan zweifelte. Sollte er den Brief jetzt öffnen? Bevor er es tun konnte, klopfte es an der Tür. Jan steckte den Brief rasch unter das Hemd. Herr von Daalder trat herein. Der Prediger brachte ihm etwas zu essen, eine Scheibe Rosinenbrot mit Butter. Hungrig biss Jan hinein. Herr von Daalder wartete geduldig, bis er aufgegessen hatte.
„Wir müssen etwas besprechen, Jan“, sagte er ernst.
Jan blickte überrascht auf.
„Es geht um deine Zukunft.“
„Ich werde nicht leichtfertig mit Vaters Vermögen umgehen, Herr von Daalder“, versicherte Jan. „Mutter wird mir bestimmt mit klugen Ratschlägen zur Seite stehen, und ich dachte mir, dass ich Herrn Tielsen, den Notar, bitten werde, mir zu helfen, bis ich die Geschäfte richtig verstehe. Vater hat sich auch immer von ihm beraten lassen.“
Der Prediger hüstelte.
„Darum geht es nicht, Jan. Du musst jetzt stark sein und daran denken, dass Gottes Wille manchmal den Menschen seltsam vorkommt, dass diese aber dennoch gehorchen müssen.“
„Ich verstehe nicht, Herr von Daalder.“
„Jan, Gott legt dir eine Prüfung auf. Frau Pelgrom hat beschlossen, dass du ...“ Der Prediger stockte.
„Was möchte Mutter?“
„Jan, dein Vater und ich waren sehr alte Freunde. Wir kannten uns schon als Kinder, und ich weiß wahrscheinlich mehr über ihn, als Frau Pelgrom selbst. Solange dein Vater lebte, war seine Vorgangsweise richtig. Er hat damit wohl ein Unrecht gesühnt, und Gott hat es ihm sicherlich längst verziehen. Aber jetzt, wo er tot ist, hätte auch dein Vater dasselbe gewollt wie Frau Pelgrom. Ihre Entscheidung mag dir unverständlich, hart, sogar ungerecht vorkommen, aber sie handelt richtig. Glaub mir das, Jan. Es ist auch zu deinem Besten.“
In Jans Bauch krampfte sich alles zusammen. Was verlangte die Mutter von ihm?
„Du sollst fortgehen, Jan. Frau Pelgrom möchte, dass du das Haus und die Stadt verlässt.“
Herr von Daalder wich Jans Augen aus.
„Fort“, flüsterte Jan bestürzt.
Der Prediger nickte. „Es ist eine Prüfung. Aber du wirst sie bestehen. Du bist der Sohn deines Vaters, vergiss das nicht.“
„Meine Mutter schickt mich fort? Aber wohin und warum?“
„Nach Amsterdam. Dein Onkel, Herr Berend, wird dich dorthin begleiten und für dich eine gute Ausbildungsstelle finden. Das hat er mir in die Hand versprochen.“
„Amsterdam? Aber das Haus, die Ländereien! Was wird aus Vaters, aus meinem Vermögen? Warum will Mutter das?“
„Jan.“ Der Prediger beugte sich zu dem Jungen. „Jan, frage nicht nach dem Warum. Es würde dich unglücklich machen. Glaube nur fest daran, dass es zu deinem Besten ist. Gehe nun hinunter und verabschiede dich von den Geschwistern und von Frau Pelgrom.“
Betäubt ließ sich Jan aus dem Zimmer führen. Unten im Gang stand Onkel Wilhelm abreisebereit. Er zwinkerte Jan freundlich zu. Der Junge bemerkte es nicht. Sanft schob ihn der Prediger ins Wohnzimmer hinein. Am langen Tisch hinter den Tellern und Tassen saßen die Geschwister, Mutters Verwandte und die Mutter selbst.
„Jan möchte sich verabschieden“, verkündete Herr von Daalder ruhig.
Jan schaute auf die Geschwister, und diese starrten ihn an. Er brachte kein Wort heraus.
Susanne stand auf und rannte zu ihm. Tränen rollten ihre pausbäckigen Wangen hinunter. Sie klammerte sich an den Bruder.
„Geh nicht, Jan.“
Der Prediger beugte sich zu ihr hinunter.
„Jan ist sechzehn Jahre alt, beinahe erwachsen, Susanne. Er muss einen Beruf lernen.“
„Herr von Daalder, haben Sie Jan die Wahrheit erzählt?“ Frau Pelgroms Stimme war kalt und scharf.
Herr von Daalder richtete sich auf und wandte sich zu ihr. „Jan weiß, dass er zu seinem Besten fort muss.“
„Nein“, verlangte Frau Pelgrom. „Belügen Sie ihn nicht. Er soll gehen, weil er die Wahrheit weiß.“
„Frau Pelgrom, wer Hass sät, erntet Tränen. Lassen Sie die Sache auf sich beruhen.“
Die Witwe stand vom Tisch auf und ging zu Jan. Susanne wich ängstlich zur Seite.
„Denken Sie an Ihre Kinder, Frau Pelgrom. Sie haben in den letzten Tagen schon genug erlebt. Sagen Sie nichts, was sie noch mehr verstören würde“, mahnte der Prediger eindringlich.
„Sechzehn Jahre habe ich geschwiegen, Herr von Daalder, sechzehn lange Jahre. Oh ja, mein Schweigen wurde erkauft mit einem schönen, neuen Haus, mit Geld, das mein Mann mir großzügig gab, damit ich in Komfort leben konnte. Aber all diese Zeit habe ich gelitten, nicht Jan. Ich musste zusehen, wie meine Söhne starben und er lebte. Ich musste dulden, dass die Kinder, die endlich am Leben blieben, Jan als Bruder liebten. Und wenn ich meinen Mann nicht heute zu Grabe getragen hätte ...“
„Frau Pelgrom, versündigen Sie sich nicht“, warnte der Prediger.
„Es ist die Wahrheit und Wahrheit ist niemals Sünde. Mein Mann hat seinen Bastardsohn bevorzugt, und er hätte Jan Pieter und Niclaas um ihr rechtmäßiges Erbe gebracht“, rief sie aufgebracht.
Bastardsohn!
Jan wurde weiß wie eine Wand. Er wusste, was dieses Schimpfwort bedeutete.
Frau Pelgrom lachte schrill.
„Ja, Jan, du bist ein Bastard. Wie der Kuckuck Eier in fremde Nester legt, so hat dein Vater dich mir vorgesetzt. Er hat mich nicht gefragt, nicht gebeten, nur mein Dulden erkauft. Der Spatz weiß nicht, dass der Vogel, der aus dem fremden Ei schlüpft, die eigenen Nachkommen aus dem Nest stoßen wird, damit sie sterben, bevor sie flügge sind. Aber ich wusste es all die Jahre und konnte nichts tun, bis heute.“
„Mutter“, flüsterte Jan und streckte seine Arme aus.
Frau Pelgrom wich zurück.
„Nenne mich nie mehr Mutter, und jetzt verschwinde.“
Susanne und Gretchen waren in die Ecke des Zimmers hinter Vaters Lehnsessel geflüchtet. Ihr Schluchzen füllte den Raum. Niclaas saß auf seinem Stuhl und schaute von einem zum anderen. Er verstand nicht mehr, als dass Jan etwas sehr Böses getan haben musste.
Der Prediger schob Jan wortlos aus dem Zimmer hinaus in den Gang, wo Onkel Wilhelm wartete.
Jan verscheuchte die Bilder aus seinem Kopf.
An diesem Tag hatte er nicht nur seinen Vater verloren, sondern auch seine Mutter, die Geschwister und sein Erbe. Er war nicht Jan Pelgrom de Bye, der erstgeborene Sohn eines erfolgreichen, wohlhabenden Kaufmannes aus Utrecht, sondern ein Bastard. Wer weiß, wer seine Mutter gewesen war, eine Dienstmagd oder gar eine Dirne. Die Scham darüber hatte sich tief in Jan hineingefressen. Und mit der Scham vermischte sich Wut auf jene Frau, die er Mutter genannt hatte, und Enttäuschung über den Vater, der ihm nichts anderes als einen Brief hinterlassen hatte. Der Brief. Jan hatte ihn schließlich, als er mit Onkel Wilhelm in der Herberge saß, geöffnet. Der Umschlag enthielt einen Schuldschein, ausgestellt vom Onkel. Dieser schuldete seinem Vater eine beträchtliche Summe Geldes. Jan hatte nicht recht gewusst, was er mit dem Schuldschein anfangen sollte und hatte ihn Onkel Wilhelm gezeigt. Herr Berend hatte ihn achtlos eingesteckt.
„Keine Angst, ich werde diesen Betrag für deine Ausbildung verwenden“, hatte er rasch gesagt, als er Jans fragenden Blick bemerkte.
„Ich hole mir also nur zurück, was mir zusteht“, dachte Jan trotzig in der Dachkammer. Aber warum fühlte er sich dann wie ein Dieb?
Am Ende der Woche war es so weit. Herr Berend überreichte Jan die Mappe mit den letzten Briefen.
„Richte allen einen respektvollen Gruß von mir aus. Sage ihnen auch, dass ich mich bei ihnen melden werde, wenn ich wieder Zeit habe.“
Jan nahm die Mappe entgegen.
„Und beeil dich diesmal, damit wir heute noch anfangen können. Ich werde diktieren, und du wirst eine erste Niederschrift machen“, rief Onkel Wilhelm ihm, auf der Türschwelle stehend, nach.
Als Jan um die Ecke gebogen war, hielt er inne. Nie wieder würde er in das Häuschen am Kanal zurückkehren. Er war frei. Einen Augenblick lang überlegte er, ob er Onkel Wilhelms Briefe von der nächsten Brücke ins Wasser werfen sollte. Nein, das wäre leichtsinnig. Er brauchte das Geld, bis er eine Stellung gefunden hatte. Er wollte nicht auf der Straße leben und betteln müssen. Ob Onkel Wilhelm nach ihm suchen würde? War es überhaupt möglich, in dieser riesigen Stadt mit den vielen Tausenden Menschen jemanden wiederzufinden? Es gab gewiss Hunderte Jungen, die wie Strandgut ohne Familie und Freunde hier angeschwemmt wurden und auf der Suche nach Arbeit waren. Bis jetzt hatte Jan sich kaum Gedanken darüber gemacht, was er tatsächlich tun würde, wenn er Onkel Wilhelms Haus endgültig verlassen hatte.
Der krumme Gustav
Sechs Tage irrte Jan durch die Straßen und über die Brücken der Stadt auf der Suche nach einer Lehrstelle. Aber niemand wollte ihn. Zu jung, zu klein, zu schmächtig sei er. Und weil er sich hartnäckig weigerte, den Namen seines Vaters zu nennen, begegnete man ihm mit offenem Misstrauen.
„Ich habe keine Eltern“, sagte Jan schließlich. „Nennt mich Jan Bemmel.“ Das war nicht einmal gelogen, denn sein Urgroßvater war ursprünglich aus diesem kleinen Dorf gekommen.
„Wenn du eine Waise bist, brauchst du einen Vormund, und wenn du keinen hast, dann geh dorthin zurück, woher du kommst. Für unsere Waisenkinder gibt es das Waisenhaus. Die Herren Regenten schauen darauf, dass sie gut versorgt werden und eine anständige Ausbildung erhalten. Wenn ich also ein Waisenkind als Lehrling haben wollte, würde ich mich dort umschauen“, meinte ein Sattelmacher, den Jan am Abend des zweiten Tages aufsuchte, nachdem er auf der Straße gehört hatte, dass dieser Lehrlinge aufnahm.
Jan schluckte seinen Stolz hinunter.
„Ich werde auch fleißig arbeiten. Sie werden bestimmt mit mir zufrieden sein“, bat er unterwürfig.
„Warum sollte ich dich nehmen, wenn ich an jedem Finger meiner Hand Söhne von Amsterdamer Bürgern bekommen könnte?“ Der Sattelmacher ließ Jan stehen und wandte sich wieder seiner Arbeit zu. Niedergeschlagen schlich Jan aus der Werkstatt.
Onkel Wilhelms Geld war beinahe aufgebraucht. Wenn er sparte, konnte er noch einen Tag überleben, ohne zu betteln. Aber danach? In der billigen Unterkunft, in der er wohnte, musste er das Bett in einem Schlafsaal am kalten Dachboden gleich für eine ganze Woche im Voraus bezahlen. Dafür reichte das Geld längst nicht mehr.
Mit hängenden Schultern saß Jan auf seiner schmalen Pritsche. Neben ihm schnarchten Burschen und Männer. Es roch nach Schweiß und auch nach Schnaps. Wer hier schlief, verdiente nur genug, um den jeweils nächsten Tag zu überleben.
War das seine eigene Zukunft? Eine schlecht bezahlte Lohnarbeit konnte er überall finden, aber das wollte er nicht. Er wollte nicht so enden wie der krumme Gustav im Bett neben ihm, der zeitlebens nie mehr verdient hatte als die paar Münzen, die er brauchte, um seine Pritsche und sein Essen zu bezahlen. Ein neues Hemd, eine Hose oder gar Schuhe konnte er nur auf Raten bei einem der Gebrauchtwarenhändler erstehen, und Jan konnte sehen, dass es lange her war, seit der alte Mann das letzte Mal dort etwas hatte kaufen können. Je älter und krummer Gustav wurde, desto schwieriger war es für ihn, Arbeit zu finden. In nicht allzu langer Zeit würde der Tag kommen, an dem er seine Pritsche nicht mehr bezahlen konnte. Dann musste er ins Armenhaus gehen oder im Freien schlafen.
„Ich wüsste nicht, was schrecklicher wäre“, hatte Gustav Jan gestanden.
„Nein“, überlegte Jan, „aus mir wird kein krummer Gustav.“ Er brauchte eine richtige Arbeit.
Ein Ausweg blieb ihm noch. Er konnte zur Ostindischen Kompanie gehen und sich dort um eine Stelle auf einem der Schiffe bewerben.
„Sie nehmen jeden mit einem ehrlichen Gesicht“, hatte er gehört.
„Den Gelddiebstahl kann man mir nicht ansehen“, dachte Jan, „und ich werde auch nie wieder stehlen, wenn ich Arbeit habe.“
Am nächsten Tag versuchte Jan, sich unter der Wasserpumpe im Hof möglichst ordentlich herzurichten. Er wusch sich trotz der Kälte die Haare mit einem Stück Seife, das er der Herbergsmutter abgeschwatzt hatte. Auch entfernte er die ärgsten Flecken aus seinen Kleidern, und rieb mit nassen Fingern das Leder seiner Schuhe, damit sie ein wenig glänzten.
„Hast du was vor, Jan?“, fragte der krumme Gustav, der seinen Buckel gegen die Hofmauer lehnte und an einer leeren Pfeife kaute.
„Ich gehe mich bei der Ostindischen Kompanie bewerben.“ „Da wirst du aber nicht der Einzige sein!“, erwiderte Gustav.
„Sie müssen mich nehmen. Ich kann hart arbeiten“, entgegnete Jan eigensinnig.
„Natürlich werden sie dich nehmen. Sie nehmen fast alle armen Schlucker. Wenn die Trommel der Kompanie sie ruft, strömen sie ahnungslos herbei. Sie prügeln und schlagen sich, um zur Musterung zu gelangen. Träume haben sie. Als Matrosen oder gar Schreiber wollen sie anheuern, und genommen werden sie als Kanonenfutter. Und halbe Kinder wie du können nur Schiffsjungen werden, deren Leben in den Augen der Herren weniger wert ist als eine Flasche spanischen Weines im Raum. Die Hälfte dieser armen Teufel kehrt nie wieder in die Heimat zurück, und ich glaube nicht, dass sie freiwillig dort in der indischen Hölle bleiben. Nein, mein Lieber, die sterben wie die Fliegen.“
„Das hat mein Onkel Wilhelm auch gesagt“, bemerkte Jan unwillkürlich.
„Dann ist dein Onkel ein kluger Mann, und wenn du so schlau bist wie er, packst du deine Sachen und gehst zu ihm statt nach Indien“, riet ihm Gustav.
„Das geht nicht“, murmelte Jan abweisend und zog das feuchte Hemd über seine mageren Schultern.
„Hast was angestellt?“ Der alte Mann beäugte Jan neugierig. Dieser wich seinem Blick aus. „So schlimm wird es nicht gewesen sein.“
„Doch. Ich habe sein Geld gestohlen und bin davongelaufen“, gestand Jan. Auf einmal fühlte er sich erleichtert, dass er es jemandem erzählt hatte, auch, wenn es nur der krumme Gustav war. „Deswegen kann ich nicht mehr zurück, und ich will auch nicht. Onkel Wilhelm hatte mir versprochen, eine Lehrstelle zu finden, und er hat es nicht getan. Wie ein Gefangener musste ich bei ihm wohnen, und mein Erbe hat er mir auch genommen. Also habe ich eigentlich ...“
„Du musst dich mir gegenüber nicht rechtfertigen“, meinte Gustav gelassen. „Und wenn du unbedingt zur Kompanie willst, kann ich dir ein paar Ratschläge geben. Ich bin selbst einmal mitgefahren. Einmal und nie wieder!“
„Wirklich?“
„Allerdings. Wenn du mir ein Bier spendierst, erzähle ich dir davon.“
Jan überlegte. Er hatte gerade noch genug Geld für eine Mahlzeit.
„Einverstanden.“
In der Schenke schlürfte Gustav sein Bier und betrachtete den schmalen Jungen mit dem verschlossenen Gesicht. Ein solches Kind sollte nicht mitfahren, aber er würde es ihm nicht mehr ausreden können. Jan würde hier in Amsterdam, auf sich allein gestellt, zu Grunde gehen. Er hatte nicht das Zeug dazu, als Gassenjunge auf der Straße zu überleben. Vielleicht standen seine Chancen auf einem Schiff besser.
Unruhig schaute Jan auf Gustav. Was, wenn dieser nur sein Bier trank, fortging und ihm auf diese Weise ein paar von seinen letzten Münzen raubte?
„Wieso hast du dich beworben bei der Kompanie?“, drängte er. „Das war ein Versehen.“ Gustav kicherte, als ob die Erinnerung daran ihn erheiterte. „Ich war ein Draufgänger, noch ein junger Bursche und ohne Arbeit. Ich hatte Schulden in einer Hafenkneipe, die ich nicht mehr bezahlen konnte. Als der Wirt hörte, dass eine Gruppe von einflussreichen Kaufherren, unterstützt von der Republik, eine Flotte nach Ostindien schicken wollte, zwang er mich, auf einem dieser vier Schiffe anzuheuern, oder er würde mich ins Gefängnis bringen. Was blieb mir anderes übrig, als dem Vaterland Lebewohl zu sagen. Die Kompanie nahm mich mit offenen Händen auf. Es war eine Fahrt ins Ungewisse. Die Schiffe würden mit Truhen voller Silbergeld lossegeln, um irgendwo im fernen Indien Gewürze dafür einzukaufen. Mein Name wurde in den Büchern der Kompanie als Soldat eingetragen. Fünf Gulden monatlich, und Kost und Unterkunft gratis, wurden mir zugesichert. Der Wirt ließ sofort einen Schuldbrief über siebzig Gulden ausstellen, damit beglich ich meine offenen Rechnungen und bekam eine Seemannskiste und eine Ausrüstung. Da musste ich also mehr als ein Jahr arbeiten, ohne auch nur einen Gulden für mich behalten zu dürfen. Aber daran dachte ich damals nicht. Ich war zuversichtlich, am Ende der Reise genug Geld in der Tasche zu haben, um mir eine sichere Zukunft aufzubauen.“
Gustav nahm noch ein Schluck Bier.
„Aber es kam ganz anders. Zwei schreckliche Jahre dauerte die Reise. Viele überlebten die Stürme, die Krankheiten und die Scharmützel mit den Einheimischen nicht. Bei unserer Rückkehr war der Gewürzpreis gefallen. Der Verkauf der Ladung brachte der Kompanie gerade so viel ein, dass sie die Unkosten decken konnte. Das bekam ich auch in meinem Beutel zu spüren.“
„Was hast du mit dem Geld gemacht? Ein Geschäft angefangen oder ein Stück Land gekauft?“, fragte Jan neugierig.
„Dafür hat es nicht gereicht. Außerdem wollten wir nach all den Strapazen das Leben genießen. Meine Kameraden und ich wurden für sechs Wochen Herren. So lange dauerte es, bis wir das Geld verprasst hatten. Ich kaufte mir teure Kleidung, heuerte eine Kutsche an, um mich durch die Stadt fahren zu lassen, nahm mir ein Mädchen und lud zu Festessen ein. Wein und Bier flossen reichlich. Nach sechs Wochen musste ich mein schönes Gewand verkaufen, verließ mich das Mädchen, und ich stand wieder auf der Straße, so arm wie zuvor. Aber ich hatte Glück im Unglück. Ich ließ mich in den Kneipen nicht dazu verleiten, abermals Schulden zu machen. Seitdem habe ich mich als Tagelöhner verdingt und bin zufrieden mit dem, was ich auf diese Weise verdienen kann.“
Gustavs Kehle war trocken nach der langen Erzählung. Er schaute Jan aufmunternd an. Jan ließ den Becher nochmals füllen.
Gustav nahm einen kräftigen Schluck und beugte sich zu Jan hinüber.
„Hör gut zu“, warnte er eindringlich. „Du darfst dich nicht als Schiffsjunge bewerben. Die sind so jung wie du. Aber die meisten überleben die Reise nicht. Sie brechen sich Arme und Beine, weil man sie bei Sturm in die Wanten hinaufschickt und sie herunterfallen. Sie werden über Bord gespült oder gehen als Erste an schrecklichen Krankheiten zu Grunde. Sag, dass du achtzehn bist. Dann bist du für einen Schiffsjungen schon zu alt. Du kannst doch lesen und schreiben und bist was Besseres gewohnt gewesen. Das sieht man dir an. Du musst nach einer Arbeit am Achterdeck fragen. Geh zu den Herren und sei höflich. Sag, du möchtest Kajütenjunge werden. Du weißt bestimmt, wie man bei Tisch Speisen aufträgt, Silber putzt und den Herren dient, sodass sie es bequem haben.“
Jan schluckte. Er sollte ein Dienstbote werden?
„Kann ich mich nicht als Sekretär bewerben?“
Gustav lachte.
„Du musst froh sein, wenn sie dir glauben, dass du zu alt für einen Schiffsjungen bist. Als Kajütenjunge hast du jede Chance. Wenn sie sehen, dass du eifrig und geschickt bist, kannst du dich vielleicht hinaufdienen. Sicherlich war dein Vater ein wohlgestellter Herr. Nenne seinen Namen, wenn du dich bewirbst, das kann dir nur nützlich sein.“
„Niemals“, dachte Jan. „Ich bin Jan Bemmel.“
Gustav trank sein Bier aus.
„Wenn wir uns nicht mehr sehen, viel Glück!“
Er klopfte Jan auf die Schulter und schlurfte davon. Das Bier hatte ihn gestärkt. Vielleicht konnte er heute noch etwas auf dem Markt verdienen.
Die Kompanie
Vor dem riesigen Gebäude der Ostindischen Kompanie am Kloveniersburgwal, einer geschäftigen Straße am Kanal, blieb Jan stehen. Männer hasteten ein und aus. Jan traute sich nicht, durch die große Tür zu gehen.
„He, du stehst im Weg.“ Jan drehte sich rasch um. Diese Stimme hatte er schon einmal gehört. Hinter ihm stand Andries de Vries, der Bittsteller mit den vielen Referenzen. Jan staunte. Der junge Mann hatte sich neu eingekleidet. Hinter Andries de Vries stellte ein Träger eine schwere Seemannskiste ab. Andries de Vries drückte ihm ein paar Münzen in die Hand.
„Herr de Vries, erkennen Sie mich nicht?“, fragte Jan schüchtern.
Der Mann schaute ihn verständnislos an.
„Sie haben vor einer Woche bei meinem Onkel, Herrn Berend, um eine Anstellung gebeten. Ich bin der Junge, der neben ihm gestanden ist.“
„Ach du bist das!“ Andries de Vries klopfte dem Jungen freundschaftlich auf die Schulter, obwohl er sich nur vage an ihn erinnern konnte. „Habe nicht erwartet, dich hier zu sehen.“
„Soll ich Ihnen beim Tragen helfen?“, bot Jan an.
„Wäre nett von dir. Aber zuerst muss ich die Vorratslisten abholen. Die Flotte liegt bereits vor Texel. In ein paar Tagen geht es los, und ich bin zuständig für die Beladung des Flaggschiffes.“ Andries de Vries schaute sehr wichtig aus. „340 Leute sollen auf der Batavia mitfahren, und jedes einzelne Fass, das hier aus den Lagerhäusern geholt wird, muss von mir persönlich genehmigt werden.“
Jan blickte Andries de Vries ehrfurchtsvoll an. Wenn dieser eine so wichtige Anstellung bekommen hatte, konnte er gewiss auch für ihn ein gutes Wort einlegen. Gemeinsam hoben sie die Kiste und trugen sie in das Gebäude hinein.
„Danke, den Rest schaffe ich schon“, verabschiedete sich Andries de Vries.
„Jetzt oder nie“, dachte Jan. „Herr de Vries, ich will mich auch bewerben.“
Andries de Vries blieb abrupt stehen.
„Du?“, fragte er ungläubig.
„Ja“, stotterte Jan. „Ich habe nämlich keinen Kopf für das Übersetzen. Ich mache zu viele Fehler. Aber ohne zu arbeiten, komme ich meinem Onkel zu teuer. Da hat er gemeint, ich soll es versuchen.“ Er schlug die Augen nieder.
„Du kommst zu spät. Vor einer Woche ist der Tambour durch die Straßen marschiert. Hast du nicht seine Trommel gehört?“, erklärte Andries de Vries freundlich.
„Nein. Aber ich muss unbedingt mit“, beharrte Jan.
„Junge, die Musterung ist vorbei. Du hättest es sehen sollen! Hunderte Männer und Jungen drängten sich hier herein. Ich war mittendrin in dieser wilden Menge und hatte Glück. Den Herren gefielen meine Referenzen, und sie haben mich als Kaufmannsassistenten angenommen.“
„Da haben Sie es aber gut getroffen, Herr de Vries“, versuchte Jan, ihm zu schmeicheln.
„Ich weiß. Ich bin ein Glückskind, und ich schwöre dir, ich werde als reicher Mann zurückkehren.“ Er winkte Jan mit dem Finger näher zu sich heran. „Man erzählt sich“, flüsterte er, „dass in Ostindien die Edelsteine nur so zum Aufheben liegen. Und ich hieße nicht Andries de Vries, wenn es mir nicht gelänge, etliche heimlich an Bord zu schmuggeln, um sie daheim unter der Hand zu verkaufen.“
Jan hielt den Atem an. Edelsteine!
„Aber Herr de Vries, könnten Sie nicht auch ein Wort für mich einlegen?“, bat er nochmals.
„Als Schiffsjunge hättest du vielleicht eine Chance, wenn du dich beim Kapitän meldest. Den kannst du wahrscheinlich im Hafen finden. Manchmal bekommt einer der Jungen kalte Füße, und es gelingt ihm davonzulaufen. In so einem Fall werden sie dich bestimmt stattdessen nehmen.“
„Nein.“ Jan schüttelte den Kopf. „Onkel meint, dass ich mich recht gut zu einem Kajütenjungen eigne.“
„Du willst wirklich mit, oder?“ Andries de Vries musterte Jan. Jan nickte heftig.
„Sie werden dich nicht nehmen. Als Schiffsjunge vielleicht, aber für andere Arbeiten bist du zu jung und unerfahren.“
„Herr de Vries, ich werde bald achtzehn. Das schwöre ich! Ich weiß, wie man bei Tisch serviert und wie man Silber putzt. Bitte helfen Sie mir!“ Jans Stimme überschlug sich.
„Nie im Leben wirst du achtzehn!“ Andries lachte gutmütig.
„Doch! Ich bin klein für mein Alter, weil ich einmal als Kind lange krank war.“ Jans Backen brannten wie Feuer.
„Sie nehmen niemanden mehr, versteh das doch!“
„Bitte!“ Jan war außer sich. Er hatte so fest damit gerechnet. Die Fahrt nach Ostindien war seine letzte Chance. Wo sollte er in Amsterdam ohne Geld und ohne Arbeit bleiben?
Andries de Vries bekam Mitleid. Sein Blick fiel auf den Unterkaufmann, der die Treppe herunterkam. Vielleicht konnte der? Nein, es war unwahrscheinlich. Aber wie sollte er das diesem verzweifelten Jungen begreiflich machen? Andererseits, warum musste er ihm diese Enttäuschung bereiten? Sollte es ein anderer tun.
„Jan, da drüben kommt Herr Cornelis. Er war Apotheker, aber die Kompanie hat ihn als Unterkaufmann angestellt“, sagte Andries de Vries. „Wenn einer noch etwas für dich tun kann, dann ist er es. Geh hin, und viel Glück.“
Andries de Vries gab Jan einen Stoß, schulterte seine Kiste und verschwand rasch.
Jan schaute hinüber. Unten an der schön geschwungenen Treppe stand ein dunkelhaariger, eleganter Herr. Jans Herz klopfte vor Aufregung.
„Er muss ja sagen“, flüsterte Jan beschwörend, während er auf den Unterkaufmann zuging.
„Mein Herr“, stotterte er, als er vor ihm stand. „Ich möchte Sie etwas bitten.“
„Ja?“ Der Unterkaufmann schaute ihn kühl an.
„Ich muss, ich möchte ... kann ich nicht Kajütenjunge werden?“, fragte Jan zittrig.
Jeronimus Cornelis betrachtete Jan prüfend. Seine großen, braunen Augen verrieten nichts.
„Kajütenjunge?“ Seine Stimme war tief und wohlklingend. Jan nickte eifrig.
„Ich kann diese Arbeit machen, und Sie werden bestimmt mit mir zufrieden sein“, beteuerte er hastig.
„Du bist noch jung“, stellte Jeronimus Cornelis fest.
„Fast achtzehn, Herr Kaufmann.“
„Lüg nicht!“ Jeronimus Cornelis fuhr Jan hart an.
„Doch“, log Jan mit rotem Kopf. „Ich bin klein, aber das war mein Vater auch.“
„Und wer war dein Vater?“
Jan zögerte. Er hatte sich geschworen, seinen Familiennamen niemals mehr zu verwenden.
„Oder war dein Vater so klein, dass es ihn nicht gegeben hat? So etwas soll vorkommen“, spottete der Kaufmann.
„Kann man mir denn die uneheliche Geburt am Gesicht ablesen?“, dachte Jan. „Pelgrom, mein Vater war Jan Pieter Pelgrom de Bye“, gab er kleinlaut zu.
„Die de Byes aus s`Hertogenbosch?“
„Das war mein Großvater. Mein Vater ist nach Utrecht gezogen, wegen der Spanier.“
„Du kommst also aus einer noblen Familie. Wieso bewirbst du dich?“
„Weil Vater tot ist“, antwortete Jan einsilbig.
„Und deine Mutter, die lässt dich gehen?“
Jan wich dem durchdringenden Blick des Kaufmannes aus. „Es kümmert sie nicht“, presste er heraus.
„Die ganze Wahrheit. Sonst rühre ich keinen Finger für dich.“ Jeronimus Cornelis schob mit einer Hand Jans Kinn in die Höhe und zwang ihn, ihm ins Gesicht zu schauen.
Jan spürte die Macht, die von diesem Mann ausging, und gab nach.
„Sie ist nicht meine Mutter“, gestand er hilflos.
„Ein Bastard“, murmelte Jeronimus Cornelis.
Jan fühlte Wut hochsteigen. Dieses abscheuliche Wort sollte nicht zwischen ihm und seinem restlichen Leben stehen.
„Als Vater tot war, hat sie mich verjagt“, sagte er trotzig. „Mein Onkel sollte mir eine Ausbildung ermöglichen, aber er tat es nicht. Stattdessen hat er mir mein Erbe weggenommen. Da habe ich Geld von ihm eingesteckt und bin weggelaufen. Jetzt möchte ich weit fort von hier. Dorthin, wo mich keiner kennt und wo mich keiner nach meinem Vater fragt. Ich will Jan aus Bemmel sein und mein eigenes Glück machen.“
Jeronimus Cornelis ließ Jans Kinn los und lächelte zufrieden.
„Da werde ich mal sehen, was ich für dich tun kann. So einem Jungen muss man doch helfen“, meinte er gutmütig. „Warte hier auf mich.“
Jan blieb allein in der Halle zurück. Leute hasteten an ihm vorbei. Alles würde gut werden, wenn er nur mitfahren durfte.
„He du, pass mal auf meine Kiste auf.“ Ein Offizier unterbrach rüde Jans Gedanken. „Ich komme gleich wieder, und bis dahin lässt du mein Zeug nicht aus den Augen, verstanden!“
„Versprochen“, sagte Jan, durch den Befehlston des Mannes eingeschüchtert.
Der Offizier rannte die Treppe hinauf.
Jan setzte sich auf die große Seemannskiste. In das dunkle Holz waren – ineinander verschlungen – die Buchstaben VOC eingebrannt. Es war das Wappen der Vereinigten Ostindischen Kompanie. Das Holz der Kiste roch süßlich würzig. Jan atmete den Duft ein. Mit seiner Hand strich er vorsichtig über die glatt gehobelten Kistenbretter.
Es dauerte eine Ewigkeit, bis der Kaufmann endlich zurückkehrte.
Jan sprang auf.
Jeronimus Cornelis ließ ihn zappeln.
„Möchtest du wissen, was ich geregelt habe?“
Jan nickte.
„Bitte mich darum“, verlangte Jeronimus Cornelis.
„Bitte, Herr Cornelis, werde ich Kajütenjunge?“
„Ich habe meinen Einfluss bei den Herren dort oben geltend gemacht. Wenn ich dich für geeignet halte, darfst du mit.“
„Ich bin geschickt und fleißig. Sie werden sich nicht über mich beklagen können“, versicherte Jan.
„Das muss ich erst sehen. Bis zur Abfahrt ist noch Zeit. Ich werde dich prüfen. Gefällst du mir, darfst du an Bord gehen und bleiben. Wenn nicht, dann kannst du jederzeit einen Fußtritt von mir haben und landest im Wasser. Hast du das verstanden?“ „Jawohl, Herr Cornelis. Ich werde Sie nicht enttäuschen. Sie sind sehr gut zu mir.“
„Das weiß ich, und jetzt komm, wir müssen gehen.“
Jan zögerte. Er hatte versprochen, auf die Kiste des Offiziers aufzupassen.
„Was ist?“
„Diese Kiste, Herr Cornelis. Ich darf sie nicht aus den Augen lassen.“
„Das musst du jetzt selbst entscheiden, Jan. Entweder kommst du mit, oder du bleibst bei dieser Kiste.“
„Ich habe mein Wort gegeben“, stammelte Jan.
Der Kaufmann zuckte mit den Schultern.
„Das geht mich nichts an“, meinte er.
„Er wird bestimmt gleich kommen, Herr Cornelis. Können wir nicht noch einen Augenblick lang hier stehen bleiben?“
Jan hatte das Gefühl, geprüft zu werden, und er konnte nicht erraten, was Herr Cornelis von ihm erwartete.
Der Unterkaufmann verneinte.
„Ich gehe jetzt, und du solltest dir rasch überlegen, was dir wichtiger ist: Mein Kajütenjunge zu werden oder ein Versprechen zu halten.“
Jeronimus Cornelis drehte sich um und ging davon.
Jan gab der Kiste verärgert einen Tritt. Der Offizier hätte ihn nicht so lange warten lassen sollen. Er war selbst schuld, wenn Jan nicht länger darauf aufpassen konnte.
„Ich komme mit, Herr Cornelis!“
Jan rannte hinter dem Kaufmann her, bis er ihn eingeholt hatte. Er schaute zum Kaufmann hinauf. Hatte er die richtige Entscheidung getroffen?
„Ein gegebenes Versprechen zu brechen, ist keine gute Eigenschaft“, rügte ihn Jeronimus Cornelis.
„Ich habe das Falsche gewählt“, dachte Jan verzweifelt. Aber vielleicht konnte er es noch ändern.
„Ich kann zurücklaufen“, stotterte er.
Der Unterkaufmann lächelte.
„Wie gut, dass ich dafür dieses eine Mal Verständnis habe. Aber merke dir eines. Wenn du mich enttäuscht, bürgst du dafür mit deinem eigenen Leben!“
Mit großen Schritten ging Jeronimus Cornelis voran, Jan hastete hinterher. Sie liefen die Kanäle entlang bis zu einem Wirtshaus. „Hier wohne ich, Jan. Morgen früh wird der Trommler die Bemannung rufen. Dann musst du dich fertig gepackt beim Ostindienhaus melden. Dort stehst du auf einer Liste. Ist diese Musterung vorbei, kommst du schleunigst hierher. Trödle nicht!“
Jan schluckte. Was sollte er packen? Er hatte doch nichts und kein Geld, um sich etwas zu kaufen.
„Ist noch was?“, fragte der Kaufmann ungeduldig.
„Ich habe kein Geld mehr, Herr Cornelis“, gestand Jan.
Einen Augenblick lang schien es, als ob sein Gegenüber die Achseln zucken würde und ihn draußen vor der Tür stehen lassen wollte.
„Komm rein. Wir werden das regeln. Du machst mir mehr Arbeit, als ich dachte. Hoffentlich bist du es auch wert.“
„Gewiss, Herr Cornelis“, versprach Jan.
Der Kaufmann hatte ein eigenes Zimmer gemietet. Neben einem Tisch stand eine offene Seemannskiste. Sie war bereits halb gefüllt mit Büchern. Auf dem Bett lagen ordentlich Hemden, Hosen und Strümpfe.
Jeronimus Cornelis setzte sich auf einen Sessel. Jan blieb stehen. Er kam sich wie ein Bettler vor. Der Kaufmann holte aus der Briefmappe, die er bei sich trug, ein Schriftstück.
„Das ist dein Vertrag, Jan. Ich habe ihn für dich unterschrieben, als dein Vormund. Das schien mir besser so, und ich werde ihn auch für dich aufheben.“
„Danke.“ Jan hätte den Vertrag gerne gelesen, aber der Kaufmann hatte das Papier bereits wieder gefaltet und eingesteckt. „Jetzt werden wir einen zweiten Vertrag machen. Ich gebe dir aus meiner eigenen Tasche einen Vorschuss auf dein Gehalt. Mit dem Geld kannst du dir eine Seemannskiste und einige andere nützliche Sachen kaufen.“
Auf dem Tisch stand ein Tintenfass. Jeronimus Cornelis holte aus der Schreibmappe ein Blatt Papier hervor, tauchte eine Feder in die Tinte, und schrieb rasch einige Zeilen.
„Hier, unterschreib das.“ Er reichte Jan die Feder und das Papier. Das Schriftstück war auf Lateinisch verfasst. Jan versuchte, es zu übersetzen. Niemals unterschrieb man etwas, was man nicht lesen konnte. Das hatte der Vater ihm eingeschärft.
„Wirds bald? Ich habe nicht viel Zeit”, fuhr ihn der Kaufmann an.
„Ich muss es doch erst lesen“, rechtfertigte sich Jan.
„Du misstraust mir?“, fragte Jeronimus Cornelis gekränkt.
„Nein“, beeilte sich Jan zu antworten, „aber mein Vater hat mir gesagt, dass man niemals ...“
„Dein Vater? Hat er nicht auch dafür gesorgt, dass du als Bastard durch die Gegend laufen musst?“, spottete der Kaufmann.
Jan griff zur Feder, tauchte sie hastig ein und unterschrieb. Jan Pelgrom de Bye. Nein, das stimmte nicht. Er strich den Namen durch. Jan Bemmel schrieb er daneben. Er legte das Schriftstück in Jeronimus Cornelis’ ungeduldig ausgestreckte Hand.
„Möchtest du wissen, was du unterschrieben hast?“ Ein Lächeln lag auf seinen Lippen.
Jan nickte und schämte sich dafür.
„Ich, Jeronimus Cornelis, Apotheker aus Haarlem und Unterkaufmann der Kompanie, habe als dein Vormund für dich einen Vertrag über fünf Jahre mit der Kompanie abgeschlossen.“
„Fünf Jahre“, dachte Jan erschrocken.