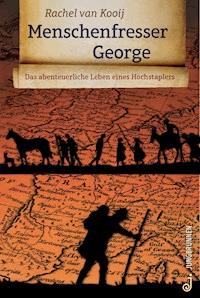
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Jungbrunnen
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Sprache: Deutsch
Frankreich um 1700: Ein völlig mittelloser junger Mann stiehlt aus einer Kapelle eine Mönchskutte. Er gibt sich zuerst als irischer Pilger aus, dann als japanischer Prinz und - als seine Lügengeschichte aufzufliegen droht - als Ureinwohner Formosas, der von Jesuiten nach Frankreich entführt wurde. Er beschreibt Landschaft, Vegetation, Kultur und Sprache eines Landes, das er nie gesehen hat. In den Niederlanden trifft er auf einen schottischen Geistlichen, der ihm auf die Schliche kommt. Aber der weiß den exotischen Fremden gut zu nutzen. Er tauft ihn und bringt ihn nach London, wo er aufgrund seines eigenartigen Benehmens - zum Beispiel isst er rohes Fleisch - Berühmtheit erlangt. Schließlich plagt George Psalmanazar das schlechte Gewissen und er enttarnt sich als Hochstapler.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 494
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Rachel van Kooij
Menschenfresser GeorgeDas abenteuerliche Leben eines Hochstaplers
Rachel van Kooij
wurde 1968 in Wageningen in den Niederlanden geboren. Im Alter von zehn Jahren übersiedelte sie nach Österreich. Nach der Matura studierte sie Pädagogik und Heil- und Sonderpädagogik an der Universität Wien.
Rachel van Kooij lebt in Klosterneuburg und arbeitet als Behindertenbetreuerin und Autorin.
Folgende Bücher von Rachel van Kooij sind bei Jungbrunnen lieferbar:
Kein Hundeleben für Bartolomé (2003), Der Kajütenjunge des Apothekers (2005), Nora aus dem Baumhaus (2007), Klaras Kiste (2008), Eine Handvoll Karten (2010).
EPUB ISBN 978-3-7026-5885-4
1. Auflage 2012
Einbandgestaltung: b3k
© Copyright 2012 by Verlag Jungbrunnen Wien
Alle Rechte vorbehalten – printed in Austria
Rachel van Kooij
Menschenfresser George
Das abenteuerliche Lebeneines Hochstaplers
Inhalt
Mein Testament
Teil 1
Lectio prima Mundus vult decipi – Die Welt will betrogen sein
Lectio secunda Primus omnium – Der Beste von allen
Lectio tertia Di nos quasi pilas homines habent – Wir Menschen sind gewissermaßen Spielbälle der Götter
Lectio quarta Abyssus abyssum invocat – Ein Fehler zieht den anderen nach sich
Lectio quinta Ultra posse nemo obligatur – Niemand kann verpflichtet werden, Unmögliches zu leisten
Lectio sexta Ex tempore – Aus dem Stegreif
Lectio septima Auri sacra fames – Der verfluchte Hunger nach Gold
Lectio octava Persona non grata – Eine ungebetene Person
Teil 2
Lectio nona Alea iacta est – Der Würfel ist gefallen
Lectio decima Deficiente pecu, deficit omne, nia – Mangelt im Beutel die Barschaft, mangelt’s an Jeglichem
Lectio undecima Ego sum, qui sum – Ich bin, wer ich bin
Lectio duodecima Perfer et obdura – Halte durch und sei hart
Lectio tertia decima Manus manum lavat – Eine Hand wäscht die andere
Lectio quarta decima Pacta sunt servanda – Verträge müssen eingehalten werden
Lectio quinta decima Mala sunt vicina bonis! – Leid und Glück sind Nachbarn!
Lectio sexta decima Nemo enim potest personam diu ferre – Niemand kann auf Dauer eine Maske tragen
Lectio septima decima Scientia potentia est – Wissen ist Macht
Lectio duodevicesima Faber est suae quisque fortunae – Jeder ist seines Glückes Schmied
Lectio undevicesima Nullius in verba – Nach niemandes Worten
Lectio vicesima Mentitur impudentissime – Es wird unverschämtest gelogen
Finis
Lectio ultima De mortuis nil nisi bene – Über die Toten sollst du nur wohlwollend reden
Mein Testament
Tabula rasa – Reiner Tisch
Ironmonger-row, old street, erste Abzweigung östlich von St. Luke, Sonntag, 23. April 1752
„Mein letzter Wille und Testament, niedergeschrieben von mir selbst, einer armen, sündigen und wertlosen Kreatur …“
Ich setze die Feder ab. In der Küche, gleich neben meinem Zimmer, höre ich Sarah. Sie spült geräuschvoll das Geschirr. Seit fünfzehn Jahren harrt sie bei mir aus, begnügt sich mit dem Bett in der Küche und dem kargen Wirtschaftsgeld, das ich ihr für meine und ihre Bedürfnisse gebe. Ich weiß nicht, ob sie an mir, einem alten Mann, irgendwie hängt, oder ob sie glaubt, noch immer nicht gehen zu dürfen.
Aufgelesen habe ich sie im Gerichtssaal. Sie kauerte auf der Anklagebank. Jetzt schäme ich mich, wenn ich daran denke, wie ich mich gerne als neugieriger Zuschauer in die Säle geschlichen habe, mit Feder, Papier und gewichtiger Miene. Viele hielten mich für eine jener Personen, die der Allgemeinheit über die Abgründe des menschlichen Wesens berichteten.
An jenem Tag saß ich auf der Bank im Saal und schaute zu, wie das junge Ding unter Tränen schwor, dass es erst fünfzehn Jahre zählte, und dass es lediglich ein paar Ziegenlederhandschuhe gewesen wären, die es hatte entlehnen wollen, um ein wenig damit vor seiner Freundin anzugeben. Hatte es denn ahnen können, dass seine Herrin den Kurbesuch in Bath vorzeitig abbrechen würde?
Fünfzehn, dachte ich damals. Fünfzehn war ich auch gewesen, als ich in die Kapelle ging und dreist das Mönchsgewand und den Pilgerstab vor den Augen eines alten Priesters stahl.
Das Mädchen warf sich beinahe vor dem Richter zu Boden.
„So eine gerissene Schauspielerin“, murmelte eine Dame neben mir missbilligend hinter ihrem Fächer. „Ich kenne diese Sorte. Die geben nur zu, was man ihnen beweisen kann. Es würde mich nicht wundern, wenn sie sich auch am Silberbesteck vergriffen oder sich aus der Haushaltsbörse bedient hätte.“
Ich beobachtete den Richter, ein älterer Mann so wie ich. Er schien empfänglich für die Tränen junger, hübscher Mädchen zu sein.
Streng, aber väterlich, mahnte er es, sich zu fassen und sich die Nase zu putzen.
„Aber ich habe doch kein Taschentuch“, hickste das Mädchen und fuhr sich mit dem Ärmel ihres verwaschenen Kleides über das Gesicht.
Der Richter setzte zu einer langen, einschläfernden Abhandlung über Dienstboten und ihre christlichen Pflichten an.
Ich döste, erwachte aber abrupt, als er umschwenkte und mit Empörung über die Abscheulichkeit von Diebstahl im Allgemeinen und über den Geldwert der Handschuhe im speziellen Fall sprach. Am schlimmsten jedoch, betonte er, sei die Tatsache, dass die Diebin zuerst noch die Tat zu leugnen versucht habe. Der Richter beugte sich nun über seinen hohen Tisch nach vorne. Die langen Locken der weißen Perücke fegten über die Papiere, die er vor sich liegen hatte.
Ob sie denn wisse, dass sie für sieben Jahre hinter Gitter wandern könne. Oder noch schlimmer, dass es gelehrte Männer gebe, die sich überlegten, ehrlose Individuen nach Übersee zu verbannen?
Die junge Frau heulte auf, streckte ihre Hände dem Richter entgegen und bettelte um Milde. Sie würde es nie wieder tun. Sie würde die ehrlichste Dienstbotin ganz Londons werden.
Die Dame neben mir schnaubte.
„Was bildet die sich ein! Die nimmt keiner mehr in den Haushalt.“
Der Richter schien ähnlich zu denken.
„Als Dienstbote wirst du nie mehr arbeiten können. Ehrlich gesagt, würde ich dir einen Gefallen tun, die Strafe möglichst hoch anzusetzen“, meinte er nachdenklich.
„Aber ich bin erst fünfzehn.“
Die Verzweiflung des Mädchens konnte nicht gespielt sein.
„Eben deshalb. In deinem Alter alleine auf der Straße zu stehen, ohne Arbeit und ohne Dach über dem Kopf, das führt ein Mädchen wie dich nur schnurstracks in den Abgrund.“
„Die kriegt die sieben Jahre“, kommentierte meine Nachbarin. „Sieben Jahre Zuchthaus, schreiben Sie das nur auf.“ Sie klopfte mit dem Fächer auf mein Blatt Papier.
Da reichte es mir. Ohne weiter zu überlegen, stand ich auf und ging nach vorne. Der Richter hielt inne. Ich setzte meine Gelehrtenmiene auf, reichte ihm meine Visitenkarte und bat um ein privates Wort.
Wenig später war Sarah Rewalling, 15 Jahre alt, zu sieben Jahren Zuchthaus verurteilt, aber auf Bewährung in meine Obhut entlassen. Von da an führte sie meinen Haushalt.
Jetzt klirren in der Küche nebenan die Kupfertöpfe. Sarah hängt sie immer mit Schwung auf die Haken, sodass sie gegeneinander stoßen. Ihr Zeichen für mich, dass sie nun mit dem Spülen fertig ist und sich gestattet, sich eine Weile mit einem Buch vor dem Herdfeuer auszuruhen. Ja, Sarah liest gerne. Etwas, was uns verbindet. Das und unsere sündige Vergangenheit.
Ich spitze die Feder, tauche sie in die Tinte und rücke das Blatt Papier zurecht.
„Die Memoiren von **** (ich male die Sternchen mit Sorgfalt), der Allgemeinheit bekannt als George Psalmanazar.“
Ja, ich habe vor, meine Lebensbeichte zu Papier zu bringen, als Teil meines Testaments, als mein Vermächtnis. Ich spüre, dass mir nicht mehr viel Zeit bleibt. Sarah soll darüber verfügen, nach meinem Tod. Es wird ihr sehr wahrscheinlich eine Zeit lang genug Geld einbringen, um davon zu leben.
Nach dieser Überschrift stehe ich auf und gehe in meinem Zimmer auf und ab, vom Schreibtisch zum Fenster – draußen regnet es in Strömen, richtiges Aprilwetter –, vom Fenster zum Bücherschrank. Hier befinden sich alle meine Bücher, bis auf eines. Das liegt eingeschlossen in meiner Schreibtischlade. Den Schlüssel trage ich immer bei mir. Ich habe es vor 48 Jahren verfasst. Damals hat das Machwerk meiner Fantasie mich mit hochmütigem Stolz gefüllt.
Als ich zum dritten Mal meine Zimmerrunde gedreht habe, setze ich mich wieder hin. Eine Unruhe zerrt an meinen Gliedern. Ein Schluck Laudanum würde helfen, aber ich reiße mich zusammen. Der Zaubertrank würde meine Sinne vernebeln. Nichts soll meine Erinnerungen trüben. Ich weiß nun, wie ich anfangen will. Mit jenem Tag, ab dem meine Erinnerungen sich nicht länger als einzelne, aus dem Zusammenhang gerissene Fetzen präsentieren, sondern eine, wenn auch lückenhafte, Kette von Ereignissen bilden.
Teil 1
Lectio prima
Mundus vult decipi – Die Welt will betrogen sein
Südfrankreich 1689
1.
Ich bemerkte es immer, wenn Vater aufgebracht war. Ich musste ihn nicht einmal sehen, um es zu wissen. Ich spürte es, wenn Maman mich in das weiße Kostüm zwängte und die schwarze Maske zu fest über meine Nase und Augen zog. Ich erkannte es an den fahrigen Bewegungen von Jacques, wenn dieser hastig das grobe Leinen mit den grell aufgemalten Häusern und den felsigen Bergen zwischen und vor die beiden Karren spannte, in denen wir unser Hab und Gut von einem zum nächsten Ort transportierten. Und an Leonores Gesang hörte ich es. Ihre Stimme piepste, wenn Vater wütend war.
Sogar unser Pantalone, der alte Mann, der in seinem feuerroten Kostüm immer den dummen, reichen Kaufmann spielte, und der mit seiner Maske über die Jahre so verschmolzen war, dass niemand von uns mehr seinen richtigen Namen wusste, sogar unser Pantalone presste dann seinen zahnlosen Mund zu einer schmalen Linie zusammen und vergaß, Matthieu und mich vor unserem Auftritt in die Wangen zu kneifen. Dabei brachte das Glück. Und an jenen Tagen, an denen Vater vor Wut schäumte, brauchten wir das Glück am nötigsten.
Am meisten jedoch merkte ich es an Matthieu, meinem gleichaltrigen Bruder und Spiegelbild. Auch wenn sich seine Augen hinter einer Maske verbargen, sah ich es an seinem mageren Körper, der in einem bunten Flickenkostüm steckte. Mit hochgezogenen Schultern, den Kopf in der steifen, weißen Halskrause versenkt, sodass nur die von einem Lachen breit aufgeblasenen Backen der Maske sichtbar waren, saß er mir verzagt auf seinem kleinen Holzschemel gegenüber.
Während es meine Rolle als Pedrolino war, immer ernst und betrübt zu schauen, etwas, was mir an so einem Tag nicht schwer fiel, musste Matthieu als Harlequino Schabernack treiben. Er musste lachen und Possen reißen, auch wenn ihm, so wie mir, eher zum Weinen zumute war.
Nicht weit von unseren beiden Schemeln ging Vater mit großen Schritten auf und ab. Er trug bereits sein elegantes, tiefschwarzes Kostüm. Seine Perücke saß makellos. Er war Scaramouche, der verwegene Held, dem es immer gelang, sich selbst zu retten und andere dafür ins Unglück zu stürzen. Sein Gesicht wurde von keiner Maske verdeckt, und als er nun auf uns beide kleine Kerle zukam, konnte ich seine Augen unter den schwarz gefärbten, dicken Brauen gefährlich funkeln sehen.
„Pedrolino, Harlequino“, herrschte Vater uns an.
Wir sprangen beide gleichzeitig auf und standen stramm. Vater nannte uns immer bei den Namen unserer Rollen, sogar wenn wir wir selbst sein durften. Oft aber nannte er mich Harlequino und Matthieu Pedrolino. Denn er konnte uns ohne unsere Verkleidung nicht auseinanderhalten.
Matthieu bat hie und da Maman, ob er nicht das weiße Kostüm anziehen dürfe. Vater würde es nicht merken. Maman stimmte dem nie zu.
„Du bist mein Harlequino und dein Bruder ist mein Pedrolino. So war es von Anfang an und so wird es auch bleiben. So, wie ich eure Columbine bin, Pantalone Pantalone ist und Jacques und Leonore sich lieben müssen“, antwortete sie jedes Mal. Sie erwähnte Vater dabei nie. Das war nicht notwendig. Vater war Scaramouche. Mit ihm waren wir eine Truppe, ohne ihn waren wir nichts. Und wer das nicht begreifen wollte, verließ uns früher oder später. So, wie unser letzter Dottore. Er hatte sich nicht an die Regeln gehalten, hatte mehr sein wollen, als er durfte. Und gestern Abend hatte er heimlich seine Habseligkeiten gepackt und war unbemerkt davongeschlichen, mit dem Geld der letzten Vorstellung im Beutel.
Kein Wunder, dass Vater heute außer sich war.
„Kopf raus, Harlequino“, blaffte Vater und boxte Matthieus’ Ohren. Matthieus’ Mund tauchte mit einem steifen, breiten Grinsen aus den ebenso steifen Stofffalten des Kragens. Jetzt nicht zu lachen, wäre mehr als leichtsinnig gewesen. „Pedrolino.“ Vater kontrollierte nun meine Mundwinkel. Diese zogen traurig genug nach unten.
„Los. Geht hinüber zu Pantalone! Wir fangen an“, befahl er uns.
Die Vorstellung war eine einzige Katastrophe. Leonore und Jacques, die beiden Liebenden, wurden ausgepfiffen. Leonore hatte so grauenvoll wie selten gesungen und Jacques hatte vergessen, Scaramouche die richtigen Stichworte zu liefern. Maman und ich hatten als Columbine und Pedrolino unser Bestes gegeben. Maman konnte auch fröhlich singen, wenn sie betrübt war, und mein Schluchzen und meine jämmerlich traurigen Gesten waren gewiss echter als echt gewesen. Auch Matthieu hatte begriffen, wie schwer es Vater an diesem Nachmittag mit Jacques und Leonore hatte, und war über seine fünf Jahre hinausgewachsen. Wie ein kleiner bösartiger Wicht war er als Harlequino mit seinem kurzen Batocio über die Bühne getobt. Er hatte mit dem doppelten Holzstab laut klappernd so getan, als ob er die heftigsten Hiebe verteilte. Sogar Pantalone hatte sich von ihm verprügeln lassen, nur, damit das Dorfvolk applaudierte und Vater zufrieden sein konnte.
Aber egal, was wir alle gemeinsam versucht hatten, die Zuschauer hatten lauthals nach dem Dottore verlangt.
Eine Komödie ohne den Dottore mit seinem lateinischen Gequassel und seinen unsinnigen Ratschlägen war keine Komödie. Einmal nicht vor den hohen Herren katzbuckeln, sondern sie herzhaft auslachen dürfen, das wollten diese Bauern hier. Darum waren sie gekommen.
Als Matthieu und ich am Ende unsere Hüte zogen, um das Geld abzusammeln, fielen die Münzen nur spärlich hinein, und eine dicke Marktfrau holte ein Ei aus ihrem Korb und zerdrückte es über meinem Kopf.
„Frag mal den Dottore, wie du diesen Dreck wieder herauswaschen kannst“, sagte sie in ihrem breiten Dialekt.
„Ja, frag mal den Dottore“, johlten auch die Umstehenden.
Erst, als das Dorf und die misslungene Vorstellung einige Meilen hinter uns lagen, und wir eine Gruppe Olivenbäume zwischen den Feldern erreichten, auf denen die Frühlingssaat die ersten zartgrünen Halme zeigte, erlaubte Vater uns anzuhalten. Jacques nahm die kleine Axt und machte sich auf die Suche nach trockenem Krüppelholz. Pantalone striegelte schweigsam die Pferde. Maman und Leonore fingen an, die Abendsuppe zuzubereiten. Sie würde nur nach Zwiebel schmecken. Vater hatte Maman kein Geld gegeben, um bei einer der Marktfrauen frisches Gemüse und ein kleines Huhn zu kaufen. Das war seine Strafe für uns.
„Harlequino, Pedrolino!“ Vater ließ uns nicht zur Ruhe kommen. Normalerweise durften wir am Abend, wenn wir im Freien nächtigten, unserer eigenen Wege gehen, solange wir in Hörweite der Karren blieben.
Wir traten vor ihn. Matthieu verzog das Gesicht gewohnheitsmäßig zu einem Grinsen. Dafür kassierte er einen Backenstreich.
„Hier gibt es nichts zu lachen“, brüllte Vater los. „Noch so eine Aufführung und meine Reputation ist dahin.“
Wir nickten folgsam. Obwohl ich mir sicher war, dass Matthieu auch nicht wusste, was Vater damit meinte.
Vater blähte sich auf.
„Jahrelange, harte Arbeit ruiniert in wenigen Augenblicken“, ereiferte er sich.
Er fixierte Matthieu und mich. Dann sagte er zu Matthieu: „Vergiss diesen Pedrolino, auf den können wir am ehesten verzichten. Du warst sowieso nie gut genug darin. Du machst ab jetzt den Harlequino.“
Vater hatte uns schon wieder verwechselt. Aber bevor ich das richtigstellen konnte, packte Vater mich mit beiden Händen an den Schultern und zog mich in die Höhe, als ob ich für das, was nun käme, zuerst ein ordentliches Stück wachsen müsste.
„Und du machst Schluss mit dem Harlequino und wirst Dottores Verse und lateinische Sprüche auswendig lernen. Gleich jetzt.“ Er ließ mich zurück auf den Boden plumpsen und zog aus seiner Manteltasche das abgegriffene Rollenheft, in dem Dottores Dummheiten geschrieben standen. „Deine Mutter soll es dir vorlesen.“
Er warf mir das Heft zu und spazierte, zufrieden mit seinem Einfall, davon. Neben mir stand Matthieu und lachte erleichtert. Ich schaute ihn wütend an und trat nach ihm mit den Füßen. Vater hatte nicht mich gemeint, sondern ihn. Auch wenn es wehtat, nun zu wissen, dass ich als Pedrolino nichts getaugt hatte. Als Harlequino, nahm ich mir vor, würde ich besser spielen, als Matthieu es je getan hatte. Ich würde sogar so lange üben, bis ich auf den Händen gehen konnte.
Ich wollte ihm das Heftchen in die Hand drücken, aber Matthieu rannte davon.
„Verwechselt ist verwechselt“, rief er über die Schulter und machte dabei seine albernen Harlequinosprünge.
Maman ließ sich nicht umstimmen.
„Wenn Vater dich in die Höhe gehoben hat, hat er dich auch gemeint, egal, ob er die Namen verwechselt hat oder nicht. Dafür kann er nichts. Ihr gleicht einander doch wie ein Ei dem anderen. Und …“, sie streichelte mir über das Haar, „du wirst bestimmt einen großartigen Dottore abgeben.“ Ich verzog die Mundwinkel nach unten. Der Dottore war ein alter, eitler Mann. Sie beugte ihren Kopf zu mir hinunter und schmeichelte verschwörerisch: „Vater weiß, dass du das klügere Köpfchen hast.“
Das versöhnte mich ein bisschen, obwohl es gelogen war. Denn wenn Matthieu und ich uns jetzt vor ihn hingestellt hätten, hätte er nicht mehr sagen können, wem er die Rolle des Dottore zugedacht hatte. Das war so sicher, wie abends die Sonne unterging.
Später, nach der Suppe, die nicht richtig satt machte, schickte Maman Matthieu sofort in den Karren, während sie sich mit mir näher ans Feuer setzte und das Heftchen aufschlug. Es war schön, neben ihr zu sitzen und die warme Glut der Flammen zu spüren. Ihr schmaler Zeigefinger glitt die Zeilen entlang, und sie las mir langsam die Reime vor. Nach dem dritten Mal konnte ich bereits ein halbes Dutzend Verse aufsagen.
Das Lateinisch war schwieriger. Immer wieder verhaspelte ich mich, bis ich bockig mit den nackten Füßen Erdklumpen ins Feuer stieß.
„Na, na!“, rügte der alte Pantalone mich, als ein Regen winziger Glutstückchen auf ihn herabprasselte.
„Ich hasse diesen Dottore. Ich weiß nicht, was er daherredet.“ Meine Mundwinkel zitterten. Ich war müde. Ich wollte schlafen.
Maman warf einen scheuen Blick auf Vater, der scheinbar unbeteiligt etwas abseits des Lagerfeuers auf dem Rücken lag und den Sternenhimmel betrachtete.
„Jetzt wirst du es schaffen“, bat Maman drängend und las die ersten vier Sätze nochmals vor. Ich wusste, dass ich einen Großteil der Rolle beherrschen musste, bevor ich mich neben Matthieu in die Decke wickeln durfte.
„Nec alia… Nec …“ Ich wusste die Worte, aber wie sollte ich sie aufsagen, wenn ich nicht wusste, was sie bedeuteten? Vater hatte Matthieu und mir immer wieder gesagt, dass man so spielen sollte, dass die Worte, die man sagte, lebendig wurden.
„Ich bin Scaramouche“, hallte Vaters Stimme bei jeder Vorstellung über die Marktplätze, wo wir auftraten. Und das stimmte haargenau. Vater war Scaramouche. Aber ich war nicht einmal ein winziges Stückchen Dottore. Pantalone rückte näher heran.
„Du musst es nur nachsprechen“, riet er mir leise. „Es fällt niemandem auf, solange du die Worte rasch und überzeugt sprichst.“
Ich zögerte. Maman fasste meine Hand und drückte sie leicht.
„Mach nur“, bedeutete das.
„Nec aliam hoc aquam sic …“ Ich reihte die Wörter, die ich mir gemerkt hatte, aneinander wie die Glasperlen auf der Kette, die Leonore vor jeder Vorstellung von Vater um den Hals gelegt bekam. Pantalone grinste zufrieden.
Vater stand auf und reckte sich.
„Halt an! Genug für heute. Ich will schlafen. Morgen früh wird weiter gelernt.“ Maman schlug das Heftchen erleichtert zu und küsste mich verstohlen auf die Backe. Vater sah das nicht gerne, denn alle Küsse gehörten ihm.
Pantalone erhob sich, und ich folgte ihm zum hinteren Karren, in dem ich zusammen mit ihm, Matthieu, Jacques und Leonore schlief. Nur Maman hatte ihren Platz bei Vater.
2.
Für unseren nächsten Auftritt ließ Vater die Dörfer links liegen und steuerte direkt Eguilon an.
Den ganzen Weg dorthin las Maman mir die Zeilen in der fremden Sprache vor.
Als wir die kleine Stadt betraten, nahm Vater mich beiseite und hob mich hoch. „So, Dottore“, sagte er streng. „Wenn man springen muss, tut man das besser in tiefes Wasser. Denn im Seichten bricht man sich die Knochen.“ Ich wäre lieber gar nicht gesprungen. Aber Maman steckte mich ins Kostüm und klebte mir einen Spitzbart aus Pferdemähne ins Gesicht. Pantalone kniff mich in die Wange und dann wurde ich hinaus auf die Bühne geschoben.
Ich war gut. Sogar Vater sagte das nachher.
„Was für ein großartiger Einfall“, prahlte er. „Habt ihr gesehen, wie die Zuschauer sich darüber amüsiert haben? So einen winzigen Dottore hat es in ganz Frankreich noch nie gegeben. Was rede ich, in ganz Europa ist das einzigartig. Wenn sich das herumspricht, werden wir sogar in Avignon empfangen.“ Er strahlte über das ganze Gesicht. Und als ein Bote des Bürgermeisters erschien und uns einlud, auf Kosten der Stadt zu bleiben, um am nächsten Tag nochmals aufzutreten, war unser Glück perfekt. Wir zogen in das beste Wirtshaus ein. Vater ließ sich feiern. Ein Krug Wein nach dem anderen wurde geleert, und Vaters Pläne wurden immer größer und verrückter. Als Maman mit uns gemeinsam schließlich hinauf in die Schlafkammer stieg, erzählte Vater gerade dem Wirt, dass wir demnächst vor dem König in Paris spielen würden.
Wir traten nicht vor dem König in Paris auf. Wir erreichten nicht einmal Avignon. Als wir einige Tage später der Garonne entlang Richtung Toulouse unterwegs waren, bekam Pantalone Fieber. Der alte Mann versuchte zuerst, es zu verheimlichen. Seine Augen schimmerten glasig, aber er spielte seine Rolle. In der Nacht jedoch spürten Matthieu und ich, die wir links und rechts neben ihm lagen, wie er vor Kälte zitterte, obwohl er glühend heiß war. Und eines Morgens wollten seine Beine ihn nicht mehr tragen und vor seinen Augen schienen die seltsamsten Figuren ein Stück aufzuführen, das nur er hören und sehen konnte. Mit heiserer Stimme versuchte er mitzumachen, warf den unsichtbaren Personen seine Stichworte zu. Manchmal hob er die Arme abwehrend gegen den Himmel und bettelte darum, nicht geschlagen zu werden. Da rief Matthieu ihm weinend zu, dass er damit aufhören solle, und dass er ihn bestimmt nie wieder mit dem Batocio verprügeln würde. Auch dann nicht, wenn Vater noch so wütend wäre. Aber seine Stimme drang nicht bis zu Pantalone durch.
Maman kochte Kräutertees und versuchte, Pantalone kleine Schlückchen davon einzuflößen. Jacques und Leonore berieten sich flüsternd, nahmen ihren Anteil Stroh und Decken aus dem Karren und schliefen lieber draußen unter den Bäumen. Vater kämpfte tagelang mit sich selbst, ob er in die nächste Stadt reiten sollte, um einen Arzt zu holen. Jedes Mal, wenn das Fieber sank, verwarf er den Plan und frohlockte, dass er sein Geld nicht leichtsinnig ausgegeben hatte. Jedes Mal, wenn das Fieber wieder stieg, raufte er sich verzweifelt die Haare. Als er sich schließlich dazu aufraffte, am nächsten Morgen aufzubrechen, war es zu spät. Meister Tod kam in der Nacht und nahm Pantalones Seele mit. Noch bevor wir Pantalone auf einem Dorffriedhof begraben konnten, wurde deutlich, dass der unheimliche Meister mit dem alten Mann allein nicht zufrieden war. Leonore fing an zu husten. Jacques, auf der Bühne immer bereit, für sie zu leiden und zu sterben, machte sich davon. Dieses Mal wartete Vater nicht ab. Er spannte den Hengst vor den Karren und brachte Leonore in ein nahe gelegenes Kloster, in dem Kranke aufgenommen wurden. Als er zurückkam, war Matthieu krank. Wie Pantalone hatte er Schüttelfrost, obwohl er vor Fieber glühte. Vater warf einen einzigen Blick auf ihn, dann befahl er Maman, ein paar Habseligkeiten für sich selbst und für mich zu packen und zu verschwinden.
Maman schaute ihn verständnislos an.
„Leonore wird gesund. Es ist nur ein Husten. Eine schwache Lunge, meinte eine Nonne. Aber im Kloster …“ Vater stockte. „Im Kloster liegen Dutzende Fieberkranke. Dieses Mal trifft es die Alten wie unseren Pantalone und die Kinder. Also nimm die Bündel, den zweiten Karren und die Stute und verschwinde.“
„Aber Matthieu? Der … Ich kann ihn …“
„Ich bringe ihn ins Kloster. Ich habe noch Geld, um auch einen Arzt zu bezahlen.“
Maman schüttelte den Kopf.
„Verdammt noch mal“, schrie Vater sie an, „muss ich dich und den Jungen von hier fortprügeln? Verschwindet, verschwindet endlich!“
Wir verschwanden. Vater warf fast alles aus dem Karren heraus. Das dreckige Stroh, die paar Töpfe und Teller. Auch die Truhe mit den Kostümen. Er hob mich auf den leeren Karren, und Maman nahm den Strick in die Hand. Wortlos führte sie das Pferd, den Karren und mich auf die Straße hinaus. Das Letzte, was ich sah, war, wie Vater das Kostüm des Dottore aus der Truhe riss und es gegen den Himmel streckte.
„Du nimmst ihn mir nicht fort, hörst du. Nicht jetzt!“, brüllte er.
Ich schluckte. Es war doch Matthieu und nicht ich, der dort bei ihm zurückblieb.
3.
„Wohin fahren wir?“, traute ich mich Maman zu fragen, als wir die Stadtmauern von Agen erreichten, die Garonne überquerten und Maman das Pferd und den Karren nach Süden lenkte.
„Nach Hause“, murmelte Maman. „Nach Hause.“
Nach Hause. Ich sah sie verständnislos an. Wir besaßen kein Haus. Seit ich mich erinnern konnte, hatten wir nur die beiden Karren und zogen von Ort zu Ort.
Hunderte Geschichten kannte ich von Vater. Wie er Wegelagerer furchtlos verjagt hatte. Wie er mit Gelehrten parliert hatte. Seine weiten Reisen, die ihn vom Rheinland hoch oben im kalten Norden, wo er geboren war, bis hier hinunter in die Gascogne geführt hatten.
„Barfuß, im letzten Hemd und mit vor Hunger hohlen Wangen würde ich noch tausendmal lieber Scaramouche spielen, als an einen eigenen Herd gefesselt zu sein“, pflegte er zu sagen. Für Vater war ein Haus ein Gefängnis. Wohin reisten wir?
„Hat Vater ein Haus?“, rief ich schließlich nach vorne zu Maman, weil ich keine Antwort finden konnte, so sehr ich auch nachdachte.
Maman warf einen kurzen Blick über ihre Schulter.
„Wie kommst du auf so eine Idee?“, fragte sie verwirrt.
„Weil wir unterwegs nach Hause sind“, erklärte ich.
„Zu Onkel Guichard fahren wir“, antwortete Maman knapp und drückte mit ihrer Faust in die Flanke der Stute, die Mamans kurze Unaufmerksamkeit genützt hatte, um das hohe Gras am Wegesrand abzurupfen.
„Geh schon weiter!“
„Wer ist Onkel Guichard?“
Maman schüttelte den Kopf. Sie sagte etwas, aber weil sie gegen den Wind sprach, konnte ich nichts verstehen. Ich ließ mich vom Karrenbock heruntergleiten und rannte nach vorne.
Mit meinen kurzen Beinen versuchte ich, mit Maman Schritt zu halten. „Wer ist Onkel Guichard?“, fragte ich ein zweites Mal.
„Mein Vormund.“
„Vormund?“
„Alphonse Guichard ist ein Cousin meines Vaters. Als meine Eltern starben, hat er mich bei sich aufgenommen.“ Maman redete schnell. „Er hatte zwei Söhne, Joseph und Bernard, aber keine Tochter. Seine Frau war im selben Winter gestorben. Ich kam ihm gerade recht. Mit zwölf Jahren war ich alt genug, um mit anzupacken. Er hat sofort eine Magd entlassen. Ich musste alles machen. Wäsche waschen, Boden schrubben, das Geschirr spülen, beim Kochen helfen. Aber er hatte auch noch ganz andere Pläne.“ Maman lachte heiser.
„Das habe ich erst nach einer Weile kapiert. Der jüngere Sohn, Bernard, vier Jahre älter als ich, hatte einen Klumpfuß und war hässlich wie die Nacht. Als ich fünfzehn wurde, hat Onkel Guichard mich in sein Kontor kommen lassen. Er saß in seinem Lehnstuhl vor dem Herdfeuer. Er packte mich am Handgelenk und zog mich zu sich auf den Schoß. Sein Atem stank nach Zwiebel und Kohl.
‚Wer eine gute Stute im Stall hat, braucht sich nicht anderswo lange umzuschauen. Ich wollte ihn zuerst Priester werden lassen, aber heutzutage soll man nichts riskieren. Josephs Frau ist trocken wie Stroh. Wer weiß, was mit mir in fünf, sechs Jahren sein wird. Du wirst mir ja wohl nicht ein Kind mit Klumpfuß zur Welt bringen, nur weil Bernard einen hat. Bist gesund, jung und kräftig.‘ Er schmatzte einen Kuss auf meine Backe.“
Maman blieb stehen und rieb sich mit der Hand über die Wange, als ob sie diesen Kuss noch spüren könnte. Ich wartete, wollte wissen, wie die Geschichte weiterging. Sie war fast so spannend wie Vaters Abenteuer.
Ich stieß Maman ungeduldig in die Seite.
Sie blickte überrascht auf mich herab.
„Das ist nichts für kleine Ohren“, sagte sie barsch.
„Aber“, protestierte ich. Die vielen Küsse und Umarmungen in den Vorstellungen. Die schrillen, spitzen Schreie von Leonore, wenn Scaramouche sie in den Hintern kniff. Ich wusste längst Bescheid über die Liebe.
„Bitte, Maman“, bettelte ich.
Maman überhörte es. Stattdessen zeigte sie auf ein Dorf, das sich am Horizont gegen einen langgestreckten Hügel schmiegte.
„Siehst du die große Kirche mit den beiden hohen Türmen?“, fragte sie. Ich nickte widerwillig.
„La Romieu. Dort werden wir übernachten.“
Ich verzog verdrießlich den Mund.
„Es ist wirklich keine Kindergeschichte“, sagte Maman und zerrte das Pferd weiter.
Ich trottete missmutig hinterher.
Als wir am frühen Abend die ersten Höfe am Fuß des Hügels erreichten, knurrte mein Magen vor Hunger und meine Fußsohlen brannten.
Maman bog, ohne zu zögern, von der Straße ab in eine Allee, die sich auf halber Höhe des Hügels befand und die zu einem Gutshof führte. Die Kronen der mächtigen Eichen links und rechts trafen sich über unseren Köpfen zu einem Flechtwerk aus Ästen und Blättern.
„Wohnt hier Onkel Guichard?“, fragte ich, als wir einen Torbogen in einer Steinmauer erreichten.
„Nein, Joseph und seine Frau Raymonde.“
Maman führte das Pferd und mich durch das Tor in den gepflasterten Hof. Ein Hund bellte und beim Haus uns gegenüber wurde die Tür mit Schwung aufgestoßen. Ein Mann trat heraus. Mit der Hand musste er die Augen vor der tief stehenden Abendsonne beschatten.
„Lass mich reden und sei still, keinen Mucks“, warnte Maman mich. Sie ließ mein Handgelenk los und verwandelte sich, wie bei jeder Aufführung, von einem Augenblick zum nächsten in Columbine. Nur, dass es diesmal fehl am Platz wirkte, ihr strahlendes Lächeln, die Grübchen in den Wangen, die Gesten, die Schritte.
„Joseph, lieber Joseph. Du wirst mich doch noch erkennen“, rief sie. Der Mann stutzte.
„Caroline?“
Maman jauchzte übertrieben fröhlich.
„Ja, ich bin’s, Caroline! Joseph, wie ich dich und Raymonde vermisst habe.“
Sie umarmte den Mann, schien nicht zu sehen, dass dieser die Arme vor der Brust verschränkt hielt. Sie küsste ihn sogar auf beide Wangen.
„Hör auf damit. Was sollen sich die Leute denken“, knurrte er.
Aus einem der Nebengebäude waren zwei Burschen getreten, Knechte. Sie trugen einfache, grobe Hemden und Hosen aus braunem Leinen. Einer der beiden hielt eine Heugabel in der Hand. Sie starrten unverhohlen neugierig zu uns herüber.
„Ich freue mich so, dich zu sehen“, rief Maman. „Und wie geht es der guten …“
„Kommt rein“, unterbrach sie der Mann und schob Maman durch die Tür. Ich folgte.
Er führte uns in eine große Küche. Mit meinen nackten Füßen stand ich neben Maman auf den Steinplatten. Die Kälte zog an meinen Beinen hinauf. Ich versuchte, nicht zu zittern.
Am Küchentisch rollte eine Frau Teig aus. Sie hatte ein verhärmtes Gesicht.
„Raymonde“, sagte der Mann. „Caroline ist wieder da.“
Aber Maman ließ sich ihren Auftritt nicht nehmen.
„Ist das nicht eine Überraschung“, rief sie der Frau entgegen und kicherte, als ob man sie beim Versteckenspielen aufgestöbert hätte.
Die Frau schaute sie entgeistert an.
„Damit hatte ich nicht gerechnet“, sagt sie schließlich schleppend. „Nie und nimmer.“
Ihr Blick glitt von Maman zu mir.
„Du hast …“
„Und was willst du hier?“, unterbrach der Mann seine Frau. Seine Stimme klang abweisend.
Maman verzog weinerlich das Gesicht.
„Du wirst einer Frau und ihrem Kind doch das Dach nicht über dem Kopf verwehren, für ein oder zwei Nächte.“
„Und dann?“
„Dann werden wir zu Onkel Guichard und Bernard weiterreisen. Es geht ihnen doch gut, oder?“ Sie streckte trotzig das Kinn vor.
„Bernard ist tot.“
Maman zuckte zusammen und verbarg das Gesicht in ihren Händen. Ganz fest presste sie dabei die Handflächen gegen ihre Augenlider. Das war ein guter Trick. Leonore hatte ihn uns gezeigt. Man drückte eine Weile gegen die Augen, und wenn man dann die Hände wegnahm, musste man heftig blinzeln. Wer es richtig machte, konnte nachher sogar echte Tränen weinen.
Jetzt machte Maman es genauso, und ihr rannen die Tränen die Wangen hinunter.
„Und Onkel Guichard?“, fragte sie.
„Gesund wie eh und je“, antwortete der Mann keine Spur freundlicher. Mamans Kummer schien ihn nicht zu berühren. „Nur, was macht dich so sicher, dass er dich wieder aufnehmen wird, nachdem du sang- und klanglos vor sechs Jahren verschwunden bist?“
„Da mach du dir mal keine Sorgen.“ Mamans Stimme klang plötzlich genauso hart. „Wenn ich ihm“, sie atmete durch, „seinen Enkel bringe, wird die Tür weit offen stehen.“
Ich sah, wie die Frau am Küchentisch blass wurde.
„Einen Enkel?“, wiederholte der Mann.
„Jawohl, seinen einzigen“, bekräftigte Maman spitz. „Oder hat Onkel Guichard etwa für Bernard nachher noch eine andere Frau gefunden?“
Die Adern an den Schläfen des Mannes schwollen an, genauso wie bei Vater, wenn er wütend war. Aber Maman schien keine Angst zu haben, dass dieser Joseph sie schlagen würde. Im Gegenteil, sie lachte ihn herausfordernd an.
„Hört auf!“, rief die fremde Frau dazwischen. „Was soll das Kind sich von euch denken. Und seht nur. Es zittert vor Kälte und Müdigkeit.“ Sie kam um den Tisch herum und nahm mich in die Arme. Sie roch gut nach Fleischpastete. Ich lehnte mich an sie und zog begehrlich den Duft ein. Ich merkte auf einmal, wie hungrig ich war.
„Joseph, beeil dich mit der Abendarbeit. Caroline, du kannst das Gästezimmer oben haben, und der Junge schläft im Kinderzimmer. Schau mich nicht so an. Ich habe ein Kinderzimmer, auch wenn nie ein eigenes Kind darin schlafen konnte!“, bestimmte die Frau.
Wenig später hatte sie mich aus meinen Kleidern geschält und in eine warme Decke gehüllt.
„Wann hast du dich denn das letzte Mal richtig gewaschen?“, fragte sie, als sie meine Hände zwischen den ihren wärmte und die dicken Trauerränder unter meinen Nägeln bemerkte.
Ich zuckte mit den Schultern.
„Vor zwei Wochen, oder drei vielleicht?“, antwortete ich unsicher.
Sie verschwand einen Augenblick aus dem Zimmer. Ich hörte, wie sie Befehle rief, nach warmem Wasser, Seife und Tüchern verlangte.
Während ich wartete, spukten Mamans Worte durch meinen Kopf. Erst jetzt fing ich an zu begreifen, was sie da gesagt hatte. Wenn ich der einzige Enkel meines Großonkels war, konnte Vater nicht mein Vater sein. Und was war mit Matthieu? Ich war nicht allein. Ich hatte einen Bruder, mein Spiegelbild. Warum hatte Maman ihn vergessen? Warum hatte sie gelogen?
„Du kannst Tante Raymonde zu mir sagen.“
Die fremde Frau war wieder im Zimmer und strich mir übers Haar.
„Wie heißt du denn eigentlich?“ Sie lächelte mich freundlich an, und sah plötzlich jung aus.
„Matthieu“, antwortete ich, weil ich noch immer an meinen Bruder denken musste.
„Matthieu, ein hübscher Name, und wenn ich dir diesen Schmutz abgewaschen habe, passt er auch zu dir.“
Ich nickte stumm.
Maman erwiderte nichts, als Tante Raymonde mich beim Abendessen als Matthieu präsentierte. Wie selbstverständlich verwendete sie diesen Namen, wenn sie mich anredete.
„Matthieu sitz gerade, auch wenn du müde bist.“
Bei den Karren oder in den Wirtschaften hatte es sie nie gekümmert, wie wir uns beim Essen benommen hatten.
„Matthieu, kannst du Onkel Joseph das Brot reichen.“
„Matthieu, du hast dich hoffentlich bei Tante Raymonde für das Waschen bedankt?“
Matthieu dies. Matthieu das. Und ich nickte und antwortete und tat, was sie von mir verlangte, bis ich vor Müdigkeit kaum mehr die Augen offen halten konnte.
Maman machte Anstalten, sich aus dem Sessel zu erheben, um mich zu Bett zu bringen, aber Tante Raymonde kam ihr zuvor.
„Lass mir die Freude, Caroline“, sagte sie, hob mich auf, als ob ich gerade den Windeln entwachsen wäre, und trug mich ins Kinderzimmer.
Dort zog sie mir Hemd und Hose aus.
„Ich werde die Kleider waschen und beim Herdfeuer trocknen“, versprach sie.
Ich kroch ins Bett, und sie deckte mich zu. Die Decke war herrlich warm und weich.
„Soll ich noch eine Weile bei dir bleiben, damit du dich nicht fürchtest?“, fragte sie sanft. „Oder möchtest du lieber, dass deine Maman kommt?“
Die Idee, dass Maman neben mir sitzen würde, bis ich einschlief, war komisch. Das hätte Vater nie erlaubt.
„Bleib du nur“, murmelte ich, bereits schläfrig.
Ich spürte, wie sie sich auf meine Bettkante setzte, und ihre Hand streichelte meinen Kopf. Sie fing an, leise und tief brummend ein Wiegenlied zu singen.
„Matthieu hätte das auch gefallen“, dachte ich, bevor ich nichts mehr wusste.
Als ich wieder aufwachte, war es stockfinster um mich herum. Ich setzte mich halb auf und entdeckte erleichtert einen schmalen, flackernden Lichtstreifen unter der Türschwelle zum Nachbarzimmer. Es dauerte ein wenig, bis ich begriff, was mich geweckt hatte. Ich hörte Stimmen. Eine höhere, eindringliche, gut verständliche Stimme und eine leisere, dunklere Stimme, die nur zu antworten schien. Ich lauschte.
„Wir könnten ihn behalten.“ Das war Tante Raymonde.
Onkel Josephs Antwort war nur als Murmeln zu hören.
„Wir könnten ihn wie unser eigenes Kind großziehen. Er ist so jung und zutraulich. Wie er sich an mich geschmiegt hat beim Einschlafen.“
„Caroline wird …“ Onkel Josephs Stimme wurde unhörbar.
„Ach, Caroline. Sie ist noch immer das flatterhafte Wesen. Wenn ich Matthieus Mutter wäre, hätte ich nie zugelassen, dass eine Fremde ihn wäscht und zu Bett bringt. Und hast du sie beim Essen beobachtet? Matthieu dies, Matthieu das. Dabei ist das Kerlchen noch nicht einmal dem Kinderkleidchen entwachsen. Weiß Gott, warum sie ihn kleidet, als ob er Jahre älter wäre.“
Ich hatte an meiner Kleidung nichts auszusetzen. Natürlich hatte ich gesehen, dass andere Kinder, die reicheren Stadtkinder, in unserem Alter über Hosen und Hemd noch ein Überkleid trugen. Aber Matthieu und ich hatten darüber gewitzelt.
„Und überhaupt, schau sie dir an. Sie kann noch so viele Kinder bekommen. Nicht so wie ich.“
„Wir müssten mit Vater reden.“ Onkel Josephs Stimme klang wenig begeistert.
„Ach Joseph, ich kann ihn lieben wie ein eigenes, und du brauchst einen Erben.“
Sie fing an zu schluchzen.
Onkel Joseph tröstete sie.
„Ist schon gut, Raymonde. Ist schon gut. Wenn du ihn wirklicht willst, wirst du ihn bekommen. Ich rede mit Vater. Und jetzt lösch das Licht.“
„Gleich!“ Tante Raymondes Stimme klang aufgekratzt. „Ich schaue nur, ob er gut zugedeckt ist.“
Ich erstarrte in meinem Bett und versuchte, ruhig und langsam zu atmen. Die Tür ging leise knarrend auf. Auch durch die geschlossenen Lider sah ich den Lichtschein. Dann Schritte und ein Schatten über mir.
Ich spürte, wie sie ihren Kopf zu mir herunter beugte. Unter der Decke ballte ich meine Faust zusammen. Maman hätte sofort gewusst, dass ich nicht schlief. Sie hätte mich einen miserablen Schwindler genannt.
Aber Tante Raymonde bemerkte nichts. Sie blieb eine ganze Weile stehen. Dann richtete sie sich wieder auf, und wenig später knarrte die Tür. Ich öffnete erleichtert die Augen. Sie war weg.
Aber das, was die beiden im Nachbarzimmer besprochen hatten, spukte in meinen Kopf herum.
Es war, als ob das Stück, das Maman und ich bei unserer Ankunft angefangen hatten, einfach weitergespielt wurde. Nur, dass jetzt auch Tante Raymonde und Onkel Joseph eine Rolle darin hatten. Während ich darüber nachdachte, schlief ich ein.
4.
Am nächsten Morgen scharwenzelte Tante Raymonde um mich herum. Sie wärmte mir die Milch und rührte Honig hinein. Sie strich mir sogar die Butter auf das Brot.
„Willst du ihm nicht einen Brei kochen und ihn füttern?“, fragte Maman amüsiert.
Tante Raymonde errötete.
„Er ist noch so klein“, wehrte sie sich.
„So klein bin ich nicht“, sagte ich gekränkt, während ich das Brot kaute.
„Vor drei Wochen habe ich den …“
Maman ließ mich nicht zu Ende reden.
„Beeil dich. Wir müssen uns auf den Weg machen.“
Der Blick, den sie mir zuwarf, war unmissverständlich. Ich sollte nichts über Scaramouche und seine Truppe erzählen.
„Willst du Matthieu und den Karren nicht dalassen?“, schlug Tante Raymonde vor. Ihre Wangen bekamen rote Flecken. „Allein kannst du die Stute reiten und bist schneller. Du hast sicherlich einiges mit Guichard zu bereden. Da ist der Kleine nur im Weg. Wir würden gut auf ihn aufpassen, und wenn alles besprochen ist, schickst du uns eine Nachricht, und wir bringen ihn.“
Sie lächelte nervös, und ihre Hände kneteten den Stoff der Schürze.
Plötzlich wusste ich ganz genau, dass das Stück, das Tante Raymonde spielen wollte, schrecklich war. Nur Maman schien es nicht zu verstehen. „Hättet ihr denn einen Sattel für mich?“, fragte sie.
„Natürlich“, rief Tante Raymonde und strahlte vor Freude.
„Maman!“, rief ich bestürzt.
„Ach Matthieu. Es sind nur ein paar Tage. Tante Raymonde wird dich so verhätscheln, dass du gar nicht mehr zu mir zurück möchtest.“ Sie lachte und hatte keine Ahnung, dass Tante Raymonde genau das plante.
Tante Raymonde kniete sich vor mich hin und versuchte, mich in die Arme zu nehmen. Ich wehrte mich und sie ließ sofort los.
„Matthieu, wir werden es uns schön machen“, lockte sie. „Wenn du willst, spazieren wir am Nachmittag zur Kirche, und du darfst auf den hohen Turm steigen. Von da aus kannst du fast die ganze Welt sehen. Wenn du scharfe Augen hast, sogar bis zum Palast des Königs in Paris.“
Ich wandte den Kopf ab.
Pah, der Palast des Königs! Tante Raymonde hatte keine Ahnung. Wenn Pantalone nicht gestorben, Matthieu und Leonore nicht krank geworden und Jacques nicht davongelaufen wäre, würden wir heute bestimmt schon in diesem Palast stehen und vor dem König auftreten.
„Wenn …“, setzte ich an und diesmal wusste Maman, was ich sagen wollte, denn sie schnitt mir das Wort ab. „Wenn du unbedingt willst, nehme ich dich mit. “
„Caroline“, wandte Tante Raymonde ein.
Maman ließ auch sie nicht zu Wort kommen.
„Raymonde, ein kleines Kind gehört zu seiner Mutter. Wir waren noch nie getrennt.“
Tante Raymonde stand auf und drehte sich zur Spüle. Mit hochgezogenen Schultern blieb sie so stehen.
Wenig später waren wir unterwegs. Als wir außer Sichtweite des Gutshofes waren, reichte Maman mir ihre freie Hand.
„So, Pedrolino“, sagte sie, „jetzt müssen wir eine Weile nicht mehr schauspielern. Wieso, um Himmels willen, bist du auf die seltsame Idee gekommen, dich Matthieu zu nennen?“
„Du hattest ihn vergessen, und ich musste an ihn denken“, verteidigte ich mich und betrachtete meine Füße.
„Ach wo. Natürlich habe ich Matthieu nicht vergessen. Es ist nur einfacher, wenn Joseph, Raymonde und Onkel Guichard nichts über ihn wissen.“
„Glaubst du, wird Matthieu sterben, so wie Pantalone?“, fragte ich.
Maman ließ meine Hand los und rubbelte mir durch das Haar.
„Pantalone war alt. Matthieu ist kräftig. Du wirst sehen, in wenigen Wochen sind wir wieder alle zusammen. Vater findet ein neues Liebespaar und einen neuen Pantalone. Oder wer weiß, vielleicht lässt Vater Matthieu den Pantalone spielen, und wir nehmen uns zwei weitere Kinder als Pedrolino und Harlequino. Aber bis es soweit ist, nisten wir uns bequem bei Onkel Guichard ein.“
Maman lachte mich an und ich lachte zurück. Es war schön zu wissen, dass ich mir keine Sorgen machen musste …
In der nächsten Stunde hüpfte ich fröhlich neben ihr her. Der Weg zog sich über Hügel, die mit Weinstöcken bewachsen waren, nur hier und da unterbrochen von einem kleinen Wäldchen oder einem Bachlauf.
Am Anfang drehte ich mich immer wieder um, um die beiden Kirchtürme zu betrachten. Sobald wir jedoch über den ersten Hügelrücken gewandert waren, verschwanden sie aus meinem Blickfeld.
„Ich habe gewusst, dass Tante Raymonde gelogen hat“, plapperte ich.
„Was?“ Maman war mit den Gedanken woanders.
„Na sieh nur.“ Ich zerrte an ihrem Rock, bis sie zurückschaute.
„Siehst du noch die Türme?“, fragte ich.
„Sollte ich?“
„Natürlich. Tante Raymonde hat behauptet, man kann von ihnen bis in den Palast des Königs in Paris sehen. Und das wäre noch viel weiter, als wir bis jetzt marschiert sind, oder? Tante Raymonde ist eine dumme Lügnerin.“
„So etwas sagt man nicht von seiner Tante“, rügte Maman, aber sie hatte wieder Grübchen in den Wangen. Und als ob mein Vorwurf sie an etwas erinnerte, band sie die Stute am nächsten Baum fest und deutete mir, neben ihr im Gras Platz zu nehmen.
„Jetzt pass mal gut auf“, fing sie an. „Tante Raymonde und Onkel Joseph waren damals nicht dabei. Aber Onkel Guichard ist schlau. Es ist deshalb wichtig, dass du deine Rolle beherrschst und dich nicht verplapperst.“
Ich schaute sie erwartungsvoll an.
„Also …“ Maman zögerte und rupfte das Gras mit ihren Fingern aus. „Dein Großonkel muss für eine Weile dein Großvater sein. Dann wird alles leichter, verstehst du?“
Ich nickte, obwohl ich nicht verstand, was sie damit meinte.
„Vater und Matthieu und die ganze Truppe musst du ein bisschen vergessen. Merk dir, dass ich von Großonkel - nein Großvater“, verbesserte sie sich, „weggegangen bin und nun mit dir zu ihm zurückkehre.“
Ich runzelte die Stirn. Keine Auftritte, keine Kostüme, keine Rollen.
„Ja, aber wo haben wir denn gewohnt? Was haben wir gemacht?“, warf ich ein.
Maman dachte eine ganze Weile nach.
„Mir ist etwas eingefallen“, erklärte sie schließlich. „Kannst du dich noch an den großen Gutshof erinnern, wo wir vor einem halben Jahr gespielt haben? Dort habe ich die beiden Töchter des Gutsherrn unterrichtet. Dort bist du aufgewachsen.“
Und ob ich mich erinnerte. Wir waren gerade rechtzeitig zum Erntedankfest gekommen und hatten nach der Vorführung an der langen Tafel mit den Bauern der Umgebung sitzen dürfen. Matthieu und ich hatten gegessen, bis wir nur noch rülpsen konnten, und Pantalone hatte so viel Wein getrunken, dass er schließlich mit dem Kopf auf dem Tisch eingeschlafen war. Ich schloss die Augen.
Es war nicht klug von mir, an Pantalone und Matthieu zu denken, da kamen die schemenhaften Bilder zurück, die ich nicht sehen wollte. Das knöcherne, eingefallene Gesicht Pantalones und Matthieus fiebrig glänzende Augen, die mich anstarrten, ohne mich zu sehen.
„Wirst du heute am Abend an meinem Bett sitzen, bis ich eingeschlafen bin?“, fragte ich unvermittelt.
„Ach Pedrolino, du bist kein Wickelkind mehr.“
„Nenn mich nicht Pedrolino, nenn mich Matthieu, bis er wieder da ist. Damit du ihn nicht vergisst“, verlangte ich eigensinnig.
Maman schaute mich stumm an.
„Wenn du dich dafür an deine Rolle hältst“, antwortete sie schließlich. Ich versprach es.
5.
Am frühen Nachmittag erreichten wir einen kleinen Fluss, eigentlich nur einen breiten Bach, der sich zwischen Sträuchern und hohen Gräsern seinen Weg bahnte. Jenseits der Furt am Hang gegenüber lag eine Stadt. Nicht groß, aber von Mauern umgeben. Über die Häuser dahinter ragte gedrungen eine Kirche.
„Condom“, sagte Maman. „Hier wohnt Onkel Guichard.“ Sie straffte ihren Rücken und trieb das Pferd mit dem Karren durch die Furt, die Straße hinauf zum Stadttor.
Wenig später fuhren wir über den Kirchplatz. Maman führte uns in eine schmale Straße, die sich in einem Bogen wieder nach unten senkte. Sie war gesäumt von zweistöckigen Häusern aus gleichmäßig gehauenen Steinen mit verzierten Türportalen und Fenstersimsen aus grauem Granit.
Bei der vierten Tür hielt Maman den Karren an. Ich kletterte hinunter und Maman reichte mir die Zügel.
„Vergiss nicht, was wir besprochen haben“, mahnte sie mich.
Ich nickte und starrte beeindruckt auf den großen Türknauf, einen Löwenkopf aus schwarz glänzendem Metall, zwischen dessen Zähnen ein Ring klemmte. Maman griff nach dem Ring und schlug ihn gegen die Holztür.
Über uns wurde ein Fenster aufgerissen. Eine Frau schaute herunter.
„Schert euch fort. Wir kaufen nichts!“, keifte sie.
Maman legte den Kopf in den Nacken.
„Aber Nanette“, rief sie hinauf, „erkennst du mich nicht mehr? Ich bin es, Caroline.“
„Das gibt’s doch nicht!“
Der Kopf verschwand und das Fenster wurde zugeschlagen.
Ich lauschte. Kein Geräusch drang aus dem Haus.
„Maman“, fragte ich besorgt, „was machen wir, wenn sie uns nicht hineinlassen?“
„Dann gehen wir durch den Hintereingang. Oder ich klopfe bei den Nachbarn an“, sagte Maman. „Ich lasse mich nicht abwimmeln, und schon gar nicht von Nanette.“
Sie streckte die Hand abermals zum Löwenkopf, als die Tür von innen geöffnet wurde. Die Frau, die vorhin aus dem Fenster geschaut hatte, trat einen Schritt zur Seite, damit ein alter Mann mit grauem, strähnigem Haar an ihr vorbei konnte. Der Mann lehnte schwer auf einem Stock und ging mit steifen, kleinen Schritten. Dabei hielt er seinen Oberkörper so gerade, dass man meinen konnte, er hätte einen zweiten Stock verschluckt.
An der Schwelle blieb er stehen.
„Monsieur! Sie nannte mich beim Namen und sie behauptete, Caroline zu sein. Aber das kann nicht wahr sein. Sie haben doch immer erzählt, sie sei gestorben …“ Die Stimme der Frau überschlug sich, und ich sah, wie sie ein Kreuzzeichen schlug.
„Guten Tag, Onkel Guichard“, grüßte Maman und lächelte wie Columbine. Dann schob sie mich nach vorne, als ob ich ein Geschenk wäre. „Das hier ist Euer Enkel, Matthieu.“
Der Mann betrachtete mich lange. Sein Blick glitt über meinen Kopf, Brust, Beine, bis zu den Zehen.
„Er hat blondes Haar“, bemerkte er schließlich knapp.
„Meine Großmutter war blond“, erwiderte Maman schlagfertig. „Strohblond.“
Der Mann nahm das wortlos zur Kenntnis, und wieder spürte ich, wie seine Augen meinen Körper prüfend abtasteten.
„Er ist gesund“, stellte er fest.
„Kerngesund“, bestätigte Maman rasch. „Und kräftig und klug.“ Ihre Hand drückte gegen meinen Rücken, aber ich stemmte mich dagegen.
„Er lernt schon Latein. Nicht wahr, Matthieu?“
Ich dachte an die holprigen Verse des Dottore, die ich herunterleiern konnte, ohne sie zu verstehen, und nickte unsicher.
„Na los, Matthieu!“ Maman schob mich plötzlich ein Stück nach vorne, sodass ich unmittelbar vor diesem Mann stand, der auf einmal mein Großvater sein sollte. Er roch süßlich scharf.
„Das Gedicht, das du so hübsch gelernt hast. Nec corporem …“, beharrte Maman.
„Nec corporem …“ Ich hob den Blick nicht und leierte die wenigen Zeilen herunter, um den Auftritt hinter mich zu bringen.
„So talentiert“, lobte Maman mich, als ich fertig war. „Ganz der Vater.“
„Leeres, nutzloses Geplapper“, bemerkte der Mann trocken. „Damit kann er vielleicht einen alten Pfarrer beeindrucken, der nur das Latein der Messe versteht.“ Er drehte sich um und entfernte sich.
„Ich hätte auch nicht zurückkommen müssen“, rief Maman ihm nach, und ihre Stimme klang merkwürdig schrill. „Aber ich hörte von Josephs Kinderlosigkeit, und da wollte ich Euch Euren einzigen Enkel nicht länger vorenthalten.“
Der alte Mann blieb stehen. Mit seiner freien Hand stützte er sich an der Mauer ab und schaute schwerfällig halb über die Schulter zu uns.
„Du kennst sicher noch den Hintereingang“, sagte er tonlos. „Stell das Pferd in den Stall.“
„Der soll mein Großvater sein?“, fragte ich Maman, als wir die Stute und den Karren aus der Gasse heraus um die Häuserzeile führten.
„Warum geht er mit dem Stock? Warum mag er meine blonden Haare nicht? Warum ist er so unfreundlich?“, beschwerte ich mich. Ich wollte nicht einmal für ein paar Stunden in einem solchen Menschen einen nahen Verwandten sehen. Aber Maman hatte dafür kein Verständnis.
„Das ist jetzt alles unwichtig. Merk dir nur, dass er für eine Weile dein Großvater sein soll“, mahnte sie mich eindringlich. „Es ist eine Rolle, aber wenn du dich verplapperst, stehen wir beide ohne Dach über dem Kopf da. Ich bin müde, Pedrolino, und ich möchte in einem Bett schlafen.“
„Matthieu, Matthieu, Matthieu“, schrie ich sie an, und meine Stimme hallte zwischen den Steinmauern der Häuser.
Maman zog mich zu sich und hielt mir den Mund fest zu.
„Bitte, Matthieu. Ich weiß sonst nicht, wohin“, flehte sie.
Sie lockerte ihren Griff erst, als ich schluchzend und nach Atem ringend nickte. Dann bedeckte sie mein Gesicht mit Küssen.
„Es wird alles gut, es wird alles wieder gut“, versprach sie.
Der Hintereingang zum Haus befand sich an einer Straße, die an einem Fluss entlang führte. Am anderen Ufer, dort wo das Wasser über eine Steinschwelle floss, stand eine Mühle. Maman ließ mir keine Zeit, das sich rasch drehende Rad zu beobachten. Sie zog mich vom Wasser fort zu einem Torbogen. Dort wartete Nanette auf uns, an ihrer Seite ein älterer Mann.
„Es tut mir leid, Madame, dass ich Sie nicht gleich erkannt habe.“
Nanette machte den Ansatz zu einem Knicks.
Der Mann betrachtete uns misstrauisch.
Maman übersah Nanette und reichte dem Mann den Strick.
„Geben Sie der Stute ausreichend zu fressen. Sie hat einen langen Weg hinter sich. Das Gepäck vom Karren tragen Sie hinein auf mein Zimmer.“ Ihre Stimme klang so hochmütig wie die Leonores, wenn sie die Gräfin gespielt hatte.
Maman nahm mich an der Hand, zögerte kurz, drehte sich resolut um, und wir traten wieder auf die Straße hinaus.
„Gehen wir nicht hinein?“, fragte ich überrascht.
„Doch, aber durch den Haupteingang. Wenn der alte Mann glaubt, ich müsste als Büßerin zurückkehren, täuscht er sich. Ich habe auch meinen Stolz.“
Von dem Stolz war allerdings wenig übrig, als wir wieder vor Großonkel Guichard standen.
Maman blickte auf den Teppich. Sie ließ es auch zu, dass ich mich hinter ihrem Rock verkroch und verstohlen seitlich vorbeilugte.
Großonkel Guichard verzog keine Miene und wartete.
„Ich“, durchbrach Maman schließlich die zermürbende Stille. Ihre Stimme zitterte leicht.
„Du musst schon lauter und deutlicher reden, wenn ich dich verstehen soll!“, fuhr Großonkel Guichard sie an. „Hast du etwa vergessen, dass ich auf einem Ohr taub bin? Und das andere ist auch nicht mehr so, wie es war.“
„Ich möchte Euch bitten, ob das Kind und ich bleiben können?“, stotterte Maman eine Spur lauter.
„Du hattest ein Zuhause, soweit ich mich erinnere. Du bist weggegangen. Warst einfach fort.“
„Ich habe einen Brief …“
„Ah ja, dein Brief!“ Onkel Guichard griff auf seinen Schreibtisch und nahm ein Stück zerknülltes Papier zur Hand. Er nahm sich nicht die Mühe, es ordentlich zu glätten.
„Werter Onkel. Ich kann nicht so, wie Ihr wollt. Verzeiht mir“, las er vor. Dann warf er den Brief vor Maman auf den Boden.
„Was ist, wenn ich jetzt nicht so kann, wie du willst? Warum sollte ich dich wieder bei mir aufnehmen? Damit die Nachbarn über mich spotten?“, ereiferte er sich. Sein Gesicht lief purpurrot an, und an seiner Schläfe schwollen die Adern.
„Ich war so dumm.“ Maman fing an zu schluchzen. Nicht wie bei einer unserer Vorstellungen, sondern so abgehackt und hässlich, dass ich Angst bekam.
„Maman, Maman.“
Ich kam aus meinem Stoffversteck hervor und klammerte mich an sie.
„Und deinem Balg soll ich wohl auch ein Dach über dem Kopf geben?“, schrie Großonkel Guichard. „Damit man mich in der Stadt vollends für einen Esel hält? Bernards Sohn, dass ich nicht lache. Wie soll er das denn geschafft haben?“ Onkel Guichard verschluckte sich an seinem eigenen keuchenden Lachen.
Maman krümmte sich unter seinen Worten. Ich begriff auf einmal, dass sie ihre Rolle vergessen hatte. Das Stück lief völlig falsch.
„Wenn ich nur Scaramouche wäre“, dachte ich. Der hätte diesen gemeinen, alten Mann in die Schranken gewiesen, so wie er es in jedem unserer Stücke mit Pantalone, dem geldgierigen, dummen Kaufmann tat. Aber ich war nicht Scaramouche, nur ein kleiner Junge, der sich vor Angst fast in die Hosen machte. Und dabei sollte ich auf Maman aufpassen. Sie gehörte Vater, und niemand durfte sie so anfahren. Ich wusste doch, wie wütend Vater jedes Mal wurde, wenn einer der Zuschauer bei einer Aufführung Columbine unter den Rock griff, und Matthieu es nicht rechtzeitig mit festen Schlägen seines Batocios verhindert hatte, oder wenn ein weinseliger Mann am Abend in einem Wirtshaus zu nahe zu Maman auf die Bank rücken wollte.
„Einer links und einer rechts von ihr“, hatte Vater uns befohlen. „Denn wer so hübsch ist wie meine Columbine, dem drohen die größten Gefahren. Ihr müsst sie beschützen.“ Und wehe, wenn wir uns nicht daran hielten.
„Du wagst es zurückzukommen, und statt um Verzeihung zu bitten, lügst du mir auch noch offen ins Gesicht!“
Großonkel Guichard erhob sich. Er bebte vor Zorn. Mit seinem Stock drohte er uns. Aber plötzlich knickten ihm die Knie ein, seine Augen weiteten sich. Er stöhnte. Der Stock glitt ihm aus der Hand, er schwankte und fiel dann mit einem dumpfen Dröhnen auf die Holzdielen.
Maman und ich schrien auf. Nanette stürzte herein.
Mit vereinten Kräften zogen Maman und Nanette Großonkel Guichard hoch und platzierten ihn wieder in seinem Lehnstuhl. Dort saß er nun, schief zur Seite geneigt, vor Schmerzen stöhnend mit glasigem Blick. Er schien uns gar nicht richtig zu bemerken.
Nanette holte eine Flasche und ein Glas aus der Küche. Sie schenkte es voll. „Monsieur?“
Großonkel Guichard nickte. Er versuchte, seine rechte Hand nach dem Glas zu strecken, aber es gelang ihm nicht. Schweißtropfen perlten von seiner Stirn und er sackte noch mehr in sich zusammen.
„Oh Gott, oh Gott“, jammerte Nanette.
„Gib her!“ Maman nahm das Glas aus Nanettes Hand, beugte sich über den alten Mann und führte es an seine Lippen.
„Trinken Sie!“ Und dann zu Nanette. „Was stehst du noch herum, dummes Ding? Hol einen Arzt.“
Nanette raffte ihren Rock hoch und rannte aus dem Zimmer.
Es stellte sich heraus, dass Onkel Guichards Unfall ein Glück für Maman und mich war.
Der Arzt, der herbeigeeilt kam, glich in keiner Hinsicht dem dummen, überheblichen Dottore, den ich gespielt hatte. Er hatte, obwohl noch jung, ein ernstes, ruhiges Gesicht. Er warf einen Blick auf Großonkel Guichard und dann auf Maman und Nanette.
Maman begrüßte ihn und stellte sich als Schwiegertochter vor. Onkel Guichard versuchte dagegen zu protestieren, aber der Arzt verstand seine gelallten Wortfetzen nicht.
Und Nanette, die händeringend auf der Türschwelle stand, übertönte den alten Mann zusätzlich mit ihrem Gejammer: „Was wird nur aus uns werden, wenn Monsieur krank ist? Was wird nur aus uns werden?“
Der Arzt schob sie ohne viel Federlesen aus dem Zimmer. Maman durfte bleiben.
Und ich? Er sah mich gar nicht. Ich hatte mich unter dem Schreibtisch verkrochen, der vor dem Fenster stand.
Der Arzt holte aus seiner Tasche seine Instrumente, und Maman musste Onkel Guichard die Weste und das Hemd aufknöpfen. Onkel Guichard wehrte sich, versuchte Maman wegzustoßen und gleichzeitig dem Arzt etwas zu sagen. Aber alles, was er aus seinem schiefen Mund pressen konnte, blieb unverständlich für einen, der nicht wusste, dass Onkel Guichard uns zum Teufel jagen wollte.
„Regen Sie sich nicht auf, Monsieur. Das verschlimmert Ihren Zustand“, mahnte der Arzt.
Und zu Maman: „Ich werde ihn zur Ader lassen. Sein Blut ist überhitzt. Holen Sie ein Gefäß.“
Als Maman aus dem Raum ging, wandte sich der Arzt an seinen Patienten. „Ohne Frauen im Zimmer, kann ich Ihnen nun geradeheraus sagen, wie es um Sie steht. Sie können froh sein, dass Sie noch am Leben sind. Aber Sie werden die nächsten Wochen wie ein Säugling umsorgt werden müssen. Die rechte Körperhälfte ist gelähmt, und ich kann Ihnen nicht sagen, ob Sie je wieder richtig gehen und sprechen werden können. Bei einigen bilden sich die Lähmungen ganz zurück, bei anderen teilweise und bei manchen bleiben sie für immer. Sie dürfen sich glücklich schätzen, dass Sie eine so gefasste und ruhige Schwiegertochter in Ihrem Haushalt haben!“ Onkel Guichard verstummte und als Maman zurückkehrte, schaute er sie mit starrem Blick an, während der Arzt das Messer setzte.
So blieben wir.
Maman und ich bezogen zwei Zimmer im obersten Stock. Nanette, die ohne Zweifel mitbekommen hatte, dass Onkel Guichard uns nicht bei sich hatte aufnehmen wollen, ließ sich nicht nur nichts anmerken, sondern war heilfroh, dass Maman zum größten Teil die Pflege von Onkel Guichard übernahm. Sie tat ihr Bestes, es Maman in allem recht zu machen, und einmal, als ich unbemerkt von ihr unter dem Küchentisch eine Handvoll Nüsse naschte, hörte ich sie mit der Magd des Nachbarn tratschen. Eine so fantasievolle, dramatische Geschichte hätte Vater sich nicht besser ausdenken können. In Nanettes Version hatte Bernard Maman heiraten wollen, und Onkel Guichard, der nicht damit einverstanden war, hatte Maman hartherzig fortgeschickt.
„Nicht ahnend, dass sie schwanger war. Das arme Ding war so eingeschüchtert, dass sie sich erst nach Jahren traute zurückzukommen. Da war der gute Bernard bereits tot“, log Nanette unbekümmert.
„Und der alte Monsieur?“, fragte das fremde Dienstmädchen neugierig.
„Monsieur? Das ist das Tragische. Die Freude über seinen Enkel – du weißt doch, der junge Monsieur Joseph hat keine Kinder – war zu groß.“ Nanette legte nachdenklich den Kopf schief. „Wer weiß, vielleicht ist es auch eine Strafe von oben. Verdient hätte er das schon. Madame einfach fortzujagen. Wenn ich Madame wäre …“
In diesem Augenblick entdeckte sie mich unter dem Tisch. Unsanft zog sie mich am Arm hervor.
„Lauschen ist eine Unart, Matthieu!“, schimpfte sie.
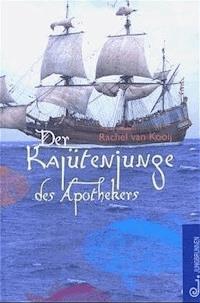




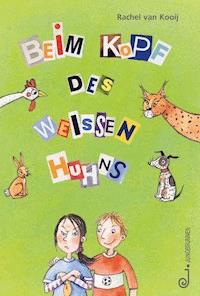













![Tintenherz [Tintenwelt-Reihe, Band 1 (Ungekürzt)] - Cornelia Funke - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/2830629ec0fd3fd8c1f122134ba4a884/w200_u90.jpg)









