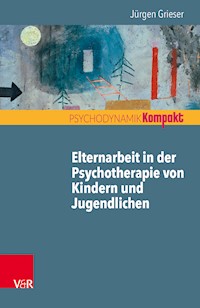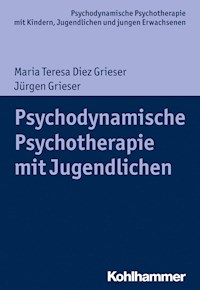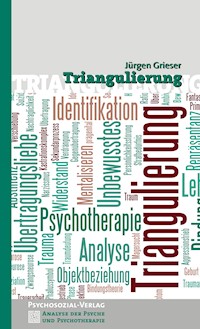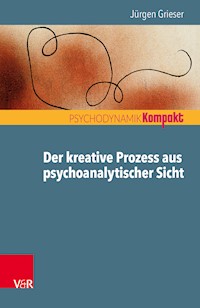
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Vandenhoeck & Ruprecht
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Psychodynamik kompakt
- Sprache: Deutsch
Kreativität ist die Fähigkeit des Menschen, seine Welt schöpferisch zu gestalten, auf die Anforderungen des Lebens zu reagieren, indem er etwas Neues erschafft. Das kleine Kind, der Mensch in seinem Alltag, der Künstler oder Wissenschaftler, alle reagieren auf Mängel, Abwesenheiten, innere Konflikte, Bedrohungen ihrer psychischen Integrität mit der kreativen Produktion von Symbolen, Vorstellungen, Werken. Der kreative Prozess verläuft in der Regel krisenhaft und umfasst verschiedene Stufen, bis er zu einer Lösung kommt, in der dann häufig auch bedrohliche innere Kräfte wieder besser integriert sind. In ihrer emotionalen Tiefe unterscheiden sich dann auch oberflächliche Produktionen ohne Bezug zu unbewussten Prozessen von emotional gesättigteren, im landläufigen Sinn kreativen Schöpfungen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 90
Veröffentlichungsjahr: 2020
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Herausgegeben von
Franz Resch und Inge Seiffge-Krenke
Jürgen Grieser
Der kreative Prozess auspsychoanalytischer Sicht
Mit 2 Abbildungen
Vandenhoeck & Ruprecht
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek:
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über https://dnb.de abrufbar.
© 2020, Vandenhoeck & Ruprecht GmbH & Co. KG,
Theaterstraße 13, D-37073 Göttingen
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk und seine Teile sind urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung in anderen als den gesetzlich zugelassenen Fällen bedarf der vorherigen schriftlichen Einwilligung des Verlages.
Umschlagabbildung: Paul Klee, Träger für ein Schild, 1934/akg-images
Satz: SchwabScantechnik, GöttingenEPUB-Produktion: Lumina Datamatics, Griesheim
Vandenhoeck & Ruprecht Verlage | www.vandenhoeck-ruprecht-verlage.com
ISSN 2566-641X
ISBN 978-3-647-99971-5
Inhalt
Vorwort zur Reihe
Vorwort zum Band
Schöpferische Kreativität und Alltagskreativität
Sublimierung und Spiel
Zerstörung und Wiedergutmachung
Die Wiedererschaffung des Verlorenen als Symbol
Kreativität als natürliches Verhältnis zur Welt
Kreativität und Krise
Geburt und Vergänglichkeit als Antrieb der Kreativität
Symbolisierung und Triangulierung
Modi der Symbolisierung
Der Schutz des Symbolischen und das Bedürfnis nach Schönheit
Angst im kreativen Prozess
Das Werk als Container des Unbewussten
Das Werk als Selbst und Objekt
Überschreiten der Grenzen
Künstliche Melancholie
Entstehen und vergehen lassen
Psychotherapie und Kreativität
Schlussgedanken
Literatur
Vorwort zur Reihe
Zielsetzung von PSYCHODYNAMIK KOMPAKT ist es, alle psychotherapeutisch Interessierten, die in verschiedenen Settings mit unterschiedlichen Klientengruppen arbeiten, zu aktuellen und wichtigen Fragestellungen anzusprechen. Die Reihe soll Diskussionsgrundlagen liefern, den Forschungsstand aufarbeiten, Therapieerfahrungen vermitteln und neue Konzepte vorstellen: theoretisch fundiert, kurz, bündig und praxistauglich.
Die Psychoanalyse hat nicht nur historisch beeindruckende Modellvorstellungen für das Verständnis und die psychotherapeutische Behandlung von Patienten und Patientinnen hervorgebracht. In den letzten Jahren sind neue Entwicklungen hinzugekommen, die klassische Konzepte erweitern, ergänzen und für den therapeutischen Alltag fruchtbar machen. Psychodynamisch denken und handeln ist mehr und mehr in verschiedensten Berufsfeldern gefordert, nicht nur in den klassischen psychotherapeutischen Angeboten. Mit einer schlanken Handreichung von 70 bis 80 Seiten je Band kann sich die Leserin, der Leser schnell und kompetent zu den unterschiedlichen Themen auf den Stand bringen.
Themenschwerpunkte sind unter anderem:
–Kernbegriffe und Konzepte wie zum Beispiel therapeutische Haltung und therapeutische Beziehung, Widerstand und Abwehr, Interventionsformen, Arbeitsbündnis, Übertragung und Gegenübertragung, Trauma, Mitgefühl und Achtsamkeit, Autonomie und Selbstbestimmung, Bindung.
–Neuere und integrative Konzepte und Behandlungsansätze wie zum Beispiel Übertragungsfokussierte Psychotherapie, Schematherapie, Mentalisierungsbasierte Therapie, Traumatherapie, internetbasierte Therapie, Psychotherapie und Pharmakotherapie, Verhaltenstherapie und psychodynamische Ansätze.
–Störungsbezogene Behandlungsansätze wie zum Beispiel Dissoziation und Traumatisierung, Persönlichkeitsstörungen, Essstörungen, Borderline-Störungen bei Männern, autistische Störungen, ADHS bei Frauen.
–Lösungen für Problemsituationen in Behandlungen wie zum Beispiel bei Beginn und Ende der Therapie, suizidalen Gefährdungen, Schweigen, Verweigern, Agieren, Therapieabbrüchen; Kunst als therapeutisches Medium, Symbolisierung und Kreativität, Umgang mit Grenzen.
–Arbeitsfelder jenseits klassischer Settings wie zum Beispiel Supervision, psychodynamische Beratung, Soziale Arbeit, Arbeit mit Geflüchteten und Migranten, Psychotherapie im Alter, die Arbeit mit Angehörigen, Eltern, Familien, Gruppen, Eltern-Säuglings-Kleinkind-Psychotherapie.
–Berufsbild, Effektivität, Evaluation wie zum Beispiel zentrale Wirkprinzipien psychodynamischer Therapie, psychotherapeutische Identität, Psychotherapieforschung.
Alle Themen werden von ausgewiesenen Expertinnen und Experten bearbeitet. Die Bände enthalten Fallbeispiele und konkrete Umsetzungen für psychodynamisches Arbeiten. Ziel ist es, auch jenseits des therapeutischen Schulendenkens psychodynamische Konzepte verstehbar zu machen, deren Wirkprinzipien und Praxisfelder aufzuzeigen und damit für alle Therapeutinnen und Therapeuten eine gemeinsame Verständnisgrundlage zu schaffen, die den Dialog befördern kann.
Franz Resch und Inge Seiffge-Krenke
Vorwort zum Band
Kreativität heißt, von sich absehen zu können. So wird der Maler Anselm Kiefer zitiert: »[…] oft muss ich dann das Bild in einen Zustand versetzen, in dem ich nicht mehr an seiner Entstehung beteiligt bin.« Sich dem Prozess der Kreativität mit psychodynamischem Hintergrund zu nähern, ist ein mutiges, aber keineswegs aussichtsloses Unterfangen. Schon das, was unter »Kreativität« zu verstehen ist, bleibt vielfältig. Der schöpferischen Begabung von Kunstschaffenden, Wissenschaftlern, Erfindern und Führungspersönlichkeiten ist eine Alltagskreativität gegenüberzustellen, die als Fähigkeit jeden Menschen auszeichnet, der die Herausforderungen seines Lebens konstruktiv meistert.
Auch ein Blick in die Geschichte der Psychoanalyse zeigt, wie unterschiedlich das Kreative bei den einzelnen Protagonisten und Protagonistinnen interpretiert wird. Freud und Klein, die das Kreative auf libidinös-sexuelle oder destruktive Triebimpulse zurückführen, stehen Rank, Erikson und Winnicott gegenüber, die in der Kreativität eine eigenständige Zugangsweise des Menschen zur Welt sehen, der eine primäre Freude am Gestalten und Schaffen von Neuem zugrunde liegt. Und doch ist festzuhalten, dass sich der kreative Prozess in der Regel krisenhaft entfaltet. Das allgemeine Modell der kreativen Krise von Ruff kennzeichnet fünf Phasen, die in der Manifestation eines Mangels ihren Ausgang nehmen. Bisherige Lösungen sind in Frage gestellt. Daraus entstehen Verunsicherung und innerer Druck, sodass die Ich-Grenzen durchlässiger werden. Subjektiv wird dies als Leiden empfunden. Aus einer krisenhaften Zuspitzung konkretisiert sich eine neue – anfangs noch diffus erscheinende – Idee, ein neuer Entwurf. Dieses Neue muss nun ausgearbeitet und in die Tat umgesetzt werden, was auch eine gerichtete Aggression voraussetzt. Nicht jede neue Lösung ist auch eine gelungene Kreation: So können formale Übertriebenheiten oder nach Roland Barthes »plappernde Texte« entstehen, denen die Tiefe und ein Bezug zum Unbewussten fehlt.
Der in der Welt der Literatur und Kunst sehr bewanderte Autor macht sich nun auf die Suche nach den Motiven für Kreativität. Ein kreatives Werk kann Verbundenheit und Vereinheitlichung herstellen, um eine Grunderfahrung des Getrenntseins zu kompensieren. Sterbliche Menschen können nach Hannah Arendt so eine nicht sterbliche Heimat finden. Die Auseinandersetzung mit Vergänglichkeit bildet ein verlässliches Grundmotiv kulturellen Schaffens.
Das kreative Werk ist ein Ausdruck von Symbolisation: vom ersten Übergangsobjekt bis zum Kunstwerk. Die Beziehung zwischen dem Ich, dem Objekt und dem Symbol entspricht einem triangulären Verhältnis. Kreativität findet also nicht allein im Kopf des Individuums statt, sondern in der Interaktion zwischen dem individuellen Denken und einem soziokulturellen Kontext.
Unterschiedliche Modi der Symbolisierung, die auch einen Rückbezug auf die normale Entwicklung des Denkens beim Kind erlauben, leiten über zu der Frage, wie sehr das Symbol eine Schutzfunktion für das Selbst entfalten kann. Dem Bedürfnis nach Schönheit steht immer wieder auch eine Angst im kreativen Prozess gegenüber.
Das Werk als Gegenüber erzeugt einen intensiven Gefühlsaustausch mit dem Schöpfer, aber auch mit dem Betrachter oder der Leserin. Es ist das Abbild der Beziehung des kreativen Menschen zu seinem Motiv und existiert unabhängig vom Selbst, das es geschaffen hat. Dabei werden auch die Grenzen des Bisherigen überschritten. Der Frage der schöpferischen Qualität in der Psychotherapie wird zum Schluss nachgegangen. Das Thema der Beharrlichkeit im kreativen Prozess wird allgemein unterschätzt.
Ein kreativer geistiger Spaziergang, reich mit Bildern, Zitaten und Ideen bestückt. Eine Bereicherung für Therapeuten und Therapeutinnen auf der Suche nach neuen Anreizen und ein Beispiel von erfreulicher Bescheidenheit gegenüber der Kreativität der Patientinnen und Patienten.
Inge Seiffge-Krenke und Franz Resch
Schöpferische Kreativität und Alltagskreativität
Unter Kreativität wird zweierlei verstanden: einerseits die schöpferische Begabung und Gestaltungskraft von Menschen, die sich durch diese Fähigkeit besonders auszeichnen – Kunstschaffende, Wissenschaftler, Erfinder, Führungspersönlichkeiten –, andererseits aber auch die Fähigkeit eines jeden Menschen, mit den Herausforderungen des Lebens erfinderisch, neue Wege und Lösungen findend, eben kreativ, umzugehen. In diesem Sinne können eine kulturverändernde »Größere Kreativität« – »Larger C« – und eine primär individuell relevante »kleinere Kreativität« – »smaller c« – unterschieden werden (Kozbelt, Beghetto u. Runco, 2010, S. 23; Hervorh. J. G.).
Was wir heute unter Kreativität verstehen, wurde zunächst als das Schöpferische von Künstlern oder Dichtern, also als deren »Größere Kreativität«, thematisiert. Freud interessierte sich für die schöpferische Kreativität bedeutender Persönlichkeiten, wie zum Beispiel Leonardo da Vinci, wobei er zu dem Schluss kam, dass »das Wesen der künstlerischen Leistung uns psychoanalytisch unzugänglich« sei (1910c, S. 209), dass die Psychoanalyse zwar »die Äußerungen und die Einschränkungen« der Kreativität, nicht aber »die Tatsache der Künstlerschaft« selbst aufzuklären vermöge (S. 210).
Freud interessierte sich eher für die schöpferische Persönlichkeit als für den schöpferischen Prozess. Den Unterschied zwischen dem schöpferischen und dem neurotischen Menschen sah er darin, dass sich zwar beide vor den Anforderungen der Realität zurückziehen, aber nur der schöpferische Mensch aus diesem Rückzug dank seiner kreativen Schöpfung einen Weg in die Realität zurückfindet und damit erfolgreich sein kann. Der neurotische Mensch hingegen scheitert, kann keine konstruktiven Lösungen für seine inneren Konflikte finden und bleibt in seinen Lebensvollzügen gehemmt. Der Künstler wendet sich wie der Neurotiker zuerst von der Realität ab, »weil er sich mit dem von ihr zunächst geforderten Verzicht auf Triebbefriedigung nicht befreunden kann und seine erotischen und ehrgeizigen Wünsche im Phantasieleben gewähren läßt« (Freud, 1911b, S. 236). Nur der Künstler »findet aber den Rückweg aus dieser Phantasiewelt zur Realität, indem er dank besonderer Begabungen seine Phantasien zu einer neuen Art von Wirklichkeiten gestaltet, die von den Menschen als wertvolle Abbilder der Realität zur Geltung zugelassen werden. Er wird so auf eine gewisse Weise wirklich der Held, König, Schöpfer, Liebling, der er werden wollte, ohne den gewaltigen Umweg über die wirkliche Veränderung der Außenwelt einzuschlagen« (S. 236 f.).
Später kritisierte Winnicott Freuds Fokussierung auf die biografischen Determinanten des Schöpferischen von herausragenden Persönlichkeiten, auf dessen Interesse, etwa Parallelen zwischen Leonardo da Vincis Werk und bestimmten Ereignissen in dessen Kindheit oder zu seiner homosexuellen Neigung herzustellen. Doch führten nach Winnicott solche Einblicke in die Kreativität von Künstlern nicht zum Kern des Themas Kreativität, das nämlich im Sinne der »kleineren Kreativität« zu sehen sei, als Begabung eines jeden Menschen, in der zugleich seine ganz ursprüngliche Lebendigkeit zum Ausdruck kommt: »Die Kreativität, um die es mir hier geht, ist etwas Allgemeines. Sie gehört zum Lebendigsein« (Winnicott, 1974, S. 80), »zur Grundeinstellung des Individuums gegenüber der äußeren Realität« (S. 81). Die Kreativität stelle ein Werkzeug dar, über das jeder Mensch verfügt, um seiner Umwelt zu begegnen, egal ob Schöpfer eines bedeutenden Werkes oder eines gelungenen Mahls, »das zu Hause angerichtet wird« (S. 80).
Freud hatte sich zunächst auf die Arbeiten seines Schülers Rank zur Psychoanalyse des Künstlers bezogen, doch auch Rank interessierte sich wie später Winnicott viel mehr für das in der Kreativität liegende Potenzial eines jeden Menschen für eine gesunde Entwicklung wie auch für die Heilung von psychischen Störungen. Rank wie Winnicott waren überzeugt, dass erst die Kreativität dem Leben eine wirkliche tiefe Lebendigkeit verleiht und dass es um mehr gehe als um ein klinisch unauffälliges, »gesundes« Leben: »Wir können hoffen, durch künstlerischen Ausdruck mit unserem primitiven Selbst, aus dem die stärksten Gefühle und sogar schneidend scharfe Empfindungen stammen, in Berührung zu bleiben, und wir sind wirklich arm dran, wenn wir lediglich geistig gesund sind« (Winnicott, 1945/1983, S. 66).
Winnicott meinte, dass die Kreativität auch bei noch so mangelhaften Erfahrungen mit den frühen Bezugspersonen und noch so belastenden traumatischen Erfahrungen im Leben nie ganz zerstört werden, immer in irgendeinem Winkel der Person überleben könne. Und Rank erkannte selbst in der Neurose eine kreative Leistung, wenn auch eine misslungene. Sah Freud in der Kreativität ein der Neurose analoges, ihr überlegenes, weil vorübergehendes Ausweichen vor der Realität, eine Flucht in die Phantasie, so erklärten Rank und Winnicott die kreative Phantasiefähigkeit zur primären Begabung vor jeder Neurose und zum jedem Menschen verfügbaren Mittel der Bewältigung der Realität.