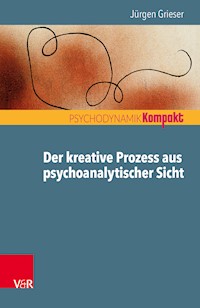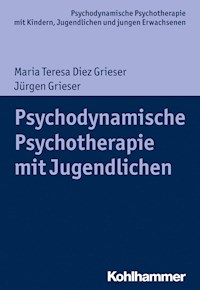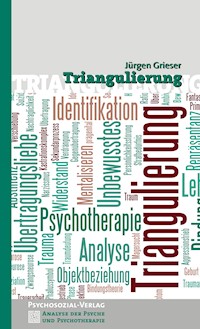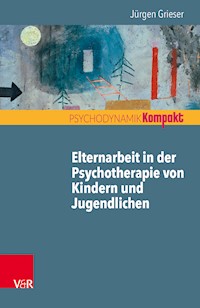
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Vandenhoeck & Ruprecht
- Kategorie: Fachliteratur
- Serie: Psychodynamik kompakt
- Sprache: Deutsch
Zur Psychotherapie mit Kindern und Jugendlichen gehört immer auch die Arbeit mit ihren Eltern und anderen wichtigen Bezugspersonen. Diese unterstützenden Gespräche mit den Bezugspersonen haben nicht nur zum Ziel, die Zustimmung der Eltern zur Psychotherapie des Kindes zu gewinnen und auch über schwierige Phasen der Therapie hinweg aufrechtzuerhalten, sondern darüber hinaus die von den Eltern mitgestaltete familiäre Beziehungsdynamik zu erkennen und so zu verändern, dass eine anhaltende Besserung der Symptomatik des Kindes oder Jugendlichen überhaupt möglich wird. In diesem Buch werden Zugänge zur therapiebegleitenden Arbeit mit den Bezugspersonen vorgestellt, die das Ziel verfolgen, der Psychotherapie des Kindes genügend Zeit und Raum zu verschaffen, im Zuge der Behandlung auftretende Enttäuschungen und Kränkungen auf Seiten der Eltern zu bewältigen und die für die Schwierigkeiten des Kindes relevanten Probleme und Defizite der Eltern wahrzunehmen und anzugehen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 87
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Herausgegeben von
Franz Resch und Inge Seiffge-Krenke
Jürgen Grieser
Elternarbeit in der Psychotherapie von Kindern und Jugendlichen
Vandenhoeck & Ruprecht
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek:
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.de abrufbar.
© 2018, Vandenhoeck & Ruprecht GmbH & Co. KG,
Theaterstraße 13, D-37073 Göttingen
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk und seine Teile sind urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung in anderen als den gesetzlich zugelassenen Fällen bedarf der vorherigen schriftlichen Einwilligung des Verlages.
Umschlagabbildung: Paul Klee, Rote Säulen vorbeiziehend, 1928/akg-images
Satz: SchwabScantechnik, GöttingenEPUB-Produktion: Lumina Datamatics, Griesheim
Vandenhoeck & Ruprecht Verlage | www.vandenhoeck-ruprecht-verlage.com
ISSN 2566-6401
ISBN 978-3-647-90114-5
Inhalt
Vorwort zur Reihe
Vorwort zum Band
Einleitung
1Warum es ohne die Eltern nicht geht
1.1Zur Geschichte der Elternarbeit
1.2Ziele der Elternarbeit
2Die Beziehung zwischen Eltern und Kind
2.1Funktionen der Eltern für das Kind
2.2Funktionen des Kindes für die Eltern
3Diagnostik der Eltern-Kind-Beziehung
3.1Das Standardsetting
3.2Diagnose der Eltern
3.3Dysfunktionale Eltern-Kind-Beziehungen
3.3.1Fixierung des Kindes in einer Rolle für seine Eltern
3.3.2Unvollständige und verzerrte Triaden
3.4Die Enttäuschung der Eltern über ihr Kind
3.4.1Das imaginäre Kind
3.4.2Das Kind als Trauma
4Rahmenvereinbarung und Klärung des Settings
4.1Getrennte und unvollständige Elternpaare
4.2Elternarbeit in der Adoleszenz
5Elemente der Elternarbeit
5.1Die therapeutische Haltung
5.1.1Wissen und Nichtwissen
5.1.2Kultursensibilität
5.2Die Gesprächstechnik
5.2.1Ratschläge versus Verstehen
5.2.2Vom Symptom zur Beziehung
5.2.3Suche nach einem Fokus
5.2.4Strukturieren und Mentalisieren
5.3Übertragung und Gegenübertragung
5.4Elternarbeit als Triangulierungsarbeit
5.5Die Eltern stärken
5.6Phasen der Elternarbeit
Literatur
Vorwort zur Reihe
Zielsetzung von PSYCHODYNAMIK KOMPAKT ist es, alle psychotherapeutisch Interessierten, die in verschiedenen Settings mit unterschiedlichen Klientengruppen arbeiten, zu aktuellen und wichtigen Fragestellungen anzusprechen. Die Reihe soll Diskussionsgrundlagen liefern, den Forschungsstand aufarbeiten, Therapieerfahrungen vermitteln und neue Konzepte vorstellen: theoretisch fundiert, kurz, bündig und praxistauglich.
Die Psychoanalyse hat nicht nur historisch beeindruckende Modellvorstellungen für das Verständnis und die psychotherapeutische Behandlung von Patienten hervorgebracht. In den letzten Jahren sind neue Entwicklungen hinzugekommen, die klassische Konzepte erweitern, ergänzen und für den therapeutischen Alltag fruchtbar machen. Psychodynamisch denken und handeln ist mehr und mehr in verschiedensten Berufsfeldern gefordert, nicht nur in den klassischen psychotherapeutischen Angeboten. Mit einer schlanken Handreichung von 70 bis 80 Seiten je Band kann sich der Leser, die Leserin schnell und kompetent zu den unterschiedlichen Themen auf den Stand bringen.
Themenschwerpunkte sind unter anderem:
– Kernbegriffe und Konzepte wie zum Beispiel therapeutische Haltung und therapeutische Beziehung, Widerstand und Abwehr, Interventionsformen, Arbeitsbündnis, Übertragung und Gegenübertragung, Trauma, Mitgefühl und Achtsamkeit, Autonomie und Selbstbestimmung, Bindung.
– Neuere und integrative Konzepte und Behandlungsansätze wie zum Beispiel Übertragungsfokussierte Psychotherapie, Schematherapie, Mentalisierungsbasierte Therapie, Traumatherapie, internet-basierte Therapie, Psychotherapie und Pharmakotherapie, Verhaltenstherapie und psychodynamische Ansätze.
– Störungsbezogene Behandlungsansätze wie zum Beispiel Dissoziation und Traumatisierung, Persönlichkeitsstörungen, Essstörungen, Borderline-Störungen bei Männern, autistische Störungen, ADHS bei Frauen.
– Lösungen für Problemsituationen in Behandlungen wie zum Beispiel bei Beginn und Ende der Therapie, suizidalen Gefährdungen, Schweigen, Verweigern, Agieren, Therapieabbrüchen; Kunst als therapeutisches Medium, Symbolisierung und Kreativität, Umgang mit Grenzen.
– Arbeitsfelder jenseits klassischer Settings wie zum Beispiel Supervision, psychodynamische Beratung, Arbeit mit Geflüchteten und Migranten, Psychotherapie im Alter, die Arbeit mit Angehörigen, Eltern, Familien, Gruppen, Eltern-Säuglings-Kleinkind-Psychotherapie.
– Berufsbild, Effektivität, Evaluation wie zum Beispiel zentrale Wirkprinzipien psychodynamischer Therapie, psychotherapeutische Identität, Psychotherapieforschung.
Alle Themen werden von ausgewiesenen Expertinnen und Experten bearbeitet. Die Bände enthalten Fallbeispiele und konkrete Umsetzungen für psychodynamisches Arbeiten. Ziel ist es, auch jenseits des therapeutischen Schulendenkens psychodynamische Konzepte verstehbar zu machen, deren Wirkprinzipien und Praxisfelder aufzuzeigen und damit für alle Therapeutinnen und Therapeuten eine gemeinsame Verständnisgrundlage zu schaffen, die den Dialog befördern kann.
Franz Resch und Inge Seiffge-Krenke
Vorwort zum Band
Die Arbeit mit den Eltern stellt in der Psychotherapie von Kindern und Jugendlichen eine oft unterschätzte Herausforderung dar. Es spricht vieles dafür, dass die – im Vergleich zu Erwachsenentherapien häufigeren – Behandlungsabbrüche bei Kindern und Jugendlichen zu einem guten Teil auf Schwierigkeiten zurückzuführen sind, die die Therapeuten und Therapeutinnen im Umgang mit den Eltern haben. Diese Erfahrung hatte schon Sigmund Freud in einer Therapie mit einer Jugendlichen gemacht. Lange Zeit hatte die Elternarbeit in der Kinderpsychoanalyse den »Beigeschmack einer Psychotherapie zweiter Klasse«. Dem vorliegenden Buch gelingt es, die Arbeit mit den Eltern von den historisch gewachsenen Abwertungen zu befreien und zur Entkrampfung und Entwicklung von Freude an dieser Arbeit beizutragen.
Jürgen Grieser formuliert die Ziele der Elternarbeit; sie helfen sehr dabei, die Zusammenarbeit zu erleichtern und Veränderungsprozesse zu initiieren. Es ist spannend zu lesen, wie sich die Eltern-Kind-Beziehung über die verschiedenen Entwicklungsphasen verändert und wie sie in der Adoleszenz noch einmal in besonderer Weise herausgefordert wird. Deutlich wird, dass nicht nur die Eltern wichtige Funktionen für das Kind besitzen, sondern auch das Kind die Einstellungen und das Verhalten der Eltern immens beeinflusst. Schon vor der Geburt wird ein ganzer phantasmatischer Bedeutungskomplex aktiviert. Die Wünsche, Erwartungen und Befürchtungen der Eltern präformieren das Verhältnis zum realen Kind. Kinder verändern die Familie und reaktivieren Kindheitserfahrungen bei den Eltern.
Im Zentrum der Elternarbeit stehen nicht die Eltern oder das Kind allein, sondern insbesondere die Beziehung zwischen den Eltern und dem Kind. Das Buch von Jürgen Grieser ist daher ganz konsistent hin auf die Arbeit in der Triade orientiert. Diagnostisch müssen deshalb nicht nur die Symptome und der Leidensdruck beim Kind erfasst werden, sondern auch die Persönlichkeiten und deren Störungen bei den Eltern, bevor eine psychodynamische Beziehungsinterpretation erfolgen kann. Die triadischen Kompetenzen der Eltern bilden die Voraussetzung für den günstigen Entwicklungsrahmen des Kindes. Dysfunktionale Eltern-Kind-Beziehungskonstellationen werden ausführlich beschrieben und deren Auswirkungen auf die Entwicklung des Kindes verdeutlicht. Ein mangelndes Kompetenzerleben ruft bei den Eltern Gefühle der Ohnmacht und Hilflosigkeit hervor. Es können familiäre Teufelskreise entstehen, die zu wechselseitigen Fehleinschätzungen und schließlich als »cotraumatische Prozesse« zur Verunmöglichung einer positiven intersubjektiven Kommunikation beitragen.
Das Buch stellt verschiedene Settings der Elternarbeit vor und bereichert durch pragmatische Empfehlungen. Das Thema der Arbeit mit getrennten Elternpaaren und die Elternarbeit in der Adoleszenz werden explizit hervorgehoben. Die therapeutische Haltung und die Gesprächstechnik bilden wichtige Elemente der Elternarbeit. Sie werden im Einzelnen erläutert und durch interessante Beispiele aus der Praxis ergänzt. Die verschiedenen Phasen der Elternarbeit lassen bestimmte Problemstellungen jeweils in den Vordergrund treten. Gerade in der mittleren Behandlungsphase, wenn die Therapie scheinbar rund läuft, darf man nicht den Fehler machen, die Elternarbeit zu vernachlässigen. Besondere Bedeutung kommt auch dem Behandlungsende zu, wenn Kinder und ihre Eltern auf die neuen Herausforderungen vorbereitet werden müssen.
Ein sehr interessantes, informatives Buch zu einem wichtigen, leider immer noch vernachlässigten Thema.
Inge Seiffge-Krenke und Franz Resch
Einleitung
Die besondere Herausforderung in der Psychotherapie von Kindern und Jugendlichen liegt weniger in der Arbeit mit dem Kind oder Jugendlichen als vielmehr im Umgang mit den Eltern und anderen wichtigen Bezugspersonen. Oft wird jedoch die Arbeit mit den Eltern als unangenehme Pflicht und die mit dem Kind als das eigentliche therapeutische Tun, die Kür, empfunden. Dennoch stellt die Arbeit mit den Eltern den eigentlichen Knackpunkt und die wahre Herausforderung in der therapeutischen Arbeit dar, sie kann für das Gelingen oder Misslingen des ganzen therapeutischen Prozesses entscheidend sein. Aus diesem Grund ist die sogenannte »therapiebegleitende« Elternarbeit auch kein Nebenschauplatz der Therapie mit dem Kind, gerade nicht etwas, das die Arbeit mit dem Kind »begleitet«, sondern der Dreh- und Angelpunkt für die ganze therapeutische Arbeit. Die Psychotherapierichtlinien der BRD sehen Elternarbeit im Verhältnis 1:4 vor.
Die Notwendigkeit, die Angehörigen in die Behandlung mit einzubeziehen, gestaltet die Arbeit des Kinder- und Jugendlichentherapeuten deutlich komplexer als die eines Erwachsenentherapeuten, der hauptsächlich im Zweipersonensetting arbeitet. Oft fühlen sich die Therapeutinnen und Therapeuten den Eltern gegenüber unsicher und erleben in den Sitzungen mit den Eltern wenig von der Freude, die sie in der Arbeit mit dem Kind finden. Dies führt dazu, dass gerade »auch bei jungen Kollegen in der Ausbildung oder in den ersten Jahren ihrer Berufstätigkeit die Elternarbeit wider besseren Wissens vernachlässigt oder vergessen wird, oft mit einem schlechten Gewissen« (Althoff, 2017, S. 45).
In diesem Sinne wäre das Ziel dieses Büchleins erreicht, wenn es etwas zur Entkrampfung und Entwicklung von Freude in und an der Arbeit mit den Eltern beitragen könnte, so wie wir ja auch bei manchen Eltern-Kind-Paaren ein Ziel der Elternarbeit so definieren, dass es darum geht, den Eltern zur »Wiederentdeckung der Freude am Kind« (Datler, Figdor u. Gstach, 1999) zu verhelfen.
Da die große Mehrzahl der in der Psychotherapie und Beratung von Kindern und Jugendlichen Tätigen weiblichen Geschlechts ist, werde ich meist nur von »Therapeutinnen« sprechen. Ebenso differenziere ich nur dann zwischen Kindern und Jugendlichen, wenn das Alter eine Rolle spielt. Auch sind in der Regel mit Eltern auch Stiefoder Patchwork-Eltern mitgemeint. Für die hier beschriebene Dynamik spielt auch keine Rolle, ob es sich um homo- oder heterosexuelle Eltern handelt. In weiten Teilen ist der beschriebene Umgang mit den Eltern auch auf Pflegeeltern oder weitere Bezugspersonen anwendbar.
1 Warum es ohne die Eltern nicht geht
Anders als erwachsene Patienten sind Kinder und Jugendliche nicht nur lebenspraktisch, sondern auch juristisch von ihren Bezugspersonen, in der Regel also den Eltern, abhängig. Also ist es aus prinzipiellen Gründen unmöglich, mit einem Kind oder Jugendlichen zu arbeiten, ohne die Sorgeberechtigten zu berücksichtigen. Angehörige, die sich von der Behandlung ausgeschlossen fühlen, können über kurz oder lang zum Problem werden, egal ob in der Kinder- oder Erwachsenentherapie. Hier wie dort haben sie Mühe, die Veränderungen als für sich selbst auch positive Veränderungen wahrzunehmen, kann doch Veränderung zunächst einmal Angst auslösen, insbesondere wenn man als Angehöriger selbst in die Dynamik mit einbezogen ist, die zur Entstehung und Aufrechterhaltung der Probleme des Patienten beitrug. Und vieles spricht dafür, dass die im Vergleich zu den Therapien mit Erwachsenen häufigeren Behandlungsabbrüche bei Kindern und Jugendlichen zu einem guten Teil auf die Schwierigkeiten der Therapeutinnen im Umgang mit den Eltern zurückzuführen sind (Diez Grieser, 1996; Seiffge-Krenke u. Cinkaya, 2017).
So machte Sigmund Freud mit jugendlichen Patientinnen schlechte Erfahrungen; die Behandlung von Dora, die er auf Drängen des Vaters, gegen den Widerstand der Jugendlichen und ohne Einbezug der Mutter, durchzuführen versuchte, scheiterte, und die Behandlung einer anderen Jugendlichen wurde abgebrochen, als deutlich wurde, dass deren Probleme mit einer geheim gehaltenen außerehelichen Beziehung der Mutter zu tun hatten. Die Mutter machte dieser für ihre Zwecke »schädlichen« Behandlung ein Ende und steckte ihre Tochter in eine Nervenheilanstalt (Freud, 1916–17, S. 479). Fortan sah Freud in der »Dazwischenkunft der Angehörigen geradezu eine Gefahr« für die psychoanalytischen Behandlungen, »der man nicht zu begegnen weiß« (S. 478).