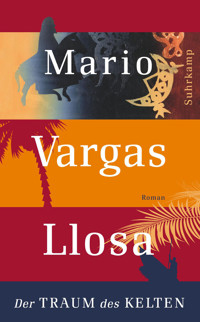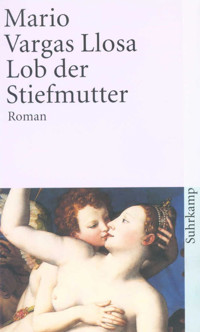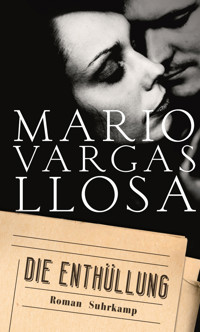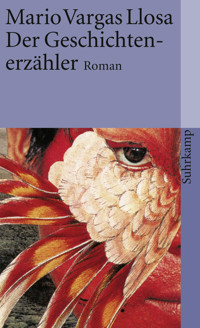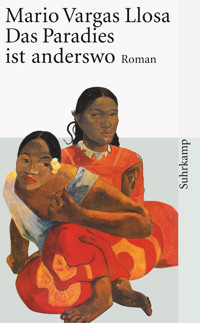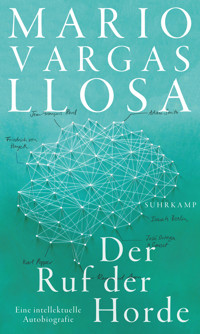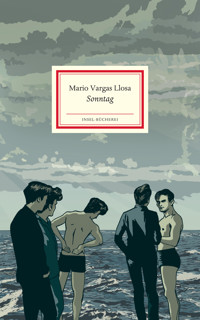14,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Suhrkamp
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Brasilien, Ende des 19. Jahrhunderts. Die Monarchie ist abgeschafft, die junge Republik versucht, sich zu konsolidieren. Ein Wanderprediger, Ratgeber genannt, zieht durch die von Hungersnöten, Seuchen und chronischer Armut geplagten Gegenden und verkündet das Ende der Welt. Eine Schar von Ausgestoßenen, der Ärmsten im Lande, sammelt sich um ihn, fest entschlossen, den wahren Glauben gegen den Antichrist zu verteidigen, der die Menschheit verderben will. Dieser Antichrist ist - die Republik.
Sie gründen in Canudos die »Gesellschaft der Ärmsten«, ein »neues Jerusalem«. Mit Brüderlichkeit und Solidarität wollen sie Widerstand leisten. Die Aufständischen haben jedoch alle gegen sich: die um ihre Autorität besorgte Kirche, einen patriarchalischen Feudalherrn, zwei um die eigene Macht kämpfende Republikaner, den Revolutionär Galileo Gall. Sie alle reagieren mit Angst auf die Gründung des »neuen Jerusalems«. Die gesamten brasilianischen Streitkräfte werden schließlich aufgeboten, um die Anhänger des Ratgebers zu vernichten.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 1199
Veröffentlichungsjahr: 2013
Ähnliche
Brasilien, Ende des 19. Jahrhunderts: Die Monarchie ist abgeschafft, die junge Republik versucht sich zu konsolidieren. Ein Wanderprediger, Ratgeber genannt, zieht durch die von Hungersnöten, Seuchen und chronischer Armut geplagten Gegenden und verkündet das Ende der Welt.
Eine Schar von Ausgestoßenen, der Ärmsten im Lande, sammelt sich um ihn, fest entschlossen, den wahren Glauben gegen den Antichrist zu verteidigen, der die Menschheit verderben will. Dieser Antichrist ist – die Republik.
Sie gründen in Canudos die »Gesellschaft der Ärmsten«, ein »neues Jerusalem«. Mit Brüderlichkeit und Solidarität wollen sie Widerstand leisten. Die Aufständischen haben jedoch alle gegen sich: die um ihre Autorität besorgte Kirche, einen patriarchalischen Feudalherrn, zwei um die Macht kämpfende Republikaner, den Revolutionär Galileo Gall. Sie alle reagieren mit Angst auf die Gründung des »neuen Jerusalem«. Die gesamten brasilianischen Streitkräfte werden schließlich aufgeboten, um die Anhänger des Ratgebers zu vernichten.
»Eines der blutigsten, grausamsten Bücher, die ich je gelesen habe, und eines der fesselndsten.«
Salman Rushdie
Mario Vargas Llosa, 1936 in Arequipa/Peru geboren, lebt heute in London, Paris und Madrid. Neben zahlreichen anderen Auszeichnungen wurde ihm 1996 der Friedenspreis des Deutschen Buchhandels verliehen. Sein schriftstellerisches Werk erscheint in deutscher Sprache im Suhrkamp Verlag.
Mario Vargas Llosa
Der Krieg am Ende der Welt
Roman
Aus dem Spanischenvon Anneliese Botond
Suhrkamp
eBook Suhrkamp Verlag Berlin 2013
Hinweise zur Textgrundlage:
Die Originalausgabe erschien 1981 unter dem Titel La guerra del fin del mundo bei Plaza & Janes, Barcelona, © Mario Vargas Llosa 1981
Der vorliegende Text folgt der 10. Auflage 2010 der Ausgabe des suhrkamp taschenbuchs 1343.
© der deutschen Ausgabe Suhrkamp Verlag Frankfurt am Main 1982
Alle Rechte vorbehalten, insbesondere das der Übersetzung, des öffentlichen Vortrags sowie der Übertragung durch Rundfunk und Fernsehen, auch einzelner Teile.
Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form (durch Fotografie, Mikrofilm oder andere Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung des Verlages reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.
Für Inhalte von Webseiten Dritter, auf die in diesem Werk verwiesen wird, ist stets der jeweilige Anbieter oder Betreiber verantwortlich, wir übernehmen dafür keine Gewähr. Rechtswidrige Inhalte waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar.
Umschlagfoto: Christopher Pillitz/Network/Agentur Focus
Umschlaggestaltung: Göllner, Michels, Zegarzewski
eISBN 978-3-518-73569-5
www.suhrkamp.de
Für Euclides da Cunha in der anderen Welt;und, in dieser Welt, für Nélida Piñón.
Ansicht von Canudos von dem Akademiemitglied Martins Horcades
Der Antichrist ward geboren
Um Herrscher von Brasilien zu sein
Aber der Ratgeber kommt
Um uns von ihm zu befrein
Eins
I
Der Mann war hochgewachsen und so mager, daß er immer wie im Profil wirkte. Seine Haut war dunkel, seine Knochen vorstehend und seine Augen brannten in immerwährendem Feuer. Er ging in Hirtensandalen, und das violette Gewand, das lose an seinem Körper herabfiel, erinnerte an die Tracht der Missionare, die von Zeit zu Zeit die, Dörfer des Sertão aufsuchten, Mengen von Kindern tauften und die in wilder Ehe lebenden Paare trauten. Über sein Alter, seine Herkunft, seine Geschichte war nichts zu erfahren, aber in seinem ruhigen Äußeren, in seiner kargen Lebensweise, seinem unerschütterlichen Ernst lag etwas, das die Leute anzog, noch ehe er Rat erteilte.
Unvermutet, anfangs allein, immer zu Fuß, staubig vom Staub der Wege, erschien er in Abständen von Wochen, Monaten. Im Licht der Abenddämmerung oder des frühen Morgens zeichnete sich seine hohe Gestalt ab, wenn er mit großen Schritten wie in dringender Eile die einzige Straße des Dorfes entlangging. Entschlossen schritt er zwischen schellenläutenden Ziegen, zwischen Hunden und Kindern durch, die ihm den Weg freigaben und ihn neugierig ansahen, erwiderte nicht den Gruß der Frauen, die ihn schon kannten und sich vor ihm verneigten und liefen, ihm Krüge voll Ziegenmilch und Teller voll Mais und Bohnen zu holen. Aber er aß und trank nicht, ehe er nicht bei der Dorfkirche angekommen war, um einmal mehr, einmal und hundertmal festzustellen, wie schadhaft sie war mit ihrem verblichenen Anstrich, den unvollendeten Türmen, den Löchern in den Wänden, dem aufgesprungenen Boden und den vom Holzwurm zernagten Altären. Sein Gesicht wurde traurig wie das eines Flüchtlings, dem die Dürre Söhne und Vieh getötet und seinen ganzen Besitz genommen hat, und er muß sein Haus und die Gebeine seiner Toten verlassen, um zu fliehen, zu fliehen, er weiß nicht wohin. Manchmal weinte er, und im Weinen verstärkten schreckliche Blitze das schwarze Feuer seiner Augen. Auf der Stelle begann er zu beten. Aber nicht so, wie andere Männer und Frauen beteten: er legte sich mit dem Gesicht auf die Erde oder die Steine oder die locker gewordenen Fliesen, dem Ort gegenüber, wo der Altar stand oder gestanden hatte oder hätte stehen sollen, und da betete er, manchmal still, manchmal laut, eine oder zwei Stunden lang, während die Leute vom Dorf ihn mit Respekt und Bewunderung beobachteten. Er betete das Credo, das Vaterunser und die bekannten Ave-Marias, auch andere Gebete, die noch nie jemand gehört hatte, die sich aber im Lauf der Tage, der Monate, der Jahre den Leuten einprägten. »Wo ist der Pfarrer?« hörten sie ihn fragen. »Warum ist hier kein Hirt für die Herde?« Denn daß die Dörfer keine Priester hatten, peinigte ihn ebenso wie der Verfall der Gotteshäuser.
Erst wenn er den guten Jesus um Verzeihung gebeten hatte für den Zustand, in dem sich sein Haus befand, nahm er Essen und Trinken an, nur eine Kostprobe dessen, was ihm die Leute bereitwillig selbst in Notjahren anboten. Er willigte ein, unter einem Dach zu schlafen, in einem der Häuser, die die Sertanejos ihm zur Verfügung stellten, aber selten sah man ihn in der Hängematte oder auf der Pritsche oder dem Strohsack liegen, die seine Wirtsleute ihm abtraten. Ohne eine Decke streckte er sich auf den Boden, legte den Kopf mit dem pechschwarzen, brodelnden Haar auf den Arm, und so schlief er ein paar Stunden. So kurz, daß er immer der letzte war, der sich zur Ruhe legte, und wenn die ersten Viehtreiber und Ziegenhirten aufs Feld gingen, sahen sie ihn schon beim Ausbessern der Mauern und Dächer der Kirche.
Rat erteilte er am Abend, wenn die Männer vom Feld heimgekommen und die Frauen mit der Hausarbeit fertig waren und die Kinder schliefen. Er erteilte ihn auf den baumlosen, steinigen Gevierten, die es im Schnittpunkt der wichtigsten Gassen in allen Dörfern des Sertão gibt und die Plätze hätten genannt werden können, wenn da Bänke gestanden, wenn Hecken und Blumenbeete angelegt worden wären oder wenn die früher vorhandenen und durch Dürre, Seuchen, Nachlässigkeit zerstörten erhalten geblieben wären. Er erteilte ihn zu der Stunde, da der Himmel im Norden Brasiliens, ehe er dunkelt und sich bestirnt, zwischen bauschigen weißen, grauen oder bläulichen Wolken in Flammen steht und dort oben so etwas wie ein weit gestreutes Feuerwerk über der Unermeßlichkeit der Welt abbrennt. Er erteilte ihn zu der Stunde, da die Feuer angezündet werden, um die Insekten zu vertreiben und das Essen zu bereiten, wenn die erstickende Schwüle nachläßt und ein leichter Wind aufkommt, der den Leuten neuen Mut gibt, Krankheit und Hunger und die Leiden des Lebens zu ertragen.
Er sprach von einfachen und wichtigen Dingen, und dabei sah er niemand im besondern an, sah vielmehr mit seinen glühenden Augen durch den Kreis der Alten, Frauen und Kinder hindurch etwas oder jemand an, den nur er sehen konnte. Er sprach von Dingen, die sie verstanden, weil sie allen seit undenklichen Zeiten dunkel bewußt waren, weil jeder sie mit der Muttermilch eingesaugt hatte. Aktuelle, greifbare, alltägliche, unausweichliche Dinge wie das Ende der Welt, das Letzte Gericht, die eintreffen konnten, ehe das Dorf endlich die verfallene Kapelle wiederaufgebaut hatte. Was würde geschehen, wenn der gute Jesus sah, wie sie sein Haus ohne alle Pflege gelassen hatten? Was würde er über das Vorgehen jener Priester sagen, die den Armen die Taschen leerten für die Dienstleistungen der Religion, statt ihnen zu helfen? Durfte man die Worte Gottes verkaufen, mußte man sie nicht umsonst geben? Mit welchen Entschuldigungen würden die Väter zu unser aller Vater kommen, die Unzucht trieben, obwohl sie Keuschheit gelobt hatten? Würden sie Den anlügen können, der Gedanken las wie der Spurenleser die Schritte des Jaguars auf der Erde? Von praktischen, alltäglichen, vertrauten Dingen sprach er, etwa dem Tod, der zur Glückseligkeit führt, wenn man mit reiner Seele wie zu einem Fest in ihn eingeht. Waren die Menschen Tiere? Wenn sie es nicht waren, mußten sie geschmückt mit ihren besten Kleidern durch diese Tür gehen zum Zeichen ihrer Verehrung für Den, dem sie dort begegnen würden. Er sprach ihnen vom Himmel und auch von der Hölle, der Wohnstatt Satans, die mit glühenden Kohlen und Klapperschlangen gepflastert war, und wie sich der Teufel in scheinbar harmlosen Neuerungen kundtun konnte.
Die Viehtreiber und die Feldarbeiter aus dem Landesinneren hörten ihm schweigend zu, betroffen, erschrocken, aufgewühlt, und so lauschten ihm auch die Sklaven und die Freigelassenen aus den Zuckerfabriken an der Küste und die Frauen und die Väter und die Söhne der einen und der anderen. Manchmal – aber selten, weil sein Ernst, seine tiefe Stimme oder seine Weisheit sie einschüchterten – unterbrach ihn jemand, um einen Zweifel loszuwerden. Würde die Welt untergehen? Würde sie im Jahr 1900 noch bestehen? Er antwortete, ohne hinzusehen, mit ruhiger Sicherheit, häufig in Rätseln. Im Jahr 1900 würden die Lichter ausgehen und es würde Sterne regnen. Aber zuvor würden sich außergewöhnliche Dinge ereignen. Ein Schweigen folgte seinen Worten, in dem das Knistern des Feuers und das Sirren der in den Flammen verbrennenden Insekten zu hören waren, während die Dorfleute mit angehaltenem Atem im voraus ihr Gedächtnis anstrengten, um sich der Zukunft zu erinnern. 1896 würden tausend Herden vom Meer in den Sertão laufen, und das Meer würde Sertão und der Sertão Meer werden. 1897 würde sich die Wüste mit Gras bedecken, Hirten und Herden würden zusammenströmen, und von da an würde es nur noch eine Herde und einen Hirten geben. 1898 würden die Hüte zunehmen und die Köpfe abnehmen und 1899 die Flüsse rot werden und ein neuer Planet den Raum durchqueren.
Man mußte sich also vorbereiten. Man mußte die Kirche instand setzen und den Friedhof, das wichtigste Bauwerk nach dem Haus des Herrn, da er Vorzimmer des Himmels oder der Hölle war, und die verbleibende Zeit mußte man auf das Wesentliche verwenden: die Seele. Würden die Männer oder die Frauen etwa in Röcken und feinen Kleidern ins Jenseits aufbrechen, in Filzhüten, Hanfschuhen und all dem Luxus aus Wolle und Seide, den der gute Jesus nie getragen hatte?
Es waren praktische, einfache Ratschläge. Wenn der Mann ging, wurde von ihm gesprochen: es hieß, er sei heilig, er habe Wunder gewirkt, er habe wie Moses den brennenden Dornbusch gesehen, und eine Stimme habe ihm den unaussprechlichen Namen Gottes offenbart. Auch über seine Ratschläge wurde geredet. So vernahmen sie die Leute von Tucano, Soure, Amparo und Pombal, noch ehe das Kaiserreich zu Ende ging und die Republik begann, und Monat um Monat, Jahr um Jahr erstanden die Kirchen von Bom Conselho, von Jeremoabo, von Massacará und von Inhambupe aus ihren Ruinen, und nach seinen Anweisungen wurden auf den Friedhöfen von Monte Santo, Entre Rios, Abadia und Barracão Mauern und Grabnischen errichtet, und in Itapicurú, Cumbe, Natuba, Mocambo wurde der Tod mit würdigen Begräbnissen geehrt. Monat um Monat, Jahr um Jahr bevölkerten sich die Nächte von Alagoinhas, Uauá, Jacobina, Itabaiana, Campos, Itabaianinha, Gerú, Riachão, Lagarto, Simão Dias mit Ratschlägen. Alle fanden die Ratschläge gut, und deshalb fingen die Leute an, zuerst im einen, dann im andern Dorf und zuletzt in allen, den Mann, der sie erteilte, obwohl er mit Vornamen Antônio Vicente und mit Nachnamen Mendes Maciel hieß, den Ratgeber zu nennen.
Ein Holzgitter trennt die Redakteure und Angestellten des Jornal de Notícias – der Name steht in gotischer Schrift über dem Eingang – von den Leuten, die hierher kommen, um eine Anzeige aufzugeben oder eine Information zu bringen. Journalisten sind nur vier oder fünf da. Einer von ihnen sieht ein in die Wand eingelassenes Archiv durch; zwei unterhalten sich angeregt, ohne Jacke, aber in steifen Kragen und langen Krawatten, neben einem Kalender, auf dem das Datum steht – Montag, der 2. Oktober 1890 –, und ein anderer, jung, wenig einnehmend, mit dicken Brillengläsern vor den kurzsichtigen Augen, schreibt mit einem Gänsekiel an einem Pult, gleichgültig gegen alles, was rings um ihn passiert. Am Ende des Raums, hinter einer Glastür, befindet sich die Direktion. Ein Mann mit Augenschirm und falschen Manschetten bedient am Schalter für kostenpflichtige Anzeigen eine Reihe von Kunden. Eben hat ihm eine Frau einen Zettel durchgereicht. Der Kassierer befeuchtet den Zeigefinger und zählt die Wörter – Klistiere Giffoni / / heilen Tripper, Hämorrhoiden, Weißfluß // Rua Primeiro de Março N. 8 – und nennt einen Preis. Die Frau bezahlt, steckt das Wechselgeld ein, und sobald sie geht, tritt der hinter ihr Wartende vor und streckt dem Kassierer ein Papier hin. Er ist dunkel gekleidet, sein schwarzer Frack und seine Melone wirken abgetragen. Das geringelte rötliche Haar fällt ihm über die Ohren. Er ist eher groß als klein, breitschultrig, kräftig, nicht mehr ganz jung. Der Kassierer läßt beim Zählen der Wörter den Finger über das Papier gleiten. Plötzlich runzelt er die Stirn, nimmt den Finger weg und hält sich den Text vor die Augen, als befürchte er, falsch gelesen zu haben. Endlich sieht er den Kunden, der bewegungslos dasteht, verblüfft an. Er blinzelt, macht dem Mann schließlich ein Zeichen zu warten. Das Papier schwenkend, schlurft er durch den Raum, klopft an die Glastür der Direktion, tritt ein. Ein paar Sekunden später erscheint er wieder und winkt den Kunden heran. Dann kehrt er an seine Arbeit zurück.
Der Dunkelgekleidete geht durch das Jornal de Notícias, seine Absätze knallen, als trüge er Hufeisen. Bei seinem Eintritt in das kleine Büro, das vollgestopft ist mit Papieren, Zeitungen und Propaganda der Progressiven Republikanischen Partei – Ein geeintes Brasilien, Eine starke Nation –, erwartet ihn ein Mann, der ihn mit freundlicher Neugier wie ein seltenes Tier betrachtet. Er sitzt an dem einzigen Schreibtisch, trägt Stiefel, einen grauen Anzug und ist jung, dunkelhäutig, sein Gesicht energisch.
»Ich bin Epaminondas Gonçalves, der Direktor der Zeitung«, sagt er. »Kommen Sie.«
Der Dunkelgekleidete macht eine leichte Verbeugung, nimmt aber den Hut nicht ab, sagt auch kein Wort.
»Sie wollen, daß wir das veröffentlichen?« fragt, das Papier schwenkend, der Direktor.
Der Dunkelgekleidete nickt. Er trägt einen kurzen Spitzbart, der rötlich ist wie sein Haar, und seine Augen sind durchdringend, sehr hell; sein breiter Mund ist kräftig geschwungen, und die weit offenen Nasenflügel scheinen mehr Luft einzuatmen, als sie brauchen.
»Vorausgesetzt, daß es nicht mehr als zweitausend Reis kostet«, murmelt er in gebrochenem Portugiesisch. »Das ist mein gesamtes Kapital.«
Epaminondas Gonçalves weiß nicht, ob er lachen oder sich ärgern soll. Der Mann steht noch immer da, ist ernst, beobachtet ihn. Der Direktor entschließt sich, den Text laut zu lesen. »›Aufforderung an alle Freunde der Gerechtigkeit, sich am 4. Oktober, um sechs Uhr abends, in einem Akt öffentlicher Solidarität mit den Idealisten von Canudos und allen Rebellen der Welt auf dem Platz der Freiheit zu versammeln‹«, liest er langsam. »Darf man erfahren, wer zu dieser Versammlung aufruft?«
»Bis jetzt ich«, antwortet der Mann unverzüglich. »Wenn das Jornal de Notícias die Schirmherrschaft übernehmen will, wonderful.«
»Wissen Sie, was die in Canudos gemacht haben?« murmelt Epaminondas Gonçalves und schlägt auf den Schreibtisch. »Sie haben anderer Leute Land besetzt und leben in Promiskuität wie Tiere.«
»Zwei Dinge, die Bewunderung verdienen«, stimmt der Dunkelgekleidete zu. »Deshalb habe ich beschlossen, mein Geld in diese Anzeige zu stecken.«
Der Direktor schweigt einen Augenblick. »Darf man erfahren, wer Sie sind, Senhor?«
Ohne Prahlerei, ohne Anmaßung, mit einem Minimum an Feierlichkeit stellt sich der Mann vor:
»Einer, der für die Freiheit kämpft, Senhor. Wird die Anzeige veröffentlicht?«
»Ausgeschlossen«, antwortet Epaminondas Gonçalves, jetzt Herr der Situation. »Die Oberen von Bahia lauern nur auf einen Vorwand, um mir die Zeitung zu schließen. Obwohl sie ein Lippenbekenntnis zur Republik abgelegt haben, sind sie nach wie vor monarchistisch. Wir sind die einzige wirklich republikanische Zeitung in Bahia, ich nehme an, sie haben es bemerkt.«
»Ich hatte es gehofft«, nuschelt der Dunkelgekleidete mit einer geringschätzigen Handbewegung.
»Ich rate Ihnen nicht, diese Anzeige dem Diário de Bahia zu bringen«, fügt der Direktor, ihm das Papier zurückreichend, hinzu. »Es gehört dem Baron de Canabrava, dem Herrn von Canudos. Sie würden im Gefängnis landen.«
Ohne ein Wort des Abschieds dreht sich der Dunkelgekleidete um, steckt die Anzeige in die Tasche, geht. Mit hallendem Schritt, ohne jemanden anzusehen, durchquert er den Geschäftsraum der Zeitung: finstere Gestalt, wogendes rotes Haar, verstohlen beäugt von den Journalisten und den Kunden am Schalter für kostenpflichtige Anzeigen. Kaum ist er fort, steht der Journalist mit den dicken Brillengläsern von seinem Pult auf und geht, ein vergilbtes Blatt in der Hand, in die Direktion, wo Epaminondas Gonçalves verstohlen dem Unbekannten nachsieht.
»›Auf Anordnung des Gouverneurs von Bahia, S. Exz. Luiz Viana, ist heute eine Kompanie des Neunten Infanteriebataillons unter dem Befehl von Leutnant Pires Ferreira aus Salvador ausgerückt, mit dem Auftrag, die Banditen zu vertreiben, die die Fazenda Canudos besetzt haben, und ihren Anführer, den Sebastianiten Antônio Conselheiro festzunehmen‹«, liest er zwischen Tür und Angel. »Erste Seite oder Innenseiten?«
»Setzen Sie es unter Beerdigungen und Messen«, sagt der Direktor. Er deutet auf die Straße, wo der Dunkelgekleidete eben verschwunden ist. »Haben Sie eine Ahnung, wer dieser Kerl ist?«
»Galileo Gall«, antwortet der kurzsichtige Journalist. »Ein Schotte, der in Bahia herumgeht und die Leute um Erlaubnis bittet, ihre Köpfe befühlen zu dürfen.«
Er wurde in Pombal geboren und war der Sohn eines Schusters und seiner Geliebten, einer Gelähmten, die dennoch drei Jungen zur Welt gebracht hatte, ehe sie ihn gebar, und die nach ihm noch ein Mädchen gebären sollte, das die Dürre überlebte. Sie nannten ihn Antônio, und wenn es auf dieser Welt logisch zuginge, wäre er nicht am Leben geblieben, denn er kroch noch auf allen vieren, als die Katastrophe hereinbrach, die die ganze Gegend verödete und Saaten, Menschen und Tiere hinwegraffte. Fast ganz Pombal wanderte der Dürre wegen an die Küste aus, aber Tiburcio da Mota, der sich in seinen fünfzig Lebensjahren nie weiter als eine Meile von seinem Dorf entfernt hatte, in dem es keinen Fuß gab, den er nicht eigenhändig beschuht hätte, ließ wissen, er werde sein Haus nicht verlassen. Und er hielt Wort. Mit kaum ein paar Dutzend Personen – selbst die Mission der Lazaristen-Patres hatte sich geleert – blieb er in Pombal.
Ein Jahr später, als die Flüchtlinge allmählich wieder nach Pombal heimkehrten, von der Nachricht ermutigt, das Tiefland stünde unter Wasser und man könnte wieder säen, waren Tiburcio da Mota, seine Konkubine und die drei größeren Söhne begraben. Sie hatten gegessen, was eßbar war, dann, als es aufgezehrt war, alles Unreife und zuletzt alles, was ihre Zähne beißen konnten. Der Vikar Dom Casimiro, der sie begraben hatte, behauptete, sie seien nicht am Hunger, sondern an der Dummheit gestorben, denn sie hätten Schusterleder gegessen und Wasser aus der Lagune do Boi getrunken, die selbst von den Ziegen gemieden wurde, eine Brutstätte der Moskitos und der Seuchen. Dom Casimiro hatte Antônio und seine kleine Schwester aufgenommen, mit Luft und Gebeten am Leben erhalten, und als sich die Häuser des Dorfs wieder mit Leuten füllten, suchte er ein Heim für sie.
Das Mädchen kam bei einer Patin unter, die auf einer Fazenda des Barons de Canabrava arbeiten ging. Antônio, der damals fünf war, wurde von dem zweiten Schuster im Pombal adoptiert, dem Einäugigen – er hatte bei einem Streit ein Auge verloren –, der sein Handwerk in der Werkstatt von Tiburcio da Mota gelernt und, nach Pombal zurückgekehrt, dessen Kundschaft übernommen hatte. Ein mürrischer Mann, der häufig betrunken war und meistens, nach Zuckerrohrschnaps stinkend, auf der Straße erwachte. Er hatte keine Frau und ließ Antônio wie ein Lasttier schuften: er mußte kehren, aufwischen, Nägel, Scheren, Sättel, Stiefel zureichen oder in die Lohgerberei laufen. Schlafen ließ er ihn auf einem Fell neben dem kleinen Tisch, an dem er alle die Stunden verbrachte, die er nicht mit seinen Saufbrüdern in der Kneipe saß.
Der Waisenknabe, klein und fügsam, war nichts als Haut und Knochen und zwei verschreckte Augen, die den Frauen von Pombal Mitleid einflößten. Sooft sie konnten, gaben sie ihm etwas zu essen oder Kleider, die sie ihren eigenen Kindern nicht mehr anzogen. Eines Tages gingen sie – ein halbes Dutzend Frauen, die die Gelähmte gekannt und bei unzähligen Taufen, Firmungen, Totenwachen und Hochzeiten an ihrer Seite geklatscht hatten – in die Werkstatt des Einäugigen und verlangten von ihm, er solle Antônio zum Katechismus schicken, damit er auf die Erstkommunion vorbereitet würde. Mit der Drohung, Gott würde ihn zur Rechenschaft ziehen, wenn das Kind ohne Kommunion stürbe, erschreckten sie den Schuster so, daß er sich zähneknirschend bereit erklärte, ihn jeden Abend vor dem Vesperläuten in den Unterricht der Mission gehen zu lassen.
Nun geschah etwas Bemerkenswertes im Leben des Kindes, das später infolge des Wandels, den der Unterricht bei den Lazaristen in ihm bewirkte, Beatinho gerufen wurde. Der Einäugige erzählte, er habe ihn nachts viele Male im Dunkeln auf den Knien liegend angetroffen, weinend über die Leiden Christi und so vertieft, daß er ihn nur durch Schütteln wieder in die Wirklichkeit habe zurückbringen können. In anderen Nächten hörte er ihn im Traum erregt vom Verrat des Judas, von der Reue der Magdalena, von der Dornenkrone sprechen, und eines Nachts vernahm er, wie er, gleich dem heiligen Franziskus an seinem elften Geburtstag, das Gelübde immerwährender Keuschheit ablegte.
Antônio hatte eine Aufgabe gefunden, der er sein Leben widmen konnte. Er fuhr fort, die Aufträge des Einäugigen unterwürfig auszuführen, aber während er sie verrichtete, hatte er die Augen halb geschlossen und bewegte die Lippen, so daß alle verstanden, daß er, auch wenn er kehrte oder zum Gerber lief oder die Sohle hielt, in Wirklichkeit betete. Die Haltung des Knaben störte und erschreckte den Adoptivvater. In der Ecke, wo er schlief, errichtete der Beatinho mit Heiligenbildern, die er in der Mission geschenkt bekam, und einem Kreuz aus Xique-Xique-Holz, das er selbst schnitzte und bemalte, einen Altar. Dort zündete er eine Kerze an, um zu beten, wenn er aufstand und wenn er sich schlafen legte, und dort verbrachte er kniend, mit gefalteten Händen und dem Ausdruck tiefster Reue, seine freien Augenblicke, statt wie die übrigen Jungen auf die Pferdeweiden zu rennen, ungesattelte Wildlinge zu reiten, Tauben zu jagen oder beim Kastrieren der Stiere zuzuschauen.
Seit seiner Erstkommunion war er Chorknabe Dom Casimiros, und als dieser starb, half er den Lazaristen in der Mission bei der Messe, obwohl er dazu, hin und zurück, eine Stunde zu gehen hatte. Bei Prozessionen schwang er die Weihrauchfässer und half beim Schmücken der Stationen und Altäre an den Straßenecken, an denen die Jungfrau und der gute Jesus anhielten, um auszuruhen. Die Frömmigkeit des Beatinho war so groß wie seine Güte. Für die Einwohner vom Pombal war es ein gewohntes Schauspiel, ihn den Blinden führen zu sehen. Manchmal begleitete er ihn bis zu den Pferdekoppeln von »Oberst« Ferreira, nach denen Adolfo sich sehnte, weil er auf ihnen gearbeitet hatte, bis er den Tränenfluß bekam. Er führte ihn am Arm, quer über die Felder, mit einem Stock in der Hand, um die Erde nach Schlangen abzutasten, und hörte sich geduldig seine Geschichten an. Und für den aussätzigen Simon, der wie ein wildes Tier lebte, seit ihm die Dorfbewohner verboten hatten, Pombal nahe zu kommen, sammelte er Essen und Kleider. Einmal die Woche brachte er ihm in einem Bündel die Brotkrumen, das Dörrfleisch und die Hülsenfrüchte, die er für ihn zusammengebettelt hatte, und von ferne sahen die Dorfleute, wie er den Alten mit dem langgewachsenen Haar, der barfuß ging und nur mit einem Fell bekleidet war, über den Felsenhügel, in dem er seine Höhle hatte, zur Wasserstelle führte.
Als der Beatinho den Ratgeber zum erstenmal sah, war er vierzehn Jahre alt und hatte wenige Wochen zuvor eine schreckliche Enttäuschung erlebt. Pater Moraes von der Lazaristen-Mission hatte ihm gesagt – und es war wie ein Kübel kalten Wassers gewesen –, daß er nicht Priester werden könne, weil er unehelich geboren sei. Er tröstete ihn, erklärte ihm, daß er Gott genauso dienen könne, ohne die Weihen erhalten zu haben, und versprach ihm, bei einem Kapuzinerkloster vorzusprechen, in dem sie ihn vielleicht als Laienbruder aufnehmen würden. In der Nacht schluchzte der Beatinho so herzzerreißend, daß der Einäugige zornig wurde und ihn zum erstenmal seit vielen Jahren prügelte. Zwanzig Tage später stürmte unter der glühenden Mittagshitze eine lange, dunkle Gestalt mit schwarzem Haar und funkelnden Augen, in ein violettes Gewand gehüllt, in die Hauptstraße von Pombal. Gefolgt von einem halben Dutzend Leute, die wie Bettler aussahen und dennoch glückliche Gesichter hatten, durchquerte er das Dorf in Richtung auf die alte Kapelle, die seit dem Tod von Dom Casimiro so zerfallen war, daß die Vögel auf den Heiligenfiguren ihre Nester bauten. Wie viele andere Einwohner von Pombal sah auch der Beatinho den Pilger beten, auf den Boden hingestreckt wie seine Gefährten, und am Abend hörte er ihn Ratschläge zur Errettung der Seele erteilen, die Gottlosen tadeln und die Zukunft voraussagen.
In dieser Nacht schlief der Beatinho nicht in der Schusterei, sondern auf dem Platz von Pombal, neben den Pilgern, die sich rings um den Heiligen auf der Erde ausgestreckt hatten. Und am folgenden Morgen und Abend und alle Tage, solange der Ratgeber in Pombal weilte, arbeitete der Beatinho neben ihm und den Seinen, versah die Bänke in der Kapelle mit Beinen und Lehnen und errichtete mit ihnen eine Steinmauer um den Friedhof, der bis dahin nur eine ins Dorf übergehende Landzunge gewesen war. Und alle Nächte kniete er neben ihm, versunken, und hörte die Wahrheiten, die sein Mund sprach. Als aber Antônio o Beatinho in der vorletzten Nacht, die der Ratgeber in Pombal verbrachte, diesen um die Erlaubnis bat, ihm durch die Welt folgen zu dürfen, da sagten zuerst die eindringlichen und zugleich eisigen Augen des Heiligen und dann auch sein Mund: nein. Auf den Knien neben dem Ratgeber, weinte der Beatinho bitterlich. Es war Nacht, Pombal schlief und es schliefen auch, ineinander verschlungen, die Zerlumpten. Die Feuer waren erloschen, aber die Sterne funkelten über ihren Köpfen, und der Gesang der Zikaden war zu hören. Der Ratgeber ließ ihn weinen, er erlaubte ihm, den Saum seines Gewandes zu küssen, änderte seine Haltung aber nicht, als der Beatinho ihn abermals anflehte, ihm folgen zu dürfen, da ihm sein Herz sage, daß er dadurch dem guten Jesus besser diene. Der Junge umschlang seine Knöchel und küßte ihm die schwieligen Füße. Als der Ratgeber sah, daß er erschöpft war, nahm er seinen Kopf in beide Hände und zwang ihn, ihm in die Augen zu schauen. Das Gesicht nahe an seinem fragte er ihn, ob er Gott so sehr liebe, daß er ihm auch den Schmerz weihen wolle. Der Beatinho nickte mehrere Male. Da hob der Ratgeber sein Gewand auf, und im ersten Licht des Morgens konnte der Junge sehen, wie er sich einen Stacheldraht abnahm, der um seine Taille lag und ihm das Fleisch aufriß. »Trag du ihn jetzt«, hörte er ihn sagen. Er selbst half dem Beatinho, die Kleider aufzumachen, den Büßergürtel fest um seinen Leib zu legen und zu verknüpfen.
Als der Ratgeber und seine Gefolgsleute sieben Monate später – neue Gesichter waren hinzugekommen, die Zahl war größer geworden, ein riesiger halbnackter Neger war jetzt dabei, aber ihre Armut und das Glück in ihren Augen waren die gleichen wie vorher – in einem Staubwirbel wieder in Pombal erschienen, lag der Büßergürtel noch immer um den Leib des Beatinho, der an dieser Stelle erst schwarzblau angelaufen war, sich dann mit offenen Wunden und später mit schwärzlichen Krusten bedeckt hatte. Nicht einen Tag hatte er ihn abgenommen, und in bestimmten Zeitabständen hatte er den Stacheldraht, der sich durch die tägliche Körperbewegung gelockert hatte, wieder festgebunden. Pater Moraes hatte ihm auszureden versucht, ihn länger zu tragen, und ihm erklärt, eine bestimmte Dosis freiwilligen Schmerzes sei Gott wohlgefällig, aber es gebe eine Grenze, von der an dieses Opfer zu einer vom Teufel geschürten, krankhaften Lust werden könne, und er, Antônio, sei in Gefahr, diese Grenze jeden Augenblick zu überschreiten.
Doch Antônio hatte ihm nicht gehorcht. An dem Tag, da der Ratgeber und sein Gefolge nach Pombal zurückkehrten, stand der Beatinho im Laden des Caboclo Umberto Salustiano, und das Herz stand ihm still und die Luft in seiner Nase erstarrte, als er ihn, nur einen Meter entfernt, umringt von seinen Aposteln und Dutzenden von Dorfleuten, Männern und Frauen, vorbeigehen und, wie das letzte Mal, geradewegs auf die Kapelle zugehen sah. Er folgte ihm, mischte sich in das erregte Gedränge der Leute, in dem er unterging, und fühlte einen Sturm in seinem Blut. In der Nacht hörte er ihn im Schein der Flammen auf dem von Menschen überfüllten Platz predigen und wagte noch immer nicht, sich ihm zu nähern. Diesmal war ganz Pombal da und hörte ihm zu.
Fast schon im Morgengrauen, als die Dorfleute gegangen waren, die gebetet und gesungen hatten und ihm ihre kranken Kinder gebracht hatten, damit er Gott um ihre Heilung bitte, und ihm ihre Kümmernisse erzählt und ihn gefragt hatten, was die Zukunft bringen werde, und die Jünger sich schlafen gelegt hatten, sich gegenseitig als Kissen und Schutz gegen die Kälte benützend, wie sie es immer taten, trat der Beatinho über die Zerlumpten hinweg in jener Haltung tiefster Verehrung, mit der er zur heiligen Kommunion ging, zu der dunklen violetten Gestalt, die den struppigen Kopf auf einen Arm gelegt hatte. Die Feuer verbreiteten einen letzten Schein. Der Ratgeber schlug die Augen auf, als er kam, und später wiederholte der Beatinho allen, die sich seine Geschichte anhörten, er habe ihnen sofort angemerkt, daß dieser Mann ihn erwartet habe. Ohne ein Wort zu sagen – er hätte nicht sprechen können –, knöpfte er sein grobes Leinenhemd auf und zeigte ihm den Stacheldraht, der um seinen Leib lag. Nachdem ihn der Ratgeber ein paar Sekunden lang angesehen habe, ohne mit der Wimper zu zucken, habe er genickt und ein kurzes Lächeln sei über sein Gesicht geglitten, und dieses Lächeln, sagte der Beatinho Hunderte von Malen in den kommenden Jahren, sei seine Weihe gewesen. Der Ratgeber wies auf einen Fleck Erde neben ihm, der im Gewirr der Körper ihm vorbehalten zu sein schien. Da rollte sich der Junge zusammen; ohne daß ein Wort nötig gewesen wäre, verstand er, daß ihn der Ratgeber für würdig hielt, mit ihm über die Wege der Welt zu ziehen und gegen den Dämon zu kämpfen. Die schläfrigen Hunde und die Frühaufsteher unter den Einwohnern von Pombal hörten noch lange das Schluchzen des Beatinho. Sie wußten nicht, daß er vor Glück weinte.
Sein wirklicher Name war nicht Galileo Gall, aber ein Kämpfer für die Freiheit, ein Revolutionär, wie er selbst sagte, und ein Phrenologe war er. Zwei Todesurteile folgten ihm durch die Welt, und von seinen sechsundvierzig Jahren hatte er fünf im Gefängnis verbracht. Er wurde um die Jahrhundertmitte in einer Ortschaft im Süden Schottlands geboren, wo sein Vater als Arzt praktizierte und vergeblich versuchte, einen Freidenker-Club zu gründen, um die Ideen von Proudhon und Bakunin zu verbreiten. Wie andere Kinder mit Feenmärchen, so wuchs Galileo Gall mit dem Grundsatz auf, das Privateigentum sei der Ursprung aller gesellschaftlichen Übel und nur mit Gewalt werde der Mensch die Ketten der Ausbeutung und des Obskurantismus sprengen.
Sein Vater war Schüler eines Mannes gewesen, den er für einen der erhabenen Weisen seiner Zeit hielt: Franz Joseph Gall, Anatom, Physiker und Begründer der Phrenologie. Während für andere Schüler Galls diese Wissenschaft allenfalls in der Annahme bestand, daß Intellekt, Instinkt und Gefühle auf der Hirnrinde angesiedelte Organe seien und demnach gemessen und abgetastet werden konnten, bedeutete dieses Fach für den Vater Galileos den Tod der Religion, die empirische Grundlage des Materialismus, den Beweis, daß der Geist nicht das war, wofür philosophische Zauberei ihn ausgab, nicht unwägbar und unberührbar, sondern eine Dimension des Körpers, wie die Sinne, und gleich diesen erforschbar und klinisch zu behandeln. Der Schotte impfte seinem Sohn, sobald er denken konnte, diesen einfachen Satz ein: Die Revolution wird die Gesellschaft von ihren Übeln befreien und die Wissenschaft das Individuum von den seinen. Dem Kampf um diese beiden Ziele hatte Galileo Gall seine Existenz verschrieben.
Da ihm seine zersetzenden Ideen das Leben in Schottland schwermachten, ließ sich sein Vater im Süden Frankreichs nieder, wo er 1868 verhaftet wurde, weil er die Leineweber von Bordeaux bei einem Streik unterstützt hatte. Er wurde nach Cayenne geschickt, und dort starb er. Ein Jahr darauf kam Galileo, der Beihilfe zur Brandstiftung in einer Kirche angeklagt, ins Gefängnis – nach dem Militär und den Bankiers galt den Geistlichen sein größter Haß –, aber nach wenigen Wochen entfloh er und arbeitete bei einem Pariser Arzt, einem alten Freund seines Vaters. In dieser Zeit legte er sich den Namen Galileo Gall zu, da sein eigener der Polizei allzu bekannt war, und begann, kleine politische und populärwissenschaftliche Aufsätze in einer Lyoner Zeitung, L’Etincelle de la révolte, zu veröffentlichen.
Er war stolz darauf, von März bis Mai 1871 mit den Pariser Kommunarden für die Freiheit des Menschengeschlechts gekämpft zu haben und Zeuge des Genozids an dreißigtausend von den Truppen Thiers niedergemetzelten Menschen, Männern, Frauen und Kindern, geworden zu sein. Auch er wurde zum Tode verurteilt, doch konnte er vor der Hinrichtung, in der Uniform eines Wachsoldaten, den er tötete, aus der Kaserne entkommen. Er ging nach Barcelona, studierte dort ein paar Jahre lang Medizin und praktizierte Phrenologie mit Mariano Cubí, einem Gelehrten, der sich rühmte, er brauche nur mit den Fingerspitzen über den Schädel eines Menschen zu fahren, um dessen geheimste Neigungen und Charakterzüge aufzuspüren. Er sollte eben als Arzt zugelassen werden, als seine Liebe für Freiheit und Fortschritt oder seine Berufung zum Abenteuer abermals Bewegung in sein Leben brachte. Mit einer kleinen Schar von Verfechtern der großen Idee überfiel er eines Nachts die Kaserne von Montjuich, um den Sturm zu entfesseln, der, wie sie glaubten, die Grundfesten Spaniens erschüttern werde. Aber jemand hatte sie verpfiffen, und die Soldaten empfingen sie mit Schüssen. Einen um den andern sah er seine Gefährten im Kampf fallen; als sie ihn festnahmen, hatte er mehrere Wunden. Er wurde zum Tode verurteilt, aber da ein Verwundeter nach spanischem Gesetz nicht hingerichtet werden darf, beschlossen sie ihn zu heilen, ehe sie ihn umbrachten. Einflußreiche Freunde ermöglichten ihm die Flucht aus dem Spital und schifften ihn mit falschen Papieren auf einem Frachtdampfer ein.
Stets treu den Ideen seiner Kindheit, war er durch Länder und Kontinente gereist. Er hatte gelbe, schwarze, rote und weiße Schädel betastet, stand je nach den Umständen in der politischen Aktion oder in der wissenschaftlichen Praxis, und im Lauf dieses mit Abenteuern, Gefängnissen, Handstreichen, heimlichen Versammlungen, Flucht und Fehlschlägen angefüllten Lebens hatte er eine Reihe von Heften vollgeschrieben, in denen er anhand von Beispielen die Richtigkeit der Lehren seines Vaters, Proudhons, Galls, Bakunins, Spurzheims und Cubís nachwies. In der Türkei, in Ägypten, in den Vereinigten Staaten wurde er wegen Angriffs auf die bestehende Gesellschaftsordnung und die Religion verhaftet, aber dank seinem guten Stern und seiner Verachtung der Gefahr blieb er nie lange hinter Gittern.
1894 war er Arzt auf dem deutschen Schiff, das an der Küste von Bahia kenterte und dessen Trümmer für immer vor der Festung São Pedro liegenblieben. Knapp sechs Jahre zuvor hatte Brasilien die Sklaverei abgeschafft, und vor fünf Jahren war aus dem Kaiserreich eine Republik geworden. Gall war fasziniert von der Mischung der Rassen und der Kulturen in diesem Land, von dem sozialen und politischen Umbruch, von dieser Gesellschaft, in der Europa und Afrika sich so eng berührten, und von noch etwas, ihm bis dahin Unbekanntem. Er beschloß zu bleiben. Eine Arztpraxis konnte er nicht aufmachen, weil er keine Titel vorzuweisen hatte, so daß er sich, wie früher in anderen Ländern, seinen Lebensunterhalt mit Sprachunterricht und Gelegenheitsarbeiten verdiente. Obwohl er durch das Land vagabundierte, kehrte er immer wieder nach Salvador zurück, wo er gewöhnlich in der Buchhandlung Catilina, im Schatten der Palmen des Mirante dos Aflitos oder in den Matrosenkneipen der Unterstadt anzutreffen war und seinen Gesprächspartnern unter der Hand erklärte, alle Tugenden seien miteinander vereinbar, wenn die Vernunft und nicht der Glaube die Achse des Lebens sei; nicht Gott, sondern Satan – der erste Rebell – sei der wahre Fürst der Freiheit, und sobald durch die revolutionäre Aktion die alte Ordnung zerstört sei, werde die neue, freie und gerechte Gesellschaft von selbst aufblühen. Obwohl es Leute gab, die ihm zuhörten, schien keiner ihn so recht ernst zu nehmen.
II
Zur Zeit der großen Dürre im Jahr 1877, in den Monaten der Hungersnot und der Seuchen, die in dieser Gegend die Hälfte der Menschen und des Viehs dahinrafften, zog der Ratgeber schon nicht mehr allein umher, sondern begleitet oder besser, gefolgt von Männern und Frauen (er schien diesen Anhang von Menschen auf seiner Spur kaum zu bemerken), die im Stich gelassen hatten, was sie besaßen, um mit ihm zu gehen, die einen, weil seine Ratschläge ihre Herzen berührt hatten, andere aus Neugier oder aus bloßer Trägheit. Manche gaben ihm nur für ein Stück Weg das Geleit, einige wenige schienen für immer an seiner Seite zu sein. Trotz der Dürre setzte er seinen Weg fort, obwohl die Felder nun übersät waren von Kuhgerippen, an denen die Aasgeier hackten, und die Dörfer, die ihn aufnahmen, halb leer standen.
Daß es in diesem Jahr 1877 nicht mehr regnen wollte, daß die Flüsse austrockneten und im Busch, auf der Suche nach Wasser und Nahrung, zahllose Karawanen von Flüchtlingen erschienen, die auf Karren oder auf den Schultern ihre armselige Habe mit sich führten, war vielleicht nicht das Schrecklichste an diesem schrecklichen Jahr. Das Schlimmste waren vielleicht die Räuber und die Kobras, die über die Sertöes im Norden Brasiliens hereinbrachen. Leute, die Fazendas überfielen, um Vieh zu stehlen, die sich mit den capangas der Gutsbesitzer und den Bewohnern abgelegener Dörfer Schießereien lieferten und zu deren Verfolgung in regelmäßigen Abständen Mobile Einheiten der Polizei geschickt wurden, hatte es immer gegeben. Aber durch den Hunger vermehrten sich die Räuberbanden wie die Brote und Fische in der Bergpredigt. Freßgierig und mörderisch fielen sie in die von der Katastrophe bereits dezimierten Dörfer ein, um die letzten Lebensmittel, Geräte und Kleider mitzunehmen und die Bewohner niederzuschießen, die es wagten, ihnen in den Weg zu treten. Den Ratgeber aber belästigten sie nie, weder mit Worten noch mit Taten. Sie trafen ihn auf den Pfaden der Wüste, zwischen Kakteen und Steinen unter bleiernem Himmel oder im verfilzten Busch, wo das Laub verdorrt war und die Stämme Risse bekamen. Die Cangaceiros, zehn, zwanzig Männer, bewaffnet mit jeglichem Werkzeug, das schneiden, stechen, bohren, ausreißen konnte, sahen den hageren Mann im violetten Gewand, der eine Sekunde lang in gewohntem Gleichmut seine eisigen und besessenen Augen auf sie richtete und dann fortfuhr zu tun, was er immer tat: beten, meditieren, gehen, Rat geben. Die Pilger erbleichten, wenn sie die Banditen sahen, und drängten sich um den Ratgeber wie Küken um die Henne. Die Räuber, die ihre äußerste Armut sahen, gingen vorbei, blieben manchmal aber auch stehen, wenn sie den Heiligen erkannten, dessen Prophezeiungen ihnen zu Ohren gekommen waren. Sie unterbrachen ihn nicht, wenn er betete; sie warteten, bis er sich herabließ, sie zu sehen. Am Ende sprach er zu ihnen mit seiner tiefen Stimme, die den kürzesten Weg in die Herzen zu finden wußte. Er sagte ihnen, was sie verstehen konnten, Wahrheiten, an die sie glauben konnten. Daß diese Landplage sicher das erste Anzeichen der Ankunft des Antichrist und der Strafen sei, die der Auferstehung der Toten und dem Jüngsten Gericht vorausgingen. Daß sie sich, wenn sie ihre Seelen retten wollten, rüsten müßten für die Kämpfe, die bevorstünden, wenn die Dämonen des Antichrist wie eine Feuersbrunst über die Sertões hereinbrechen würden, und der Antichrist, das sei der Teufel selber, der auf die Erde käme, um Bundesgenossen zu werben. Wie die Viehtreiber, die Feldarbeiter, die Freigelassenen und die Sklaven, dachten auch die Cangaceiros nach. Und einige von ihnen – Pajeú mit dem zerschnittenen Gesicht, der riesenhafte Pedrão und der blutrünstigste von allen: João Satanás – bereuten ihre Verbrechen, bekehrten sich zum Guten und folgten ihm nach.
Und wie die Banditen verschonten ihn auch die Klapperschlangen, die wegen der Dürre auf schreckenerregende Weise zu Tausenden auf den Feldern auftraten. Lang, schlüpfrig, dreieckig, verließen sie ihre Schlupfwinkel, wanderten wie die Menschen ab und töteten auf ihrer Flucht Kinder, Kälber, Ziegen. Auf der Suche nach Flüssigkeit und Nahrung fielen sie am hellen Tag in die Dörfer ein. Sie waren so zahlreich, daß es nicht genügend Geier gab, um mit ihnen fertig zu werden, und es war in diesen verkehrten Zeiten nicht ungewöhnlich, Schlangen zu sehen, die diesen Raubvogel fraßen, statt daß sich wie früher der Geier mit der Beute im Schnabel in die Lüfte erhob. Tag und Nacht mußten die Sertanejos mit Stöcken und Macheten gehen, und manche Flüchtlinge töteten bis zu hundert Klapperschlangen an einem Tag. Doch der Ratgeber schlief weiterhin auf dem Boden, wo immer die Nacht ihn überraschte. Als er eines Abends seine Begleiter über die Schlangen sprechen hörte, erklärte er ihnen, dies geschehe nicht zum erstenmal. Als die Kinder Israels aus Ägypten in ihre Heimat zurückgekehrt seien und sich über das beschwerliche Leben in der Wüste beklagt hätten, habe ihnen der Vater zur Strafe eine Schlangenplage geschickt. Und da Moses sich zum Fürsprecher gemacht, habe der Vater ihm befohlen, eine eherne Schlange herzustellen. Wer sie anblicke, der werde vom Schlangenbiß geheilt. Sollten sie das auch tun? Nein, denn Wunder wiederholten sich nicht. Aber sicher würde es der Vater mit Wohlgefallen sehen, wenn sie das Antlitz seines Sohnes als Schutz mit sich führten. Von da an trug eine Frau aus Monte Santo, Maria Quadrado, in einer Urne das Bild des guten Jesus, das ein Junge aus Pombal, seiner Frömmigkeit wegen Beatinho genannt, auf Stoff gemalt hatte. Dem Vater mußte die Geste gefallen haben, denn kein Pilger wurde von einer Schlange gebissen.
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!