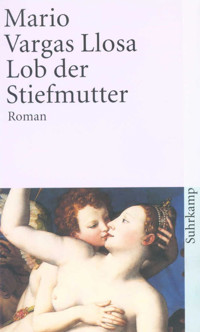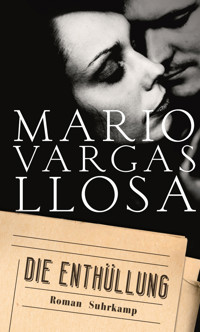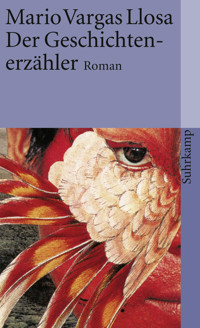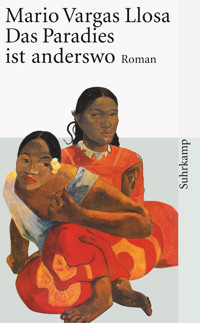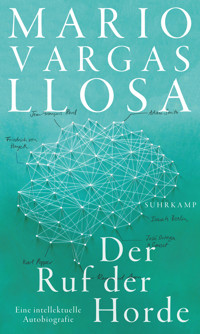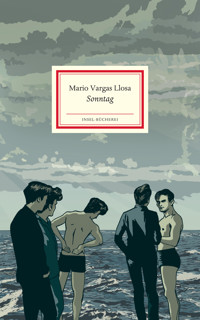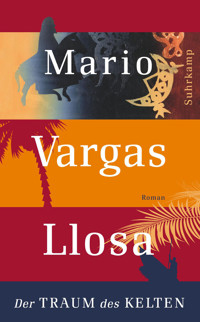
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Suhrkamp
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
August 1916, die Todeszelle eines Londoner Gefängnisses. Roger Casement erinnert sich an seine Jahre im belgischen Kongo, wo er für die britische Regierung einen Bericht über die kolonialen Grausamkeiten verfasst. Er denkt zurück an seine Kindheit in Irland und seine zwiespältige Herkunft aus einer katholisch-protestantischen Familie. An das Jahr 1910, als er die Gräuel einer mit britischem Kapital im Amazonasgebiet tätigen Firma aufdeckt. Und an seine eigentliche Mission, die Berlinreise, wo er Unterstützung für die irische Unabhängigkeitsbewegung sucht. Doch in den Wirren des Ersten Weltkrieges gerät er zwischen alle Fronten. Und wird von denen verraten, die er zu lieben glaubt … Mario Vargas Llosa zeichnet eindrucksvoll das Leben, die inneren und äußeren Kämpfe des abenteuerlichen Idealisten Roger Casement aus Irland nach, den Traum eines Kelten von einer freien, befriedeten Welt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 629
Veröffentlichungsjahr: 2012
Ähnliche
August 1916, die Todeszelle eines Londoner Gefängnisses. Roger Casement erinnert sich an seine Jahre im belgischen Kongo, wo er für die britische Regierung einen Bericht über die kolonialen Grausamkeiten verfasst. Er denkt zurück an seine Kindheit in Irland und seine zwiespältige Herkunft aus einer katholisch-protestantischen Familie. An das Jahr 1910, als er die Gräuel einer mit britischem Kapital im Amazonasgebiet tätigen Firma aufdeckt. Und an seine eigentliche Mission, die Berlinreise, wo er Unterstützung für die irische Unabhängigkeitsbewegung sucht. Doch in den Wirren des Ersten Weltkrieges gerät er zwischen alle Fronten. Und wird von denen verraten, die er zu lieben glaubt ...
Mario Vargas Llosa zeichnet eindrucksvoll das Leben, die inneren und äußeren Kämpfe des abenteuerlichen Idealisten Roger Casement aus Irland nach, den Traum eines Kelten von einer freien, befriedeten Welt.
»... ein Denkmal – passioniert geschrieben, souverän erzählt, gewidmet dem Leben des Diplomaten und Abenteurers, des irischen Nationalisten und Verräters Roger Casement.« Süddeutsche Zeitung
Mario Vargas Llosa, geboren 1936 in Arequipa/Peru, lebt heute in Madrid und Lima. Neben zahlreichen anderen Auszeichnungen erhielt er 1996 den Friedenspreis des Deutschen Buchhandels und 2010 den Nobelpreis für Literatur. Sein schriftstellerisches Werk erscheint auf deutsch im Suhrkamp Verlag.
Mario Vargas Llosa
Der Traum des Kelten
Roman
~
Aus dem Spanischen vonAngelica Ammar
Suhrkamp
Die Originalausgabe erschien 2010 unter dem Titel
El sueño del celta, bei Alfaguara, Madrid.
© Mario Vargas Llosa, 2010
eBook Suhrkamp Verlag Berlin 2012
© der deutschsprachigen Ausgabe Suhrkamp Verlag Berlin 2011
Alle Rechte vorbehalten, insbesondere das der Übersetzung, des öffentlichen Vortrags sowie der Übertragung durch Rundfunk und Fernsehen, auch einzelner Teile. Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form (durch Fotografie, Mikrofilm oder andere Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung des Verlages reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.
Umschlagfotos: Gloria Wallington/Private Collection/Bridgeman (Celtic Image); Hemera/thinkstock (rote Palme); iStockphoto/thinkstock (Fischerboot, Palmwedel)
Umschlaggestaltung: any.way grafik partner
eISBN 978-3-518-73605-0
www.suhrkamp.de
Inhalt
Der Kongo
Der Amazonas
Irland
Epilog
Für Álvaro,
Gonzalo und Morgana.
Und für Josefina,
Leandro, Ariadna, Aitana,
Isabella und Anaís.
Jeder von uns ist, sukzessive, nicht einer,
sondern viele. Und diese Persönlichkeiten,
die eine aus der anderen hervorgehen,
zeigen untereinander die sonderbarsten
und verblüffendsten Kontraste.
José Enrique Rodó, Motivos de Proteo
Der Kongo
I
Als die Zellentür aufging und mit dem Lichtschwall und Windstoß auch der Straßenlärm hereinbrach, schreckte Roger aus dem Schlaf. Während er blinzelnd gegen die Benommenheit ankämpfte, machte er den im Türrahmen lehnenden Umriss des Sheriffs aus. Die boshaften Äuglein in dem schwammigen Gesicht mit dem blonden Schnurrbart musterten ihn mit unverhohlener Abneigung. Für diesen Menschen wäre es ein schwerer Schlag, sollte die englische Regierung das Gnadengesuch erhören.
»Besuch«, brummte der Sheriff, ohne den Blick abzuwenden.
Roger stand auf und rieb sich die Arme. Wie lange hatte er geschlafen? Eine der Qualen im Pentonville-Gefängnis bestand darin, nicht zu wissen, wie spät es war. Im Gefängnis von Brixton und im Tower von London hörte man wenigstens alle halbe Stunde die Kirchenglocken läuten. Durch das dicke Gemäuer hier drang dagegen weder das Geläut in der Caledonian Road noch der Trubel des Marktes von Islington, und die Wächter an der Tür hielten sich strikt an den Befehl, nicht mit ihm zu reden. Der Sheriff legte ihm die Handschellen an und forderte ihn mit einer Geste auf, ihm voran nach draußen zu gehen. Vielleicht brachte sein Anwalt gute Nachrichten? Hatte das Kabinett getagt und eine Entscheidung getroffen? Bedeutete der heute besonders große Abscheu im Blick des Sheriffs, dass man ihn begnadigt hatte? Er wanderte den langen Korridor aus schmutzigem Backstein entlang, vorbei an Zellentüren und verwitterten Wandpartien, in die alle zwanzig oder fünfundzwanzig Schritte ein hohes vergittertes Fenster eingelassen war, durch das er ein Stückchen grauen Himmel erspähte. Warum fror er nur so? Es war Juli, Hochsommer, woher also die Eiseskälte, die ihm solche Gänsehaut verursachte?
Als er den kleinen Besucherraum betrat, verließ ihn der Mut. Nicht sein Anwalt, George Gavan Duffy, erwartete ihn, sondern einer von dessen Assistenten, ein blonder junger Geck mit schiefem Gesicht und hohen Wangenknochen, der während der vier Prozesstage Akten zwischen den Verteidigern hin und her getragen hatte. Weshalb schickte Gavan Duffy einen Mitarbeiter, statt selbst zu kommen?
Der junge Mann musterte ihn kühl. In seinem Blick lag Geringschätzung. ›Was hat dieser Typ nur? Er starrt mich an, als wäre ich Ungeziefer‹, dachte Roger.
»Irgendwelche Neuigkeiten?«
Der junge Mann schüttelte den Kopf. Dann holte er tief Luft.
»Wegen Ihres Gnadengesuchs«, sagte er brüsk und zog eine Grimasse, die sein Gesicht noch schiefer wirken ließ, »müssen wir warten, bis der Ministerrat zusammengetreten ist.«
Roger störte die Anwesenheit des Sheriffs und des anderen Wärters. So still und reglos sie dort auch standen, wusste er doch, dass sie jedes Wort mithörten. Das machte ihm das Atmen noch schwerer.
»Aber angesichts der neuesten Entwicklungen«, fügte der junge Blonde mit übertriebenen Mundbewegungen hinzu und blinzelte zum ersten Mal, »ist jetzt alles viel komplizierter geworden.«
»Man erfährt hier nichts von der Welt da draußen. Was ist passiert?«
Und wenn die deutsche Heeresleitung sich endlich entschlossen hatte, Großbritannien von der irischen Küste aus anzugreifen? Wenn die erhoffte Invasion tatsächlich stattfand und die Kanonen des Kaisers in ebendiesem Moment die irischen Patrioten rächten, die von den Engländern beim Osteraufstand erschossen worden waren? Sollte der Krieg diese Richtung genommen haben, würden sich seine Pläne trotz allem verwirklichen.
»Die Erfolgsaussichten sind jetzt gering, wenn nicht sogar ausgesprochen schlecht«, sagte der Assistent. Roger sah unter seiner blassen Haut die Schädelknochen durchschimmern. Er stellte sich das Grinsen des Sheriffs vor, der hinter ihm stand.
»Wovon sprechen Sie? Herr Gavan Duffy war zuversichtlich bezüglich des Gesuchs. Was ist vorgefallen, dass er seine Meinung geändert hat?«
»Ihre Tagebücher«, antwortete der junge Mann gedehnt und verzog verächtlich das Gesicht. Er hatte die Stimme gesenkt, so dass Roger ihn kaum noch verstand. »Scotland Yard hat sie in Ihrem Haus in der Ebury Street gefunden.«
Er machte eine lange Pause in Erwartung einer Reaktion. Doch als Roger stumm blieb, ließ er seiner Entrüstung freien Lauf:
»Wie konnten Sie nur so unbesonnen sein, Menschenskind.« Dass er dabei so langsam sprach, die Silben so betonte, machte es noch verletzender. »Wie konnten Sie derartige Dinge schwarz auf weiß zu Papier bringen. Und wenn Sie es schon taten, warum haben Sie diese Tagebücher dann nicht vernichtet, ehe Sie zum Verschwörer gegen das Empire wurden?«
›Was fällt diesem Grünschnabel ein, mich mit ›Menschenskind‹ anzureden‹, dachte Roger. Er war mindestens doppelt so alt wie dieser Fatzke.
»Auszüge dieser Tagebücher sind momentan überall im Umlauf«, sagte der jetzt, den Blick abgewandt. »In der Admiralität hat der Sprecher des Ministers, Hauptmann Reginald Hall, höchstpersönlich an Dutzende Journalisten Kopien verteilt. Sie kursieren in ganz London, im Parlament, im House of Lords, in den liberalen wie konservativen Clubs, in den Zeitungsredaktionen, in den Kirchen. Die ganze Stadt spricht von nichts anderem.«
Roger blieb stumm. Wieder hatte er das seltsame Gefühl, das ihn in den letzten Monaten häufig übermannt hatte, seit er an jenem regnerischen, grauen Morgen im April 1916 halb erfroren in der Ruine von McKenna’s Fort im Süden Irlands verhaftet worden war, das Gefühl, dass nicht er es war, der dies durchlebte, dass all das einem anderen zustieß.
»Ich weiß, Ihr Privatleben geht weder mich noch Herrn Gavan Duffy noch sonst jemanden etwas an«, redete der Assistent mit beleidigender Sachlichkeit weiter. »Es handelt sich hier um eine rein berufliche Angelegenheit. Herr Gavan Duffy wollte Sie über die Situation informieren lassen. Und Sie vorwarnen. Das Ganze könnte sich nachteilig auf das Gnadengesuch auswirken. Heute Morgen sind in einigen Zeitungen bereits Spekulationen, Gerüchte und böse Kommentare über Ihre Tagebücher zu lesen. Die Ihrem Gnadengesuch gegenüber prinzipiell positiv eingestellte öffentliche Meinung könnte sich gegen Sie wenden. Das ist natürlich eine bloße Vermutung. Herr Gavan Duffy wird Sie auf dem Laufenden halten. Soll ich ihm etwas ausrichten?«
Roger schüttelte schwach den Kopf und machte auf dem Absatz kehrt. Der Sheriff bedeutete dem anderen Wärter, den schweren Riegel aufzuschieben und die Tür zu öffnen. Der Rückweg in die Zelle kam Roger endlos vor. Während er den langen Korridor mit den geschwärzten Backsteinmauern entlangging, fürchtete er, jeden Moment zu stolpern, der Länge nach auf den feuchten Stein zu schlagen und einfach liegen zu bleiben. An seiner Zellentür angekommen, erinnerte er sich, was der Sheriff ihm an dem Tag gesagt hatte, als man ihn ins Pentonville-Gefängnis eingeliefert hatte: Ausnahmslos alle Häftlinge aus dieser Zelle waren auf dem Schafott geendet.
»Kann ich heute duschen?«, fragte er, bevor er hineinging.
Der Sheriff schüttelte den Kopf und sah ihn mit demselben Abscheu an, den Roger im Blick des Assistenten gelesen hatte.
»Duschen können Sie am Tag Ihrer Hinrichtung«, sagte er genüsslich. »Aber auch nur, wenn es Ihr letzter Wille ist. Andere ziehen dem Duschen ein gutes Mahl vor. Dumm für Mr. Ellis, dann scheißen sie nämlich, wenn sie den Strick um den Hals spüren. Einen schönen Dreck hinterlassen die. Mr. Ellis ist der Henker, falls Sie das nicht wissen.«
Als die Tür hinter ihm zufiel, warf Roger sich bäuchlings auf die Pritsche. Er schloss die Augen. Wie wohltuend wäre es gewesen, das kalte Wasser aus dem dicken Rohr auf die Haut prasseln zu spüren, bis sie blau vor Kälte wäre. Im Pentonville-Gefängnis durften sich alle Häftlinge, mit Ausnahme der zum Tode Verurteilten, einmal die Woche mit Seife in diesem eiskalten Wasserstrahl waschen. Und die Lebensbedingungen in den Zellen waren generell erträglich. Dagegen dachte er mit Schaudern an das verdreckte Gefängnis von Brixton zurück, an die Matratze voller Läuse und Flöhe, die ihm Rücken, Beine und Arme zerbissen hatten. Doch sosehr er versuchte, an etwas anderes zu denken, kamen ihm immer wieder das angeekelte Gesicht und die widerwärtige Stimme des herausgeputzten blonden Assistenten in den Sinn, den Gavan Duffy ihm geschickt hatte, anstatt ihm persönlich die schlechten Nachrichten zu überbringen.
II
An seine Geburt am 1. September 1864 in Doyle’s Cottage, Lawson Terrace, in dem Dubliner Vorort Sandycove, konnte er sich natürlich nicht erinnern. Er hatte zwar in der irischen Hauptstadt das Licht der Welt erblickt, doch lange Zeit war für ihn selbstverständlich gewesen, was sein Vater, Hauptmann Roger Casement, der acht Jahre mit Auszeichnung im 3. leichten Dragoner-Regiment in Indien gedient hatte, ihm stets eingeschärft hatte: Seine wahre Heimat war die Grafschaft Antrim im Herzen von Ulster, das protestantische und englandtreue Irland, wo die Familie der Casements seit dem 18. Jahrhundert ansässig war.
Roger wurde zwar nach der anglikanischen Tradition der Church of Ireland erzogen, wie auch seine drei älteren Geschwister Agnes, genannt Nina, Charles und Tom, aber bereits als Kind ahnte er, dass hinsichtlich der Religion in seiner Familie weniger Einklang herrschte als anderswo. Selbst für einen kleinen Jungen war es nicht zu übersehen, dass seine Mutter, wenn sie mit ihren schottischen Geschwistern und Verwandten zusammen war, ein sonderbar geheimnistuerisches Verhalten an den Tag legte. Als Jugendlicher sollte er dem Rätsel auf die Spur kommen: Anne Jephson war zwar für ihre Heirat mit seinem Vater offiziell zum Protestantismus konvertiert, hatte ihren katholischen (für ihren Gatten papistischen) Glauben jedoch insgeheim beibehalten, ging zur Beichte und zur Messe und empfing die heilige Kommunion; und unter dem Siegel der größten Verschwiegenheit war sogar er selbst mit vier Jahren, im Zuge einer Urlaubsreise mit der Mutter nach Ryl in Nordwales zu den dort ansässigen Onkeln und Tanten, katholisch getauft worden.
Weder zu jener Zeit in Dublin noch während seiner Jahre in London und Jersey hegte Roger irgendein Interesse für die Religion, mochte er auch aus Rücksicht auf seinen Vater aufmerksam und respektvoll in die Gebete und Psalmengesänge des Gottesdienstes einstimmen. Seine Mutter hatte ihm das Klavierspielen beigebracht, und er besaß eine klare, wohlklingende Stimme, die ihm Beifall einbrachte, wenn er bei Familienzusammenkünften alte irische Balladen sang. Wirklich gebannt war er nur von den Geschichten, die Hauptmann Casement ihm und seinen Geschwistern erzählte, wenn er guter Laune war. Geschichten aus Indien und Afghanistan, vor allem von den Kämpfen gegen die Afghanen und Sikhs. All die exotischen Namen und Landschaften, Reisen durch Urwälder und Gebirge, die Schätze, Raubtiere und Ungeziefer bargen, uralte Völker mit sonderbaren Bräuchen und heidnische Götter beflügelten seine Fantasie. Seine Geschwister langweilten diese Erzählungen mitunter, doch der kleine Roger konnte stundenlang den Abenteuergeschichten seines Vaters lauschen.
Kaum hatte er zu lesen gelernt, verschlang er Bücher über die großen Seefahrer, über Wikinger, Portugiesen, Engländer und Spanier, die über die Weltmeere gesegelt waren und die alten Mythen Lügen gestraft hatten, nach denen die Ozeane an einem bestimmten Punkt zu brodeln begännen und aus ihren Tiefen Ungeheuer auftauchten, in deren Rachen ganze Schiffe verschwänden. So gern er auch las, hörte Roger doch immer noch am liebsten den Erzählungen seines Vaters zu. Hauptmann Casement hatte eine warme Stimme und beschrieb anschaulich und lebendig die indischen Dschungel oder die Schluchten des Chaiber-Passes in Afghanistan, wo sein Dragoner-Regiment einmal in den Hinterhalt einer Horde beturbanter Fanatiker geraten war, gegen die sich die tapferen Engländer erst mit Gewehren, dann mit Bajonetten und schließlich mit bloßen Fäusten zur Wehr setzen mussten, bis sie die Angreifer schließlich in die Flucht schlugen. Allerdings begeisterte sich der kleine Roger weniger für die eigentlichen Kämpfe als für die Reisen, bei denen Wege durch Regionen erschlossen wurden, die kein Weißer je zuvor zu Gesicht bekommen hatte, bei denen die körperliche Widerstandskraft auf eine harte Probe gestellt wurde und die Natur überwunden werden musste. Sein Vater war ein unterhaltsamer Mensch, gleichzeitig aber sehr streng, und er zögerte nicht, seine Kinder, die kleine Nina eingeschlossen, für schlechtes Benehmen mit der Peitsche zu züchtigen, denn so wurde Fehlverhalten in der Armee bestraft, und er hatte die Erfahrung gemacht, dass das Auspeitschen die einzig wirksame Form der Strafe war.
Roger mochte seinem Vater zwar Bewunderung entgegenbringen, eine wesentlich tiefere Zuneigung empfand er hingegen für seine Mutter, diese schlanke, ätherische Frau mit den hellen Augen und Haaren, deren sanfte Hände ihm beim Baden durch die Locken oder über den Körper strichen und ihn mit Glückseligkeit erfüllten. Sehr früh – mit fünf oder sechs Jahren? – lernte er jedoch, dass er ihr nur entgegenlaufen und sich ihr in die Arme werfen durfte, wenn der Hauptmann nicht in der Nähe war. Getreu der Familientradition war sein Vater dagegen, Kinder zu verhätscheln und zu verweichlichen. In Gegenwart des Vaters hielt Roger sich stets auf Distanz zu seiner Mutter. War sein Vater aber mit Freunden im Club oder auf einem Spaziergang, lief er zu ihr und wurde mit Küssen und Liebkosungen bedeckt. Manchmal protestierten Charles, Nina und Tom: »Du liebst Roger mehr als uns.« Ihre Mutter versicherte ihnen das Gegenteil, sie liebe alle gleich, nur sei Roger eben noch klein und brauche deshalb mehr Aufmerksamkeit und Zuwendung als die Älteren. Trotzdem war Roger kein schwächliches Kind. Bald lernte er schwimmen, bei Wettrennen schlug er alle gleichaltrigen und manche älteren Kinder.
Roger war neun Jahre alt, als seine Mutter 1873 starb. Im Unterschied zu Nina, Charles und Tom, die während der Totenwache und der Beerdigung untröstlich weinten, vergoss Roger keine Träne. Das Haus der Casements verwandelte sich in diesen düsteren Stunden in eine Begräbniskapelle mit etlichen Besuchern in Trauerkleidung, die wispernd sprachen und Hauptmann Casement und die vier Kinder mit betroffenen Mienen und Beileidsworten in die Arme schlossen. Roger verstummte mehrere Tage lang. Auf Fragen antwortete er mit einem Nicken oder einer Handbewegung, ansonsten starrte er mit gesenktem Kopf vor sich hin, selbst nachts in seinem dunklen Zimmer, wo er keinen Schlaf fand. Für den Rest seines Lebens sollte ihm die Gestalt von Anne Jephson immer wieder in seinen Träumen begegnen, in denen sie mit ihrem warmen Lächeln die Arme ausbreitete und er sich an sie schmiegte, beschützt und glücklich, während ihre feinen Finger über seinen Kopf, seinen Rücken, seine Wangen strichen und ihn gegen alles Übel der Welt feiten.
Seine Geschwister kamen bald darüber hinweg. Roger scheinbar auch. Zumindest erwähnte er seine Mutter nie, als er wieder zu sprechen begann. Wenn irgendein Verwandter sich ihrer erinnerte, sagte er so lange nichts, bis derjenige das Thema schließlich wechselte.
Wer ihren Tod nicht verwand und nie wieder der Alte wurde, war Hauptmann Casement. Weder Roger noch seine Geschwister hatten ihren wortkargen Vater der Mutter gegenüber je besonders liebevoll erlebt, doch über ihren Verlust kam er offenbar nicht hinweg. Er vernachlässigte seine sonst so tadellose Kleidung, rasierte sich nicht mehr und blickte seine Kinder mit gefurchter Stirn so finster an, als trügen sie die Schuld an seinem Witwertum. Kurz nach dem Tod von Anne beschloss er, aus Dublin wegzuziehen. Die vier Kinder schickte er nach Ulster auf den Familiensitz Magherintemple House, wo sich von nun an der Großonkel väterlicherseits John Casement und dessen Frau Charlotte um die Erziehung der Geschwister kümmerten. Als wollte er nichts mehr mit ihnen zu tun haben, ließ sich Hauptmann Casement vierzig Kilometer entfernt im Adair Arms Hotel in Ballymena nieder, wo er, wie es Großonkel John bisweilen entschlüpfte, »halb wahnsinnig vor Schmerz und Einsamkeit« seine Tage und Nächte mit spiritistischen Sitzungen zubrachte, um durch Spielkarten, Kristallkugeln oder ein Medium mit der Toten in Verbindung zu treten.
Roger sah seinen Vater in der Folge nur noch selten, und nie wieder hörte er ihn Geschichten über Indien und Afghanistan erzählen. 1876, drei Jahre nach dem Tod seiner Frau, starb Hauptmann Roger Casement an Tuberkulose. Roger war gerade zwölf geworden. Auf der Ballymena Diocesan School, die er drei Jahre lang besuchte, war er ein zerstreuter, durchschnittlicher Schüler, nur in den Fächern Latein, Französisch und Alte Geschichte tat er sich hervor. Er war in sich gekehrt, schrieb Gedichte und verschlang Chroniken von Reisen nach Afrika und in den Fernen Osten. Er machte Sport, vor allem schwamm er. An den Wochenenden fuhr er häufig nach Galgorm Castle, Eigentum der Familie Young, der einer seiner Klassenkameraden entstammte. Allerdings verbrachte Roger weniger Zeit mit seinem Klassenkameraden als mit der etwas älteren, schönen und klugen Rose Maud Young, die selbst schrieb und durch die Fischer- und Bauerndörfer von Antrim zog, um gälische Gedichte, Legenden und Lieder zu sammeln. Durch sie lernte er die epischen Schlachten der irischen Mythologie kennen. Das Schloss mit seinem schwarzen Gemäuer, der Kathedralenfassade, den Türmchen, Wappen und Kaminen war im 17. Jahrhundert von Alexander Colville erbaut worden, einem Theologen von eher – nach seinem Porträt in der Eingangshalle zu schließen – verdrießlichem Wesen, der, wie eine Legende in Ballymena besagte, einen Pakt mit dem Teufel geschlossen hatte und dessen Geist fortan im Schloss spukte. Schaudernd wagte sich Roger in manchen Mondnächten auf die Suche nach ihm, durch Korridore und leerstehende Zimmer, ohne ihn jemals aufzustöbern.
Erst viel später gelang es ihm, sich in Magherintemple House wohl zu fühlen, dem Besitz der Casements, der früher Churchfield geheißen hatte und das Pfarrhaus der anglikanischen Gemeinde von Culfeightrin gewesen war. Denn die sechs Jahre, die er dort mit seinem Großonkel John, seiner Großtante Charlotte und anderen Verwandten väterlicherseits verbrachte, hatte er sich immer etwas fremd gefühlt in dem mächtigen dreistöckigen Herrenhaus mit den grauen Steinmauern, den neugotischen Dächern und den schweren, gespenstisch aufgebauschten Vorhängen. Die großen Räume, langen Fluchten und Treppen mit ihren abgenutzten Holzgeländern und knarrenden Stiegen riefen ein tiefes Einsamkeitsgefühl in ihm hervor. Dagegen war er gern draußen zwischen den stämmigen Ulmen, Maulbeerfeigen- und Pfirsichbäumen, die den stürmischen Winden widerstanden, auf den sanften Hügeln voller Kühe und Schafe, von denen aus man das Dorf Ballycastle sah, das Meer, die an die Insel Rathlin schlagende Brandung und an klaren Tagen die Schemen der schottischen Küste. Er wanderte häufig in die benachbarten Dörfer Cushendun und Cushendall, die wie Schauplätze alter irischer Legenden anmuteten, und zu den neun Glens Nordirlands, jenen schmalen, von Hügeln und Felsen umragten Tälern, über denen die Adler ihre Kreise zogen, ein Anblick, der ihn bestärkte und froh stimmte. Er liebte die Ausflüge durch diese schroffen Gegenden, in denen die Bauern ebenso bejahrt waren wie die Bäume ringsum und untereinander zuweilen noch Altirisch sprachen, worüber sein Großonkel John und seine Freunde manchmal gehässige Witze machten. Weder Charles noch Tom teilten seine Begeisterung für die Natur, Streifzüge querfeldein oder Wanderungen durch die felsige Hügellandschaft von Antrim reizten sie nicht. Nina dafür schon, weshalb sie, obwohl acht Jahre älter als Roger, ihm die Liebste war und er die größte Zuneigung für sie hegte. Gemeinsam unternahmen sie mehrere Ausflüge in die Murlough Bay mit ihrem Kieselstrand am Fuße einer zerklüfteten Steilküste oder an die Mündung des Glenshesk, die ihm in lebenslange Erinnerung bleiben sollte und die er in seinen Briefen an die Familie »dieses Stück Paradies« nannte.
Doch wichtiger noch als diese Wanderungen waren für Roger die Sommerferien in Liverpool, bei seiner Tante Grace, einer Schwester seiner Mutter, in deren Haus er sich willkommen und geliebt fühlte. Natürlich von Tante Grace, aber auch von ihrem Mann, Edward Bannister, der auf seinen Handelsreisen viel von der Welt gesehen hatte und auch nach Afrika gekommen war. Er arbeitete für die Schifffahrtsgesellschaft Elder Dempster Line, die Fracht- und Passagierverkehr zwischen Großbritannien und Westafrika betrieb. Die Kinder von Tante Grace und Onkel Edward waren Roger engere Spielgefährten als seine eigenen Geschwister, vor allem seine Cousine Gertrude Bannister, genannt Gee, stand ihm von klein auf sehr nahe. Die beiden waren so unzertrennlich, dass Nina sie aufzog: »Ihr werdet noch einmal heiraten.« Gee lachte darüber, doch Roger wurde tiefrot und stammelte mit gesenktem Blick: »Aber nein, was redest du denn für einen Unsinn.«
Manchmal überwand Roger seine Schüchternheit und fragte Onkel Edward über Afrika aus. Allein die Erwähnung dieses Kontinents beschwor in seinem Kopf Dschungel, Raubtiere, Abenteuer und furchtlose Männer herauf. Durch seinen Onkel hörte er zum ersten Mal von Doktor David Livingstone, dem schottischen Arzt und Missionar, der seit Jahren den afrikanischen Kontinent erforschte, dabei Flüsse wie den Sambesi und den Shire befuhr, Berge und noch unbekannte Gebiete mit Namen versah und unzivilisierten Stämmen das Christentum brachte. Er war der erste Europäer gewesen, der Afrika von Westen nach Osten durchquert hatte, und war zum allseits bewunderten Helden des Empire geworden. Roger träumte von ihm, verschlang die Artikel, die von seinen Großtaten berichteten, und hätte nur zu gern selbst an diesen Expeditionen teilgenommen und allen Gefahren zum Trotz dem Missionar geholfen, jene noch in der Steinzeit lebenden Heiden zum rechten Glauben zu bekehren. Als Livingstone auf seiner Suche nach den Quellen des Nils im afrikanischen Urwald verschollen ging, war Roger zwei Jahre alt. Und als 1872 ein weiterer legendärer Forscher, Abenteurer und Journalist walisischen Ursprungs, Henry Morton Stanley, den eine New Yorker Zeitung entsandt hatte, wieder aus dem Dschungel auftauchte und der Welt verkündete, er habe Doktor Livingstone lebend gefunden, war Roger beinahe acht. Die spektakuläre Geschichte versetzte ihn in neidvolles Staunen. Ein Jahr später wurde bekannt, dass Livingstone, der in Afrika geblieben war und nicht nach England zurückkehren wollte, verstorben war. Roger hatte das Gefühl, er persönlich habe einen großen Verlust erlitten. Wenn er einmal groß wäre, nahm er sich vor, würde er auch ein so außergewöhnliches Forscherleben führen wie Livingstone und Stanley.
Mit fünfzehn Jahren wurde Roger von seinem Großonkel John Casement nahegelegt, die Schule zu verlassen und sich eine Anstellung zu suchen, da weder er noch seine Geschwister über ein Vermögen verfügten, von dem sie leben konnten. Roger willigte ein. Gemeinsam beschlossen sie, dass Roger nach Liverpool gehen würde, wo leichter Arbeit zu finden war als in Nordirland. Und in der Tat verschaffte ihm kurz nach seiner Ankunft bei den Bannisters sein Onkel Edward eine Stelle in derselben Handelskompanie, für die er tätig war. So trat Roger als Lehrling in die Schifffahrtsgesellschaft ein. Er wirkte älter als fünfzehn, groß und schmal, wie er war. Er hatte tiefgründige graue Augen, lockiges schwarzes Haar, einen hellen Teint und gerade Zähne. Von Natur aus eher wortkarg, zeigte er sich diskret, freundlich und hilfsbereit. Englisch sprach er mit einem leichten irischen Akzent, wofür er von seinen Cousins aufgezogen wurde.
Seine abgebrochene Schulausbildung machte Roger durch Ernsthaftigkeit und Fleiß wett. Er erledigte gewissenhaft seine Pflichten in der Handelskompanie und war bemüht, möglichst viel zu lernen. Er wurde der Verwaltungs- und Buchhaltungsabteilung zugeteilt, zunächst als Laufbursche. Er trug Schriftstücke von einer Schreibstube in die andere und erledigte am Hafen die Zollformalitäten für Schiffsfrachten. Seine Vorgesetzten schätzten ihn. Doch in den vier Jahren, die er bei der Elder Dempster Line angestellt war, freundete er sich mit niemandem an, was wohl an seiner zurückhaltenden Art und seinen spartanischen Gewohnheiten liegen mochte: Feuchtfröhliches Beisammensein war ihm zuwider, er selbst trank so gut wie nie, und in die Hafenkneipen und Bordelle setzte er keinen Fuß. Allein das Rauchen gewöhnte er sich zu dieser Zeit an. Seine Leidenschaft für Afrika und sein Bestreben, sich in der Handelskompanie hochzuarbeiten, brachten ihn dazu, aufmerksam alle Publikationen zu lesen, die in den Geschäftsstellen zirkulierten, und ihr Gedankengut zu verinnerlichen. Europäische Produkte nach Afrika zu verschiffen und Rohstoffe zu importieren, die auf afrikanischem Boden wuchsen und vorkamen, war demnach weniger eine Handelsoperation als eine Unternehmung zugunsten der Entwicklung der Naturvölker, unter denen Kannibalismus und Sklavenhandel herrschten. Der Handel brachte ihnen Religion, Moral, Gesetz, die Werte des modernen, kultivierten, freien und demokratischen Europas, dessen Fortschrittlichkeit aus unglücklichen Stammesbewohnern Menschen auf der Höhe der Zeit machen würde. Großbritannien nahm dabei die Vorreiterrolle ein, und man musste stolz auf das Vaterland und den Beitrag einer Kompanie wie der Elder Dempster Line sein. Seine Arbeitskollegen wechselten, wenn Roger solche Gedanken zum Ausdruck brachte, spöttische Blicke und fragten sich wohl, ob er wirklich so naiv oder im Gegenteil ganz besonders gerissen war, ob er an diesen Unsinn glaubte oder ihn bloß von sich gab, um sich bei seinen Vorgesetzten beliebt zu machen.
Während der vier Jahre in Liverpool wohnte Roger bei seiner Tante Grace und seinem Onkel Edward, denen er dafür einen Teil seines Lohns gab und die ihn wie einen Sohn behandelten. Er verstand sich gut mit seinen Cousins und vor allem mit Gee, mit der er an Sonn- und Feiertagen bei gutem Wetter rudern oder angeln ging und sich bei Regen an den Kamin setzte, wo sie einander vorlasen. Ihre Beziehung war geschwisterlich, kannte weder Streit noch Turtelei. Gee zeigte er auch die Gedichte, die er heimlich schrieb.
Bald wusste Roger über die Tätigkeiten der Handelsgesellschaft bestens Bescheid, und ohne jemals in einem der afrikanischen Häfen gewesen zu sein, sprach er von ihnen, als hätte er sich sein Leben lang dort aufgehalten und sei vertraut mit ihren Handelsgeschäften, Bräuchen und Menschen.
Schließlich fuhr er an Bord der SS Bonny dreimal selbst nach Westafrika. Das beglückte ihn so sehr, dass er nach der dritten Fahrt seine Stelle kündigte und seiner Familie mitteilte, er habe beschlossen, nach Afrika zu gehen. Er machte dabei einen so inbrünstigen Eindruck, dass er, wie sein Onkel Edward versicherte, einem Kreuzfahrer glich, der sich aufmacht, um Jerusalem zu befreien.
Seine Familie verabschiedete ihn am Hafen, Gee und Nina unter Tränen. Roger war gerade zwanzig Jahre alt.
III
Als der Sheriff mit geringschätzigem Blick die Zellentür öffnete, dachte Roger gerade beschämt daran, dass er immer ein Befürworter der Todesstrafe gewesen war. Wenige Jahre zuvor hatte er sich in einem für das Foreign Office verfassten Bericht über Putumayo, bekannt als das Blaue Buch, auch öffentlich dafür ausgesprochen, indem er eine exemplarische Strafe für den Peruaner Julio César Arana forderte, den Kautschukbaron von Putumayo: »Könnten wir erreichen, dass wenigstens er für diese grausamen Verbrechen gehängt wird, wäre dies der Anfang vom Ende des unermesslichen Martyriums und der infernalischen Hetzjagd, denen sich die unglücklichen Eingeborenen ausgesetzt sehen.« Heute würde er das nicht mehr so schreiben. Und vorher hatte er sich auch daran erinnert, welches Unbehagen es ihm bereitete, ein Haus zu betreten, in dem es einen Vogelkäfig gab. Eingesperrte Kanarienvögel, Stieglitze und Papageien hatte er stets als Opfer einer unnötigen Grausamkeit empfunden.
»Besuch«, grummelte der Sheriff. Während Roger aufstand und sich den Staub von der Sträflingsuniform klopfte, fügte er hämisch hinzu: »Heute ist wieder etwas über Sie in den Zeitungen zu lesen, Mr. Casement. Aber nicht wegen Vaterlandsverrat …«
»Mein Vaterland ist Irland«, fiel Roger ihm ins Wort.
»… sondern wegen der Schweinereien.« Der Sheriff schnalzte mit der Zunge, als wollte er ausspucken. »Ein Verräter und dazu noch ein Perverser. Schöner Abschaum! Es wird ein Vergnügen sein, Sie an einem Strick baumeln zu sehen, Ex-Sir Roger.«
»Hat das Kabinett das Gnadengesuch abgewiesen?«
»Noch nicht«, sagte der Sheriff schließlich. »Aber das wird es. Und Seine Majestät, der König, wird es natürlich auch ablehnen.«
»Ihn werde ich nicht um Gnade bitten. Das ist Ihr König, nicht meiner.«
»Irland ist britisch«, fuhr ihn der Sheriff an. »Besonders seit wir diesen feigen Aufstand in der Osterwoche in Dublin niedergeschlagen haben. Ein hinterhältiger Dolchstoß gegen ein Land im Krieg. Ich hätte die Anführer nicht erschossen, sondern erhängt.«
Er verstummte, sie waren am Besucherraum angelangt.
Es war nicht etwa Pater Carey, der katholische Kaplan vom Pentonville-Gefängnis, sondern Gertrude, seine Cousine Gee. Roger drückte sie an sich und spürte ihr Zittern. Sie kam ihm vor wie ein verängstigter Vogel. Wie sehr war Gee seit seiner Verhaftung und dem Prozess gealtert! Er dachte an das übermütige, unbeschwerte Mädchen aus Liverpool zurück, an die attraktive junge Frau, der das Londoner Leben so gefiel, die wegen ihres kranken Beins von Freunden liebevoll Hoppy, Hinkebeinchen, genannt wurde. Die gekrümmte, kränkliche Person vor ihm hatte nichts mehr von der kräftigen, selbstsicheren Frau, die Gertrude noch vor wenigen Jahren gewesen war. Der Glanz in ihren Augen schien erloschen, Gesicht, Hals und Hände waren ganz faltig. Ihre Kleidung wirkte dunkel und abgetragen.
»Ich stinke bestimmt wie eine Kloake«, scherzte Roger und deutete auf seine derbe blaue Uniform. »Man hat mir das Recht entzogen, mich zu waschen. Es wird mir nur im Fall meiner Hinrichtung noch einmal zugestanden werden.«
»Sie werden dich nicht hinrichten, der Ministerrat wird das Gnadengesuch bewilligen«, sagte Gertrude heftig nickend. »Präsident Wilson wird sich bei der britischen Regierung für dich verwenden, Roger. Er hat versprochen, zu telegrafieren. Sie werden dich begnadigen, es wird keine Hinrichtung geben, glaube mir.«
Ihre Stimme klang so angespannt und brüchig, dass Roger Mitleid mit ihr und seinen übrigen Freunden bekam, die in diesen Tagen der Ungewissheit um ihn bangten. Er hätte sie gern nach den Zeitungsattacken gegen ihn gefragt, die der Kerkermeister erwähnt hatte, doch er hielt sich zurück. Der Präsident der Vereinigten Staaten würde sich für ihn einsetzen? Das war wahrscheinlich John Devoy und den anderen Mitgliedern des Clan na Gael zu verdanken. Würde der amerikanische Präsident intervenieren, wäre es eine wirkungsvolle Geste. Es gab noch eine Chance, dass das Kabinett ihn begnadigen würde.
In Ermangelung einer Sitzgelegenheit standen Roger und Gertrude nah beisammen, mit dem Rücken zum Sheriff und dem anderen Wachmann. Der Besucherraum mit vier Personen darin hatte etwas Klaustrophobisches.
»Gavan Duffy hat mir erzählt, dass man dich entlassen hat«, sagte Roger bedauernd. »Das ist meine Schuld. Ich bedauere es unendlich, liebe Gee. Ich wollte auf keinen Fall, dass man dich mit hineinzieht.«
»Sie haben mich nicht entlassen, sie haben mich gebeten, der Auflösung meines Arbeitsvertrags zuzustimmen. Und sie haben mir eine Entschädigung von vierzig Pfund gezahlt. Es macht mir nichts aus. So habe ich mehr Zeit, Alice Stopford Green in ihren Bemühungen zu unterstützen, dir das Leben zu retten. Das ist jetzt das Wichtigste.«
Gee griff nach der Hand ihres Cousins und drückte sie liebevoll. Sie hatte viele Jahre an der Schwesternschule des Queen Anne’s Hospital in Caversham unterrichtet, wo sie zuletzt Vizedirektorin gewesen war. Sie hatte die Arbeit gemocht, etliche heitere Anekdoten in ihren Briefen an Roger zeugten davon. Jetzt hatte sie wegen der Verwandtschaft mit einem Geächteten ihre Stelle verloren. Wovon würde sie leben, wer würde ihr helfen?
»Niemand glaubt an die infamen Dinge, die man über dich veröffentlicht«, sagte Gertrude plötzlich im Flüsterton, als könnte sie damit verhindern, von den beiden Wächtern gehört zu werden. »Alle respektablen Bürger sind empört, dass die Regierung sich solcher Verleumdungen bedient, um den offenen Brief zu entkräften, mit dem so viele bedeutende Persönlichkeiten für dich eingetreten sind.«
Ihre Stimme brach ab, als würde sie gleich losschluchzen. Roger umarmte sie erneut.
»Du bedeutest mir so viel, Gee, liebste Gee«, wisperte er ihr ins Ohr. »Und jetzt mehr denn je. Ich bin dir zutiefst dankbar für die Treue, die du mir in guten wie in schlechten Zeiten gehalten hast. Deshalb ist mir deine Meinung so besonders wichtig. Du weißt, dass alles, was ich getan habe, für Irland war, nicht? Für eine große edle Sache wie die irische. Nicht wahr, Gee?«
Leise schluchzend lehnte sie sich an seine Brust.
»Von Ihren zehn Minuten sind fünf vorbei«, mahnte der Sheriff.
»Ich habe jetzt viel Zeit zum Nachdenken«, flüsterte Roger seiner Cousine ins Ohr, »und oft erinnere ich mich an die Jahre in Liverpool. Wir waren so jung, Gee, und das Leben meinte es so gut mit uns.«
»Alle glaubten, wir seien ein Paar und würden eines Tages heiraten«, flüsterte Gee. »Auch ich denke mit Wehmut an diese Zeit zurück, Roger.«
»Wir waren mehr als ein Paar, Gee. Wir waren Geschwister, Komplizen. Die zwei Seiten einer Münze. Unzertrennlich. Du warst so vieles für mich. Die Mutter, die ich mit neun Jahren verlor. Die Freunde, die ich niemals hatte. Mit dir war ich zuversichtlich und fröhlich. Während all meiner Jahre in Afrika waren deine Briefe meine einzige Verbindung zum Rest der Welt. Du weißt nicht, wie glücklich mich deine Briefe machten und wie oft ich sie las und wieder las, Gee.«
Er verstummte. Seine Cousine sollte nicht merken, dass auch er den Tränen nahe war. Von jeher war ihm, fraglos aufgrund seiner puritanischen Erziehung, jegliche öffentliche Zurschaustellung von Gefühlen ein Gräuel gewesen, doch in den letzten Monaten zeigte er bisweilen gewisse Schwächen, die ihm an anderen immer so missfallen hatten. Gee umarmte ihn weiter stumm, Roger spürte das flatternde Atmen ihrer Brust.
»Du warst die Einzige, der ich meine Gedichte gezeigt habe. Erinnerst du dich?«
»Ich erinnere mich. Sie waren furchtbar schlecht«, sagte Gertrude. »Aber ich hatte dich so gern, dass ich sie in den Himmel lobte. Eines habe ich sogar auswendig gelernt.«
»Ich habe sehr wohl gemerkt, dass sie dir nicht gefielen, Gee. Zum Glück habe ich sie nie veröffentlicht. Du weißt, ich war kurz davor.«
Sie blickten einander an und mussten lachen.
»Wir tun alles, absolut alles, um dir zu helfen, Roger«, sagte Gee und wurde wieder ernst. Auch ihre Stimme war gealtert. Statt heiter und fest wie früher, klang sie nun matt und zögerlich. »Und wir sind viele, an erster Stelle natürlich Alice. Sie hat Himmel und Hölle in Bewegung gesetzt. Briefe geschrieben, Behörden, Politiker, Diplomaten aufgesucht. An alle Türen geklopft, erklärt, gefleht. Sie hat eine Besuchserlaubnis beantragt. Es ist so schwierig. Nur Angehörigen wird sie bewilligt. Aber Alice hat gute Beziehungen, sie ist bekannt. Sie wird die Erlaubnis erhalten, und dann kommt sie dich besuchen, ganz bestimmt. Wusstest du, dass Scotland Yard nach dem Aufstand in Dublin ihr Haus durchsucht hat? Sie haben viele Dokumente mitgenommen. Sie liebt und bewundert dich sehr, Roger.«
›Ich weiß‹, dachte Roger. Auch er liebte und bewunderte Alice Stopford Green. Die Historikerin und Schriftstellerin, die wie Roger einer anglikanischen irischen Familie entstammte, deren Salon eines der Zentren des Londoner Geisteslebens und gleichzeitig den Treffpunkt für die irischen Nationalisten und Unabhängigkeitskämpfer bildete, war für ihn mehr als eine Freundin und Ratgeberin in politischen Angelegenheiten gewesen. Dank ihrer Unterweisungen hatte er die Geschichte Irlands kennen- und lieben gelernt, die blühende alte Kultur, die der übermächtige Nachbar unterjocht hatte. Sie hatte ihm Bücher empfohlen, ihn bei Gesprächen mit ihrer Begeisterung angesteckt, hatte ihn ermutigt, weiter die irische Sprache zu lernen, die zu beherrschen ihm leider nie ganz gelang. ›Ich werde sterben, ohne Gälisch zu sprechen‹, dachte er. Und später, als er selbst zum radikalen Nationalisten geworden war, hatte Alice ihn in London als Erste mit dem Spitznamen angeredet, den Herbert Ward ihm verliehen hatte und der Roger sehr amüsierte: der Kelte.
»Zehn Minuten«, unterbrach sie der Sheriff. »Zeit, sich zu verabschieden.«
Roger merkte, wie seine Cousine in ihrer Umarmung ihren Mund vergeblich seinem Ohr zu nähern versuchte, denn er war um einiges größer als sie. In einem beinahe unhörbaren Flüstern sagte sie:
»All die schrecklichen Dinge, die in den Zeitungen stehen, sind Verleumdungen, grässliche Lügen, nicht wahr, Roger?«
Er war so wenig auf diese Frage gefasst gewesen, dass er einige Sekunden brauchte, um zu antworten.
»Ich weiß nicht, was die Zeitungen über mich schreiben, liebe Gee, ich bekomme hier keine. Aber«, er wählte seine Worte sorgfältig, »gewiss sind sie das. Ich möchte, dass du mir eines glaubst und nie vergisst, liebste Gee. Ich habe viele Fehler begangen, ohne Frage. Aber es gibt nichts, dessen ich mich schämen müsste. Weder du noch irgendeiner meiner Freunde muss sich meiner schämen. Glaubst du mir das, Gee?«
»Natürlich glaube ich dir.« Schluchzend legte sie sich beide Hände auf den Mund.
Auf dem Rückweg zur Zelle stiegen Roger die Tränen in die Augen, was er sich vor dem Sheriff nicht anmerken lassen wollte. Wie seltsam, dass ihm jetzt nach Weinen zumute war. Soweit er sich erinnerte, hatte er in diesen letzten Monaten seit seiner Verhaftung kein einziges Mal geweint. Weder bei den Verhören durch Scotland Yard noch während des Prozesses oder bei der Urteilsverkündung. Warum gerade jetzt? Wegen Gertrude. Wegen Gee. Dass sie solche Qualen ausstand, zeugte von ihrer tiefen Zuneigung. Er war also nicht ganz so allein, wie er sich fühlte.
IV
Die Reise den Kongo flussaufwärts, auf die sich der britische Konsul Roger Casement am 5. Juni 1903 begab und die sein Leben verändern sollte, hätte eigentlich ein Jahr zuvor stattfinden sollen. Er hatte dem Foreign Office die Notwendigkeit dieser Expedition nahegelegt, seit er im Jahr 1900, nachdem er in Old Calabar (Nigeria), Lourenço Marques (Mosambik) und São Paolo de Luanda (Angola) tätig gewesen war, offiziell das Amt des britischen Konsuls in Boma – damals kaum mehr als ein größerer Weiler – angetreten hatte. Um tatsächlich über die Situation der Einheimischen im Unabhängigen Staat Kongo berichten zu können, so führte er an, müsse man aus der abgelegenen Hauptstadt in die Urwälder und zu den Stämmen am Mittel- und Oberlauf des Kongos vordringen. Dort fand die Ausbeutung statt, über die er das Foreign Office seit seinen ersten Vorstößen in diese Region informierte. Nach langer Abwägung der politischen Hindernisse, die er als Konsul zwar verstand, die ihm aber trotzdem Widerwillen einflößten – Großbritannien war Verbündeter Belgiens und wollte das Land nicht den Deutschen in die Arme treiben –, ermächtigte ihn das Foreign Office, zu den Dörfern, Stationen, Missionen, Posten, Lagern und Handelsfaktoreien zu reisen, in denen der Kautschuk gewonnen wurde, das schwarze Gold, aus dem inzwischen weltweit Reifen und Stoßstangen von Autos und Lastwagen sowie zahllose andere Industrie- und Haushaltsprodukte hergestellt wurden. Er sollte vor Ort den Vorwürfen auf den Grund gehen, die von der Londoner Gesellschaft zum Schutz der Eingeborenen und einigen baptistischen Kirchen und katholischen Missionen in Europa und den Vereinigten Staaten vorgebracht wurden und nach denen die Einheimischen im Kongo des belgischen Königs, Seiner Majestät Leopolds II., schlecht behandelt würden.
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!