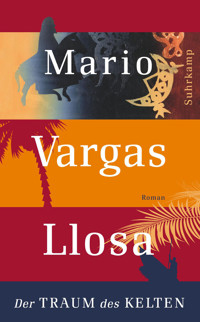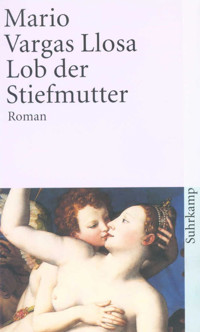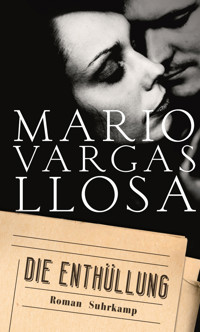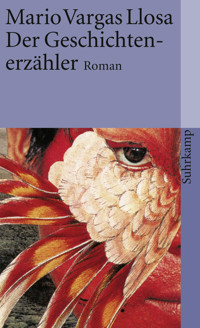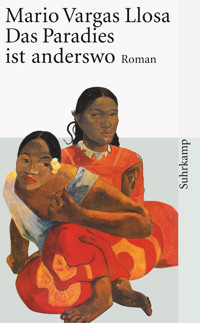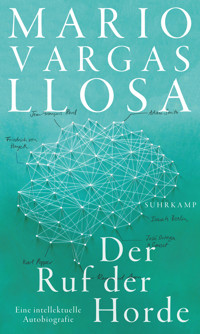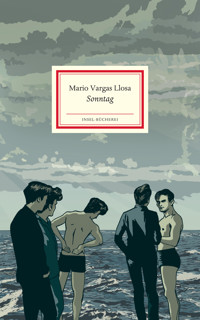13,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Suhrkamp
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Fünfhundert Dollar – monatlich! Der Transportunternehmer Felícito denkt überhaupt nicht daran, auf die Schutzgeldforderung der peruanischen Mafia einzugehen. Bis plötzlich die Liebe seines Lebens spurlos verschwindet. Zur gleichen Zeit spielt sich in Lima ein turbulentes Familiendrama ab: Ismael, ein erfolgreicher Geschäftsmann auf dem Sprung in den Ruhestand, vermählt sich im Gefühlstaumel mit seiner bildhübschen Haushälterin Armida. Damit bringt er jedoch seine unberechenbaren Söhne um ihr Erbe und wird kurzerhand das Opfer einer hitzigen Medienkampagne. Zwei Männer alten Schlages, die sich Hals über Kopf in Schwierigkeiten manövrieren und die viel mehr miteinander verbindet, als sie ahnen … Wohlmeinende Väter und habgierige Söhne, die Fallstricke erotischer Hingabe – »Ein diskreter Held« ist eine pralle, vor Erzähllust sprühende Geschichte über die Wirrungen des Lebens.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 580
Veröffentlichungsjahr: 2013
Ähnliche
Fünfhundert Dollar – monatlich! Der Transportunternehmer Felícito denkt überhaupt nicht daran, auf die Schutzgeldforderung der peruanischen Mafia einzugehen. Bis plötzlich die Liebe seines Lebens spurlos verschwindet. Zur gleichen Zeit spielt sich in Lima ein rasantes Familiendrama ab: Ismael, ein erfolgreicher Geschäftsmann auf dem Sprung in den Ruhestand, vermählt sich mit seiner bildhübschen Haushälterin Armida. Damit bringt er jedoch seine unberechenbaren Söhne um ihr Erbe und wird kurzerhand das Opfer einer hitzigen Medienkampagne.
Zwei Männer im Liebestaumel, die vollkommen arglos in Turbulenzen geraten und die viel mehr miteinander verbindet, als sie ahnen …
Mario Vargas Llosa, geboren 1936 in Peru, lebt in Madrid und Lima. 2010 erhielt er den Nobelpreis für Literatur.
Zuletzt sind im suhrkamp taschenbuch von ihm erschienen: Alles Boulevard (st 4526), Tante Julia und der Schreibkünstler (st 4381) und Der Traum des Kelten (st 4380).
Mario Vargas Llosa
Ein diskreter Held
Roman
Aus dem Spanischen vonThomas Brovot
Suhrkamp
Die Originalausgabe erschien 2013 unter dem Titel El héroe discreto bei Alfaguara, Madrid.
Im Gedenken an meinen Freund
Javier Silva Ruete
eBook Suhrkamp Verlag Berlin 2014
Der vorliegende Text folgt der 1. Auflage der Ausgabe des suhrkamp taschenbuchs 4545.
© Suhrkamp Verlag Berlin 2013
© Mario Vargas Llosa, 2013
Alle Rechte vorbehalten, insbesondere das des öffentlichen Vortrags sowie der Übertragung durch Rundfunk und Fernsehen, auch einzelner Teile.
Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form (durch Fotografie, Mikrofilm oder andere Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung des Verlages reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.
Für Inhalte von Webseiten Dritter, auf die in diesem Werk verwiesen wird, ist stets der jeweilige Anbieter oder Betreiber verantwortlich, wir übernehmen dafür keine Gewähr. Rechtswidrige Inhalte waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar.
Umschlagabbildung: László Moholy-Nagy, Lyon: Im Stadion, 1928,© VG Bild-Kunst, Bonn 2014, Foto: ullstein bild
Umschlaggestaltung: hißmann, heilmann, hamburg
eISBN 978-3-518-73459-9
www.suhrkamp.de
Unsere schöne Aufgabe ist es,uns vorzustellen, dass es ein Labyrinth gibtund einen Faden.
JORGE LUIS BORGES
Der Faden der Fabel
I
Felícito Yanaqué, Inhaber der Firma Transportes Narihualá, trat an jenem Morgen, so wie jeden Tag von Montag bis Samstag, Punkt halb acht aus seinem Haus, nachdem er eine halbe Stunde Qigong gemacht, kalt geduscht und sich das übliche Frühstück bereitet hatte: Kaffee mit Ziegenmilch und Röstbrot mit Butter, darauf ein paar Tropfen Zuckersirup. Er wohnte im Zentrum von Piura, und auf der Calle Arequipa war der Lärm der Stadt schon losgebrochen, über die hohen Bürgersteige strömten die Menschen auf dem Weg zum Büro, zum Markt, oder sie brachten die Kinder zur Schule. Ein paar fromme Seelen begaben sich in die Kathedrale für die Messe um acht. Die fliegenden Händler riefen lauthals ihre Ware aus, Honigpaste, Lutscher, Teigtaschen, Bananenchips, alle möglichen Leckereien, und an der Ecke, unter dem Dachvorsprung des Gebäudes aus der Kolonialzeit, hatte sich auch schon der blinde Lucindo niedergelassen, das Bettelschälchen zu seinen Füßen. Alles genau wie jeden Tag, seit unvordenklicher Zeit.
Mit einer Ausnahme. Am Morgen hatte jemand an die alte, mit Nägeln beschlagene Holztür seines Hauses, in Höhe des bronzenen Türklopfers, einen blauen Umschlag geheftet, auf dem in Großbuchstaben deutlich der Name des Hausbesitzers stand: DON FELÍCITO YANAQUÉ. Soweit er sich erinnerte, war es das erste Mal, dass ihm jemand auf diese Weise einen Brief zustellte, wie einen gerichtlichen Bescheid oder einen Strafzettel. Normalerweise schob der Briefträger die Post durch den Türspalt. Er nahm den Umschlag ab, öffnete ihn und las stumm, nur seine Lippen bewegten sich:
Werter Herr Yanaqué,
dass es Ihrer Firma Transportes Narihualá so gutgeht, darauf können Piura und alle Bürger der Stadt stolz sein. Aber es ist auch ein Risiko, denn jedes erfolgreiche Unternehmen läuft Gefahr, von nachtragenden, neidischen oder notleidenden Menschen geplündert und verwüstet zu werden, Menschen, von denen es hier allzu viele gibt, wie Sie selber wissen. Aber machen Sie sich keine Sorgen. Unsere Organisation wird sich darum kümmern, Ihr Unternehmen ebenso wie Sie und Ihre werte Familie vor jedem Zwischenfall, jeder Unannehmlichkeit oder Bedrohung durch diese Halunken zu schützen. Als Vergütung für unsere Tätigkeit nehmen wir monatlich 500 Dollar (eine gewiss bescheidene Summe bei Ihrem Vermögen). Zu den Zahlungsmodalitäten werden wir uns zu gegebener Zeit mit Ihnen in Verbindung setzen.
Wir müssen nicht eigens betonen, wie wichtig es ist, dass Sie die Sache mit der größten Diskretion behandeln. Das alles muss zwischen uns bleiben.
Gott befohlen.
Statt einer Unterschrift trug der Brief die plumpe Zeichnung von etwas, was wie eine kleine Spinne aussah.
Don Felícito las ihn noch einige Male, betrachtete die tänzelnde Schrift, die Tintenkleckse. Er war überrascht und belustigt und hatte das vage Gefühl, dass es sich um einen schlechten Scherz handelte. Er zerknüllte den Brief mitsamt Umschlag und wollte ihn schon an der Straßenecke in die Mülltonne werfen. Aber dann überlegte er es sich anders, strich ihn glatt und steckte ihn ein.
Es waren gut zehn Blocks von seinem Haus in der Calle Arequipa bis zu seinem Büro an der Avenida Sánchez Cerro. Diesmal ging er nicht, während er den Weg zu Fuß lief, die Termine des Tages durch, so wie sonst immer, sondern grübelte über den Brief mit der kleinen Spinne nach. Sollte er ihn ernst nehmen? Zur Polizei gehen und Anzeige erstatten? Die Erpresser hatten angekündigt, sie würden sich wegen der »Zahlungsmodalitäten« mit ihm in Verbindung setzen. Also lieber warten, bis sie sich meldeten, ehe er zum Revier ging? Vielleicht war es auch bloß irgendein Lümmel, der nichts Besseres zu tun hatte, als ihm den Tag zu verderben. Andererseits hatte in letzter Zeit die Kriminalität in Piura zugenommen: Hauseinbrüche, Straßenüberfälle bis hin zu Entführungen, die, wie es hieß, die Familien dieser Weißen von El Chipe und Los Ejidos heimlich arrangierten. Er fühlte sich verwirrt und unentschlossen, doch eins war für ihn gewiss: Nie und nimmer würde er, egal was passierte, diesen Banditen auch nur einen einzigen Centavo geben. Und abermals, wie so oft in seinem Leben, erinnerte sich Felícito an die letzten Worte seines Vaters auf dem Sterbebett: »Lass dich niemals von irgendwem herumschubsen, mein Sohn. Dieser Rat ist das Einzige, was ich dir vermachen kann.« Er hatte ihn beherzigt, nie hatte er sich herumschubsen lassen. Und mit seinem guten halben Jahrhundert auf dem Buckel war er schon zu alt, um seine Gewohnheiten zu ändern. Er war so versunken in seine Gedanken, dass er den Vortragskünstler Joaquín Ramos nur mit einem angedeuteten Nicken grüßte und weitereilte; sonst blieb er schon mal stehen, um ein paar Worte mit diesem unverbesserlichen Bohemien zu wechseln, der wahrscheinlich die Nacht in irgendeiner Kaschemme verbracht hatte und erst jetzt nach Hause ging, mit glasigen Augen, seinem ewigen Monokel und der Ziege im Schlepp, seiner Gazelle, wie er sie nannte.
Als er zu seiner Firma kam, überzeugte er sich, dass die Busse zur vorgesehenen Uhrzeit losgefahren waren, nach Sullana, Talara und Tumbes, nach Chulucanas und Morropón, nach Catacaos, La Unión, Sechura und Bayóvar, alle gut besetzt, ebenso die Sammeltaxis nach Chiclayo und die Lieferwagen nach Paita. Eine Handvoll Leute gaben Pakete auf oder erkundigten sich nach den Abfahrtszeiten der Busse und Sammeltaxis am Nachmittag. Josefita, seine Sekretärin – breite Hüften, kesse Augen und immer tief ausgeschnittene Blusen – hatte ihm ereits die Liste mit den Terminen und Verpflichtungen des Tages auf den Schreibtisch gelegt und die Thermosflasche mit dem Kaffee dazugestellt, den er bis zum Mittagessen trinken würde.
»Was ist mit Ihnen, Chef?«, grüßte sie ihn. »Warum so ein Gesicht? Haben Sie schlecht geträumt?«
»Ach, nichts Besonderes«, antwortete er, hängte Jackett und Hut an den Garderobenständer und setzte sich. Doch sofort stand er auf und schnappte sie sich wieder, als wäre ihm etwas Dringliches eingefallen.
»Bin gleich zurück«, sagte er, schon auf dem Weg zur Tür. »Muss nur zur Polizei, Anzeige erstatten.«
»Hat man bei Ihnen eingebrochen?« Josefita riss ihre lebhaften Glubschaugen auf. »Das passiert heute jeden Tag in Piura.«
»Nein, nicht, ich erzähl’s dir später.«
Entschlossenen Schrittes ging Felícito zum Revier, nur wenige Straßen von seinem Büro entfernt, ebenfalls an der Avenida Sánchez Cerro. Es war noch recht früh, die Hitze noch erträglich, aber er wusste, in weniger als einer Stunde würde diese Straße mit all ihren Reiseagenturen und Busgesellschaften zu glühen beginnen, und zurück käme er schweißnass. Miguel und Tiburcio, seine Söhne, hatten ihm oft gesagt, er sei verrückt, immer Sakko, Weste und Hut zu tragen in einer Stadt, wo alle, ob Arm oder Reich, das ganze Jahr über im kurzärmligen Hemd oder in Guayabera herumliefen. Aber seit er Transportes Narihualá eröffnet hatte, sein Lebenswerk, trug er diese Kleidungsstücke immer, ein Zeichen von Seriosität: sommers wie winters Sakko, Weste und die Krawatte mit dem Miniknoten. Er selbst war klein und spindeldürr, bescheiden und fleißig, ein Mensch, der drüben in Yapatera, wo er geboren war, und in Chulucanas, wo er die Grundschule besuchte, niemals Schuhe getragen hatte. Damit begann er erst, als er mit seinem Vater nach Piura kam. Mittlerweile war er fünfundfünfzig und hielt sich fit und gesund. Sein guter körperlicher Zustand verdankte sich, für ihn keine Frage, den morgendlichen Qigong-Übungen, die ihm sein Freund gezeigt hatte, der verstorbene Lau, Besitzer eines Kramladens. Es war der einzige Sport, den er, abgesehen vom Zufußgehen, in seinem Leben getrieben hatte, sofern man diese Bewegungen in Zeitlupe Sport nennen konnte, die weniger ein Muskeltraining als vielmehr eine andere und klügere Art waren, zu atmen. Als er das Revier erreichte, war er empört, wütend. Ob Scherz oder nicht, wer diesen Brief geschrieben hatte, ruinierte ihm den ganzen Morgen.
Das Revier war ein einziger Backofen, und da alle Fenster geschlossen waren, war es drinnen düster. Am Eingang stand ein Ventilator, der sich aber nicht rührte. Der Polizist am Meldetisch, ein Milchbubi noch, fragte ihn, was er wünsche.
»Mit dem Kommissar sprechen, bitte«, sagte Felícito und reichte ihm sein Kärtchen.
»Der ist für ein paar Tage in Urlaub«, erklärte ihm der Polizist. »Wenn Sie möchten, kann Sergeant Lituma sich um Sie kümmern, er vertritt ihn so lange.«
»Dann spreche ich mit ihm, danke.«
Er musste eine Viertelstunde warten, bis der Sergeant sich herabließ, ihn zu empfangen. Als der Polizist ihn zu der kleinen Stube führte, war sein Taschentuch ganz durchnässt, so oft hatte er sich die Stirn gewischt. Der Sergeant erhob sich nicht zu seinem Gruß, er streckte ihm nur eine feuchte, pummelige Hand entgegen und deutete auf den freien Stuhl vor sich. Er war rundlich, fast schon dick, mit gütigen Äugelchen und dem Ansatz eines Doppelkinns, das er immer wieder liebevoll knetete. Das Khakihemd seiner Uniform trug er aufgeknöpft und mit Schweißflecken unter den Achseln. Auf dem kleinen Tisch stand ein Ventilator, der funktionierte immerhin. Felícito spürte dankbar, wie ihm ein Stoß kühler Luft übers Gesicht fuhr.
»Womit kann ich Ihnen dienen, Herr Yanaqué?«
»Diesen Brief hier habe ich heute bekommen. Er hing an meiner Haustür.«
Sergeant Lituma setzte sich eine Brille auf, die ihm das Aussehen eines Winkeladvokaten verlieh, und las den Brief in aller Ruhe durch.
»Tja, was soll man da sagen«, meinte er schließlich und zog ein Gesicht, das Felícito nicht recht zu deuten vermochte. »Das sind die Folgen des Fortschritts, Don Felícito.«
Als er die Verwirrung des Unternehmers sah, erläuterte er, mit dem Brief wedelnd:
»Als Piura noch eine arme Stadt war, gab es so etwas nicht. Wer wäre schon auf die Idee gekommen, von einem Geschäftsmann Schutzgeld zu verlangen. Jetzt, wo es Geld gibt, fahren die Leute ihre Krallen aus und wollen ihren Schnitt machen. Schuld sind die Ecuadorianer, mein Herr. Da sie der Regierung misstrauen, ziehen sie ihr Kapital ab und investieren es hier. Und dann greifen sie den Bürgern von Piura in die Tasche und stopfen sich die eigene voll.«
»Das ist mir nicht gerade ein Trost, Sergeant. Außerdem, wenn man Sie so hört, da klingt es fast, als wäre es ein Unglück, dass es Piura jetzt so gutgeht.«
»Das«, sprach der Sergeant bedächtig, »habe ich nicht gesagt. Nur dass in diesem Leben alles seinen Preis hat. Auch der Fortschritt.«
Wieder wedelte er mit dem Brief, und Felícito Yanaqué kam es vor, als machte sich dieses dunkle, rundliche Gesicht über ihn lustig. In den Augen des Sergeanten schimmerte es, ein gelblich grünes Leuchten, wie bei einem Leguan. Irgendwo hinten im Revier brüllte eine Stimme: »Solche Ärsche wie in Piura gibt es nirgendwo sonst in Peru. Ich unterschreibe, Scheiße!« Der Sergeant lächelte und tippte sich an die Schläfe. Felícito wurde klaustrophobisch zumute. Es gab fast keinen Platz für sie beide zwischen diesen rußigen Holzwänden, übersät mit Meldungen, Bekanntmachungen, Fotos und Zeitungsausschnitten. Es roch nach Schweiß und alten Männern.
»Schreiben kann er jedenfalls«, sagte der Sergeant und überflog noch einmal den Brief. »Zumindest kann ich keine Grammatikfehler entdecken.«
Felícito spürte, wie sein Blut in Wallung geriet.
»Ich bin nicht gut in Grammatik, und ich glaube nicht, dass es darauf ankommt«, murmelte er und musste sich zurückhalten. »Was meinen Sie, was jetzt passiert?«
»Erst einmal nichts«, erwiderte der Sergeant in aller Ruhe. »Ich nehme Ihre Angaben auf, für alle Fälle. Kann sein, dass es bei diesem Brief bleibt. Vielleicht hat jemand ein Hühnchen mit Ihnen zu rupfen und will Sie auf die Palme bringen. Genauso könnte es sein, dass die Sache ernst ist. Da steht, man wird sich wegen der Zahlung mit Ihnen in Verbindung setzen. Wenn das passiert, kommen Sie her und wir sehen weiter.«
»Sie scheinen der Sache keine Bedeutung beizumessen«, protestierte Felícito.
»Fürs Erste hat sie keine«, sagte der Sergeant und zuckte die Achseln. »Das ist bloß ein zerknittertes Stück Papier, Herr Yanaqué. Es könnte ein dummer Streich sein. Aber wenn die Sache ernst wird, wird die Polizei handeln, das verspreche ich Ihnen. Dann also an die Arbeit.«
Eine ganze Weile musste Felícito die Angaben zu seiner Person und seiner Firma herbeten. Sergeant Lituma notierte sie in ein grün eingebundenes Heft, mit einem Bleistiftstummel, den er immer wieder mit der Zunge befeuchtete. Felícito beantwortete die Fragen mit schwindendem Selbstvertrauen, so unnütz erschienen sie ihm. Herzukommen und die Anzeige aufzugeben war reine Zeitverschwendung. Nichts würde dieser Sergeant unternehmen. Außerdem, hieß es nicht, dass die Polizei die korrupteste aller Institutionen war? Vielleicht stammte der Brief mit der kleinen Spinne ja aus dieser stinkenden Höhle hier. Als Lituma ihm sagte, das Schreiben müsse als Beweismittel im Revier bleiben, sprang Felícito auf.
»Ich würde gerne zuerst eine Kopie machen.«
»Wir haben kein Kopiergerät hier«, erklärte der Sergeant und deutete auf die franziskanische Kargheit der Stube. »Draußen auf der Straße gibt es viele Geschäfte, wo man Kopien machen kann. Kommen Sie danach wieder zu mir, Herr Yanaqué. Ich warte so lange.«
Felícito ging hinaus auf die Avenida Sánchez Cerro, und nahe dem Großmarkt fand er einen Laden. Er musste warten, bis ein paar Ingenieure einen Stapel Pläne kopiert hatten, und beschloss, sich nicht weiter der Befragung durch den Sergeanten auszusetzen. Er gab die Kopie dem jungen Polizisten am Meldetisch, und statt zurück zu seinem Büro zu gehen, stürzte er sich wieder ins Zentrum der Stadt, die jetzt voller Menschen war, Gehupe, Hitze, Lautsprecher, Motorradtaxis, Autos und rumpelnder Karren. Er überquerte die Avenida Grau, ging im Schatten der Tamarinden an der Plaza de Armas entlang und schlug, der Versuchung widerstehend, auf ein Früchtesorbet ins El Chalán zu gehen, die Richtung zum alten Schlachthofviertel ein, das Viertel seiner Jugendzeit, La Gallinacera, unten am Fluss. Er flehte zu Gott, dass Adelaida in ihrem Laden war. Es würde ihm guttun, mit ihr zu sprechen, würde sein Gemüt aufhellen, und wer weiß, vielleicht konnte die Santera ihm ja einen Rat geben. Die Sonne brannte schon vom Himmel, und dabei war es nicht einmal zehn Uhr. Er spürte, wie ihm der Schweiß auf der Stirn stand, im Nacken ein glühendes Eisen. Er beeilte sich, mit kurzen, raschen Schritten, stieß gegen die Leute, die sich auf den engen Bürgersteigen drängten, es roch nach Pisse und Fettgebratenem. Aus einem aufgedrehten Radio tönte Salsa.
Manchmal sagte sich Felícito, und er hatte es auch zu seinen Söhnen gesagt und zu Gertrudis, seiner Frau, dass Gott, um seine Mühen und Opfer zu belohnen, ihm zwei Personen über den Weg geschickt hatte, den Krämer Lau und die Wahrsagerin Adelaida. Ohne die beiden wäre es ihm nie so gut ergangen. Weder wäre er geschäftlich so weit vorangekommen, noch hätte er eine ehrbare Familie gegründet, auch hätte er nicht diese eiserne Gesundheit. Er war keiner, der leicht Freundschaften schloss. Seit eine Darminfektion den armen Lau ins Jenseits befördert hatte, blieb ihm nur noch Adelaida. Zum Glück war sie da, hinter der Theke ihres kleinen Ladens für Kräuter, Heilige, Kurzwaren und allen möglichen Krempel, und sah sich die Bilder in einer Illustrierten an.
»Tag, Adelaida«, grüßte er sie und streckte die Hand aus. »Schlag ein. Wie gut, dass ich dich antreffe.«
Sie war eine alterslose Mulattin, untersetzt, vollbusig, mit breitem Hintern und langen gekräuselten Haaren, die ihr über die Schultern strichen, wenn sie über den gestampften Lehmboden ihres kleinen Ladens lief, immer barfuß und in diesem ewigen, bis zu den Knöcheln reichenden rotbraunen Hemdkleid oder Gewand aus Leinen. Ihre Augen waren riesig und schienen mehr zu durchbohren als zu schauen, gemildert durch einen sympathischen Gesichtsausdruck, der den Menschen Vertrauen einflößte.
»Wenn du mich besuchen kommst, ist dir etwas Schlimmes passiert. Oder es wird dir passieren«, lachte Adelaida und klopfte ihm auf die Schulter. »Sag schon, was ist das Problem, Felícito?«
Er gab ihr den Brief.
»Das hing heute Morgen an meiner Haustür. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Ich habe bei der Polizei Anzeige erstattet, aber ich glaube, das hätte ich mir sparen können. Der Typ, der die Anzeige aufgenommen hat, hat mir kaum zugehört.«
Adelaida befühlte den Brief und roch daran, sog den Geruch ein, als wäre es ein Parfüm. Dann hielt sie sich das Papier an den Mund, und Felícito kam es vor, als lutschte sie an einem Zipfelchen.
»Lies ihn mir vor, Felícito«, sagte sie und gab ihm den Brief zurück. »Ich sehe schon, ein Liebesbriefchen ist das nicht, che guá.«
Sehr ernst hörte sie zu, während er vorlas. Als er zum Ende kam, zog sie ein spöttisches Gesicht und breitete die Arme aus:
»Was soll ich dazu sagen, Schätzchen?«
»Sag mir, ob das ernst gemeint ist, Adelaida. Ob ich mir Sorgen machen muss oder nicht. Oder ob mir bloß jemand einen Streich spielen will.«
Die Santera ließ ein Lachen erschallen, dass die ganze Fülle ihres Körpers unter dem weiten rotbraunen Gewand erbebte.
»Ich bin nicht Gott, sonst könnte ich es dir sagen«, rief sie, hob immer wieder die Schultern und schwang ihre Arme.
»Hast du keine Eingebung, Adelaida? In den fünfundzwanzig Jahren, die ich dich kenne, hast du mir nie einen schlechten Rat gegeben. Alle sind mir nützlich gewesen. Ich weiß nicht, was aus meinem Leben geworden wäre ohne dich, meine Liebe. Könntest du mir jetzt nicht auch einen geben?«
»Nein, Schätzchen, keinen«, erwiderte Adelaida und tat betrübt. »Ich habe keine Eingebung. Bedaure, Felícito.«
»Na dann, da kann man nichts machen.« Er griff nach dem Portemonnaie. »Wo nichts ist, kann man nichts holen.«
»Wozu willst du mir Geld geben, wenn ich dir keinen Rat geben konnte«, protestierte Adelaida. Aber dann steckte sie den Zwanzig-Sol-Schein, den anzunehmen Felícito sie eindringlich bat, ein.
»Kann ich mich hier einen Augenblick hinsetzen, im Schatten? Ich bin fix und fertig von der Lauferei, Adelaida.«
»Setz dich und ruh dich aus, Schätzchen. Ich bringe dir ein Glas schön kühles Wasser, frisch vom Filterstein. Mach’s dir bequem.«
Während Adelaida nach hinten durchging, betrachtete Felícito im Halbdunkel des Ladens die silbrigen Spinnweben, die von der Decke herabhingen, die alten Regale mit den Tütchen Petersilie, Rosmarin, Koriander und Minze, die Schachteln mit Stecknadeln, Ösen, Schmucksteinen und Knöpfen zwischen Marien- und Christusbildchen und -figürchen, Heiligen und Seligen, ausgeschnitten aus Illustrierten und Zeitungen, einige mit brennender Kerze davor, andere geschmückt mit Rosenkränzen, Skapulieren und Blumen aus Wachs oder Papier. Eben wegen dieser Heiligenbildchen nannte man sie in Piura Santera, aber in all den Jahren, die er sie kannte, war Adelaida ihm nie besonders religiös vorgekommen. So hatte er sie auch nicht ein einziges Mal in der Messe gesehen. Außerdem hieß es, die Pfarrer in den Vierteln hielten sie für eine Hexe. Das riefen ihr manchmal auch die Kinder auf der Straße nach: »Hexe, Hexe!« Aber das stimmte nicht, es war keine Hexerei, was sie tat, anders als die vielen feurigen Cholas aus Catacaos und La Legua, die einen Trank verkauften, mit dem man angeblich die Liebe gewinnen oder verlieren oder ein Unglück heraufbeschwören konnte, oder diese Schamanen aus Huancabamba, die den Kranken, die sie dafür bezahlten, dass man sie von ihren Leiden befreite, mit einem Meerschweinchen über den Körper strichen oder sie in Las Huaringas ins Wasser tauchten. Adelaida war nicht einmal eine professionelle Wahrsagerin. Sie übte ihre Kunst nur ab und zu aus und nur unter Freunden und Bekannten, ohne dafür einen Centavo zu nehmen. Auch wenn sie, sofern diese darauf bestanden, am Ende immer das kleine Geschenk einsteckte, das man ihr gab. Felícitos Frau und seine Söhne (und auch Mabel) machten sich lustig darüber, wie blindgläubig er Adelaidas Eingebungen und Ratschlägen folgte. Er glaubte ihr nicht nur, er hatte sie auch liebgewonnen. Es tat ihm leid, wie einsam und arm sie war. Von einem Ehemann oder von Verwandten war nichts bekannt, aber sie schien zufrieden zu sein mit ihrem Leben einer Einsiedlerin.
Zum ersten Mal hatte er sie gesehen, ein Vierteljahrhundert war es her, als er auf den Strecken in die anderen Provinzen als Lastwagenfahrer arbeitete, noch vor der Zeit seines kleinen Bus- und Fuhrunternehmens, auch wenn er Tag und Nacht davon träumte. Es geschah bei Kilometer fünfzig an der Panamericana, bei diesen Hüttensiedlungen, wo die Fahrer der Busse, Lastwagen und Sammeltaxis immer anhielten, um eine Hühnerbouillon, einen Kaffee oder ein Schälchen Chicha zu sich zu nehmen und ein Sandwich zu essen, bevor sie sich auf die lange Fahrt durch die glühend heiße Wüste von Olmos machten, eine Weite aus Staub und Steinen ohne das kleinste Dorf, ohne eine einzige Tankstelle oder Werkstatt. Adelaida, die damals schon dieses rotbraune Hemdkleid trug, das immer ihr einziges Kleidungsstück sein sollte, hatte einen der Stände mit Dörrfleisch und Erfrischungsgetränken. Felícito fuhr den Lkw der Casa Romero, vollbeladen mit Baumwollbündeln, in Richtung Trujillo. Er fuhr allein, sein Beifahrer hatte die Fahrt im letzten Moment abgesagt, weil man ihm aus dem Hospital Obrero mitgeteilt hatte, dass es seiner Mutter sehr schlecht gehe und sie jede Minute sterben könne. Er aß gerade eine Maispastete, auf einem Hocker am Verkaufstisch von Adelaida, als er bemerkte, wie die Frau ihn auf eine seltsame Weise anschaute, mit diesen riesigen Augen und diesem tiefen, stochernden Blick. Was war nur in sie gefahren, che guá? Sie sah erschrocken aus.
»Was ist mit Ihnen, Señora Adelaida? Warum sehen Sie mich so an?«
Sie sagte nichts. Sie stand nur da, die großen Augen auf ihn geheftet, und machte ein so angewidertes oder entsetztes Gesicht, dass ihre Wangen einsanken und die Stirn sich kräuselte.
»Fühlen Sie sich nicht gut?«, fragte Felícito noch einmal, ihm war ganz unbehaglich.
»Steigen Sie nicht ein, besser nicht«, sagte die Frau schließlich, mit rauer Stimme, als wollte ihr die Kehle nicht gehorchen. Sie deutete auf den roten Lkw, den Felícito am Straßenrand abgestellt hatte.
»Ich soll nicht in meinen Lastwagen steigen?«, fragte er verwirrt. »Und wieso nicht, wenn ich fragen darf?«
Adelaida entließ ihn für einen Moment aus ihrem Blick und schaute sich um, als fürchtete sie, die anderen Fahrer, Kunden oder Besitzer der Läden und kleinen Bars der Siedlung könnten sie hören.
»Ich habe eine Eingebung«, sagte sie mit leiser Stimme und immer noch verzerrtem Gesicht. »Ich kann es Ihnen nicht erklären. Glauben Sie einfach, was ich Ihnen sage, bitte. Steigen Sie besser nicht ein.«
»Haben Sie Dank für Ihren Rat, Señora, Sie meinen es sicher gut. Aber ich muss mir mein Geld verdienen. Ich bin Fahrer, ich verdiene mir meinen Lebensunterhalt mit der Fahrerei, Doña Adelaida. Wie sollen meine Frau und meine zwei kleinen Kinder sonst etwas zu essen haben?«
»Dann seien Sie wenigsten vorsichtig«, bat ihn die Frau und senkte den Blick. »Hören Sie auf mich.«
»Das tue ich, Señora, versprochen. Ich fahre immer vorsichtig.«
Anderthalb Stunden später, in einer Kurve der unbefestigten Landstraße, unter einer dichten, graugelben Staubwolke, kam der Bus der Gesellschaft Das Kreuz von Chalpón auf ihn zugeschlittert und krachte in seinen Lkw, mit einem donnernden Lärm von Blech, Bremsen, Schreien und Reifenquietschen. Felícito hatte gute Reflexe und schaffte es, so weit auszuweichen, dass der vordere Teil des Wagens noch von der Piste abkam, so dass der Bus gegen die Kipplade schlug, was ihm das Leben rettete. Aber bis die Knochen seines Rückens, der Schulter und des rechten Beins zusammengeflickt waren, lag er unbeweglich in einem Gipsbett, das ihm nicht nur Schmerzen bereitete, sondern auch ein wahnsinniges Jucken. Als er sich schließlich wieder ans Steuer setzen konnte, fuhr er als Erstes zum Kilometer fünfzig. Adelaida erkannte ihn sofort.
»Sieh an, was für eine Freude, dass es Ihnen wieder gut geht«, sagte sie zur Begrüßung. »Ein leckeres Maispastetchen und eine Brause, so wie immer?«
»Ich bitte Sie, um alles in der Welt, sagen Sie mir, woher Sie wussten, dass dieser Bus in mich krachen würde, Señora Adelaida. Ich kann seither an nichts anderes mehr denken. Sind Sie eine Hexe, eine Heilige oder was?«
Er sah, wie die Frau bleich wurde und nicht wusste, was sie mit ihren Händen tun sollte. Sie hatte den Kopf gesenkt, offenbar verwirrt.
»Ich wusste nichts davon«, stammelte sie, ohne ihn anzuschauen. »Ich hatte eine Eingebung, das ist alles. Das passiert mir manchmal, warum, weiß ich nie. Ich suche nicht danach, che guá. Das schwöre ich. Es ist ein Fluch, der über mich gekommen ist. Ich mag es nicht, dass der liebe Gott mich so gemacht hat. Ich bete jeden Tag zu ihm, dass er mir diese Gabe wieder nimmt. Es ist schrecklich, glauben Sie mir. Damit fühle ich mich schuld an allem, was den Leuten passiert.«
»Aber was haben Sie denn gesehen, Señora? Warum haben Sie mir an dem Tag gesagt, ich soll nicht in meinen Lastwagen steigen?«
»Ich habe nichts gesehen, ich sehe nie, was geschehen wird. Ich hatte nur eine Eingebung. Dass Ihnen, wenn Sie in den Lastwagen steigen, etwas passieren kann. Was, wusste ich nicht. Ich weiß nie, was genau passiert. Nur dass es Dinge gibt, die man besser nicht tun sollte, weil sie schlimme Folgen haben. Essen Sie jetzt Ihr Pastetchen und trinken eine Inca Kola?«
Damals hatten sie sich angefreundet, und bald duzten sie sich. Seit Adelaida die Siedlung bei Kilometer fünfzig verlassen und ihren kleinen Laden für Kräuter, Kurzwaren, Krimskrams und religiöse Bildchen in der Umgebung des ehemaligen Schlachthofs aufgemacht hatte, kam Felícito wenigstens einmal in der Woche vorbei, um mit ihr zu plaudern. Fast immer brachte er ihr ein kleines Geschenk mit, eine Süßigkeit, ein Törtchen, Sandalen, und beim Abschied drückte er ihr dann einen Schein in ihre harten, schwieligen Hände. Alle wichtigen Entscheidungen, die er in diesen über zwanzig Jahren getroffen hatte, hatte er zuvor mit ihr beraten, vor allem seit der Gründung von Transportes Narihualá: die finanziellen Verbindlichkeiten, die er einging, die Lkws, Busse und Autos, die er nach und nach kaufte, die Geschäftsräume, die er anmietete, die Fahrer, Mechaniker und Angestellten, die er einstellte oder entließ. Meist lachte Adelaida über seine Fragen. »Was soll ich schon davon wissen, che guá. Woher soll ich dir sagen, ob ein Chevrolet besser ist oder ein Ford, was weiß ich schon von Automarken, wo ich nie ein Auto gehabt habe und nie eins haben werde.« Doch manchmal, auch wenn sie kaum wusste, worum es ging, kam ihr eine Eingebung, und sie gab ihm einen Rat: »Ja, mach das, Felícito, ich glaube, das wird klappen.« Oder: »Nein, Felícito, das wäre nicht gut, ich weiß nicht, was, aber etwas scheint mir an der Sache faul zu sein.« Die Worte der Santera waren für den Unternehmer wie geoffenbarte Wahrheiten, und er befolgte sie, so unbegreiflich oder absurd sie auch erscheinen mochten.
»Du bist eingeschlafen, Schätzchen«, hörte er sie sagen.
Tatsächlich, er war eingeschlafen, nachdem das Glas frisches Wasser, das Adelaida ihm gebracht hatte, ausgetrunken war. Wie lange hatte er wohl geschlummert auf diesem harten Schaukelstuhl, der ihm einen Krampf im Hintern bescherte? Er sah auf die Uhr. Halb so schlimm, ein paar Minuten nur.
»Das war die Anspannung heute Morgen und das ganze Hin und Her«, sagte er und stand auf. »Bis dann, Adelaida. Wie ruhig du es hier in deinem Laden hast. Es tut mir immer gut, dich zu besuchen, auch wenn dir keine Eingebung kommt.«
Und im selben Moment, als er das Schlüsselwort aussprach, Eingebung, bemerkte Felícito, dass der Gesichtsausdruck der Santera nicht mehr derselbe war. Jetzt war sie sehr ernst, mit versteinerter Miene, die Stirn gerunzelt, und biss sich auf einen Fingernagel. Als hielte sie die Angst zurück, die in ihr aufstieg. Mit ihren riesigen Augen starrte sie ihn an. Felícito spürte, wie sein Herz galoppierte.
»Was ist mit dir, Adelaida?«, fragte er erschrocken. »Sag nicht, du hast auf einmal …«
Sie packte ihn am Arm und bohrte die Finger hinein.
»Gib ihnen, was sie von dir verlangen, Felícito«, murmelte sie. »Am besten gibst du es ihnen.«
»Ich soll diesen Erpressern fünfhundert Dollar im Monat geben, damit sie mir nichts antun?« Der Unternehmer war empört. »Sagt dir das deine Eingebung, Adelaida?«
Die Santera ließ seinen Arm los und tätschelte ihn liebevoll.
»Ich weiß, das ist nicht gut, das ist viel Geld«, sagte sie schließlich. »Aber was bedeutet nach allem schon das Geld, meinst du nicht? Wichtiger ist deine Gesundheit und dass du deine Ruhe hast, deine Arbeit, deine Familie, dein Liebchen in Castilla. Ich weiß, es gefällt dir nicht, dass ich dir das sage. Mir auch nicht, du bist ein guter Freund. Außerdem, womöglich irre ich mich ja und ich gebe dir einen schlechten Rat. Du musst mir nicht glauben, Felícito.«
»Das Geld ist es nicht«, sagte er mit fester Stimme. »Ein Mann darf sich von niemandem herumschubsen lassen in diesem Leben. Darum geht es, nur darum, Adelaida.«
II
Als Don Ismael Carrera, Inhaber der Versicherungsgesellschaft, in sein Büro kam und ihm vorschlug, zusammen zu Mittag zu essen, dachte Rigoberto: Jetzt wird er mich wieder bitten, einen Rückzieher zu machen. Denn Ismael war, so wie alle Kollegen und Untergebenen, sehr überrascht gewesen von seiner plötzlichen Ankündigung, er werde drei Jahre vor der Zeit in den Ruhestand treten. Wozu mit zweiundsechzig Abschied nehmen, sagten sie ihm, wo er doch noch in der Geschäftsführung verbleiben und, umgeben vom einmütigen Respekt der fast dreihundert Angestellten, die Firma weiter leiten konnte.
Wozu, ja, wozu, dachte er. Nicht einmal ihm selbst war es richtig klar. Doch keine Frage, sein Beschluss stand fest, felsenfest. Keinen Schritt zurück würde er tun, auch wenn er, eben weil er drei Jahre vor Vollendung des fünfundsechzigsten Lebensjahres ging, nicht die volle Rente bekäme und auch kein Anrecht hätte auf all die Boni und netten Kleinigkeiten für jene, die die Altersgrenze für den Ruhestand erreichten.
Er versuchte sich aufzumuntern und dachte an die freie Zeit, über die er bald verfügte. Stundenlang würde er in seinem Kultureckchen verbringen, geschützt vor der Verrohung ringsum, würde seine geliebten Bilder betrachten, die Kunstbände, die sich in seiner Bibliothek aneinanderreihten, würde gute Musik hören, mit Lucrecia nach Europa reisen, jedes Jahr im Frühjahr oder im Herbst, würde auf Festivals und Kunstmessen gehen, Museen besuchen, Stiftungen, Galerien, noch einmal diese wunderbaren Bilder und Skulpturen ansehen und weitere entdecken, die er dann in seine geheime Pinakothek aufnahm. Er hatte es überschlagen, und rechnen konnte er. Wenn er seine Ersparnisse von fast einer halben Million Dollar und seine Rente besonnen und umsichtig ausgab und verwaltete, hätten Lucrecia und er einen unbeschwerten Lebensabend und könnten Fonchito die Zukunft absichern.
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!