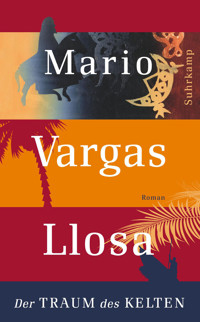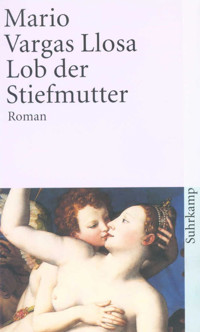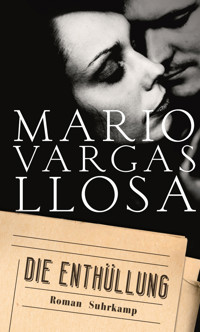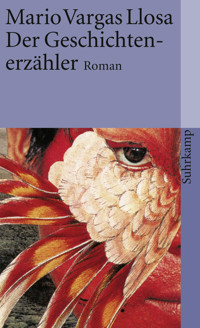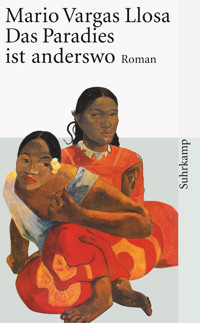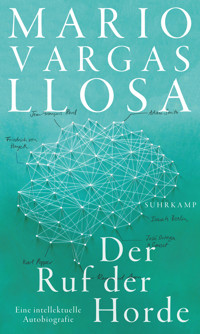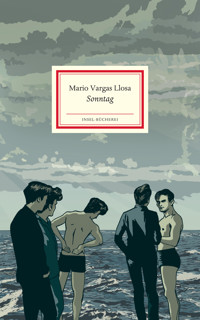14,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 11,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 11,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Suhrkamp
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Tante Julia, ebenso attraktiv wie kapriziös, taucht nach ihrer Scheidung in Lima auf, wo sie einen neuen Ehemann zu finden hofft. Doch es kommt anders. Ihr Neffe Mario verliebt sich in sie, ein gerade 18-jähriger Student, der beim Radio jobbt und von einem Schriftstellerleben in Paris träumt. Aus dem unwahrscheinlichen Flirt wird die große Liebe, der Skandal ist perfekt: Um jeden Preis versucht der Familienclan, ihr Glück zu verhindern. Mario und Tante Julia fliehen, und auf einer irrwitzigen Fahrt durch das Land suchen sie einen bestechlichen Bürgermeister, der den Minderjährigen mit seiner Tante traut. Einer der berühmtesten Romane der lateinamerikanischen Literatur und der beliebteste Roman des Nobelpreisträgers Mario Vargas Llosa: eine rasante Liebes- und Gesellschaftskomödie voll lebensklugem Witz.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 643
Veröffentlichungsjahr: 2012
Ähnliche
Der junge Mario träumt von einem Schriftstellerleben in Paris. Da kreuzt Tante Julia seinen Weg, vierzehn Jahre älter als er und in Lima auf der Suche nach einem neuen Ehemann. Aus dem Flirt wird die große Liebe, der Skandal ist perfekt: Um jeden Preis versucht der Familienclan, ihr Glück zu verhindern.
Eine der berühmtesten Romane der lateinamerikanischen Literatur und der beliebteste Roman des Nobelpreisträgers Mario Vargas Llosa: eine rasante Liebes- und Gesellschaftskomödie voll lebensklugem Witz. In neuer Übersetzung von Thomas Brovot.
»Einer der lustigsten Romane aller Zeiten.« Daniel Kehlmann
Mario Vargas Llosa, geboren 1936 in Arequipa/Peru, lebt heute in Madrid und Lima. Neben zahlreichen anderen Auszeichnungen erhielt er 1996 den Friedenspreis des Deutschen Buchhandels und 2010 den Nobelpreis für Literatur. Sein schriftstellerisches Werk erscheint auf deutsch im Suhrkamp Verlag.
Mario Vargas Llosa
Tante Juliaund der Schreibkünstler
Roman
~
Aus dem Spanischen vonThomas Brovot
Suhrkamp
Die Originalausgabe erschien 1977 unter dem Titel
La tía Julia y el escribidor
© Mario Vargas Llosa, 1977
eBook Suhrkamp Verlag Berlin 2012
© der deutschen Ausgabe Suhrkamp Verlag Berlin 2011
Alle Rechte vorbehalten, insbesondere das der Übersetzung, des öffentlichen Vortrags sowie der Übertragung durch Rundfunk und Fernsehen, auch einzelner Teile. Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form (durch Fotografie, Mikrofilm oder andere Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung des Verlages reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.
Umschlagabbildung: Condé Nast Archive/Corbis
Umschlag: Cornelia Niere
eISBN 978-3-518-73625-8
www.suhrkamp.de
Inhalt
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
XIII
XIV
XV
XVI
XVII
XVIII
XIX
XX
Für Julia Urquidi Illanes,
der dieser Roman und ich
so viel verdanken.
Ich schreibe. Ich schreibe dass ich schreibe. Im Geiste sehe ich wie ich schreibe dass ich schreibe und mir dabei zusehe wie ich sehe dass ich schreibe. In meiner Erinnerung schrieb ich schon und sah mir zu wie ich schrieb. Und ich sehe wie ich mich erinnere dass ich sehe wie ich schreibe und mich erinnere wie ich sehe dass ich mich erinnere wie ich schrieb und schreibe während ich sehe wie ich schreibe dass ich mich erinnere gesehen zu haben wie ich schrieb dass ich sah wie ich schrieb in meiner Erinnerung gesehen zu haben wie ich schrieb dass ich schrieb und dass ich schrieb dass ich schreibe dass ich schrieb. Ich kann mir auch vorstellen wie ich schreibe ich hätte schon geschrieben ich würde mir vorstellen wie ich schreibe ich hätte geschrieben ich stellte mir vor wie ich schreibe dass ich sehe wie ich schreibe dass ich schreibe.
Salvador Elizondo, Der Graphograph
I
In jenen fernen Tagen war ich noch sehr jung und lebte bei meinen Großeltern in Miraflores, in einem weißgestrichenen kleinen Haus in der Calle Ocharán. Ich studierte an der San Marcos, Jura, glaube ich, und durfte mich darauf gefasst machen, meinen Lebensunterhalt einmal mit einem bürgerlichen Beruf zu verdienen, auch wenn ich eigentlich lieber Schriftsteller werden wollte. Ich hatte einen Job mit pompösem Namen, mäßigem Gehalt, fragwürdigen Beschaffungsmethoden und geschmeidigen Arbeitszeiten: Nachrichtenchef von Radio Panamericana. Es ging darum, aus den Zeitungen die interessantesten Meldungen auszuschneiden und sie ein wenig zu retuschieren, bevor sie gesendet wurden. Die mir unterstellte Redaktion bestand aus einem jungen Mann mit Pomadefrisur und einem Faible für Katastrophen namens Pascual. Nachrichten gab es jede Stunde, eine Minute lang, außer mittags um zwölf und abends um neun, da waren es fünfzehn, aber wir stellten immer gleich mehrere zusammen, so dass ich oft draußen unterwegs war, auf einen Kaffee in der Avenida Colmena, gelegentlich bei einer Vorlesung, wenn nicht in den Räumlichkeiten von Radio Central, wo es munterer zuging als bei uns.
Beide Sender hatten denselben Eigentümer und lagen in unmittelbarer Nachbarschaft in der Calle Belén, unweit der Plaza San Martín. Sie ähnelten sich in nichts. Wie diese Schwestern aus dem Drama, von denen die eine voller Anmut auf die Welt kam und die andere voller Makel, zeichneten sie sich durch ihre Gegensätze aus. Radio Panamericana belegte das Obergeschoss und das Dach eines schicken Neubaus und gab sich mit seinem Personal ambitioniert und programmbewusst, weltoffen und ein wenig snobistisch, man war modern, jugendlich, aristokratisch. Die Sprecher waren zwar keine Argentinier, hätten es (um mit Pedro Camacho zu sprechen) aber verdient. Es wurde viel Musik gespielt, jede Menge Jazz und Rock, eine Prise Klassik auch, der Sender war der erste in Lima, der die neuesten Hits aus New York und Europa in den Äther schickte, aber auch lateinamerikanische Musik wurde nicht geringgeschätzt, solange sie nur ein Minimum an Raffinement bewies; wogegen die heimische mit Vorsicht genossen wurde, ein Vals musste es schon sein. Es gab Sendungen mit einem gewissen intellektuellen Biss, Porträts aus der Historie, Kommentare zum Weltgeschehen, und selbst im seichteren Programmteil, den Ratespielen oder dem Sprungbrett zum Ruhm, war man merklich bestrebt, allzu Plumpes oder Triviales zu meiden. Ein Ausweis seines kulturellen Engagements war auch ebenjener Nachrichtendienst, den Pascual und ich fütterten, in einer Bretterbude auf dem Dach, von wo aus die letzten verbliebenen Lichtkuppeln über den Häusern von Lima und die Müllkippen zu erkennen waren. Hinauf gelangte man mit einem Aufzug, dessen Tür die beunruhigende Angewohnheit hatte, sich vorzeitig zu öffnen.
Radio Central dagegen quetschte sich in ein altes Gebäude mit zahllosen Innenhöfen und verschlungenen Gängen, und man brauchte nur die hemdsärmeligen, im Slang badenden Sprecher zu hören, und es war klar, dass man sich hier bodenständig gab und an die Masse richtete, das gemeine Volk. Nachrichten wurden kaum welche gesendet, Königin und Herrscherin war die peruanische Musik einschließlich jener der Anden, und nicht selten traten die aus den Stadien bekannten indianischen Sänger bei Publikumsveranstaltungen auf, zu denen sich schon Stunden vor Beginn die Menschen an den Türen drängten. Auch reichlich karibische, mexikanische und argentinische Musik ließ von hier aus den Äther erbeben, und die Sendungen waren so schlicht und einfallslos wie erfolgreich: Hörerwünsche, Geburtstagsständchen, Klatsch und Tratsch aus der Welt der Show, der Film- und Plattenstars. Die Hauptattraktion aber, immer wieder, sturzbachgleich, was dem Sender nach allen Umfragen seinen ungeheuren Zuspruch sicherte, waren die Hörspielserien.
Täglich brachten sie ein halbes Dutzend mindestens, und es bereitete mir großes Vergnügen, den Darstellern bei den Aufnahmen über die Schulter zu schauen, abgetakelten, hungrigen, zerlumpten Schauspielerinnen und Schauspielern, deren jugendliche, schmelzende, glockenhelle Stimmen auf erschreckende Weise mit ihren alten Gesichtern, den bitteren Mündern und müden Augen kontrastierten. »An dem Tag, an dem das Fernsehen nach Peru kommt, bleibt ihnen nur der Selbstmord«, prophezeite Genaro junior und deutete durch die Scheiben des Studios, wo sie, wie in einem großen Aquarium, Skripte in der Hand, um das Mikrophon Aufstellung genommen hatten, bereit für Folge vierundzwanzig von Die Familie Alvear. Und tatsächlich, wie enttäuscht wären all die Hausfrauen gewesen, denen bei Luciano Pandos Stimme das Herz aufging, hätten sie seinen verwachsenen Körper und seine schielenden Blicke gesehen; wie enttäuscht all die Rentner, die bei Josefina Sánchez’ wohlklingendem Raunen in Erinnerungen schwelgten, hätten sie von ihrem Doppelkinn gewusst, ihrem Damenbart, ihren Segelohren und den Krampfadern. Aber die Ankunft des Fernsehens in Peru lag noch in weiter Ferne, und das diskrete Überleben der Hörspielfauna schien vorerst gesichert.
Schon immer hätte ich gerne gewusst, welche Schriftsteller all die Serien fabrizierten, die die Nachmittage meiner Großmutter begleiteten, diese Geschichten, mit denen man mir in den Ohren lag, wenn ich Tante Laura, Tante Olga, Tante Gaby oder meine vielen Cousinen besuchte (unsere Familie war von biblischer Zahl, altes Mirafloriner Blut, man hielt zusammen). Ich hatte schon den Verdacht, dass die Hörspiele Importe waren, aber dann erfuhr ich zu meiner Überraschung, dass die Genaros sie nicht aus Mexiko oder Argentinien bezogen, sondern aus Kuba. Produziert wurden die Serien von CMQ, einem regelrechten Radio- und Fernsehimperium, das Goar Mestre regierte, ein Herr mit meliertem Haar, den ich einmal, als er auf Durchreise in Lima war, auf den Fluren von Radio Panamericana gesehen hatte, eskortiert von den beflissenen Chefs und den ehrerbietigen Blicken aller Anwesenden. Ich hatte schon so viel über diesen kubanischen Sender gehört – für die Sprecher, Moderatoren und Techniker war er ein ebensolcher Mythos wie das damalige Hollywood für die Filmliebhaber –, dass Javier und ich einmal, als wir beim Kaffee im Bransa saßen, unserer Phantasie freien Lauf ließen und uns das Heer der Vielschreiber ausmalten, wie sie im fernen Havanna mit seinen Palmen, paradiesischen Stränden, Pistoleros und Touristen in der Zitadelle von Goar Mestre in klimatisierten Büros saßen und acht Stunden am Tag auf dahinsurrenden Schreibmaschinen diese Flut an Seitensprüngen, Selbstmorden, Leidenschaften produzierten, an Bekanntschaften und Erbschaften, Zufällen, Zuneigungen und Verbrechen, eine Flut, die sich von der Antilleninsel über ganz Lateinamerika ergoss, um, Klang geworden in den Stimmen der Luciano Pandos und Josefina Sánchez, die Nachmittage der Großmütter, Tanten, Cousinen und Rentner eines jeden Landes mit Träumen zu erfüllen.
Genaro junior kaufte (besser gesagt: CMQ verkaufte) die Hörspiele nach Gewicht und telegraphischer Order. Er selbst hatte es mir einmal erzählt, als ich ihn zu seinem Erstaunen fragte, ob er, seine Brüder oder sein Vater die Skripte absegneten, bevor sie über den Sender gingen. »Wärst du in der Lage, siebzig Kilo Papier zu lesen?«, meinte er nur und sah mich mit jener milden Nachsicht an, die er für Intellektuelle übrighatte, ein Status, den er meiner Person zugestanden hatte, als er eine Erzählung von mir in der Sonntagsbeilage von El Comercio entdeckte. »Was schätzt du, wie lange würde es dauern, einen Monat, zwei? Wer hat schon Monate Zeit, Hörspiele zu lesen? Das machen wir auf gut Glück, und gottlob hat uns der Herr der Wunder bisher beschützt.« Wenn es gut lief, fand Genaro junior über irgendeine Werbeagentur oder über Kollegen und Freunde heraus, wie viele Länder und mit welchen Hörerzahlen eine angebotene Serie gekauft hatten; wenn nicht, entschied er je nach Titel oder warf eine Münze. Nach Gewicht wurden die Serien gehandelt, weil es eine weniger betrugsanfällige Methode war als nach Seitenzahl oder Zahl der Wörter, letztlich war es die einzig überprüfbare. »Klar«, sagte Javier, »wenn keine Zeit ist, sie zu lesen, dann erst recht nicht, die ganzen Wörter zu zählen.« Er fand es reizvoll, sich einen Roman von achtundsechzig Kilo und dreißig Gramm vorzustellen, dessen Preis, wie der von Kühen, Butter oder Eiern, eine Waage bestimmte.
Dergleichen Verfahren bereitete den Genaros aber auch Scherereien. Die Texte strotzten von kubanischen Wörtern und Wendungen, die Luciano, Josefina und ihre Kollegen Minuten vor der Sendung eigenhändig und so gut sie konnten (immer schlecht) ins Heimatidiom übertrugen. Bisweilen kam hinzu, dass auf dem Weg von Havanna nach Lima, in den Bäuchen der Schiffe oder Flugzeuge oder auch beim Zoll, die vollgetippten Papierstöße beschädigt wurden und ganze Folgen verlorengingen, die Feuchtigkeit machte sie unlesbar, Seiten gerieten durcheinander, die Mäuse im Magazin von Radio Central fraßen sie auf. Da dies erst in letzter Minute, wenn Genaro senior die Skripte verteilte, auffiel, kam es zu beängstigenden Situationen. Sie wurden gemeistert, indem man die abhandengekommene Folge ohne Rücksicht auf Verluste übersprang oder, in diffizileren Fällen, Luciano Pando oder Josefina Sánchez für einen Tag aufs Krankenlager schickte, so dass vierundzwanzig Stunden Zeit blieb, die verschwundenen Gramme oder Kilos unter einem Flicken zu verbergen, wiederzubeleben oder ohne allzu traumatische Begleiterscheinungen zu streichen. Da CMQ noch dazu saftige Preise verlangte, war Genaro junior verständlicherweise hocherfreut, als er von der Existenz und den außerordentlichen Talenten Pedro Camachos erfuhr.
Ich erinnere mich noch genau an den Tag, als er mir von dem Rundfunkphänomen erzählte, denn an ebenjenem Tag, zur Mittagessenszeit, sah ich Tante Julia zum ersten Mal. Sie war die Schwester der Frau meines Onkels Lucho und am Abend zuvor aus Bolivien gekommen. Frisch geschieden, wollte sie ein wenig Ruhe finden und sich von ihrem Ehedebakel erholen. »Sich bloß einen neuen Mann angeln«, wie Tante Hortensia, das größte Lästermaul unter meinen Verwandten, bei einem Familientreffen befand. Donnerstags aß ich immer bei Onkel Lucho und Tante Olga zu Mittag, und an besagtem Tag war die Familie noch im Schlafanzug und verdaute bei pikanten Muscheln und einem kühlen Bier die feuchtfröhliche Nacht. Bis in den Morgen hatten sie mit dem Besuch gequatscht und getratscht und zu dritt eine Flasche Whisky geleert. Sie hatten einen Brummschädel, Onkel Lucho jammerte, in seinem Büro herrsche bestimmt das Chaos, Tante Olga meinte, es sei eine Schande, an einem Wochentag die Nacht durchzumachen, und die Angereiste, im Morgenrock, ohne Schuhe und mit Lockenwicklern im Haar, leerte einen Koffer. Es schien sie nicht zu stören, dass ich sie in einem Aufzug sah, in dem niemand sie für eine Schönheitskönigin gehalten hätte.
»Du bist also der Sohn von Dorita«, sagte sie und drückte mir einen Kuss auf die Wange. »Die Schule hast du aber schon hinter dir, oder?«
Wie ich sie hasste. Wenn ich mit der Familie immer mal wieder aneinandergeriet, dann weil alle meinten, sie müssten mich noch wie ein Kind behandeln und nicht wie das, was ich war, nämlich schon achtzehn und ein ganzer Mann. Nichts brachte mich so zur Weißglut wie dieses Marito; der Diminutiv, hatte ich das Gefühl, schickte mich zurück in die kurzen Hosen.
»Er studiert schon seit langem Jura und arbeitet als Journalist«, erklärte Onkel Lucho und hielt mir ein Glas Bier hin.
»Ehrlich gesagt«, konnte Tante Julia sich nicht verkneifen, »du siehst immer noch aus wie ein kleiner Junge, Marito.«
Während des Mittagessens fragte sie mich in diesem anschmiegenden Ton, den Erwachsene anschlagen, wenn sie mit Schwachsinnigen oder Kindern sprechen, ob ich eine Freundin hätte, ob ich auf Feten ginge, welchen Sport ich machte, und dann riet sie mir – mir war nicht klar, ob diese abartige Bemerkung Absicht war oder Naivität, jedenfalls traf sie mich ins Herz –, ich solle mir sobald wie möglich einen Schnurrbart wachsen lassen. Dunklen Typen stehe das, und bei den Mädchen würde es mir die Sache erleichtern.
»Der denkt nicht an Weib und Gesang«, erklärte Onkel Lucho. »Er ist ein Intellektueller. Er hat eine Erzählung in der Sonntagsbeilage von El Comercio veröffentlicht.«
»Nicht dass Doritas Junge uns noch andersrum wird«, lachte Tante Julia, und in einem Anfall von Solidarität musste ich an ihren Exmann denken. Aber ich lächelte und spielte das Spiel mit. Dann erzählte sie ein paar grauenvolle bolivianische Witze und zog mich weiter auf. Als ich mich verabschiedete, sah es so aus, als wollte sie sich für ihre spitze Zunge entschuldigen, denn sie sagte mir im liebenswürdigsten Ton, ich solle sie doch mal abends ins Kino begleiten, sie sei ganz verrückt aufs Kino.
Ich kam gerade noch rechtzeitig zu Radio Panamericana, um Pascual daran zu hindern, die gesamten Drei-Uhr-Nachrichten einer Keilerei zwischen Totengräbern und Leprakranken in den exotischen Straßen von Rawalpindi zu widmen, Ultima Hora hatte die Meldung gebracht. Nachdem ich auch die beiden nächsten Nachrichten aufbereitet hatte, ging ich einen Kaffee trinken. Am Eingang von Radio Central traf ich einen überschwänglichen Genaro junior. Er packte mich am Arm und schleppte mich ins Bransa: »Ich muss dir etwas Unglaubliches erzählen.« Er war ein paar Tage in La Paz gewesen, in Geschäften, und hatte ihn dort in Aktion erlebt, diesen vielfachen Menschen: Pedro Camacho.
»Nein, kein Mensch, eine Fabrik«, korrigierte er sich voller Bewunderung. »Er schreibt alle Theaterstücke, die in Bolivien aufgeführt werden, und spielt in allen mit. Und er schreibt alle Hörspiele und führt Regie und ist in allen der Liebhaber.«
Mehr noch als seine Produktivität und Vielseitigkeit hatte ihn jedoch seine Beliebtheit beeindruckt. Um ihn im Teatro Saavedra von La Paz sehen zu können, hatte er sich die Eintrittskarten auf dem Schwarzmarkt besorgen müssen, zum doppelten Preis.
»Wie beim Stierkampf, nicht zu fassen«, wunderte er sich immer noch. »Davon können die Theater in Lima nur träumen.«
Er erzählte, zwei Tage hintereinander habe er gesehen, wie die Frauen, ob jung oder alt, sich an den Ausgängen von Radio Illimani drängten und für ein Autogramm auf ihr Idol warteten. Die örtliche Filiale von McCann Erickson hatte ihm außerdem versichert, dass die Serien von Pedro Camacho die meisten Hörerzahlen aller bolivianischen Sender hätten. Genaro junior war, was man damals einen fortschrittlichen Unternehmer zu nennen begann: Das Geschäft interessierte ihn mehr als alle Ehrentitel, er war kein Mitglied des Club Nacional und auch nicht darauf aus, er befreundete sich mit aller Welt, und seine Dynamik war anstrengend. Als Mann der schnellen Entschlüsse überredete er Pedro Camacho nach seinem Besuch bei Radio Illimani, exklusiv für Radio Central nach Peru zu kommen.
»Das war ein Leichtes, die haben ihn dort kurzgehalten«, meinte er. »Er wird die Serien übernehmen, und die kubanischen Haie von CMQ jage ich zum Teufel.«
Ich versuchte ihm seine Freude ein wenig zu vergällen und sagte, wie ich soeben hätte feststellen dürfen, seien die Bolivianer fürchterliche Unsympathen. Pedro Camacho würde sich mit den Leuten von Radio Central nur in der Wolle liegen, sein Akzent würde den Hörern wie Kieselsteine in den Ohren klingen, und da er Peru nicht kenne, würde er von einem Fettnapf in den nächsten treten. Doch Genaro junior lächelte nur, meine defätistischen Prophezeiungen perlten an ihm ab. Pedro Camacho sei zwar noch nie hier gewesen, aber er habe ihm von der Seele Limas erzählt wie ein echter Bajopontino, und seine Aussprache sei vorzüglich, ohne überbetonte s und r, Kategorie Samt.
»Luciano Pando und die anderen Schauspieler werden ihn schon zusammenstauchen, unseren Ausländer«, träumte Javier. »Oder die schöne Josefina Sánchez vergewaltigt ihn.«
Wir saßen in der Dachbude und unterhielten uns, während ich, Adjektive und Adverbien austauschend, Meldungen aus El Comercio und La Prensa für El Panamericano in die Maschine tippte, das Nachrichtenmagazin um zwölf. Javier war mein bester Freund, und wir sahen uns jeden Tag, und sei es nur kurz, um uns zu vergewissern, dass es uns gab. Er war ein Mensch von wechselnden und widersprüchlichen, immer aber aufrichtigen Schwärmereien. Im Fachbereich Literaturwissenschaft an der Católica war er der Star gewesen, nie zuvor hatte man einen so fleißigen Studenten erlebt, nie einen so luziden Leser von Lyrik, nie einen so geistreichen Exegeten schwieriger Texte. Für alle stand außer Frage, dass er sein Studium mit einer brillanten Arbeit abschließen, ein brillanter Professor und ein ebenso brillanter Dichter oder Kritiker würde. Doch eines Tages hatte er, ohne ein Wort der Erklärung und zur allgemeinen Enttäuschung, die Abschlussarbeit hingeworfen, der Literatur und der Universidad Católica den Rücken gekehrt und sich an der San Marcos in Wirtschaftswissenschaften eingeschrieben. Als jemand ihn fragte, was der Grund für diesen Sinneswandel sei, gestand (oder scherzte) er, die Arbeit, an der er schreibe, habe ihm die Augen geöffnet. Ihr vorgesehener Titel war Die Parömien bei Ricardo Palma, und so hatte er, auf der Jagd nach Sprichwörtern, die Peruanischen Überlieferungen unter die Lupe genommen und es mit seiner Gewissenhaftigkeit und Akribie geschafft, einen ganzen Karteikasten mit gelehrten Kärtchen zu füllen. Eines Morgens dann verbrannte er die Kiste samt Kärtchen auf einem Feld -– wir beide vollführten einen Indianertanz um das philologische Feuer – und beschloss, fortan die Literatur zu hassen, selbst die Wirtschaftswissenschaften seien da noch besser. Sein Praktikum machte Javier bei der Zentralbank von Peru, wo er immer einen Vorwand fand, vormittags auf einen Sprung bei Radio Panamericana vorbeizukommen. Von seinem parömiologischen Albtraum war ihm die Angewohnheit geblieben, mich mit den wildesten Sprichwörtern zu traktieren.
Es wunderte mich sehr, dass Tante Julia, obwohl sie Bolivianerin war und in La Paz lebte, noch nie von Pedro Camacho gehört hatte. Aber sie erklärte mir, sie habe noch nie ein Hörspiel gehört und auch in kein Theater mehr einen Fuß gesetzt, seit sie im Tanz der Stunden als Morgenröte aufgetreten sei, in ihrem letzten Schuljahr bei den irischen Nonnen (»Frag mich bloß nicht, wie lange das her ist, Marito«). Wir waren auf dem Weg von Onkel Luchos Haus am Ende der Avenida Armendáriz zum Kino Barranco. Sie selbst hatte mir am Mittag die Einladung aufgedrängt, und das auf die hinterhältigste Art. Es war der Donnerstag nach ihrer Ankunft, und auch wenn mir die Aussicht, wieder bolivianischen Scherzen zum Opfer zu fallen, alles andere als behagte, wollte ich beim wöchentlichen Mittagessen nicht fehlen. Ich hatte die Hoffnung, sie nicht anzutreffen, da ich am Abend zuvor – mittwochs wurde Tante Gaby besucht – gehört hatte, wie Tante Hortensia in einem Tonfall, als kennte sie das Geheimnis der Götter, bekanntgab:
»In ihrer ersten Woche in Lima ist sie viermal ausgegangen, mit vier verschiedenen Verehrern, einer davon verheiratet. Die Geschiedene hat was vor!«
Als ich gleich nach dem Mittagsmagazin zu Onkel Lucho kam, war ausgerechnet einer ihrer Verehrer da. Kaum trat ich ins Wohnzimmer, verspürte ich die süße Lust der Rache, denn neben ihr, mit Erobererblick zu ihr hingewandt und von sprühender Lächerlichkeit in seinem altmodischen Anzug mit Fliege und Nelke im Knopfloch, saß Onkel Pancracio, ein leiblicher Cousin meiner Großmutter. Er war schon seit Ewigkeiten Witwer, hielt beim Gehen die Füße auf zehn nach zehn, und seine Besuche wurden in der Familie stets bissig kommentiert, da er es sich nicht nehmen ließ, vor aller Augen die Dienstmädchen zu kneifen. Er färbte sich die Haare, trug eine Taschenuhr mit Silberkettchen, und jeden Nachmittag Punkt sechs konnte man ihm begegnen, wie er an einer Ecke des Jirón de la Unión stand und der aus den Büros strömenden Damenwelt Komplimente nachrief. Als ich mich zu der Bolivianerin beugte, um ihr einen Begrüßungskuss zu geben, flüsterte ich ihr voll Schadenfreude ins Ohr: »Welch eine Eroberung, Julita.« Sie zwinkerte mir zu und nickte. Beim Essen dann, nachdem Onkel Pancracio erst einen Vortrag über Volksmusik gehalten hatte, für die er Experte war – bei Familienfesten legte er immer ein Solo auf dem Cajón hin –, wandte er sich an Tante Julia, und wie ein geleckter Kater schnurrte er: »Apropos, donnerstags abends trifft sich immer der Club Felipe Pinglo in La Victoria, dort schlägt das kreolische Herz. Hättest du nicht Lust, einmal richtige peruanische Musik zu hören?« Ohne eine Sekunde zu zögern und mit untröstlicher Miene, was der Verleumdung noch die Beleidigung aufsetzte, deutete Tante Julia auf mich und antwortete: »Ach, wie schade. Marito hat mich ins Kino eingeladen.« Onkel Pancracio zeigte Sportsgeist und verbeugte sich: »Der Jugend den Vortritt.« Als er gegangen war, dachte ich, ich wäre davongekommen, denn Tante Olga fragte: »Das mit dem Kino war nur, um den alten Lustmolch loszuwerden, oder?« Aber Tante Julia verwahrte sich: »Von wegen, meine Liebe, ich wünsche mir nichts sehnlicher, als diesen Film im Barranco zu sehen, er ist für junge Damen nicht empfohlen.« Dann wandte sie sich an mich, der ich hatte zuhören dürfen, wie sich mein abendliches Schicksal entschied, und zu meiner Beruhigung schickte sie noch eine erlesene Artigkeit hinterher: »Wegen des Geldes mach dir keine Sorgen, Marito. Ich lade dich ein.«
Und da liefen wir dann über die dunkle Quebrada de Armendáriz, die breite Avenida Grau, einem Film entgegen, der noch dazu ein mexikanischer war und Mutter und Geliebte hieß.
»Das Schlimmste für eine geschiedene Frau ist nicht, dass alle Männer glauben, sie seien verpflichtet, dir Sachen vorzuschlagen«, klärte Tante Julia mich auf. »Aber sie denken, weil du geschieden bist, ist alles Romantische überflüssig. Sie machen dir nicht den Hof, sagen dir keine galanten Worte, sie fallen einfach mit der Tür ins Haus, und das auf die plumpeste Weise. Die können mich mal. Ehe die mich zum Tanz auffordern, gehe ich lieber mit dir ins Kino.«
Ich bedankte mich für die Blumen.
»Die sind so dumm und halten jede geschiedene Frau für ein leichtes Mädchen«, fuhr sie fort und ignorierte meine Bemerkung. »Außerdem denken sie nur an das eine. Wobei das doch gar nicht das Schönste ist, sondern sich zu verlieben, etwa nicht?«
Ich erklärte ihr, die Liebe gebe es nicht, das sei eine Erfindung der provenzalischen Troubadoure und eines Italieners namens Petrarca. Was die Leute für das lautere Plätschern der Gefühle hielten, für reinsten Herzenserguss, sei nichts anderes als das triebgesteuerte Verhalten rolliger Katzen, verborgen hinter schönen Worten und den Mythen der Literatur. Ich glaubte selber nichts davon, aber ich wollte mich wichtigtun. Im Übrigen reagierte Tante Julia recht ungläubig auf meine erotisch-biologische Theorie – glaubte ich wirklich diesen Quatsch?
»Ich bin gegen die Ehe«, sagte ich und gab mich so altklug wie möglich. »Ich bin für das, was man freie Liebe nennt. Nur sollten wir es, wenn wir ehrlich sind, besser freies Kopulieren nennen.«
»Kopulieren meint das eine, ja?«, sagte sie und lachte. Aber sofort zog sie ein enttäuschtes Gesicht: »Zu meiner Zeit schrieben die jungen Männer noch Akrostichen, schickten den Mädchen Blumen, brauchten Wochen, bis sie sich trauten, ihnen einen Kuss zu geben. Was für ein läppisches Zeug die Liebe unter den jungen Leuten von heute geworden ist, Marito.«
An der Kasse gab es ein kleines Geplänkel zu der Frage, wer von uns den Eintritt zahlt, und nachdem wir anderthalb Stunden Dolores del Río ertragen hatten, wie sie stöhnte, umarmte, liebte, weinte und mit wehendem Haar durch den Urwald lief, gingen wir zurück zu Onkel Lucho, wieder zu Fuß und unter einem Nieselregen, der unsere Haare und Kleider durchnässte. Erneut kamen wir auf Pedro Camacho zu sprechen. War sie wirklich sicher, dass sie noch nie von ihm gehört hatte? Schließlich war er, hatte Genaro junior gesagt, in Bolivien eine Berühmtheit. Nein, sein Name sagte ihr nichts. Ich dachte, dann hatte man Genaro junior wohl einen Bären aufgebunden, oder die angebliche bolivianische Hörspielindustrie war bloß seine eigene Erfindung, um irgendeinen einheimischen Schreiberling werbewirksam zu vermarkten. Drei Tage später lernte ich Pedro Camacho leibhaftig kennen.
Ich war gerade mit Genaro senior aneinandergeraten, weil Pascual mit seinem überschießenden Hang zu Grausigkeiten die Elf-Uhr-Nachrichten komplett einem Erdbeben in Isfahan gewidmet hatte. Was den alten Genaro so erzürnte, war weniger, dass Pascual andere Meldungen aussortiert hatte, um in aller Ausführlichkeit zu berichten, wie die Perser, die den Einsturz ihrer Häuser überlebten, von Schlangen attackiert wurden, welche beim Zusammenbruch ihrer Nester mit wütendem Zischen an die Oberfläche schossen, sondern dass das Erdbeben schon vor Wochen stattgefunden hatte. Es ließ sich nicht bestreiten, dass Genaro senior recht hatte, und um mich abzureagieren, warf ich Pascual an den Kopf, er sei unzurechnungsfähig. Woher hatte er die ollen Kamellen? Aus einer argentinischen Zeitschrift. Und warum ausgerechnet etwas so Absurdes? Weil es keine aktuelle Meldung gab, die sich lohnte, und diese sei wenigstens amüsant. Als ich ihm erklärte, dass wir nicht fürs Amüsement der Hörer bezahlt würden, sondern für den Service, ihnen die Meldungen des Tages zusammenzufassen, kam Pascual mir, begütigend den Kopf wiegend, mit seinem unwiderleglichen Argument: »Wir haben nun mal unterschiedliche Auffassungen vom Journalismus, Don Mario.« Ich wollte ihm gerade sagen, dass wir, falls er es darauf anlegte und jedes Mal, kaum dass ich ihm den Rücken zukehrte, mit Schreckensnachrichten seine Auffassung vom Journalismus in die Tat umsetzte, alle beide bald auf der Straße stehen würden, als in der Tür unserer Dachbude eine unvermutete Gestalt erschien. Es war ein winziges Kerlchen, an der Grenze zwischen einem klein gewachsenen Mann und einem Zwerg, mit einer großen Nase und außergewöhnlich lebhaften Augen, in denen etwas Maßloses brodelte. Er trug Schwarz, einen recht verschlissen wirkenden Anzug, und Hemd und Fliege hatten Flecken, doch in der Art, wie er seine Kleidung trug, lag zugleich etwas Tadelloses und Gepflegtes, etwas Strenges auch, wie auf diesen alten Fotografien, auf denen die Herrschaften in ihren steifen Gehröcken und Angströhren festzustecken scheinen. Er mochte jeden Alters zwischen dreißig und fünfzig sein und trug sein öliges schwarzes Haar schulterlang. Seine Haltung, seine Bewegungen, seine Miene waren ein einziger Einspruch gegen alles Spontane und Natürliche, man musste sogleich an eine Gliederpuppe denken, an Marionettenfäden. Er machte einen Diener, und mit einer Feierlichkeit, die so ungewöhnlich war wie seine ganze Person, stellte er sich vor:
»Ich komme, Ihnen eine Schreibmaschine zu entwenden, meine Herren. Für Ihre Hilfe wäre ich Ihnen sehr verbunden. Welche der beiden können Sie empfehlen?«
Mit dem Zeigefinger deutete er abwechselnd auf meine Schreibmaschine und auf die von Pascual. Den Kontrast zwischen Stimme und Äußerem war ich von meinen Ausflügen zu den Studios von Radio Central zwar gewohnt, doch es verblüffte mich, wie aus einem Knirps von so hilfloser Erscheinung eine so feste und wohlklingende Stimme tönen konnte, eine so vollendete Ausdrucksweise. Es war, als paradierten in dieser Stimme nicht nur alle Buchstaben, ohne dass ein einziger Schaden litt, sondern auch die Teilchen und Atome eines jeden einzelnen, die Töne ihres Klangs. Ungeduldig und ohne Notiz zu nehmen von unserer Verwunderung über seinen Aufzug, seine Dreistigkeit und seine Stimme, hatte er sich gleich darangemacht, die beiden Schreibmaschinen zu begutachten und fast zu beschnuppern. Er entschied sich für meine altgediente, riesige Remington, eine richtige Leichenkutsche, der die Jahre nicht anzumerken waren. Pascual reagierte als Erster:
»Sind Sie ein Einbrecher oder was?«, fuhr er ihn an, und ich merkte, dass er die Scharte mit dem Erdbeben von Isfahan auswetzen wollte. »Glauben Sie, Sie können einfach so die Schreibmaschinen des Nachrichtendienstes mitnehmen?«
»Die Kunst ist wichtiger als dein Nachrichtendienst, du Kobold«, fauchte das Männlein und warf ihm einen Blick zu, wie man es zertretenem Ungeziefer hinterherschickt. Darauf setzte er die Aktion fort, und unter den verblüfften Augen Pascuals, der sich ohne Zweifel (genau wie ich) fragte, was er mit Kobold meinte, versuchte der Besucher, die Remington anzuheben. Er schaffte es, das Trumm in die Arme zu nehmen, was ihn eine solche Anstrengung kostete, dass die Halsadern anschwollen und die Augen fast aus den Höhlen sprangen. Sein Gesicht lief granatrot an, auf seiner schmalen Stirn stand der Schweiß, aber er ließ nicht ab. Mit zusammengebissenen Zähnen schwankte er ein paar Schritte auf die Tür zu und musste sich geschlagen geben – noch eine Sekunde, und die Fracht hätte ihn zu Boden gerissen. Er setzte die Remington auf Pascuals Tischchen ab und schnaufte. Doch kaum war er wieder bei Atem, hatte er uns, ohne etwas auf das Grinsen zu geben, das dieses Schauspiel uns entlockte (Pascual tippte sich ein ums andere Mal an die Stirn, da war uns wohl ein Verrückter untergekommen), schon scharf gerügt:
»Stehen Sie nicht untätig herum, meine Herren, ein wenig menschliche Solidarität. Fassen Sie mit an.«
Ich sagte, so leid es mir tue, aber wenn er die Remington mitnehmen wolle, dann nur über Pascuals Leiche und zur Not auch über meine. Der Knirps rückte sich die Fliege zurecht, die bei dem Einsatz leicht verrutscht war, und zu meiner Überraschung erwiderte er, ernst nickend, mit verdrießlicher Miene und deutlichen Anzeichen, dass Humor ihm völlig fremd war:
»Ein Mann aus gutem Hause wird eine Herausforderung zum Kampf nicht zurückweisen. Ort und Uhrzeit, meine Herren.«
Wie vom Himmel gesandt, tauchte Genaro junior in unserer Bude auf und vereitelte, was eine Aufforderung zum Duell zu sein schien. Er kam genau in dem Moment herein, als das zähe Männlein erneut und mit violett anlaufendem Gesicht versuchte, die Remington in die Arme zu nehmen.
»Lassen Sie, Pedro, ich helfe Ihnen«, sagte er und schnappte sich die Schreibmaschine, als wäre sie eine Streichholzschachtel. Als er mir und Pascual ansah, dass er uns eine Erklärung schuldete, tröstete er uns fröhlich flötend: »Es ist niemand gestorben, kein Grund, traurig zu sein. Sie bekommen von meinem Vater bald eine neue.«
»Wir sind hier das fünfte Rad am Wagen«, protestierte ich, um der Form Genüge zu tun. »Wir dürfen in dieser schäbigen Bude hocken, einen Schreibtisch hat man mir schon weggenommen und dem Buchhalter gegeben, und jetzt auch noch die Remington. Noch dazu ohne jede Vorankündigung.«
»Wir dachten, der Herr wäre ein Einbrecher«, sprang Pascual mir bei. »Kommt einfach herein, beleidigt uns und spielt sich auf.«
»Unter Kollegen streitet man doch nicht«, sagte Genaro junior salomonisch. Er hatte sich die Remington auf die Schulter gepackt, und ich sah, dass das Männlein ihm genau bis zum Revers ging. »Hat mein Vater Sie noch nicht einander vorgestellt? Dann tue ich es, und alle sind glücklich.«
Sogleich streckte der Knirps mit einer raschen, automatischen Bewegung eins seiner Ärmchen aus, ging ein paar Schritte auf mich zu, reichte mir sein Patschhändchen und stellte sich mit wundervoller Tenorstimme und erneutem Kratzfuß vor:
»Ein Freund: Pedro Camacho aus Bolivien, Künstler.«
Er wiederholte die Geste, die Verbeugung und die Worte gegenüber Pascual, der offensichtlich einen Moment tiefster Verstörung durchlebte und nicht zu entscheiden vermochte, ob dieser Mensch sich über uns lustig machte oder einfach so war. Nachdem er uns feierlich die Hand geschüttelt hatte, wandte Pedro Camacho sich an den Nachrichtendienst en bloc, und in der Mitte der Bude stehend, im Schatten von Genaro junior, der sich hinter ihm wie ein Riese ausnahm und ihn sehr ernst beobachtete, zog er die Oberlippe hoch und runzelte das ganze Gesicht, eine Bewegung, die ein paar gelbe Zähne bloßlegte – eine Karikatur oder das Phantom eines Lächelns. Er wartete ein paar Sekunden ab, bevor er uns, begleitet von der Abschiedsgebärde eines Gauklers, folgende wohltönende Worte schenkte:
»Ich trage es Ihnen nicht nach, das Unverständnis der Menschen bin ich gewohnt. Gehaben Sie sich wohl, meine Herren!«
Er verschwand durch die Tür, hüpfend wie ein Wichtelmännchen, um den fortschrittlichen Unternehmer einzuholen, der, die Remington auf der Schulter, mit ausgreifenden Schritten zum Aufzug strebte.
II
Es war einer dieser sonnigen Frühlingsmorgen in Lima, wenn die Geranien den Tag glühender, die Rosen duftender und die Bougainvilleen fülliger begrüßen, als ein berühmter Arzt der Stadt, Dr. Alberto de Quinteros – breite Stirn, Adlernase, durchdringender Blick, von aufrechtem Sinn und gütigem Wesen –, in seiner geräumigen Villa in San Isidro die Augen aufschlug und sich rekelte. Durch die Gardinen sah er, wie die Sonne den Rasen des gepflegten, von Wundersträuchern umfriedeten Gartens vergoldete, sah die Makellosigkeit des Himmels, die Fröhlichkeit der Blumen, und er spürte jenes Wohlgefühl, das acht Stunden erholsamen Schlafs und ein ruhiges Gewissen schenken.
Es war Samstag, und wenn es bei der Frau mit den Drillingen nicht im letzten Moment zu Komplikationen kam, musste er nicht in die Klinik und konnte sich am Vormittag noch ein wenig bewegen und in die Sauna gehen, bevor die Trauung von Elianita begann. Seine Frau und seine Tochter waren in Europa, wo sie sich der Pflege ihres Geistes und der Erneuerung ihrer Garderobe hingaben, erst in einem Monat würden sie zurückkehren. Jeder andere, zumal bei seinem Vermögen und seinem Aussehen – sein schlohweißes Schläfenhaar, sein distinguiertes Auftreten und die Eleganz seiner Umgangsformen weckten begehrliche Blicke selbst bei den unbestechlichsten Damen –, jeder andere hätte den vorübergehenden Junggesellenstand ausgenutzt und sich eine vergnügte Zeit gemacht. Aber Alberto de Quinteros war ein Mann, den weder das Spiel noch die Frauen oder der Alkohol über Gebühr lockten, und unter seinen Bekannten – deren Zahl Legion war – kursierte folgender Spruch: »Ein Mann, drei Laster: Wissenschaft, Familie und Fitness.«
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!