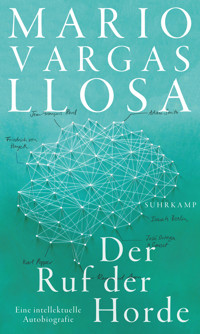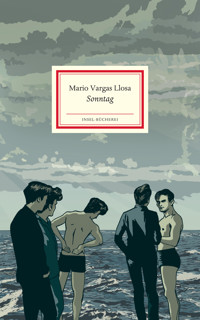11,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 11,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 11,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Suhrkamp
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Mario Vargas Llosa erzählt die Geschichte einer Obsession, einer leidenschaftlichen Beziehung, in der Glück und Unglück untrennbar miteinander verbunden sind.
Wie gelingt es ihr nur immer wieder, ihn um den Finger zu wickeln? Und warum tut sie das, wenn sie seine ehrlichen Gefühle doch zugleich schroff zurückweist? Schon als aufmüpfige Halbwüchsige verdreht sie dem jungen Ricardo im konservativen Lima der 50er Jahre den Kopf. Von da an wird sie regelmäßig seine Wege kreuzen, wird in Paris, London, Madrid oder Tokio mal als Guerrillera, mal als Heiratsschwindlerin mit falschem Paß in sein Leben treten – und es immer wieder durcheinanderwirbeln. Auf rätselhafte Weise scheinen beide dennoch füreinander bestimmt; oder ist nur er es, der nicht lassen kann von diesem faszinierend »bösen Mädchen«?
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 593
Veröffentlichungsjahr: 2012
Ähnliche
Immer wieder tritt sie unerwartet in sein Leben und wirbelt es durcheinander. Aber sobald Ricardo »das böse Mädchen« zu fassen geglaubt hat, ist es schon wieder verschwunden. Auf rätselhafte Weise scheinen sie füreinander bestimmt; oder ist nur er es, der nicht von ihr lassen kann? Mario Vargas Llosa erzählt die Geschichte einer erotischen Obsession, einer leidenschaftlichen Beziehung, in der Glück und Unglück untrennbar miteinander verbunden sind.
Mario Vargas Llosa, geboren 1936 in Arequipa/Peru, lebt heute in Madrid und Lima. Neben zahlreichen anderen Auszeichnungen erhielt er 1996 den Friedenspreis des Deutschen Buchhandels und 2010 den Nobelpreis für Literatur. Sein schriftstellerisches Werk erscheint auf deutsch im Suhrkamp Verlag.
MARIO VARGAS LLOSA
Das böse Mädchen
Roman
~
Aus dem Spanischenvon Elke Wehr
Suhrkamp
Die Originalausgabe erschien 2006 unter dem Titel
Travesuras de la niña mala
bei Alfaguara, Madrid.
© Mario Vargas Llosa, 2006
Umschlagfoto: Howard Schatz.
Aus: Passion & Line c/o Marion Enste-Jaspers
eBook Suhrkamp Verlag Berlin 2012
© der deutschen Ausgabe Suhrkamp Verlag Frankfurt am Main 2006
Alle Rechte vorbehalten, insbesondere das des öffentlichen Vortrags sowie der Übertragung durch Rundfunk und Fernsehen, auch einzelner Teile. Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form (durch Fotografie, Mikrofilm oder andere Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung des Verlages reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.
Umschlag: Göllner, Michels, Zegarzewski
eISBN 978-3-518-73565-7
www.suhrkamp.de
Inhalt
IDie kleinen Chileninnen
IIDer Guerrillero
IIIPferdemaler im swinging London
IVDer Dragoman von Château Meguru
VDas Kind ohne Stimme
VIArquímedes, Erbauer von Wellenbrechern
VIIMarcella in Lavapiés
Für X,
zur Erinnerung an die heroischen Zeiten
IDie kleinen Chileninnen
Was für ein grandioser Sommer! Pérez Prado kam mit seinem Zwölf-Mann-Orchester und animierte die Faschingsbälle im Terrazas-Klub in Miraflores und im Lawn-Tennis-Klub von Lima, in der Stierkampfarena wurde ein landesweiter Mambo-Wettbewerb veranstaltet, der trotz der Drohung des Erzbischofs von Lima, Kardinal Juan Gualberto Guevara, sämtliche teilnehmenden Paare zu exkommunizieren, ein großer Erfolg wurde, und meine Clique, das Fröhliche Viertel der Straßen Diego Ferré, Juan Fanning und Colón in Miraflores, trug mit ihrem Gegenpart aus der Calle San Martín olympische Wettkämpfe in Straßenfußball, Radrennen, Leichtathletik und Schwimmen aus, die wir natürlich gewannen.
In jenem Sommer 1950 geschahen außergewöhnliche Dinge. Hinkefuß Lañas erklärte sich zum ersten Mal einem Mädchen – der rothaarigen Seminauel –, und diese sagte zum Erstaunen von ganz Miraflores ja. Hinkefuß vergaß sein Hinken und ging fortan wie ein Charles Atlas mit stolz geschwellter Brust durch die Straßen. Tico Tiravante brach mit Ilse und erklärte sich Laurita, Víctor Ojeda erklärte sich Ilse und brach mit Inge, Juan Barreto erklärte sich Inge und brach mit Ilse. Es kam zu einer so großen Umschichtung der Gefühle im Viertel, daß wir wie benommen waren, Liebesbande lösten sich auf und wurden neu geknüpft, und wenn die Samstagsfeten zu Ende waren, fanden sich nicht immer dieselben Paare zusammen, die gekommen waren. »Was für lockere Sitten!« empörte sich meine Tante Alberta, bei der ich seit dem Tod meiner Eltern lebte.
Am Badestrand von Miraflores brachen sich die Wellen zweimal, das erste Mal in der Ferne, zweihundert Meter vom Ufer entfernt, und bis dorthin schwammen wir Mutigen hinaus, um sie zu reiten, und ließen uns an die hundert Meter mitreißen, bis an die Stelle, wo die Wellen ausliefen, nur um sich erneut zu prächtigen Bergen aufzutürmen und sich abermals zu brechen, in einem zweiten Überschlag, der uns Wellenreiter bis zu den Kieseln des Strandes trug.
In jenem außergewöhnlichen Sommer wurden auf den Feten keine Walzer, Corridos, Blues, Boleros und Huarachas mehr getanzt, denn der Mambo fegte sie alle hinweg. Der Mambo, eine Lawine, die sämtliche Paare erfaßte und alle, egal ob Kinder, Jugendliche oder Erwachsene, dazu brachte, auf den Parties im Viertel die Hüften zu schwingen, zu hüpfen, zu springen und wilde Figuren zu tanzen. Und sicher geschah das auch außerhalb von Miraflores, was soviel hieß wie jenseits der Welt und des Lebens überhaupt, in Lince, Breña, Chorrillos oder in noch exotischeren Vierteln wie La Victoria, dem Zentrum von Lima, Rímac und El Porvenir, die wir, die Bewohner von Miraflores, niemals betreten hatten oder jemals betreten zu müssen glaubten.
Und so wie wir von den Walzern und den Huarachas, den Sambas und den Polkas zum Mambo übergegangen waren, gingen wir auch von den Rollschuhen und Rollern zum Fahrrad über und manche, Tato Monje und Tony Espejo zum Beispiel, zum Motorrad und einer oder zwei sogar zum Auto, wie Luchín, die Bohnenstange der Clique, der seinem Vater zuweilen das Chevrolet-Kabriolett stibitzte und mit uns eine Runde über die Uferstraßen drehte, vom Terrazas-Klub bis zur Quebrada de Armendáriz, mit hundert Sachen in der Stunde.
Doch das bemerkenswerteste Ereignis jenes Sommers war die Ankunft zweier Schwestern, die aus Chile, ihrer fernen Heimat, nach Miraflores gekommen waren und mit ihrer aufsehenerregenden Erscheinung und unverwechselbaren, schnellen Redeweise, bei der sie die Endsilben der Wörter verschluckten und die Sätze mit einem gehauchten Ausruf beendeten, der wie »pff« klang, uns Jungen aus Miraflores, die wir gerade die kurzen gegen die langen Hosen eingetauscht hatten, gehörig den Kopf verdrehten. Und mir am allermeisten.
Die jüngere schien die ältere zu sein und umgekehrt. Die ältere hieß Lily und war etwas kleiner als Lucy, der sie ein Jahr voraus war. Lily mochte vierzehn oder höchstens fünfzehn sein und Lucy dreizehn oder vierzehn. Das Adjektiv »aufsehenerregend« schien wie gemacht für sie beide, aber Lucy, auf die es durchaus zutraf, war es weniger als ihre Schwester, nicht nur, weil ihr Haar weniger blond und kürzer war und sie sich weniger gewagt anzog als Lily, sondern auch, weil sie schweigsamer war und beim Tanzen, obwohl sie ebenfalls Figuren konnte und einen kühnen Hüftschwung hatte, wie ihn kein Mädchen aus Miraflores wagte, fast gehemmt und unscheinbar wirkte im Vergleich zu diesem Kreisel, dieser flackernden Flamme, diesem Irrlicht, in das Lily sich verwandelte, wenn mit dem Aufsetzen der Nadel auf dem Plattenteller der Mambo explodierte und wir zu tanzen begannen.
Lily tanzte sinnlich, rhythmisch und mit großer Anmut, dabei lächelte sie und trällerte den Text des Liedes mit, reckte die Arme hoch, entblößte die Knie und bewegte Hüften und Schultern in einer Weise, als würde ihr kleiner, von Rock und Bluse so durchtrieben kurvenreich modellierter Körper unter Hochspannung stehen, vibrieren und von den Füßen bis in die Haarspitzen am Tanz beteiligt sein. Wer Mambo mit ihr tanzte, dem erging es immer schlecht, denn wie konnte man ihr folgen, ohne sich im teuflischen Wirbel dieser hüpfenden Beine und Füße zu verfangen? Unmöglich! Man hinkte von Anfang an hinterher und wußte dabei genau, daß die Augen sämtlicher Paare auf Lilys Mambo-Künste gerichtet waren. »Dieses Mädchen!« wetterte meine Tante Alberta, »sie tanzt wie eine Tongolele, wie eine Rumbatänzerin in einem mexikanischen Film. Na ja, wir dürfen nicht vergessen, daß sie Chilenin ist«, antwortete sie sich selbst, »Tugend ist nicht gerade die Stärke der Frauen dieses Landes.«
Ich verliebte mich wie ein Mondkalb in Lily, was die romantischste Form des Verliebtseins ist – man sagte auch: sich total verknallen –, und erklärte mich ihr dreimal in jenem unvergeßlichen Sommer. Das erste Mal auf dem oberen Rang im Ricardo Palma, dem Kino, das sich im Parque Central in Miraflores befand, bei der sonntäglichen Nachmittagsvorstellung, und sie gab mir einen Korb, sie sei noch zu jung, um einen Freund zu haben. Das zweite Mal auf der Rollschuhbahn, die in ebenjenem Sommer am Fuß des Parque Salazar eröffnet wurde, und sie gab mir einen Korb, sie müsse es sich überlegen, gefallen würde ich ihr schon ein bißchen, aber ihre Eltern hätten sie gebeten, vor dem Abschluß der vierten Klasse keinen Freund zu haben, und sie sei erst in der dritten. Und das letzte Mal wenige Tage vor dem großen Schlamassel, im Cream Rica in der Avenida Larco, während wir einen Vanille-Milchshake tranken, und natürlich sagte sie wieder nein, warum sollte sie ja sagen, wenn wir so, wie die Dinge lagen, längst wie ein Liebespaar wirkten. Taten sie uns bei Marta nicht immer als Paar zusammen, wenn wir das Wahrheitsspiel spielten? Saßen wir nicht am Strand von Miraflores nebeneinander? Tanzte sie mit mir nicht mehr als mit jedem anderen auf den Feten? Warum sollte sie mir also formell ja sagen, wenn ganz Miraflores uns schon für ein Pärchen hielt? Mit ihrer Mannequin-Figur, ihren dunklen, schalkhaften Augen und ihrem kleinen Mund mit den vollen Lippen war Lily die Frau gewordene Koketterie.
»Mir gefällt alles an dir«, sagte ich zu ihr. »Am meisten aber die Art, wie du redest.« Sie war witzig und originell, was an der Betonung und der Melodie lag, die so ganz anders waren als im Peruanischen, auch an gewissen Ausdrücken, kleinen Wörtern und Wendungen, die uns Jungen in der Clique im dunkeln tappen ließen, so daß wir raten mußten, was sie bedeuteten und ob sich irgendein Spott in ihnen verbarg. Lily sagte ständig doppeldeutige Dinge, gab Rätsel auf oder erzählte so pikante Witze, daß die Mädchen der Clique puterrot wurden. »Diese kleinen Chileninnen sind schrecklich«, befand meine Tante Alberta, voll Sorge, diese beiden Fremden könnten die Moral von Miraflores untergraben.
Es gab noch keine Hochhäuser im Miraflores der beginnenden fünfziger Jahre, es war ein Viertel mit kleinen, ein- oder höchstens zweigeschossigen Häusern, in deren Gärten nie die Geranien fehlten, dazu Poinsettien, Lorbeer, Bougainvilleen, Rasenflächen und ebenerdige Terrassen, von denen sich Geißblatt oder Efeu hochrankten, mit Schaukelstühlen, in denen die Bewohner, umgeben vom Duft nach Jasmin, plaudernd die Nacht erwarteten. In einigen Parks wuchsen dornige Kapokbäume mit roten und rosafarbenen Blüten, auf den geraden, sauberen Bürgersteigen standen kleine Magnolien, Jakaranda- und Maulbeerbäume, und die farbige Note lieferten, neben den Gartenblumen, die gelben Wägelchen der D’Onofrio-Eisverkäufer, die einheitliche weiße Kittel und schwarze Mützen trugen, Tag und Nacht umherzogen und ihr Kommen durch eine Hupe ankündigten, die sich mit ihrem langsamen Aufheulen wie ein barbarisches Horn ausnahm, das an Urzeiten denken ließ. Man hörte noch die Vögel singen in diesem Miraflores, wo die Familien die Pinien fällten, wenn die Mädchen ins heiratsfähige Alter kamen, denn wenn sie es nicht taten, dann würden die Armen alte Jungfern werden wie meine Tante Alberta.
Lily sagte mir niemals ja, aber es stimmte, daß wir, von dieser Formalität abgesehen, in allem übrigen wie ein Liebespaar waren. Wir hielten Händchen bei den Nachmittagsvorstellungen im Ricardo Palma, im Leuro, im Montecarlo und im Colina, und wenn man auch nicht behaupten konnte, daß wir im Dunkel der Ränge fummelten wie andere, ältere Paare – fummeln war etwas, das von harmlosen Küßchen bis zu tiefen Zungenküssen und unzüchtigen Berührungen reichte, die man am ersten Freitag des Monats dem Pfarrer als Todsünde beichten mußte –, so ließ Lily doch zu, daß ich sie auf die Wangen, auf den Rand der kleinen Ohren, auf die Mundwinkel küßte, und bisweilen vereinte sie eine Sekunde lang ihre Lippen mit den meinen, um sie sofort mit einer melodramatischen Grimasse zu lösen: »Nein, nein, das auf keinen Fall, Dürrer.« »Du bist ein Mondkalb, Dürrer, dich hat’s erwischt, Dürrer, du schmilzt ja dahin vor Liebe, Dürrer«, spotteten meine Freunde aus dem Viertel, die mich nie bei meinem Namen – Ricardo Somocurcio –, sondern immer nur bei meinem Spitznamen nannten. Sie übertrieben nicht im geringsten: Ich war total verknallt in Lily.
Um ihretwillen prügelte ich mich in jenem Sommer mit Luquen, einem meiner besten Freunde. Bei einem Treffen zwischen den Mädchen und Jungen der Clique, an der Ecke Colón und Diego Ferré, im Garten der Familie Chacaltana, spielte Luquen sich auf und behauptete plötzlich, die kleinen Chileninnen seien ordinäre Aufsteigerinnen und keine echten Blondinen, sondern gebleichte, und man habe in Miraflores begonnen, sie hinter meinem Rücken »Die Kakerlaken« zu nennen. Ich verpaßte ihm einen Kinnhaken, dem er knapp auswich, und dann gingen wir bis zur Uferstraße La Reserva, an der Steilküste, um dort unseren Streit mit Fausthieben auszutragen. Eine ganze Woche lang redeten wir kein Wort miteinander, bis die Mädchen und Jungen der Clique uns auf der nächsten Fete miteinander versöhnten.
Lily ging an den Nachmittagen gern in den dicht mit Palmen, Stechapfelbäumen und Glockenmalven bewachsenen Winkel des Parque Salazar, wo wir uns auf die niedrige Mauer aus roten Ziegelsteinen setzten, vor uns die ganze Bucht von Lima, wie ein Schiffskapitän, der von der Kommandobrücke aus das Meer betrachtet. Wenn der Himmel klar war, und ich würde schwören, daß der Himmel in jenem Sommer immer wolkenlos war und die Sonne über Miraflores schien, ohne uns einen einzigen Tag im Stich zu lassen, sah man in der Ferne, an den Grenzen des Ozeans, die rote, flammende Scheibe, die sich mit ihren Strahlen und einem letzten Aufblitzen verabschiedete, während sie in den Wassern des Pazifiks versank. Lilys Gesicht hatte den gleichen konzentrierten, inbrünstigen Ausdruck, mit dem sie bei der Zwölf-Uhr-Messe in der Pfarrkirche am Parque Central die heilige Kommunion empfing, den Blick fest auf die Feuerkugel gerichtet, während sie auf den Augenblick wartete, in dem das Meer den letzten schwachen Strahl verschluckte, um dann den Wunsch zu formulieren, den das Gestirn oder Gott erfüllen würde. Auch ich wünschte mir etwas, obwohl ich nur halb glaubte, daß es in Erfüllung gehen könnte. Und es war immer das gleiche, natürlich: daß sie endlich ja sagen würde, daß wir ein richtiges Paar wären, daß wir fummeln, uns lieben, uns verloben und heiraten und am Ende reich und glücklich in Paris leben würden.
Soweit ich zurückdenken konnte, träumte ich davon, in Paris zu leben. Schuld daran war wahrscheinlich mein Vater, waren die Bücher von Paul Féval, Jules Verne, Alexandre Dumas und vielen anderen, die er mir zu lesen gab, bevor er bei dem Unfall ums Leben kam, der mich zur Waise machte. Diese Romane füllten meinen Kopf mit Abenteuern und überzeugten mich davon, daß das Leben in Frankreich reicher, heiterer, schöner und überhaupt in allem besser war als irgendwo sonst. Deshalb brachte ich meine Tante Alberta dazu, mich zusätzlich zu meinem Englischunterricht am Peruanisch-Nordamerikanischen Institut an der Alliance Française in der Avenida Wilson einzuschreiben, wohin ich dreimal in der Woche ging, um die Sprache der Franzmänner zu lernen. Obwohl ich mir gern mit meinen Kumpels von der Clique die Zeit vertrieb, war ich ziemlich fleißig, erhielt gute Noten, und die Sprachen machten mir Spaß.
Wenn das Taschengeld es mir erlaubte, lud ich Lily zum Tee – es war noch nicht Mode geworden, tomar lonche zu diesem Ritual zu sagen – in La Tiendecita Blanca ein, das Café mit der schneeweißen Fassade, den kleinen Tischen, den Markisen über dem Bürgersteig und Herrlichkeiten wie aus Tausendundeinernacht – Biskuits, Gewürzkuchen mit Milchkonfitüre, Cremegebäck! – am Ende der Avenida Larco, der Avenida Arequipa und der Alameda Ricardo Palma, der Allee, der die Kronen der hohen Gummibäume Schatten spendeten.
Mit Lily in La Tiendecita Blanca zu gehen und ein Eis und ein Stück Torte zu essen war ein Glück, das leider fast immer durch die Anwesenheit ihrer Schwester Lucy getrübt wurde, die ich ebenfalls am Hals hatte, wenn wir ausgingen. Sie spielte unverdrossen die Anstandsdame, verdarb mir das Rendezvous und hinderte mich daran, allein mit Lily zu sprechen und ihr all die hübschen Dinge zu sagen, die ich ihr gerne ins Ohr geflüstert hätte. Aber obwohl wir bei unserem Gespräch Lucys wegen gewisse Themen vermeiden mußten, war es unbezahlbar, mit Lily zusammenzusein, zu sehen, wie ihre kleine Mähne mitschwang, wenn sie den Kopf bewegte, wie der Schalk in ihren Augen von der Farbe dunklen Honigs blitzte, ihre so andere Redeweise zu hören und ab und zu im Ausschnitt ihrer enganliegenden Bluse einen Blick auf den Ansatz der kleinen Brüste zu erhaschen, die sich schon formten, rund und mit zarten Knospen.
»Ich weiß nicht, was ich hier bei euch verloren habe, als Anstandsdame«, entschuldigte Lucy sich zuweilen. Ich belog sie: »Wie kommst du denn darauf, wir freuen uns doch über deine Gesellschaft, nicht wahr, Lily?« Lily lachte und gab den für sie so typischen Laut von sich, während ihre Pupillen spöttisch funkelten: »Klar, pfff ...«
Ein Spaziergang über die Avenida Pardo, unter den von Singvögeln besetzten Gummibäumen, zwischen den niedrigen Häusern auf beiden Seiten, in deren Gärten kleine Jungen und Mädchen über den Rasen und die Terrassen tollten, überwacht von Kindermädchen in weißen, gestärkten Uniformen, war ebenfalls ein Ritual in jenem Sommer. Da es aufgrund von Lucys Anwesenheit schwierig war, mit Lily über das zu sprechen, worüber ich gern gesprochen hätte, lenkte ich das Gespräch auf harmlose Themen: auf meine Pläne für die Zukunft zum Beispiel, wenn ich nach meinem Abschluß als Anwalt in diplomatischem Auftrag nach Paris gehen würde – denn in Paris fand das richtige Leben statt, Frankreich war das Land der Kultur – oder mich vielleicht der Politik widmen würde, um diesem armen Peru ein wenig zu helfen, wieder groß und wohlhabend zu werden, weshalb ich die Reise nach Europa etwas verschieben müßte. Und sie, was würden sie gerne machen, wenn sie erwachsen wären? Lucy, die vernünftig war, hatte sehr genaue Ziele: »Als erstes die Schule abschließen. Dann eine gute Anstellung bekommen, vielleicht in einem Plattenladen, das macht bestimmt Spaß.« Und Lily dachte an ein Reisebüro oder an eine Fluggesellschaft, sah sich als Stewardeß, wenn sie ihre Eltern davon überzeugen konnte, auf diese Weise würde sie kostenlos durch die ganze Welt reisen. Oder vielleicht als Filmschauspielerin, aber sie würde sich nie im Bikini filmen lassen. Reisen, reisen, alle Länder kennenlernen, das würde ihr am meisten gefallen. »Na ja, du kennst schon mindestens zwei, Chile und Peru, was willst du mehr«, sagte ich zu ihr. »Vergleich dich mit mir, ich bin nie aus Miraflores rausgekommen.«
Alles, was Lily über Santiago erzählte, war für mich wie ein Vorgeschmack auf das Pariser Paradies. Mit welchem Neid ich ihr zuhörte! Dort gab es im Unterschied zu hier keine Armen und keine Bettler auf den Straßen, die Eltern ließen die Jungen und Mädchen ihre Feten bis zum frühen Morgen feiern, cheek to cheek tanzen, und nie sah man, wie hier, die Alten, die Mütter, die Tanten den jungen Leuten beim Tanzen hinterherspionieren und sie zur Ordnung rufen, wenn sie zu weit gingen. In Chile durften die Jungen und Mädchen in Filme für Erwachsene gehen und nach ihrem fünfzehnten Geburtstag rauchen, ohne sich zu verstecken. Dort war das Leben lustiger als in Lima, denn es gab mehr Kinos, Zirkusvorstellungen, Theater, Veranstaltungen und Bälle mit Orchester, und ständig traten Eislauf- und Ballettkompanien und Musikgruppen aus den Vereinigten Staaten auf, und die Chilenen verdienten mit egal welcher Arbeit das Doppelte oder Dreifache wie die Peruaner.
Wenn es aber so war, warum hatten dann die Eltern der kleinen Chileninnen dieses herrliche Land verlassen und waren nach Peru gekommen? Weil sie nicht reich waren, sondern, wie man mit bloßem Auge erkennen konnte, ziemlich arm. Vor allem lebten sie nicht wie wir, die Mädchen und Jungen aus dem Fröhlichen Viertel, in Einfamilienhäusern mit Hausdienern, Köchinnen, Dienstmädchen und Gärtnern, sondern in einer kleinen Wohnung in einem schmalen, dreistöckigen Gebäude in der Calle La Esperanza, auf der Höhe des Restaurants Gambrinus. Und im Unterschied zu späteren Zeiten, als die Mietshäuser in die Höhe zu wachsen begannen und die kleinen Villen verschwanden, wohnten im Miraflores jener Jahre nur arme Schlucker zur Miete, jene mindere menschliche Spezies, zu der – leider, leider – die kleinen Chileninnen zu gehören schienen.
Nie bekam ich ihre Eltern zu Gesicht. Weder ich noch sonst ein Mädchen oder ein Junge der Clique durfte sie je zu Hause besuchen. Nie feierten sie einen Geburtstag oder gaben eine Fete oder luden uns zum Tee ein und zu Spielen, als wäre es eine Schande für sie, wenn wir sehen würden, wie bescheiden sie lebten. Daß sie arm waren und sich für alles schämten, was sie nicht besaßen, weckte mein Mitgefühl, verstärkte meine Liebe zu der kleinen Chilenin und gab mir edelmütige Vorsätze ein: ›Wenn Lily und ich heiraten, werden wir ihre ganze Familie zu uns holen.‹
Doch meine Freunde und vor allem meine Freundinnen aus Miraflores machte es mißtrauisch, daß Lucy und Lily uns nicht die Tür ihres Zuhauses öffneten. »Sind sie denn solche Hungerleider, daß sie nicht mal eine Fete machen können?« fragten sie. »Vielleicht sind sie nicht arm, sondern knausrig«, versuchte Tico Tiravante zu beschwichtigen, womit er es nur noch schlimmer machte.
Plötzlich begann man in der Clique darüber herzuziehen, wie die kleinen Chileninnen geschminkt und angezogen waren, sich über die wenigen Kleidungsstücke zu mokieren, die sie besaßen – alle kannten wir sie bereits auswendig, die Röcke, Blusen und Sandalen, die sie in jeder nur erdenklichen Weise kombinierten, damit man es nicht merkte –, aber ich verteidigte sie voll heiliger Empörung: diese Verleumdungen seien Neid, grüner Neid, giftiger Neid, weil die kleinen Chileninnen bei den Feten niemals sitzenblieben, sämtliche Jungen standen Schlange, um mit ihnen zu tanzen – »weil sie hauteng tanzen, da bleibt keine sitzen«, konterte Laura –, oder weil sie bei den Treffen der Clique, bei den Spielen, am Strand oder im Parque Salazar immer im Mittelpunkt standen, umringt von sämtlichen Jungen, während sie die anderen Mädchen ... »Weil sie erwachsen tun und frech sind und weil ihr euch traut, ihnen schmutzige Witze zu erzählen, was wir euch nie erlauben würden!« attackierte Teresita. Und nicht zuletzt, weil die kleinen Chileninnen toll, modern, aufgeschlossen waren und sie dagegen zimperliche, rückständige Betschwestern voller altmodischer Vorurteile. »Allerdings!« antwortete Ilse herausfordernd.
Trotzdem luden die Mädchen aus dem Fröhlichen Viertel die beiden weiter zu den Feten ein und gingen mit ihnen vereint zum Strand von Miraflores, zur Zwölf-Uhr-Messe an den Sonntagen, zu den Nachmittagsvorstellungen und drehten mit ihnen die obligaten Runden durch den Parque Salazar, von der Abenddämmerung bis zum Auftauchen der ersten Sterne, die in jenem Sommer von Januar bis März am Himmel von Lima funkelten, ohne daß die Wolken, ich bin sicher, sie auch nur einen Tag verdunkelten, wie es in dieser Stadt zu vier Fünfteln des Jahres geschieht. Sie taten es, weil wir Jungen sie darum baten und die Mädchen aus Miraflores im Grunde so fasziniert von den Chileninnen waren wie die Heilige von der Sünderin, der Engel vom Teufel. Sie beneideten die fremden Mädchen um die Freiheit, die sie selbst nicht besaßen, die Freiheit, überallhin gehen und bis spät in der Nacht ausbleiben oder tanzen zu können, ohne um ein bißchen Verlängerung betteln zu müssen, ohne daß ihr Vater, ihre Mutter oder eine ältere Schwester oder eine Tante durch die Fenster beobachteten, mit wem und wie sie tanzten, oder sie mit nach Hause nahmen, weil es schon zwölf Uhr war, die Stunde, in der anständige Mädchen nicht tanzten oder auf der Straße mit Männern redeten – das taten die Möchtegern-Erwachsenen, die ordinären Aufsteigerinnen und die Frauen aus der Unterschicht –, sondern zu Hause und im Bett waren und den Schlaf der Unschuld schliefen. Sie waren neidisch darauf, daß die Chileninnen so ungeniert waren, so ungezwungen tanzten, daß es ihnen nichts ausmachte, wenn ihre Knie sich entblößten, daß sie ihre Schultern, ihre kleinen Brüste und den Po bewegten, wie es kein Mädchen in Miraflores tat, und daß sie sich womöglich bei den Jungen Freiheiten herausnahmen, an die sie nicht einmal zu denken wagten. Wenn sie aber so frei waren, warum wollten dann weder Lily noch Lucy einen Freund haben? Warum gaben sie allen, die wir uns ihnen erklärten, einen Korb? Nicht nur mir hatte Lily einen Korb gegeben; auch Lalo Molfino und Lucho Claux, und Lucy hatte Loyer, Pepe Cánepa und dem hübschen Julio Bienvenida einen Korb gegeben, der als erster Junge in Miraflores zu seinem fünfzehnten Geburtstag, noch vor dem Schulabschluß, von seinen Eltern einen Volkswagen geschenkt bekam. Warum nur wollten die kleinen Chileninnen, die so frei waren, keinen festen Freund haben?
Dieses und andere Rätsel im Zusammenhang mit Lily und Lucy klärten sich unverhofft am 30. März 1950, am letzten Tag jenes denkwürdigen Sommers, auf der Fete von Marirosa Álvarez-Calderón, genannt Schweinchen Dick. Eine Fete, die das Ende einer Epoche markierte und allen Teilnehmern für immer im Gedächtnis bleiben sollte. Das Haus der Familie Álvarez-Calderón an der Ecke 28 de Julio und La Paz mit seinem weitläufigen, von hohen Bäumen bewachsenen Garten, seinen Rosenholzbäumen mit gelben Blüten, seinen Glockenmalven und Rosenstöcken und seinem gekachelten Swimmingpool war das schönste von Miraflores und vielleicht sogar von ganz Peru. Bei Marirosas Feten gab es immer ein Orchester und einen Schwarm von Kellnern, die den ganzen Abend Kuchen, Häppchen, Sandwichs, Säfte und alle möglichen nichtalkoholischen Getränke herumreichten, es waren Feten, auf die wir Gäste uns vorbereiteten, als gälte es, den Himmel zu gewinnen. Alles lief bestens, bis wir, an die hundert Mädchen und Jungen, Marirosa bei gelöschten Lichtern umringten, Happy Birthday für sie sangen, sie die fünfzehn kleinen Kerzen auf der Torte ausblies und wir uns anstellten, um die üblichen Wangenküsse auszutauschen.
Als Lily und Lucy an der Reihe waren, sagte Marirosa, ein glückliches kleines Schweinchen, deren Locken sich, von einer großen Haarschleife im Nacken gehalten, über das rosafarbene Kleid ergossen, plötzlich mit großen Augen, nachdem sie die beiden auf die Wange geküßt hatte:
»Ihr seid doch Chileninnen, nicht? Ich werde euch meiner Tante Adriana vorstellen. Sie ist auch Chilenin und gerade aus Santiago gekommen. Los, kommt mit.«
Sie nahm sie bei der Hand und führte sie ins Innere des Hauses, während sie rief: »Tante Adriana, Tante Adriana, ich habe eine Überraschung für dich.«
Durch die Scheiben des großen Glasfensters, ein erleuchtetes Rechteck, das einen großen Salon mit einem erloschenen Kamin, Wänden mit Landschaftsund Porträtbildern in Öl, Sesseln, Sofas, Teppichen und einem Dutzend Damen und Herren mit Gläsern in der Hand umrahmte, sah ich Augenblicke später Marirosa mit den kleinen Chileninnen hereinplatzen und konnte verschwommen und flüchtig die Gestalt einer sehr großen, sehr zurechtgemachten, sehr schönen Frau mit einer brennenden Zigarette in einer langen Zigarettenspitze erblicken, die mit einem herablassenden Lächeln auf ihre jungen Landsmänninnen zuging, um sie zu begrüßen.
Ich holte mir einen Mangosaft und ging zwischen den Ankleidekabinen am Swimmingpool heimlich eine Viceroy rauchen. Dort traf ich meinen Freund und Kameraden von der Champagnat-Schule, Juan Barreto, der sich ebenfalls in diese Einsamkeit geflüchtet hatte, um eine zu rauchen. Ohne Umschweife fragte er mich:
»Würde es dir was ausmachen, wenn ich mich Lily erklären würde, Dürrer?«
Er wußte, daß wir kein Liebespaar waren, obwohl es so aussah, und er wußte auch – wie alle, betonte er –, daß ich mich ihr dreimal erklärt und daß sie mich ebenfalls dreimal abgewiesen hatte. Ich antwortete ihm, daß mir das sehr viel ausmachen würde, denn Lily habe mir zwar einen Korb gegeben, aber das sei ein Spielchen von ihr – in Chile waren die Mädchen so –, in Wirklichkeit gefiele ich ihr, wir seien gewissermaßen ein Paar, und außerdem hätte ich an dem Abend schon angefangen, mich ihr zum vierten und endgültigen Mal zu erklären, und sie habe gerade ja sagen wollen, als das Erscheinen von Schweinchen Dicks Torte mit den fünfzehn kleinen Kerzen uns unterbrochen habe. Doch jetzt, wenn sie mit der Tante von Marirosa fertig geredet hätte, würde ich mich ihr weiter erklären, und sie würde mich akzeptieren und von heute an meine Freundin sein mit allem, was dazugehört.
»Wenn es so ist, werde ich mich Lucy erklären müssen«, sagte Juan Barreto resigniert. »Das Dumme ist nur, daß Lily mir gefällt, Bruderherz.«
Ich ermunterte ihn, sich Lucy zu erklären, und versprach ihm, sie zu bearbeiten, damit sie ja sagte. Er mit Lucy und ich mit Lily – wir wären ein tolles Quartett.
Während ich mich am Swimmingpool mit Juan Barreto unterhielt und zusah, wie die Paare zu den Takten des Orchesters der Brüder Ormeño tanzten – es mochte ja nicht das von Pérez Prado sein, aber es war Spitze, was für Trompeter, was für Trommler –, rauchten wir jeder zwei Viceroy. Warum war es Marirosa gerade in diesem Moment eingefallen, Lucy und Lily ihrer Tante vorzustellen? Was tratschten sie da so lange? Das machte mir einen Strich durch die Rechnung, verdammt. Denn es stimmte, als man die Torte mit den fünfzehn Kerzen ankündigte, hatte ich meine vierte – und, ich war sicher, dieses Mal erfolgreiche – Liebeserklärung an Lily begonnen, denn ich hatte das Orchester überredet, Me gustas zu spielen, den Bolero, der wie dafür geschaffen war, sich einem Mädchen zu erklären.
Es dauerte eine Ewigkeit, bis sie zurückkamen. Und sie kamen völlig verändert zurück: Lucy ganz blaß und mit dunklen Augenschatten, als hätte sie ein Gespenst gesehen und würde sich gerade von dem Schrecken erholen, den das Jenseits ihr bereitet hatte, und Lily, mürrisch, einen bitteren Zug um den Mund, mit blitzenden Augen, als hätten die schnöseligen Herrschaften dort drinnen ihr böse zugesetzt. Ich forderte sie sogleich zum Tanzen auf, es war einer dieser Mambos, die ihre Spezialität waren – der Mambo Nummer 5 –, und ich konnte es nicht glauben: Lily brachte nichts zustande, sie kam aus dem Takt, war nicht bei der Sache, irrte sich, stolperte, und ihre Matrosenmütze verrutschte, was ihr ein leicht lächerliches Aussehen verlieh. Sie machte sich nicht einmal die Mühe, sie wieder geradezurücken. Was war passiert?
Ich bin sicher, daß am Ende von Mambo Nummer 5 die ganze Fete Bescheid wußte, denn Schweinchen Dick hatte dafür gesorgt. Wie genußvoll muß diese Klatschtante die Geschichte erzählt, sie ausgemalt und übertrieben haben, die Augen weit aufgerissen vor Neugier, Abscheu und Glück! Was für eine böse Freude müssen sämtliche Mädchen der Clique empfunden haben – was für eine Genugtuung, was für eine Rache – in ihrem Neid auf die kleinen Chileninnen, die nach Miraflores gekommen waren, um die Sitten von uns kleinen Jungen zu revolutionieren, die wir in jenem Sommer die Reifeprüfung als Teenager ablegten!
Ich war der letzte, der es erfuhr, als Lily und Lucy bereits auf mysteriöse Weise verschwunden waren, ohne sich von Marirosa oder sonst jemandem verabschiedet zu haben – »sie haben die Bremse der Scham gezogen«, erklärte später meine Tante Alberta –, und das rätselhafte Gerücht sich auf der ganzen Tanzfläche ausgebreitet und die hundert Jungen und Mädchen aufgescheucht hatte, die das Orchester, ihre Liebeleien und Fummeleien vergaßen und die Köpfe zusammensteckten, die gleichen Worte wiederholten, sich ereiferten, sich erhitzten und große, vor Bosheit glühende Augen machten: »Weißt du schon? Hast du’s schon gehört? Wie findest du das? Ist dir das klar? Kannst du dir so was vorstellen?« »Die sind gar keine Chileninnen! Nein, sie waren keine! Reine Erfindung! Weder Chileninnen, noch wußten sie was über Chile! Die haben gelogen! Die haben uns angeschmiert! Die haben alles erfunden! Die Tante von Marirosa hat ihnen die Tour vermasselt! Diese Gaunerinnen!«
Sie waren schlicht Peruanerinnen. Noch dazu arme, ärmste! Tante Adriana, gerade aus Santiago eingetroffen, muß ziemlich verdutzt gewesen sein, als sie die beiden mit dem Akzent reden hörte, der uns so gut getäuscht hatte, den sie jedoch sofort als Hochstapelei erkannte. Was müssen die kleinen Chileninnen gelitten haben, als Schweinchen Dicks Tante, da sie die Farce ahnte, sie nach ihrer Familie in Santiago fragte, nach dem Viertel in Santiago, in dem sie gelebt hatten, nach der Schule, die sie in Santiago besucht hatten, nach ihrer Verwandtschaft und nach den Freunden ihrer Familie in Santiago und Lucy und Lily damit den bittersten Augenblick ihres kurzen Lebens bescherte; sie setzte ihnen so lange zu, bis sie ihren Verwandten und Freunden und der verdatterten Marirosa verkünden konnte, nachdem die beiden in schrecklicher Verfassung das Wohnzimmer verlassen hatten: »Von wegen Chileninnen! Diese Mädchen haben nie einen Fuß nach Santiago gesetzt und sind Chileninnen, so wie ich Tibetanerin bin!«
An jenem letzten Sommertag des Jahres 1950 – auch ich war kurz zuvor fünfzehn Jahre alt geworden – begann für mich das wirkliche Leben, das Leben, das die Luftschlösser, die Illusionen und die Märchen von der rauhen Wirklichkeit scheidet.
Die vollständige Geschichte der falschen kleinen Chileninnen habe ich nicht erfahren, auch sonst kannte sie niemand, außer ihnen beiden, aber ich habe die Vermutungen, Klatschgeschichten, Hirngespinste und angeblichen Enthüllungen gehört, die ihnen lange Zeit wie eine Kielspur folgten, nachdem sie gleichsam aufgehört hatten zu existieren, denn sie wurden nie wieder zu den Feten oder den Spielen oder zum Tee oder zu den Treffen der Clique eingeladen. Böse Zungen behaupteten, daß zwar die anständigen Mädchen aus dem Fröhlichen Viertel und von ganz Miraflores nicht mit ihnen verkehrten und sich von ihnen abwandten, wenn sie ihnen auf der Straße begegneten, aber die Jungen, die Jugendlichen, die Männer sie sehr wohl aufsuchten, heimlich, so wie man eben die ordinären Mädchen und Frauen aufsucht – und was waren Lily und Lucy anderes als zwei ordinäre Möchtegerns aus irgendeinem Viertel wie Breña oder El Porvenir, die ihre Herkunft verleugnet und sich als Ausländerinnen ausgegeben hatten, weil sie sich bei den anständigen Leuten von Miraflores einschleichen wollten? –, um mit ihnen zu fummeln, um all die Sachen mit ihnen zu machen, die nur die Mädchen aus der Unterschicht mit sich machen lassen.
Später dann, denke ich, haben die einen wie die anderen Lily und Lucy allmählich vergessen, weil andere Menschen, andere Ereignisse an die Stelle jenes Abenteuers im letzten Sommer unserer Kindheit traten. Aber ich nicht. Ich vergaß die beiden nicht, vor allem Lily nicht. Obwohl so viele Jahre vergangen sind und Miraflores sich ebenso verändert hat wie die Sitten und obwohl die Schranken und Vorurteile verschwunden sind, auf die man sich früher ohne jede Scheu berief und heute hinter vorgehaltener Hand, habe ich sie in Erinnerung behalten und denke bisweilen an sie zurück, höre abermals ihr durchtriebenes Lachen, sehe den spöttischen Blick ihrer Augen von der Farbe dunklen Honigs und wie sie sich einem Schilfrohr gleich im Mambotakt biegt. Und ich denke noch immer, obwohl ich schon so viele Sommer erlebt habe, daß jener Sommer von allen der grandioseste war.
IIDer Guerrillero
Das México Lindo befand sich an der Ecke der Rue des Canettes und der Rue Guisarde, einen Schritt entfernt von der Place Saint-Sulpice, und in meinem ersten Jahr in Paris, in dem ich knapp bei Kasse war, stellte ich mich viele Abende an die Hintertür dieses Restaurants und wartete, daß Paúl mit ein paar in Papier gewickelten Maispasteten, Tortillas, Enchiladas oder einer Portion gebratenem Schweinefleisch herauskam, die ich mir dann in meiner Dachkammer im Hôtel du Sénat zu Gemüte führte, bevor sie kalt wurden. Paúl hatte als Küchenjunge im México Lindo angefangen und war schon nach kurzer Zeit dank seiner kulinarischen Fähigkeiten zum Assistenten des Küchenchefs aufgestiegen, und als er alles aufgab, um sich mit Leib und Seele der Revolution zu widmen, war er bereits bestallter Koch des Lokals.
Damals, zu Beginn der sechziger Jahre, lebte Paris im Fieber der kubanischen Revolution und wimmelte nur so von jungen Leuten aus allen fünf Kontinenten, die, wie Paúl, davon träumten, in ihren Ländern die Heldentat Fidel Castros und seiner bärtigen Gefährten zu wiederholen, und sich ernsthaft oder spielerisch in Kaffeehauskonspirationen darauf vorbereiteten. Neben seiner Erwerbstätigkeit im besuchte Paúl, als ich ihn wenige Tage nach meiner Ankunft in Paris kennenlernte, Vorlesungen in Biologie an der Sorbonne, die er später ebenfalls für die Revolution aufgab.
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!