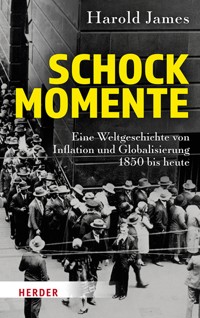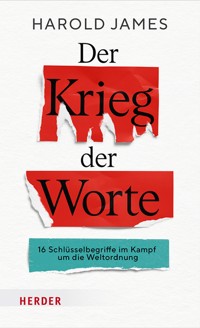
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Verlag Herder
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Nationalismus, Sozialismus oder Kapitalismus – diese Begriffe gehören zu den am heftigsten diskutierten Ideen in der Politik. Ihre eigentliche Bedeutung ist jedoch verloren gegangen. Die Wörter werden meist genutzt, um produktive Diskussionen zu kippen. Das Ergebnis sind Missverständnisse und Polarisierung. In diesem Buch deckt der große Wirtschaftshistoriker Harold James die Ursprünge zentraler Begriffe unserer politischen Debatten wieder auf. Er untersucht, wie ihre problematische Definition und Bedeutung zu einem Hindernis für eine respektvolle Kommunikation geworden sind. James zeigt, dass nur ein historisches Wissen über das Vokabular rund um Globalisierung, Politik und Wirtschaft hilft, die Schlüsselwörter unserer Zeit zu begreifen. So lässt sich die Kluft zwischen den unterschiedlichen Auffassungen überwinden und eine produktive politische Debatte führen. »Die Worte haben ihre Bedeutung verloren, die Debatten werden immer schlechter und die Gesellschaft polarisiert sich. Gibt es einen Ausweg aus der Sackgasse, aus den Missverständnissen und der Misskommunikation?«(Harold James)
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 661
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Harold James
Der Krieg der Worte
16 Schlüsselbegriffe im Kampf um die Weltordnung
Aus dem Englischen von Carla Hegerl, Franka Reinhart und Carolin Weißbach
Die englische Originalausgabe ist 2021 unter dem Titel War of the Words bei der Yale University Press in New Haven & London erschienen.
Published with assistance from the Mary Cady Tew Memorial Fund.
Copyright © 2021 by Harold James.
© Verlag Herder GmbH, Freiburg im Breisgau 2024
Alle Rechte vorbehalten
www.herder.de
Umschlaggestaltung: zero-media.net, München
Umschlagmotiv: © FinePic®, München
E-Book-Konvertierung: Daniel Förster
ISBN Print: 978-3-451-39669-4
ISBN E-Book (EPUB): 978-3-451-83439-4
ISBN E-Book (PDF): 978-3-451-83441-7
Für Maximilian, Marie-Louise, Montagu und die nächste Generation auf dieser Welt
Inhalt
Vorwort
Einleitung: Wie aus Wörtern Auseinandersetzungen werden
Über Niedergang, Verfall, Entkopplung und deren Rhetorik Vorwort zur deutschen Ausgabe
1 Kapitalismus
2 Sozialismus
3 Demokratie, Nationalstaat und Nationalismus
4 Hegemonie
5 Multilateralismus
6 Die furchterregenden deutschen Politikbegriffe
7 Schulden
8 Technokratie
9 Populismus
10 Globalismus
11 Globalisierung und ihre Neologismen
12 Neoliberalismus
13 Gerechtigkeit und Globale Gerechtigkeit
14 Krise
15 Neuprägung der Wörter in unserem Wortschatz
Anmerkungen
Über den Autor
Vorwort
Die Idee für dieses Buch ist dem starken Eindruck geschuldet, dass die heutige Globalisierungsdebatte nicht auf einem klaren Verständnis der grundlegenden Konzepte und Begrifflichkeiten fußt. Ich beschäftige mich seit mehr als dreißig Jahren mit der Globalisierung und der Kritik an ihr, und ich bin zu der Überzeugung gelangt, dass die meisten Missverständnisse in der Debatte auf unpräzises Vokabular zurückzuführen sind. Bestimmte Begriffe – wie neuerdings Neoliberalismus, Globalismus und Geopolitik – werden auf einmal überall benutzt, ohne dass sie adäquat definiert wären. Um diesen Missstand zu beheben, spanne ich in diesem Buch einen weiten Bogen und betrachte historische Fakten ebenso wie aktuelle Ereignisse. Es soll allen, die diese wichtigen konzeptuellen politischen Debatten voranbringen wollen, endlich eine gemeinsame Sprache an die Hand geben.
Manche Kapitel bauen teilweise auf bereits anderweitig veröffentlichten Artikeln auf. Ich danke den Herausgeberinnen und Herausgebern der Fachzeitschrift Capitalism für die Erlaubnis, eine abgewandelte Version des 12. Kapitels verwenden zu dürfen, das teilweise auf meinem Aufsatz »Neoliberalism and its Interlocutors« basiert (Capitalism: A Journal of History and Economics 1, Nr. 2, Frühling 2020, © University of Pennsylvania Press). Teile des 1. Kapitels erschienen in meinem Beitrag »Finance Capitalism« in dem von Jürgen Kocka und Marcel van der Linden herausgegebenen Sammelband Capitalism: The Reemergence of a Historical Concept, London: Bloomsbury Academic, 2016; Teile des 4. Kapitel erschienen in meinem Aufsatz »International Order after the Financial Crisis« in International Affairs 87, Nr. 3 (Mai 2011), S. 525–537, © 2014 The Royal Institute of International Affairs mit Erlaubnis der Oxford University Press; und Teile des 11. Kapitels erschienen als »Deglobalization: The Rise of Disembedded Unilateralism« im Annual Review of Financial Economics 10 (2018), S. 219–237, © Annual Reviews.
Mein Dank gilt den Organisatorinnen und Organisatoren zahlreicher Seminare und Konferenzen, auf denen ich Teile der in diesem Buch vorgebrachten Argumentationen vorgestellt habe, u. a. David Bell vom Davis Center for Historical Studies und Markus Brunnermeier vom Bendheim Center for Finance in Princeton; Wolfgang Quaisser von der Akademie für Politische Bildung; Piotr Pysz von der Konrad-Adenauer-Stiftung Warschau; Liz Mohn, Wolfgang Schüssel und Jörg Habich vom Trilog der Bertelsmann Stiftung; Daniel Gros vom Brüsseler Centre for European Policy Studies; Andrew Los und Robert Mertons Konferenz des Annual Review of Financial Economics an der Stern School, New York University; Anne Deighton und der Cyril-Foster-Lesungsreihe der Oxford University; Jeffrey Edward Green von der University of Pennsylvania; Adam Posen vom Peterson Institute; und Mary Lewis von der Harvard University. Ich danke auch Michael Bordo, Luís António Vinhas Catão, Marc Flandreau, Jürgen Kocka, Jurgen Reinhoudt und Daniel Rodgers für ihre wertvollen Kommentare zu einigen Buchabschnitten. Joshua Derman hat den gesamten Text einer scharfsinnigen Lektüre unterzogen.
Seth Ditchik von der Yale University Press stand mir mit hilfreichem Rat zur Seite. Anna Vinitsky hat als Forschungsassistenz ausgezeichnete Arbeit geleistet und mir einige russischsprachige Quellen zugänglich gemacht. Julie Carlson hat das Manuskript sehr gründlich und aufmerksam redigiert. Kapitel 5 und 6 habe ich gemeinsam mit Marzenna James vom Politics Department der Princeton University geschrieben. Ihr gilt mein ewiger Dank. Unsere Kinder Maximilian, Marie-Louise und Montagu James haben ebenfalls unendlich wertvollen Input gegeben.
Einleitung: Wie aus Wörtern Auseinandersetzungen werden
Wir erleben aktuell, wie das Aufeinandertreffen zweier Prinzipien oder Philosophien die Wirtschaft, Gesellschaft und Politik radikal verändert. Globalismus, Kosmopolitismus, Internationalismus, Multilateralismus: Es gibt viele Wörter für das Prinzip der Weltoffenheit. Auf der anderen Seite stehen Partikularismus, Lokalismus und Nationalismus. Ein Virus, das 2020 zum Gesicht – zur Verwirklichung – der Globalisierung wurde, hat diese Polarisierung weiter verschärft. Die Coronapandemie hat viele Entwicklungen beschleunigt, die bereits weit fortgeschritten waren. Sie führte dazu, dass Technologien in neue, häufig privatere Anwendungsbereiche vordrangen, und gab (zwischenzeitlich) dem Anti-Globalisierungs-Backlash neuen Aufwind. Sie hat zu ökonomischen und sozialen Spannungen sowie zu neuen und eigenartigen Formen psychischer Belastungen geführt.
In Krisenzeiten muss man umdenken und sich umorientieren: Man kann auf die Grundlagen zurückgreifen. Verrät uns die Geschichte irgendetwas darüber, was uns bevorsteht und wie wir darüber denken sollen? Dieses Buch geht davon aus, dass Zeiten des tiefgreifenden sozialen Wandels neue Fragen aufwerfen und neue Vokabeln hervorbringen. Unser Wortschatz ist ein Spiegel unserer Ideen, und diese bündeln unsere kollektiven Ansichten der Realität. Sie übersetzen individuelle Erfahrungen in ein allgemeineres oder sogar universelles Verständnis. Ein Kernsatz von Ludwig Wittgensteins Philosophie lautet bekanntermaßen: »Die Grenzen meiner Sprache bedeuten die Grenzen meiner Welt.«1 Es war schon immer die Sprache, die Menschen voneinander trennte: In der Geschichte vom Turmbau zu Babel, einer unserer mächtigsten Mythen, zerstört Gott ein Gebäude, das eine universelle Sprache erschaffen hätte, weil diese den Menschen quasi-göttliche Kräfte verliehen hätte (»Wohlauf, lasst uns eine Stadt und einen Turm bauen, dessen Spitze bis an den Himmel reiche, dass wir uns einen Namen machen; denn wir werden sonst zerstreut über die ganze Erde.«)2. Es hat seitdem zahlreiche Versuche gegeben, Universalsprachen zu erschaffen – zwei Beispiele sind Esperanto und Volapük –, doch diese sind schnell wieder in Vergessenheit geraten. Stattdessen haben wir uns weitgehend an den Gedanken gewöhnt, dass Übersetzungen möglich sind, auch wenn dabei vielerlei Nuancen verloren gehen. Insbesondere wenn wir verstehen wollen, mit welchen Begriffen Menschen über Staaten und Regierungen nachdenken – und inwiefern die internationale Gesellschaft von internationalen Beziehungen und ideologischen Kämpfen geprägt ist –, werden bestimmte Sprachen immer wieder übersetzt, und zwar häufig schlecht oder unzureichend. Dabei bleibt oft unbemerkt, wie groß die Verluste in Übersetzungen sind.
Häufig wird so getan, als sei das Übersetzen ein simpler Tauschhandel, ähnlich dem Bezahlen mit Geld, bei dem Äquivalenzen zwischen Waren, Dienstleistungen oder sogar Versprechungen hergestellt werden. Doch die Wörter, mit denen in den heutigen kulturellen, politischen und ökonomischen Kampfdebatten wie mit Munition ständig um sich geworfen wird – Kapitalismus, Sozialismus, Demokratie, Imperialismus und Hegemonie, Multilateralismus, Geopolitik, Populismus, Technokratie, Schuldenpolitik, Globalismus, Globalisierung und Neoliberalismus, um nur einige zu nennen –, sind so unklar definiert, dass sie gar nicht mehr für einen Tauschhandel genutzt werden, sondern für das Verwischen von Argumenten und das Diskreditieren von Menschen mit anderen Meinungen. Alle Begriffe, denen in diesem Buch auf den Grund gegangen wird, wurden im Laufe ihrer langen Geschichte von Befürwortern und Gegnern ausgiebig hin- und hergeschmissen. Nachdem sich mit diesen Begriffen anfangs eine bestimmte Problemlage eines historischen Moments präzise einfangen ließ, beschleunigte sich die Vielfalt ihrer Bedeutungen und sie verleibten sich lawinenartig im Laufe der Zeit immer mehr Konnotationen ein, bis sie schließlich vereisten – oder schmolzen. Präzise Analysen sind mit ihnen nunmehr unmöglich.
Ein bemerkenswerter und bis heute aktueller Aufsatz des großen russischen Schriftstellers Alexander Solschenizyn behandelt diese Art von Wortverwirrung. Für ihn war eine Lüge nicht einfach eine Unwahrheit, sondern die Folge verzerrter und verdrehter Bezeichnungen: »Nicht die toten Knöchelchen und Schuppen der Ideologie zusammenkleben, nicht den vermoderten Lappen flicken – und wir werden erstaunt sein, wie schnell und hilflos die Lüge abfällt, und was nackt und bloß dastehen soll, wird dann nackt und bloß vor der Welt stehen.«3
Der Philosoph William James sorgte vor über einem Jahrhundert mit seiner These für großen Aufruhr, dass sich eine Theorie an dem, so James, »Barwert der Wahrheit in Bezug auf die tatsächliche Erfahrung«4 messen lassen müsse. Laut James hätten Theorien keine eigene Qualität für einzelne Individuen, sondern bezögen ihren Wert aus ihrer Akzeptanz innerhalb eines breiteren Umfelds bzw. durch ihre Zirkulation in einem Markt. Diese Ansicht wurde von John Grier Hibben, einem Philosophen und späteren Präsidenten der Princeton University, scharf angegriffen. Er sagte – kurz nach dem verheerenden Finanzcrash von 1907 –, James’ Forderung würde »in der Welt unseres Denkens eine ebenso große Panik auslösen wie ein ähnlicher Gedanke in der Finanzwelt.«5 Die Diskussion hat nicht an Aktualität verloren, denn tatsächlich greift Panik unter vielen Menschen um sich.
Genau wie Währungen findet man den Ursprung der Begriffe, um die es in diesem Buch geht, in den Machtzentren. In der Geschichte des Geldes waren Großbritannien im 19. Jahrhundert und die Vereinigten Staaten im späten 20. Jahrhundert vorherrschend. Auch Theorien haben ihren Ursprung in Produktions- und Handelszentren – Orte, an denen Ideen entstehen, aufeinandertreffen, weiterentwickelt und verzerrt werden. In der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts, in der Zeit nach der Französischen Revolution, brachte Frankreich, insbesondere Paris, formbare Begriffe wie Nation, Sozialismus und Demokratie hervor. Im späten 19. Jahrhundert nahm Deutschland nicht nur eine neue politische Rolle ein, sondern wurde auch zu einem intellektuellen Machtzentrum. Hatten deutsche Denker das französische Vokabular zuvor noch begeistert in ihre eigene Sprache übernommen, so entwickelten sie nun selbst neue Begrifflichkeiten wie Machtpolitik und Geopolitik.
In der Mitte des 20. Jahrhunderts überquerte viel deutsches Vokabular den Atlantik und landete in einem neuen Schmelztiegel. Die Menschen, die diese Begriffe mit sich brachten, waren oft vor dem Nationalsozialismus geflohen – einem System, das teilweise aus jenen Begriffen hervorgegangen war, die sie selbst internalisiert hatten. In den Vereinigten Staaten wurden diese Begriffe Teil einer neuen Sprache, mit der die aufsteigende Supermacht über ihre Vision einer Weltordnung nachdachte.
Die Vergangenheit (und ihre Denkerinnen und Denker) vererben uns die Sprache, mit der wir Meinungen ausdrücken und anfechten. Besonders zwei Epochen haben einen Großteil unserer heutigen politischen Begriffe und damit auch unsere Reaktionen auf die zahlreichen Krisen, die wir der Globalisierung zu verdanken haben, geprägt. Die erste sprachliche Innovationsepoche fand vor rund 200 Jahren statt, nach dem Ende der Französischen Revolution und der Napoleonischen Kriege. In der Zeit nach der doppelten Umwälzung durch die Französische und Industrielle Revolution entstand eine neue politische Sprache, in deren Zentrum Nation und Demokratie, später dann Kapitalismus und Sozialismus standen. Der große deutsche Geisteshistoriker Reinhart Koselleck hat diese Phase als Sattelzeit bezeichnet (abgeleitet von einem Bergsattel, von dem Reisende die gegensätzlichen Landschaften zweier unterschiedlicher Täler überblicken können). Es geht hier also um eine Bewegung durch Zeit und Raum. Im frühen 19. Jahrhundert erblickten die Schlüsselbegriffe der politischen Moderne das Licht der Welt: Neben Nation und Nationalismus auch Konservatismus, Liberalismus, Sozialismus, Kapitalismus und Demokratie. Der letzte Begriff, Demokratie, ist natürlich viel älter, doch der Begriff wurde damals auf neue Weise im Kontext einer anderen Organisationsform – großangelegte Wahlen anstelle von Losverfahren für die Vergabe politischer Ämter – wiederentdeckt. Daher hatten die demokratischen Debatten kaum noch etwas mit dem antiken Athen oder den spätmittelalterlichen Stadtstaaten Italiens zu tun. Wir denken auch heute noch in Ismen und aufgrund ihrer Entstehungsgeschichte sind diese Begriffe auf ebenso seltsame wie komplexe Weise miteinander verflochten und voneinander abhängig. Sie atmen dieselbe intellektuelle Luft.
Sozialismus und Kapitalismus sind ein Beispiel für diese Form der begrifflichen Symbiose – sie sind Antonyme wie Yin und Yang. Der Begriff des Sozialismus entwickelte sich aus einer Kritik am Kapitalismus, während dieser wiederum die negativen Merkmale einer sich verändernden Welt zusammenfassen sollte. Traditionelle Handwerker, neue Industriearbeiter, aber auch eine Aristokratie, deren Reichtum dahinzuschmelzen drohte, und Intellektuelle, deren soziales Kapital untergraben sein könnte: Sie alle fühlten sich von der Übermacht der neuen, kapitalistischen Maschinerie bedroht. Sie waren nicht unbedingt für den Sozialismus, aber verurteilten den Kapitalismus; und all jene, die von Kollektiven sprachen, erhielten viel Zulauf. Die zwei Antonyme blieben eng miteinander verwoben und im späten 20. Jahrhundert verteidigten die Apologeten des Kapitalismus ihre Position ganz einfach dadurch, dass sie von einem Scheitern des Sozialismus sprachen. Ein alter sowjetischer Witz bringt die gegenseitige Abhängigkeit dieser beiden Begriffe perfekt zum Ausdruck: Was ist der Unterschied zwischen Kapitalismus und Kommunismus? Der Kapitalismus ist die Ausbeutung des Menschen durch den Menschen. Beim Kommunismus ist es andersrum. Wie wir noch sehen werden, beschleunigte sich die Konvergenz oder Vermischung dieser beiden Begriffe durch billigere und leichter zugängliche Informationen.
Die Bedeutungen der Begriffe Kapitalismus und Sozialismus waren im 19. Jahrhundert, als sie zum ersten Mal auftauchten, vielschichtig, und sie wurden in verschiedenen Kontexten und zu unterschiedlichen Zwecken verwendet. Sie beschrieben ein sich ständig veränderndes Verständnis dessen, wie die Welt organisiert war und sein sollte. Sehr früh wurde erkannt, dass der Kapitalismus keine Staatsgrenzen kannte und so zu einer globalen Realität wurde. Der Sozialismus, sein Spiegelbild, war ein ebenso internationales Phänomen. Doch der Ort der Verwirklichung der sozialistischen Ordnung wurde vom Staat vorgegeben, der mehr und mehr die Form des Nationalstaats annahm. Die Nationalpolitik und die internationalen, grenzüberschreitenden Phänomene des Kapitalismus und Sozialismus befanden sich also in einem ständigen Spannungsverhältnis. Um die Beziehung zwischen diesen unterschiedlichen Gesellschaftsentwürfen zu verstehen, müssen wir uns den Debatten zum Zeitpunkt der Entstehung dieser Begriffe zuwenden.
Mit Kapitalismus sollte zunächst ein System beschrieben werden, das den Austausch von Eigentum und Arbeitskraft ermöglichte und die Subjekte dieser Tauschhandlungen auf eine Weise wiederum zu kaufbaren Produkten machte, was mit den alten Traditionen brach. Je weiter die Tauschlogik um sich griff, desto diffuser wurde der Kapitalismus als ein Prinzip und durchdrang immer mehr Aspekte des individuellen Verhaltens. Marktprinzipien wurden auf die Suche und Wahl der (Ehe-)Partner, das Sportmanagement, die Kulturproduktion und vieles mehr angewendet. Alles schien finanzielle Äquivalente zu haben. Geld diente als Übersetzungsmechanismus und Erinnerungsspeicher – und ähnlich einer Sprache wurde und wird es immer wieder neu erfunden. Es gab ein weiteres Paradox: Der Kapitalismus beruht auf dezentralisierten Entscheidungsprozessen. Doch je stärker sich das Kapital konzentriert, desto eher scheinen Entscheidungen an nur wenigen Knotenpunkten getroffen zu werden: Geht das schon in Richtung Planwirtschaft?
Der Sozialismus war eine Reaktion auf die organisatorischen Herausforderungen einer Humanisierung des Kapitalismus. Er entwickelte sich in zwei verschiedene Richtungen: Die erste setzte auf Planwirtschaft, die zweite auf die Umverteilung der Profite im Sinne einer gerechteren Gesellschaft. Trotz der internationalistischen Ansprüche des Sozialismus wurden beide Denkrichtungen am ehesten noch im Kontext existierender Staaten realisiert. Das Verhältnis zwischen Sozialismus und Internationalismus blieb daher immer angespannt.
Der Nationalstaat, ob nun populistisch oder demokratisch regiert, war eine Reaktion auf den delokalisierten Kapitalismus. Mit der Zeit brachte man ihn zunehmend mit Wirtschaftsfragen und der Förderung von Wachstum und Entwicklung in Verbindung – eine Fixierung, die in Zeiten von Wirtschaftskrisen oder Unruhen gefährlich werden konnte. Dieselbe Denkweise, die die Existenz des Nationalstaates mit dessen wirtschaftlichen Vorteilen begründete, wurde auch auf transnationale Organisationen übertragen – insbesondere im Falle Europas. Die Europäische Gemeinschaft und die Europäische Union machten sich angreifbar, weil es so wirkte, als seien sie primär für einen rein wirtschaftlichen Zweck erschaffen worden.
Gegen Ende des 19. Jahrhunderts wurde die Frage der Dominanz eines Staates über einen anderen – gefasst als Hegemonie oder als Imperialismus – zur organisatorischen Schlüsselfrage internationaler Beziehungen. Hegemonie war ein komplexes Phänomen, denn sie beruhte zwar auf Macht, ließ sich aber nicht durch schiere Stärke durchsetzen. Vielmehr musste der Hegemon etwas investieren, eine Bürde schultern oder einen Preis zahlen. Und die Ausübung von Hegemonie produzierte keine steigenden Kosten, sondern eine Gegenreaktion, den Anstoß zum Prozess der Dehegemonisierung.
Vor hundert Jahren, nach einer weiteren Epoche revolutionärer Umwälzungen wie dem Ersten Weltkrieg und der Oktoberrevolution, erlebten die Menschen eine weitere Sattelzeit – eine neue Herausforderung für die globale Verbundenheit. Die Gewissheiten der Welt vor 1914 schienen dahin zu sein. Gleichzeitig blickten viele nostalgisch auf die Vorkriegszeit zurück und wünschten sich einige ihrer besseren Eigenschaften zurück. John Maynard Keynes hat in seinem berühmten Buch Die wirtschaftlichen Folgen des Friedensvertrags auf brillante Weise die Ära der globalen wirtschaftlichen Vernetzung vor 1914 beschrieben, um dann aufzuzeigen, wie die politische Kurzsichtigkeit diese Chance für nachfolgende Generationen wieder zerstörte. Der Nationalismus, Sozialismus, Kapitalismus und sogar die Demokratie schienen weitaus mehr von Gewalt und weitaus weniger von Sachlichkeit bestimmt zu sein. Die damals entwickelten Ideen – wie Technokratie, Geopolitik, Multilateralismus, Globalismus, Neoliberalismus – sollten die obsolet gewordenen Konzepte des vergangenen Jahrhunderts ablösen. Sie prägten den Rest des Jahrhunderts, auch wenn nach 1945 und dem Sieg über den europäischen Faschismus wieder Normalität und Ordnung einzukehren schienen. Gegen Ende des 20. Jahrhunderts war ein weiteres Buzzword aus der Taufe gehoben: Globalisierung. Es schien eine andere Beschreibung des erdrückenden Molochs zu sein, der die individuellen Entscheidungen veränderte und nationalpolitische Programme sowohl schwieriger als auch komplexer werden ließ.
Könnte es ein neues Instrument geben, mit dem man eine große Anzahl von Staaten dazu bringen könnte, zum Wohle aller zusammenzuarbeiten? Für Frieden und Gesundheit, gegen den Hunger und zur Begrenzung von Umweltschäden und Klimawandel? Das Konzept des Multilateralismus war ein Gegenentwurf zur Hegemonie und dem zunehmend populären Begriff der Geopolitik, der globale Politik auf Interaktionen basierend auf physischer Geografie reduzierte.
Die Verflechtungen des frühen 20. Jahrhunderts wurden durch Finanzbeziehungen weiter verkompliziert. Die Dominanzfrage ging mit der Schuldenfrage Hand in Hand. Der Kapitalismus hatte im Laufe des 19. Jahrhunderts zu einer noch nie dagewesenen Vermarktlichung internationaler Schulden geführt, so wurden sie zu einem Machtinstrument. Manchmal war der Einfluss unvorhergesehen: Schuldner hoher Beträge beispielsweise konnten beträchtlichen Druck auf Gläubiger ausüben, indem sie damit drohten, ihre Schulden nicht zurückzuzahlen. Schulden und Schuldenpolitik wurden zu einem entscheidenden Einflussfaktor moderner Politik.
Zu Beginn des 20. Jahrhundert tauchte ein weiterer Begriff auf: die Technokraten Sie haben bestimmte Fähigkeiten oder verfügen über ein Expertenwissen, das sie von den eher generalistischen Politikern unterscheidet. Wer von Technokraten und Technokratie spricht, impliziert dabei häufig, Technokraten könnten die Langzeitfolgen ihrer Entscheidungen besser abschätzen als Politiker, die unpopuläre Entscheidungen eher zu vermeiden versuchen. Technokraten könnten daher eher erkennen, welche – oft schmerzhaften – Entscheidungen oder Opfer gerade notwendig seien. Dem technokratischen Gedanken wird vor allem dann gern gefolgt, wenn noch nie dagewesene (ein Lieblingsbegriff der Technokraten) Herausforderungen (noch so einer) mithilfe einer womöglich neuen Herangehensweise bewältigt werden müssen.
So wie der Kapitalismus und der Sozialismus zwei Seiten einer Medaille sind, stehen den Technokraten die Populisten gegenüber, die Erstere oder politische Eliten abschütteln und das Volk wieder an die Macht bringen wollen.
Eine extreme Form der Hegemonie war der Globalismus, laut dem jede Debatte über zwischenstaatliche Beziehungen darauf hinauslief, dass ein Staat einen anderen durch militärische, wirtschaftliche, politische oder kulturelle Einflussnahme zu dominieren versuchte. Der Globalismus war vor allem im späten 20. Jahrhundert en vogue. Damals brach eine neue Ära der Globalisierung an, die einige Gemeinsamkeiten mit der des 19. Jahrhunderts hatte. Somit wurde auch wieder über Fragen der Dominanz und des Machtmissbrauchs diskutiert.
Vom Neoliberalismus begann man in der Zwischenkriegszeit zu sprechen und wollte damit der zunehmenden Machtkonzentration etwas entgegensetzen – sei es auf nationaler Ebene im Hinblick auf die Etablierung von Zentren mit starker Wirtschaftsmacht oder auf internationaler im Hinblick auf das Hegemoniestreben. Doch die Analyse hegemonischer Praktiken war so erfolgreich – oder zersetzend –, dass auch der Neoliberalismus ihr anheimfiel und selbst als eine neue und noch wirksamere Form hegemonialer Machtausübung kritisiert wurde.
Nach der globalen Finanzkrise von 2007 und der Coronapandemie wurden die Begriffe des vergangenen Jahrhunderts – Technokratie, Globalismus, Globalisierung und Neoliberalismus – auf einmal zu einem Problem. Man hatte fast überall den Eindruck, dass sich viele verschiedene Bereiche der Gesellschaft im Krisenzustand befanden – ohne Lösungen in Sicht. All jene Begriffe wurden gern eloquent angeprangert, was dann Teil der politischen Rhetorik und als selbstverständlich hingenommen wurde. Die Welt wandte sich gegen diese Begriffe, obwohl die grundlegenden Probleme jener Zeit (Gesundheit, Umwelt, Wirtschaft und Wohlbefinden) eindeutig globaler Natur waren; und heute fehlen uns die Wörter, um die Organisation unserer Gesellschaft, Politik und Wirtschaft auf begrifflicher Ebene zu fassen. Manche Kommentatoren lassen verlauten, sie seien auf der Suche nach einer »Nachfolgeideologie« für die heutigen, unzeitgemäßen Begriffe. Diese solle der Tatsache, dass »Begriffe, die zu kritischer Selbstreflexion anregen sollten, zu einer Echokammer werden, die sich zunehmend von der Realität abkapselt«6, etwas entgegensetzen. Ich beschäftigte mich 2001 in einem Buch über »das Ende der Globalisierung« mit einer ähnlichen Problematik und kam zu dem Schluss, dass die Alternativen zum gängigen analytischen Vokabular zu inkohärent, metaphorisch oder postmodern waren.7 Heute stehen wir einer regelrechten Flut von widersprüchlichen Theorien und missverständlichen Wörtern gegenüber.
Eine liberale, offene Gesellschaft lässt sich am besten als Marktplatz der Ideen begreifen. Demnach sollten alle Menschen eigene Ideen frei entwickeln, ausdrücken, erforschen, korrigieren, bestreiten, anfechten und widerlegen dürfen. So wird die Debatte zu einem Testfeld, auf dem Zuspruch den Preis oder Werthaftigkeit der Ideen erhöht, sie somit attraktiver und überzeugender macht, während Unklarheiten und Widersprüche ihre Akzeptanz oder ihren Wert verringern.
Wenn dem so wäre, dann müssten die besseren Ideen immer triumphieren und die Welt wäre ein besser regierter – und vielleicht generell ein besserer – Ort. Geltende Glaubensgerüste müssten mit den sich verändernden Umständen nur hie und da leicht angepasst werden. Sehr selten gäbe es radikale epistemische Brüche, die eine neue Weltanschauung hervorbrächten, die scheinbar besser mit der Realität im Einklang wäre. So sah es auch John Stuart Mill: »Wenn die Menschheit fortschreitet, wird die Zahl der Lehren, über die kein Zweifel mehr besteht, beständig zunehmen, und das Gedeihen der Menschheit kann beinahe bemessen werden nach der Wichtigkeit und Zahl der Wahrheiten, die nicht mehr bezweifelt werden können.«8 Man braucht kein großes Geschichtsverständnis, um die Realitätsferne hier zu bemerken, denn viele schlechte und destruktive Ideen haben sich durchgesetzt, zumindest eine gewisse Zeit lang. Nicht immer setzen sich im Kampf der Ideen die besseren durch. Das 20. Jahrhundert war ein großes Versuchsfeld, bei dem der Marktplatz der Ideen der Menschheit nicht allzu gut gedient hat.
Die Lebenswelt des 21. Jahrhunderts ist ähnlich verstörend. Es wird immer offensichtlicher, dass Debatten – ein zentrales Element der Theorie vom Marktplatz der Ideen – heute unmöglich geworden sind. In vielen Ländern werden polarisierte Diskussionen geführt – sei es über Trump, den Brexit, die europäische Austeritätspolitik oder das Anti-Drogen-Programm auf den Philippinen – ohne Raum für einen nuancierten Gedankenaustausch. Antagonismen bestimmen die Debatten. Die Welt wird auf eine Weise in Freunde und Feinde aufgeteilt, die der antiliberale deutsche Philosoph Carl Schmitt im 20. Jahrhundert für charakteristisch für die Politik und den politischen Prozess hielt. Schmitt wird auf den folgenden Seiten immer wieder auftauchen, jedoch weniger als Inspiration, denn als das beste Beispiel für einen rhetorisch bestechenden Denker, dessen politische Philosophie auf einer dichotomen Weltaufteilung beruht.9
Diese neue Polarisierung könnte auch technologisch bedingt sein. Anstelle nationaler oder universeller Medien wird die Realität im Hinblick auf rivalisierende Erklärungs- und Lösungsansätze für Krisen zunehmend selektiv gefiltert. Man bewegt sich in Informations- und ideologischen Blasen. Menschen beziehen ihre Informationen und ihre Ansichten aus Quellen, die sie ausgewählt haben, weil sie mit ihren eigenen Ansichten und Vorurteilen übereinstimmen; und immer häufiger auf Plattformen, die die Wünsche und Konsummuster der Verbraucher algorithmisch vorhersagen. Auf diese Weise erhalten die Menschen genau die Nachrichten und Meinungen, die ihre eigenen Neigungen und Identitäten bestärken. Politische Einordnungen sind wenig mehr als ein Ausbau smarter Werbung. Dass Menschen sich derart in selbstreferenziellen Blasen bewegen, ist nichts Neues, doch das Phänomen ist offensichtlicher geworden und wird breiter diskutiert.
Liberale Politik beruht auf einer Debatten- und Streitkultur; antiliberale Politik beruht auf einer gegenseitigen Dämonisierung, die das Ergebnis einer solchen Streitkultur sein kann. Das stellt Liberale vor ein riesiges Dilemma: Bestätigen sie nicht die dualistische Weltsicht und alle Grundannahmen ihrer politischen Gegner, wenn sie sich dazu verleiten lassen, diese zu dämonisieren? Heute wissen wir, dass der militante Antitrumpismus zu einer Mobilisierung eines bedeutenden Teils der Bevölkerung geführt hat, der dem Angriff des Präsidenten auf die liberale politische und kulturelle Elite etwas abgewinnen konnte. Das größte Argument für einen Brexit hatte nichts mit übermäßigen EU-Regulationen zu tun, sondern basierte auf dem Argwohn und der Feindseligkeit gegenüber jenen Expertinnen und Experten, die Argumente über diese Regulationen hervorbrachten.
Und dann ist da noch der »Ausnahmezustand«, ein politisches Konstrukt, das in Krisenzeiten zwar sinnvoll sein kann, aber auch das Tor öffnet für außergewöhnliche Missstände, Chaos und Schäden. Er soll nicht nur bestehende Regeln und Prozesse aushebeln, sondern auch die Sprache unterwandern. Historisch gesehen reagierten Demokratien mit Ausnahmezuständen auf die Weltwirtschaftskrise der 1930er-Jahre und den Zweiten Weltkrieg. In der Gegenwart war der Ausnahmezustand nach der Finanzkrise, als »große Bazookas«, »Shock and Awe« und »alles Notwendige« beschworen wurden, wieder in aller Munde – und vielleicht sogar noch stärker während der Coronapandemie 2020. Es wäre töricht, zu bestreiten, dass Notsituationen Ausnahmereaktionen erforderten, oder zu behaupten, Gesellschaften könnten nach Katastrophen einfach wie gewohnt weitermachen. Es stimmt aber auch, dass das Aussetzen bewährter institutioneller Schutzmechanismen zu einem Heer an Unregelmäßigkeiten, Korruption und Unternehmenswohlfahrt führen, und somit die etablierte organisatorische Legitimität und Funktionsfähigkeit untergraben kann. Im Europa der Zwischenkriegszeit etablierte sich Carl Schmitt zum Vordenker des Ausnahmezustandes: Er sah darin den Vorläufer einer neuen Politik. Seine Politische Theologie, die 1922 mitten in der (Hyper-)Inflationskrise der Weimarer Republik erschien, beginnt mit einer erstaunlichen Neudefinition der Souveränität: »Souverän ist, wer über den Ausnahmezustand entscheidet. Diese Definition kann den Begriff der Souveränität als einen Grenzbegriff allein gerecht werden.«10
Diese historischen Beobachtungen lassen mehrere Schlussfolgerungen zu: einerseits, dass die Konzepte der freiheitlichen Gesellschaft und des Markplatzes der Ideen grundlegend falsch und dass der Markt die Ursache für die absurden Berg- und Talfahrten der Wirtschaft seien, die von Ökonominnen und Ökonomen erforscht werden. Der Markt muss reguliert werden. Doch wer sollte diesen Markt der Ideen regulieren? Und auf welcher Grundlage? Ist dieser Gedanke selbst nicht ein Einfallstor für Tyrannei und Unrecht?
Die andere mögliche Schlussfolgerung ist die Prämisse dieses Buches. Der Marktplatz funktioniert nicht, weil die Ideen nicht korrekt bewertet werden können. Sie verändern sich zu schnell, sind zu unklar definiert. Der Marktplatz funktioniert nicht, weil es keine Preise gibt, an denen der Tauschhandel sich orientieren könnte. Der Preis ist die Bedeutung, aber die Bedeutungen jedes Begriffs sind unklar. Daher kann der Preis nicht festgelegt werden.
Die politischen Begriffe wurden von verschiedenen Ländern immer wieder ausgiebig diskutiert, wurden vor dem Hintergrund der spezifischen nationalen Traditionen zu Deutungen und Verständnis so sehr verändert, dass man ihre Nutzung woanders formen und pervertieren konnte. Sie werden aber alle von dem Gedanken der Spillovers zwischen verschiedenen politischen Systemen geprägt. Teilweise mag dieser Spillover-Effekt auch erklären, warum die reaktionäre Gegenbewegung ausgerechnet in jenen Ländern am stärksten ist, die wiederum die Idee der globalen Ordnung im 20. Jahrhundert entscheidend geprägt hatten. Mit dem Brexit-Referendum und der Wahl Donald Trumps ist ein neuer Politikstil entstanden, der die liberale internationale Ordnung gefährdet, die nach dem Sieg über den Nationalsozialismus im Jahr 1945 aufgebaut und nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion zwischen 1989 und 1991 noch einmal gestärkt worden war. Das Vereinigte Königreich und die Vereinigten Staaten waren die wichtigsten Architekten der politischen Ordnung nach 1945 mit der Erschaffung der Vereinten Nationen, aber scheinen heute an der Spitze einer entgegengesetzten politischen Bewegung zu stehen, die sich auf wechselhafte, inkonsistente (und vor allem innenpolitisch stark umkämpfte) Weise vom Multilateralismus abwendet.
Die Vereinigten Staaten gaben die internationale Sprache der Ideen im 20. Jahrhundert vor. Sie übernahmen den Staffelstab von Frankreich und Deutschland, die das vorherige Jahrhundert dominiert hatten. Walter Lippmann, der als Vater des modernen politischen Journalismus gilt und großen Einfluss auf Woodrow Wilson hatte, als dieser die USA auf die politische Weltbühne führte, ist für viele Begriffsbildungen bekannt. Im Gegensatz zu Carl Schmitt mussten Begriffe seiner Ansicht nach nicht immer polarisieren. Er erkannte, dass jede Analyse auf klar definierten Konzepten beruhte, und lieferte diese häufig gleich selbst mit. Er erfand die Idee des Stereotyps, für den diese Begriffe häufig gehalten werden, sowie den Begriff des Kalten Kriegs, vor dessen Hintergrund die politische Sprache erstmals polarisierte und mobilisierte. Seine eigene Sicht der Dinge wandelte sich mehrmals recht schnell: vom jugendhaften Sozialismus, zu einem uneingeschränkten Glauben an die Wissenschaft, zum Wilsonianismus, zum Skeptizismus gegenüber Mehrheitsentscheidungen und Demokratie, zur Ablehnung des Wilsonianismus und schließlich zu dem Versuch, Realpolitik mit einer umfassenden Religion zu verbinden, obwohl er der organisierten Religion sein Leben lang skeptisch gegenüberstand. Nach dem Börsencrash von 1929 schlussfolgerte er:
Das eigentliche Problem der heutigen Welt ist, dass die Demokratie, die nun endlich an der Macht ist, eine Kreatur des unmittelbaren Augenblicks ist. Ohne eine übergreifende Autorität, ohne religiöse, politische oder moralische Überzeugungen, die ihre Meinungen steuern, fehlen ihr Zweck und Zusammenhalt. Eine solche Demokratie ist zum Scheitern verurteilt.11
Lippmann wird auch mit dem Wort Neoliberalismus in Verbindung gebracht, das auf einem Pariser Kolloquium im Jahr 1938, also kurz vor Ausbruch des Zweiten Weltkrieges, als Schlagwort für Lippmanns Ideen geprägt wurde. Auch kritisierte er oft den Globalismus. Dieser schien wie eine Erklärung für die Verbindungen, die nun die Welt zusammenbrachten. Um heutige Stereotype aufzulösen, müssen wir zu den Grundlagen für Lippmanns Definitionen zurückkehren und diese neu denken.
Die Begriffe, die in diesem Buch untersucht werden, waren einst klar definiert. Doch je modischer und beliebter sie wurden, desto größer wurde auch der Drang, ihre Verwendung auszuweiten und ihnen quasimetaphorische Bedeutungen zuzuschreiben. In diesem neuen Begriffsuniversum kann das Original kaum noch von der Metapher unterschieden werden, zudem werden Wortbedeutungen überdehnt und aufgebläht. Moral und Moralismus haben Einzug in das Vokabular gehalten und machen aus Wörtern simple Labels, meist zur Verurteilung anderer. Aus vielen Begriffen, die ursprünglich konkrete politische oder soziale Phänomene benannten, werden so ganz einfach Beschreibungen geistiger Zustände. Paradoxe und politische Verwirrung sind die Folge: Die Begriffe infizieren die politische Debatte und verwandeln sich in dämonisierende Wörter.
Die verbale Verwirrung unserer politischen Debatten lädt zu einer Analogie mit der Inflation, der Erweiterung von Krediten und der Vergrößerung der Geldmenge ein. Daher werden sich meine nächsten Betrachtungen mit den Zusammenhängen zwischen Geld und Informationen sowie Ideen beschäftigen, und dann mit den Veränderungen in der Geldpolitik, die, ausgelöst von starken ökonomischen Schocks, neue Gesellschaftsformen hervorbringen können. In meiner Untersuchung des Multilateralismus werde ich ein Kernproblem des finanziellen und geldpolitischen Multilateralismus herausarbeiten: seine Fixierung auf eine nationale Währung, den US-Dollar. Wie sähe eine Welt mit echter Währungsdiversität aus, mit klaren Äquivalenzen, die zu einem nahtloseren Handel und Umtausch führen würden? Würde das in einer globalisierten Welt, die nun von Geld und Informationen getrieben ist, zu mehr Flexibilität in sozialen und politischen Kategorisierungen führen?
Ein gutes Beispiel für einen valenzverschiebenden Terminologiewandel ist der Begriff der Gerechtigkeit, der Mitte des 19. Jahrhunderts als soziale Gerechtigkeit und ab dem 20. Jahrhundert als globale Gerechtigkeit neu definiert, erweitert und schließlich sabotiert wurde. Die Hinwendung zum Thema der sozialen Gerechtigkeit begann als reaktionärer Angriff auf die aus der Französischen Revolution hervorgegangene Idee universeller Rechte und Freiheiten. 150 Jahre später hatten sich die politischen Vorzeichen umgekehrt. So kam es Ende des 20. Jahrhunderts zu Kritik seitens der Linken an konventionellen beziehungsweise klassisch liberalen Anliegen in Bezug auf Rechte und politische Gleichberechtigung, was eine destruktive Spirale sich stetig ausweitender Forderungen auslöste. Infolgedessen wurde die klassische Funktion der Gerechtigkeit als Kern staatlicher Legitimität untergraben. Auseinandersetzungen um die Umverteilung, gerechtfertigt durch das Bestreben nach immer lockereren Gerechtigkeitsgrundsätzen, erodieren ebenfalls das Potenzial zur Schaffung von Wohlstand und Prosperität als Grundlage für ein umfassenderes Maß an menschlicher Wirkmacht.
In den aktuellen Debatten über die Globalisierung und ihre Probleme schwirren zahlreiche Begriffe umher und manche Leser und Leserinnen werden sich vielleicht darüber wundern, dass ihr Lieblingsglobalisierungswort kein eigenes Kapitel bekommen hat. Manche Begriffe sind zwar wichtig, ihre Verwendung jedoch nicht umstritten. Das Thema der Ungleichheit streife ich in einigen Kapiteln über andere Begriffe, ohne ihm ein eigenes zu widmen. Thomas Piketty, Tony Atkinson und Branko Milanović haben in den letzten Jahren einflussreiche Bücher zu diesem Thema veröffentlicht.12 Der Handel sowie Waren- oder Finanzflüsse gehören zur Standardanalyse der Globalisierung und werden daher auch im zugehörigen Kapitel behandelt.
Das andere Extrem sind Wörter, die inzwischen so fluide genutzt werden, dass sie konzeptuell kaum noch zu fassen sind. Manche Begriffe, die in der politischen Debatte hoch im Kurs stehen und inflationär gebraucht werden, werden hier nur an solchen Stellen behandelt, wo sie die anderen Begriffe betreffen: Insbesondere der Begriff des Faschismus ist ein allgegenwärtiges Schimpfwort geworden. So wird Trump häufig als Faschist bezeichnet, der wiederum seine politischen Gegner regelmäßig als Linksfaschisten beschimpft.
Ein anderer, sehr weitverbreiteter Begriff ist für dieses Buch von zentraler Bedeutung: Liberalismus. Eine Diskussion dieses Begriffs – vages Ehrenabzeichen für die einen, hasserfüllter Kampfbegriff für die anderen – erfordert eine nuancierte und kontextualisierte Definition. Helena Rosenblatt hat die komplexe Geschichte dieses Begriffs kürzlich sehr detailliert nachgezeichnet: wie die Atlantischen Revolutionen des späten 18. Jahrhunderts sich ein römisches Ideal aneigneten und es »christianisierten, demokratisierten, sozialisierten und politisierten«, bis es ihren revolutionären Zielen entsprochen habe.13 Seither war der Begriff des Liberalismus in aller Munde, sodass die US-amerikanische Historikerin Jill Lepore ihn schlicht als »den Glauben« beschreiben konnte, »dass die Menschen gut sind und frei sein sollten, und dass die Menschen Regierungen einsetzen, um diese Freiheit zu garantieren.«14
Einige weitverbreitete Begriffe überlappen mit oder haben ein enges Verhältnis zu anderen. Daher werde ich Imperialismus, der die Geschichte der Globalisierung entscheidend geprägt hat und heute sehr flexibel verwendet wird (weil die Untersuchung der Ausweitung der formalen Herrschaft um ein informelles Verständnis von Imperien erweitert wurde), im Kontext der Hegemonie behandeln.
Es ist tatsächlich der Kern unserer aktuellen Dilemmata, wie jeder der Begriffe definiert werden soll. Ihre unklaren Bedeutungen stellen ein Hindernis für eine produktive Debatte und die Anwendung einer rigorosen Logik dar. Damit Lösungen für drängende Probleme gefunden werden können, muss jeder dieser Begriffe in einem Akt intellektueller Entrümpelung neu gedacht werden. Die Lifestyle-Influencerin Marie Kondō hat eine sehr erfolgreiche Aufräummethode entwickelt, bei der Menschen ihr Zuhause im Sinne einer minimalistischen Ästhetik in Ordnung bringen können. Gegenstände, die »nicht mehr glücklich machen«, werden aussortiert. Das Kondō-Prinzip sieht vor, dass Familien gemeinsam die Gegenstände früherer Generationen durchgehen. Eine Übertragung dieser Methode auf die intellektuelle Hygiene würde bedeuten, dass aus der familiären Aufräumaktion eine nationale und internationale Debatte wird: eine Entrümpelung, die Platz für jene Ideen schafft, die »die kreativ machen«. Um noch einmal Mill zu zitieren: »Aber wenn wir uns zu Gegenständen wenden, die unendlich viel komplizierter sind, etwa zu Fragen der Moral, der Religion, der Politik, oder zu soziologischen Beziehungen und den Geschäften des täglichen Lebens, so bestehen Dreiviertel der Argumente in der Bekämpfung der Gründe, die für die entgegengesetzte Meinung sprechen.«15
Zuerst müssen wir verstehen, woher die Ideen kommen und warum sie so dermaßen generalisiert und globalisiert wurden, dann aber sollten wir mit der Frage enden, wie ihre Bedeutungen und Verwendungen, die ihre ursprüngliche Konzeptualisierung vorangetrieben hatten, wiederhergestellt werden können. Wenn wir verstehen, wie sich die Bedeutungen der Begriffe in verschiedenen nationalen Kontexten, mit der Beschleunigung der Lebenswelt und dem technologischen Wandel verändert haben, können wir uns wieder auf das Wesentliche besinnen. Dafür müssen wir uns nicht nur über die Ursprünge des gesellschaftlichen Zusammenhalts und der politischen Organisation Gedanken machen, sondern auch über die Begriffe (die politische Sprache) und die Instrumente (das Geld), die wir nutzen, um unsere eigenen Erfahrungen in unsere Ideen über die Erfahrungen anderer zu übersetzen. Damit wir uns wieder auf das wirklich Wichtige konzentrieren können, müssen wir einen Blick in die Vergangenheit werfen, um zu verstehen, was jene Begriffe bedeuteten, bevor unser Wortschatz durcheinandergeriet.
Über Niedergang, Verfall, Entkopplung und deren Rhetorik
Vorwort zur deutschen Ausgabe
Globalisierung bringt die Welt näher zusammen: Menschen, Dinge, Ideen, Geld – alle befinden sich in ständiger Bewegung. Doch die derzeitigen Gespräche über Globalisierung polarisieren stark. Worte haben ihre Bedeutung verloren und die Streitkultur verfällt, was zur Polarisierung der Gesellschaft beiträgt. In diesen entmutigenden Zeiten werfen sich politische Gegner gegenseitig voller Inbrunst individuelle Begriffe und Ausdrücke an den Kopf. Sie beteiligen sich an einem unerbittlichen Schlagabtausch, der einem übereifrigen Tennismatch gleicht. Leider löst sich das linguistische Gewebe unserer Sprache durch solche unermüdlichen Wortgefechte immer weiter auf, wie auch ein Tennisball durch exzessives Spiel irgendwann sein vorzeitiges Ende findet. Das zeigt sich gut an folgendem Schlagwort, das unser Bewusstsein in den letzten zehn Jahren in Atem gehalten hat: »Fake News«. An der eher kurzen Beliebtheit, derer sich die »Fake News« erfreuten, erkennt man die flüchtige Natur einer solchen linguistischen Konstruktion.
Das Konzept »Fake News« läutete eine Demokratiekrise ein. Wahlsiege wurden Falschinformationen oder Fake News zugeschrieben und das Verbreiten falscher Informationen wurde schnell zum Erfolgsmodell. Washington Post und Buzzfeed schrieben Donald Trumps Wahlsieg 2016 Facebook-Manipulationen zu; anschließend verwendete Trump das Label »Fake News«, um seinerseits den »Mainstream« anzugreifen. Trump erklärte auf der Conservative Political Action Conference: »Ich sage Ihnen, wir bekämpfen Fake News. Sie sind falsch, erfunden und falsch. Vor ein paar Tagen habe ich Fake News als ›den Feind des Volks‹ bezeichnet und das sind sie auch. Sie sind der Feind des Volks. Denn sie haben keine Quellen. Wenn es keine gibt, erfinden sie einfach welche.«1 Die Bezeichnung gelangte schnell auch in den deutschen Sprachgebrauch, als die AfD kurzzeitig erfolglos versuchte, ein »Aussteiger-Programm für Mainstream-Journalisten«2 zu starten. Margaret Sullivan, die für die Washington Post aus dem Weißen Haus berichtete, zog den Schluss: »Es ist an der Zeit, dass wir uns von dem vergifteten Terminus ›Fake News‹ verabschieden.«3
Der Analyst Henri Gendreau interpretierte den rasanten Aufstieg und das ebenso schnelle Ausbrennen des Konzepts als eine Besonderheit unserer Gegenwart, beziehungsweise dessen »was mit Faktizität passiert, wenn Menschen durch Algorithmen ersetzt werden.«4 Die Idee, Worte als politische Waffe zu nutzen, ist wesentlich älter. So auch die Tatsache, dass Worte im Zuge dieser Instrumentalisierung ihre Bedeutung verlieren. Der großartige Politikwissenschaftler und Historiker Karl Dietrich Bracher diagnostizierte in den 1970er-Jahren der studentischen Linken, sie marschiere nicht durch die Institutionen, stattdessen veranstalte sie einen »Marsch durch die Wörter«. Er fragte:
Sind historische Wörter, die sich in demselben Maße von ihrem ursprünglichen Kontext entfernen, in dem sie als Kampfbegriffe manipulierbar werden und in der gegenwärtigen Flut neuer Schlagwörter untertauchen, überhaupt noch als aussagefähig ernst zu nehmen, können sie noch etwas zum Verständnis der Geschichte leisten oder fällt ihr Gebrauch letzterdings unter das Verdikt einer Sprachkritik, die auf Enthistorisierung hinausliefe?5
Die neue Rechte nahm die Idee in den 2010er-Jahren ebenfalls auf, und kämpfte mithilfe linguistischer Manipulation.
Die Idee, sich Worte zunutze zu machen, ist älter. Goethe, der ein entscheidendes Globalisierungskonzept erfand (Weltliteratur), legt Mephistopheles die diabolische Verwendung von Worten in den Mund, als dieser einem jungen Studenten rät:
Im Ganzen — haltet euch an Worte! Dann geht ihr durch die sichre Pforte Zum Tempel der Gewißheit ein. […] Denn eben wo Begriffe fehlen, Da stellt ein Wort zur rechten Zeit sich ein. Mit Worten läßt sich trefflich streiten, Mit Worten ein System bereiten, An Worte läßt sich trefflich glauben […].6
Der romantische Dichter Joseph von Eichendorff erklärte seinerseits, wie ein »Ratskollegium« funktionierte: »Doch werden die Zeiten so ungeschliffen, / wild umzuspringen mit den Begriffen.«7
Die alten Echokammern wurden durch die Computer-Algorithmen noch stärker gefestigt, außerdem gilt es als gesichert, dass die rapiden Fortschritte im Bereich der KI diesen Prozess noch beschleunigen und damit destruktiver gestalten werden. ChatGPT, ein generatives KI-Programm, sorgte bereits für Aufsehen mit seinen »Halluzinationen«, in denen es völlig falsche Geschichten, Bibliografien und Biografien entwarf. Alles scheint unwirklich. Bedeutungsleere Unterhaltung liefert eine neue Schablone für politische Sprache. Zu Beginn der Trump-Ära konstatierte ein Artikel in der New York Times, alles sei jetzt wie Wrestling. World Wrestling Entertainment ist »eine inszenierte ›Realität‹, in der geskriptete Geschichten sich ungehindert mit realen Ereignissen vermischen, wobei die verschwommene Grenze zwischen wahr und falsch die Abhängigkeit des Publikums vom Melodrama nur noch verstärkt.«8 Rick Rubin, US-amerikanischer Musikproduzent und Mitbegründer von Def Jam, meinte, die gestellte Wrestling-Show »WWE ist real, es sind die politischen Nachrichten der Mainstream-Medien, die fake sind.«9
Dementsprechend unterläuft oder untergräbt Sprache den Prozess der Verbundenheit, den man mit der Globalisierung assoziiert. Für eine gemeinsame Welt müssen wir uns über Sprache und deren Verwendung einig werden. Es kann keine eine Welt geben, da es nicht das eine Wort gibt.
Rhetorische Konflikte können zu weiterer Spaltung führen, nicht nur zwischen einzelnen Nationen, sondern auch innerhalb einer Nation. Vor allem funktioniert die moderne Politisierung von Worten und Begriffen wie Fake News über das Kultivieren eines Gefühls von Verlust und einer Opferrolle. Sprache wird genutzt, um einen Opferstatus zu definieren und auszustellen. Immer mehr Gruppen sehen sich als Opfer: Schwarze Amerikanerinnen und Amerikaner sind Opfer des langanhaltenden Vermächtnisses der Sklaverei, weiße Amerikanerinnen und Amerikaner sind Opfer von Immigration und Wokeness. Die zunehmende Polarisierung in den Vereinigten Staaten findet sich auch in anderen Gesellschaften wieder: Debatten über Migration rühren in Europa an tiefsitzenden historischen Empfindlichkeiten, wo islamische Migration zusätzliche Ängste freisetzt und wo das historische Vermächtnis des Ethnonationalismus traumatisch ist.
Zwei Prozesse machten Worte zum Ursprung eines neuen Unbehagens: rhetorische Inflation und rhetorischer Imperialismus. Beide Prozesse – die sich sogar in der kurzen Zeit, die seit der Veröffentlichung der englischen Ausgabe von »Der Krieg der Worte« vergangen ist, noch beschleunigt haben – werden in diesem Buch analysiert; außerdem enthält es ein neues Kapitel, das sich mit einem entscheidenden Teil dieser Debatte über eine zeitgenössische globale Ordnung auseinandersetzt: der Forderung nach globaler Gerechtigkeit.
Es fällt auf, dass die destruktiven Auswirkungen linguistischer Zerrissenheit besonders in reichen Ländern auftreten, die von der Idee eines drohenden Niedergangs besessen sind. In dieser Hinsicht ist der Diskurs in Deutschland dem in den Vereinigten Staaten auffallend ähnlich. Vollkommen verschiedene Einschätzungen des Globalisierungsprozesses und seiner zukünftigen Entwicklung spalten die globalisierte Welt. Länder mit mittlerem Einkommen – Schwellenmärkte – schießen sich auf die Chancen einer neuen Dynamik ein. Selbst in vielen Ländern mit niedrigem Einkommen hofft man, mithilfe von Technologie einige Entwicklungsstadien überspringen zu können. Derweil bleibt der reiche Teil der Welt unzufrieden und gespalten.
In ausgewachsenen Industriegesellschaften, vor allem in den Vereinigten Staaten, löst Globalisierung Skeptizismus und Überdruss aus. Larry Fink von Black Rock traf letztes Jahr einen Nerv, als er das Ende der Globalisierung erklärte. Politiker und Politikerinnen sprechen von Friend-shoring und Entkopplung. Vielleicht hatten sie sich von Gwyneth Paltrows linguistische Neuschöpfung des »bewussten Entkoppelns« (conscious uncoupling, als Umschreibung für Scheidung) inspirieren lassen. Worte verwandeln sich dann in Mechanismen, die Menschen für ihre eigene Entkopplung nutzen. Weitere Metaphern wären Fragmentierung und Blockbildung. Kristalina Georgieva, geschäftsführende Direktorin des IWF, meint: »Obwohl wir an verschiedenen Fronten mehr internationale Zusammenarbeit benötigen, sehen wir uns dem Schreckgespenst eines neuen Kalten Kriegs gegenüber, der die Welt in rivalisierende Wirtschaftsblöcke aufteilen könnte.«10 Die neuen Beschreibungen sind Varianten eines altbekannten Mantras – Haltet die Welt an, ich will aussteigen.
Die Vereinigten Staaten sind seit Langem vom nationalen Niedergang besessen. Donald Trumps zentrale Strategie verließ sich auf das Heraufbeschwören eines Gefühls der Hoffnungslosigkeit, indem er die Trostlosigkeit der Gegenwart beschwor. Seine Amtsantrittsrede stand unter dem Thema »American Carnage« (dem Gemetzel Amerikas):
Viele Jahrzehnte lang haben wir ausländische Industrien auf Kosten der amerikanischen Industrie reicher gemacht; die Armeen anderer Länder finanziell unterstützt, während wir unsere eigene Armee ausgehungert haben. Wir haben die Grenzen anderer Länder verteidigt, aber uns geweigert, unsere eigene zu verteidigen. Wir haben Billionen und Aberbillionen von Dollar im Ausland ausgegeben, während die amerikanische Infrastruktur zerfallen ist. Wir haben andere Länder bereichert, während sich der Reichtum, die Stärke und das Selbstbewusstsein unseres eigenen Landes sich über dem Horizont aufgelöst hat. Eine Fabrik nach der anderen schloss und verließ das Land, ohne auch nur einen Gedanken an die Millionen und Abermillionen amerikanischer Arbeiter zu verschwenden, die zurückgelassen wurden. Der Reichtum unsere Mittelklasse ist von ihr gerissen und in der ganzen Welt verteilt worden.11
Das Wahlversprechen lautete »Make America Great Again«, doch hauptsächlich sorgte man nur für ein noch tiefgreifenderes Gefühl nationaler Verzweiflung.
Europa hatte seine ganz eigene Version eines von Zerfall geprägten Selbstbilds. Jedes Mal, wenn die deutsche Wirtschaft einen kleinen Schock erleidet – wie zum Beispiel nach dem russischen Angriff auf die Ukraine –, beginnt eine nationale Nabelschau. Die großen europäischen Länder lebten mit der Geschichte vom Verlust eines Imperiums und einer Historie relativen Niedergangs. Als aus der Globalisierung im 20. Jahrhundert die Hyperglobalisierung wurde, behaupteten führende Politiker und Politikerinnen in Europa zunehmend, dass eine europäische Integration notwendig sei, damit Europa wieder zu einer bestimmenden Kraft in der Welt werden könnte. Somit wurde Europäischsein zur Antwort auf den drohenden Niedergang.
Die Währungsunion und die Einführung einer gemeinsamen Währung in Form des Euros stellten im 20. Jahrhundert die institutionell komplexesten Aspekte der europäischen Integration dar. In den 1960er-Jahren kritisierten europäische Staatsmänner – und besonders französische Politikschaffende – die politischen Vorteile, die sich für die Vereinigten Staaten mutmaßlich aus dem festen Wechselkurssystem der Bretton-Woods-Ordnung ergaben. Der französische Finanzminister Valéry Giscard d’Estaing sprach 1965 von einem »exorbitanten Privileg«; Staatspräsident Charles de Gaulle erklärte Alain Peyrefitte: »Kein Bereich entkommt dem amerikanischen Imperialismus. Er nimmt alle möglichen Formen an. Die tückischste ist die des Dollars.«12 De Gaulles Nachfolger Georges Pompidou sah in der Währungsunion eine »Karte«, die Europäer im internationalen Machtspiel ausspielen konnten. Und später sahen Giscard (mittlerweile französischer Staatspräsident) und der deutsche Bundeskanzler Helmut Schmidt in der Politik den Hauptgrund, weswegen Europa auf Währungsebene handeln musste. Ganz wie Schmidt zu Giscard meinte: »Die Amerikaner dürfen nicht länger glauben, dass wir nach ihrer Pfeife tanzen.«13
In der Praxis griffen Populisten den Euro immer wieder an und stellten seine Daseinsberechtigung infrage. Die Erklärung, ein scheinbarer Verlust der Souveränität sei die notwendige Antwort auf die Herausforderungen der Globalisierung, führte zwangsläufig zu folgender Frage: Weshalb ist diese Globalisierung überhaupt notwendig? Dementsprechend hingen antieuropäische und antiglobale soziale Bewegungen eng miteinander zusammen. Die AfD begann als Anti-Euro-Partei, anschließend richtete sie sich gegen Einwanderung, dann gegen Klimaschutz und schließlich verwandelte sie sich in eine prorussische Bewegung.
Je mehr sich Politiker und Politikerinnen in reichen Ländern mit der Sprache der antiglobalistischen Herausforderung auseinandersetzen mussten, desto mehr schienen sie einen Antiglobalisierungskurs einzuschlagen. Die Frustration über Lieferengpässe nach der Coronapandemie verwandelt sich oft in Sorge über die Abhängigkeit von ausländischen Ressourcen. Es herrschen verschiedene Ängste: russisches Gas, die Alternativen aus dem Persischen Golf, aus US-amerikanischem Fracking, aus Gasfeldern in den Niederlanden oder in Norwegen; Halbleiterchips aus Taiwan; Elektronik aus China; Antibiotika aus China und Indien. Ein naives Vertrauen in die globale Vernetzung scheint nicht länger möglich. Angela Merkel wurde als »Merkantilistin« dämonisiert, weil sie auf Globalisierung setzte. An ihre Stelle trat eine noch trügerischere Logik: Wäre es nicht besser, all diese internationalen Verbindungen abzubauen und sich stattdessen auf nationaler Ebene mit nationalen Bedürfnissen auseinanderzusetzen? Während der Nachwehen der Finanzkrise von 2008 verlor die Globalisierung an Fahrt. Die Pandemie und der Krieg Russlands führten zu einer neuen Auseinandersetzung mit nationaler Autarkie.
Die momentan herrschende linguistische Verwirrung hat eine lange Vorgeschichte. Die Belastungen der Globalisierung treiben führende Politiker und Politikerinnen dazu, die Realität mithilfe linguistischer Verwirrspiele falsch darzustellen und neue Machtdynamiken zu erschaffen. Als er sich mit der Pariser Friedenskonferenz von 1919 auseinandersetzte, schimpfte der britische Ökonom John Maynard Keynes über »Sophisterei und jesuitische Exegese«.14 Mitte der 1970er-Jahre bedrohten die stark angestiegenen Ölpreise die industrialisierte Welt, woraufhin sich Henry Kissinger auf eine kühne rhetorische Strategie verlegte, um die Macht der Vereinigten Staaten zu sichern. Er war der Meinung, die Vereinigten Staaten sollten die neue internationale Wirtschaftsordnung, wie sie die Entwicklungsländer vorschlugen, nicht akzeptieren, gleichzeitig sollten sie aber ebenso wenig militärisch gegen die Ölproduzenten vorgehen (er sprach davon, nicht auf die Barrikaden zu gehen). Stattdessen wollte er »die Sache aufmischen« (eine Formulierung, die Richard Nixon Kissinger aufgedrängt hatte). Kissinger drückte es wie folgt aus:
Meine Aufgabe besteht darin, ein Bild der Vereinigten Staaten nach außen zu tragen, das sie fortschrittlich zeigt. [Alan] Greenspan [ein Wirtschaftsberater, der später Vorsitzender der US-Notenbank wurde,] ist Theoretiker. Er will an einem System festhalten, das niemand unterstützen wird. [Helmut Schmidt] meinte zu mir, wenn wir uns in Bezug auf Rohstoffe nicht zusammenreißen, wird er allein weitermachen. Ich möchte die Sache aufmischen.
Er erkannte, dass man sich ins eigene Fleisch schneiden würde, wenn man das existierende System verteidigte, und dass die politischen Anführer wie ihre österreichischen Kollegen im 19. Jahrhundert (besonders wie Metternich) enden würden, wenn sie sich gegen den Meinungsumschwung stellten, nämlich verschmäht und zurückgewiesen.15 Man brauchte also eine neue Sprache, um die alte Ordnung verteidigen zu können.
Neue Ängste bringen auch einen Skeptizismus gegenüber Wachstum mit sich. Vielleicht werden Ressourcen im Zuge von Deglobalisierung weniger gut oder zu weniger günstigen Preisen verfügbar sein. Doch sind all diese Waren, die von weither kommen, wirklich notwendig? Wäre es für die Welt nicht besser, wenn sie nicht in erster Linie über Wachstum nachdenken würde und sich stattdessen mehr auf Nachhaltigkeit und Klimaneutralität konzentrierte, welche sich durch eine einfachere Lebensweise vielleicht eher erreichen ließen?
In Japan und Deutschland entwerfen Bestseller über politische Ökonomie eine Logik des Nicht-Wachstums. In Japan berief sich der Philosoph Kohei Saito auf die frühen Schriften von Karl Marx, um zu erklären, wie der Kapitalismus in Bezug auf die Umwelt an seine Grenzen gekommen sei und durch einen wachstumskritischen Kommunismus ersetzt werden sollte;16 in Deutschland folgte Ulrike Hermann derselben Logik, um das »Ende des Kapitalismus« vorherzusagen.17 Die wachstumskritischen Botschaften von Saito und Hermann bauten auf Anti-Preis- und Anti-Globalisierungslogiken auf.
Die Beliebtheit solcher Annahmen geht weniger auf die ihnen zugrundeliegende Logik zurück als auf die demografische Schicht, in der sie Anklang finden. Japan und Deutschland sind extreme Fallbeispiele für ein Phänomen, das in der industrialisierten Welt und mittlerweile auch in China stark um sich greift: eine schrumpfende und alternde Bevölkerung. Die Alten sorgen sich zwangsläufig um ökonomische Tragfähigkeit, und die Jungen fürchten, die Alten könnten das politische System zu ihrem eigenen Vorteil manipulieren. Charles Goodhart und Manoj Pradhan weisen in einem wichtigen Buch sogar darauf hin, dass das Ende eines niedrigen Inflationsregimes die Folge eines demografischen Übergangs sein könnte.18
Das wirkmächtige Heraufbeschwören einer Welt, mit der es bergab geht, entspricht nicht der Realität. Man kann Deglobalisierung in der Sprache finden, jedoch nicht in den Zahlen. Der Welthandel wächst. Sogar der Handel zwischen China und den Vereinigten Staaten, der im Mittelpunkt des Entkopplungsnarrativs steht, wächst. Internetkommunikation und Datentransfer wachsen weiterhin exponenziell. Nachdem man sich zunehmend von der Pandemie und den Lockdowns erholt hat, bewegen sich Menschen nun wieder häufiger über Ländergrenzen hinweg. Führt man die Analogie von Gwyneth Paltrow weiter, hat das in Scheidung lebende Paar mehr und mehr Sex miteinander, während gleichzeitig beide Partner allerorts ihren Hass aufeinander bekunden. Dieses Paradox lässt Analysten und Analystinnen perplex zurück: Entweder sie schauen auf die Rhetorik und sagen, dass sich die Wirtschaft wie Wile E. Coyote verhält, der in der Luft weiterrennt, obwohl er schon über den Klippenrand hinaus ist. Oder sie schauen sich den Handel an und sagen, dass die politische Gemeinschaft und viele Analystinnen und Analysten Fake News zum Opfer gefallen sind.
Die Unzufriedenheit der reichen Länder verschärft die Debatte. Während die Reize der Globalisierung zu schwinden scheinen, ist es verführerisch, die Welt als Nullsummenspiel anzusehen. Wenn Sie gewinnen, muss ich verlieren. Wenn ich verliere, werden Sie gewinnen. Dementsprechend besteht das US-Narrativ zum großen Teil darin, einen technologischen Vorteil gegenüber China zu bewahren, besonders indem man die fortschrittlichsten Halbleiter beschränkt. Sogar global ausgerichtete Intellektuelle, die Wettbewerb gegenüber positiv eingestellt sind, müssen darauf bestehen, dass die Vereinigten Staaten im Wettrennen mithalten können.
Die Rhetorik der reichen Länder, die darauf bestehen, Nr. 1 zu sein, löst automatisch eine konfrontative Gegenreaktion aus. Das ist besonders in den großen Ökonomien der Fall, die gerade dabei sind, aufzuholen und deren Ziel es ist, die Vereinigten Staaten mithilfe ihrer Technologien und der fortschreitenden Modernisierung ihrer Ausbildungssysteme abzulösen. Die Überzeugung, die Vereinigten Staaten würden alles tun, ja, wirklich alles, um China an der Übernahme der weltweiten Führungsposition zu hindern, bildet die Grundlage für eine ganz eigene wirkmächtige und konfrontative Rhetorik. Diplomatinnen und Diplomaten sind nicht länger diplomatisch, stattdessen werden aus ihnen wettstreitende »Wolfskrieger«. Das Gefühl der Bedrohung treibt China, ein Land, das bisher keine Allianzen einging, außerdem dazu, eine Beziehung zu Russland zu pflegen. Ein solches Land erscheint mit seinen Nuklearwaffen und seiner starken antiwestlichen Einstellung, die sich nicht nur auf Worte beschränkt, als eine vielversprechende Möglichkeit, die eigene Macht auszuweiten und die Realität der Herausforderung Chinas zu verstärken.
Das Reden über Entkopplung setzt ein fortwährendes Hin und Her in Gang, bei dem sich erst zurückgezogen wird, um sich dann darüber klarzuwerden, dass man von der Weltwirtschaft abhängig ist und dass diese ganz klar sowohl die Vereinigten Staaten als auch China mit einschließt. 2022 sprach die US-Finanzministerin Janet Yellen von Friend-shoring; bereits Mitte 2023 ruderten sie und der Nationale Sicherheitsberater Jake Sullivan wieder zurück, indem sie gegenseitige Verbundenheit betonten und versuchten, den kaputten Prozess gegenseitigen Engagements wieder zu kitten. Sullivan erklärte: »Unsere Kooperation mit Partnern beschränkt sich nicht nur auf fortgeschrittene industrielle Demokratien.« Besonders fiel auf, wie er die Zeit des amerikanischen Optimismus der 1960er-Jahre heraufbeschwören wollte, wofür er Präsident Kennedy zitierte: »›Wenn ein Teil unseres Landes stillsteht, wird die Ebbe früher oder später alle Boote nach unten ziehen.‹ Das trifft auf unser Land zu. Das trifft auf unsere Welt zu. Und wirtschaftlich werden wir mit der Zeit gemeinsam aufsteigen – oder fallen.«19
Indien erlebt eine sanftere Version des gleichen Phänomens. Es möchte sich nicht zurückhalten, obwohl es eine tiefe Wertschätzung für die Stärke der wirtschaftlichen und persönlichen Beziehungen zu den Vereinigten Staaten verspürt, die die Grundlage für eine wirksame Entwicklung bilden. Für die wichtigen aufstrebenden Märkte – wie auch für China – bietet die Sprache des Anti-Kolonialismus eine gute Möglichkeit, die neue politische Bewegung zu erklären. Dabei wird Globalisierung zur Rache, die der Rest der Welt für den Kolonialismus übt. Und wenn die Reichen – die alten Kolonialmächte – versuchen, die Welt zu entkoppeln und die Globalisierung zu stoppen, dann üben sie eigentlich nur eine neue Form alter kolonialer Unterdrückung aus. Der Kampf um die Zukunft der Globalisierung wird so auf einen Streit um eine vorangegangene historische Epoche übertragen.
Die sprachliche Zerrissenheit erschwert den Umgang mit Globalisierung wesentlich, und der Prozess ist folglich deutlich unvorhersehbarer – und scheint potenziell ebenso unfair zu sein. Die Fahrt auf dem Konnektivitäts-Express wird wohl wilder werden. Viele der alten Institutionen, die eigentlich die Politik koordinieren sollten, stehen zunehmend unter Druck. Die Welthandelsorganisation wurde bereits vor einem Jahrzehnt stark in Mitleidenschaft gezogen, als die Doha-Runde scheiterte. Es bedurfte nicht wirklich Donald Trumps aggressiver Haltung in Bezug auf Handelspolitik, um ihr den Todesstoß zu versetzen. Die Bretton-Woods-Institutionen – die geschaffen wurden, um mit einer Welt fertigzuwerden, in der Deglobalisierung zu Krieg geführt hatte, und die eine kooperative internationale Ordnung voranbringen sollten – sind nach wie vor unverzichtbar, doch sie müssen mittlerweile mit einer Vielzahl neuer, kleinerer und speziellerer kooperativer Institutionen zusammenarbeiten. Diese Aufgabe verlangt nach einer funktionierenden Kommunikation, doch ein solcher Dialog wird oft durch die stark umkämpfte Sprache der Globalisierung behindert und vereitelt.
Gibt es einen Weg aus dieser Pattsituation, aus den Missverständnissen und der Fehlkommunikation heraus? Können wir uns von unseren »Suspicious Minds« lösen, die für Elvis Presley bedeuteten: »We can’t go on together«? Eine Voraussetzung dafür ist, dass wir zwei Tatsachen anerkennen, die die Kombination von Technologie und zunehmendem kommunikativem Austausch mit sich bringt: Wir können nicht wissen, was kommt und es auch nicht lenken. Wir wissen nicht, welches Land letztendlich Nr. 1 werden wird und wir können es auch nicht mit Sicherheit vorhersagen.
Außerdem sollten sich die Menschen jedes Landes zu einem gewissen Grad sicher sein können, dass sie unterstützt werden, falls sie von einer technischen Neuerung oder vielleicht von einer unerwarteten wirtschaftlichen Entwicklung betroffen sind. Das Prinzip der Absicherung führt zu größerer Selbstsicherheit. Psychologen, insbesondere Eldar Shafir und Sendhil Mullainathan, haben empirisch bewiesen, wie Zukunftsunsicherheit die Intelligenz und die kognitive Entscheidungsfähigkeit mindert, also die Fähigkeit, rationale Entscheidungen zu treffen.20
Im Herzen des miteinander verbundenen Prozesses von Globalisierung und technischer Entwicklung herrscht also ein grundlegendes Dilemma. Die Resultate sind ungewiss, doch Ungewissheit ist (wenn sie groß ist) lähmend. Die Aufgabe einer funktionierenden Regierung ist es daher, der Bevölkerung eine gewisse Sicherheit zu vermitteln. Je besser diese Rückversicherung wirkt, desto weniger wird die Welt von unterschiedlichen Ansichten über Gewinnen und Verlieren gespalten werden. Und die Suspicious Minds, die Misstrauischen, werden beruhigt sein. Wir müssen genau darüber nachdenken, was die Begriffe der Globalisierung wirklich bedeuten – und dabei dem Impetus rhetorischer Inflation, rhetorischer Verwechslung und rhetorischen Imperialismus widerstehen. Das ist die notwendige Voraussetzung für Neubewertung, Rückversicherung und die Wiedergeburt von Selbstsicherheit und Vertrauen.
1 Kapitalismus
Der Kapitalismus bestimmt das moderne Leben, und die letzten dreißig Jahre waren hyperkapitalistisch. Man glaubte 1989 weithin, der Kapitalismus habe triumphiert. Aber was genau hatte sich da nach dem Ende des Sowjetkommunismus durchgesetzt? Ein Großteil der Debatte über den Kapitalismus dreht sich häufig um die Frage seiner Definition. Sehen wir in ihm mit Adam Smith einfach eine Folge der »Neigung zum Handeln und Tauschen«, dann ist er ein universelles Merkmal des menschlichen Lebens. (Tatsächlich zeigt auch eine beträchtliche Anzahl von nicht-menschlichen Tieren kapitalistisches Verhalten. Zum Beispiel sammeln antarktische Pinguine runde Kieselsteine – eine Art Kapitalakkumulation –, die sie dann gegen Sex eintauschen.) In Chroniken kann man nachlesen, dass in fast jeder menschlichen Gesellschaft gehortet und gehandelt wurde, selbst unter extremen Umständen wie in Gefängnissen oder Konzentrationslagern. Kapitalakkumulation findet statt, wenn Menschen etwas horten. Im Kapitalismus kann man diese gehorteten Waren oder Produkte tauschen. Er ist von Natur aus dezentralisiert, kommt also ohne zentrale Kontrolle aus.
Dementsprechend ist das Kapital ein dehnbarer Begriff, der recht weit gefasst werden kann. Manchen Forschern war die Ausweitung dieses Begriffs sogar ein wichtiges intellektuelles Anliegen. Der französische Soziologe Pierre Bourdieu wollte zwischen vier Arten von Kapital unterscheiden und sprach, neben dem bekannten ökonomischen Kapital, auch von symbolischem, sozialem und kulturellem Kapital. Ihm war der ökonomische Fokus künstlich zu eng gefasst worden:
Die Wirtschaftstheorie hat sich nämlich ihren Kapitalbegriff von einer ökonomischen Praxis aufzwingen lassen, die eine historische Erfindung des Kapitalismus ist. Dieser wirtschaftswissenschaftliche Kapitalbegriff reduziert die Gesamtheit der gesellschaftlichen Austauschverhältnisse auf den bloßen Warenaustausch, der objektiv und subjektiv auf Profitmaximierung ausgerichtet und vom (ökonomischen) Eigennutz geleitet ist. Damit erklärt die Wirtschaftstheorie implizit alle anderen Formen sozialen Austausches zu nicht-ökonomischen, uneigennützigen Beziehungen. Sie definiert besonders jene Austauschverhältnisse als uneigennützig, die die Transsubstantiation sicherstellen, durch die die meisten materiellen Kapitalsorten … sich in immaterielles kulturelles oder soziales Kapital umwandeln, oder vice versa.1
Das symbolische Kapital ist oft von den Bräuchen und Traditionen einer bestimmten Gesellschaft abhängig und kann nicht so einfach auf einem Markt gehandelt werden.
Sowohl das symbolische als auch das kulturelle Kapital haben im Kapitalismus immer mehr an Bedeutung gewonnen, besonders seit dessen Triumph über andere politische Systeme. Diese Kapitalsorten können bei dem Verständnis darüber helfen, wie ein innovativer, kreativer und destruktiver Prozess dennoch irgendwann existierende Ungleichheiten fortschreiben kann. Sie werfen auch ein anderes Licht auf die Entwicklungsgeschichte des Kapitalismus, weil dieser auf keine anfängliche, großangelegte Kapitalbeschaffung mehr angewiesen sein muss, wie in Marx’ Vision der »ursprünglichen Akkumulation«. Die Historikerin Joyce Appleby beispielsweise beschreibt, dass »die Akkumulation kulturellen Kapitals, insbesondere von Know-how und produktivem Innovationsdrang, in der Geschichte des Kapitalismus eine wichtigere Rolle gespielt hat« als die Akkumulation physischen Kapitals. Mittelalterliche Kathedralen erforderten diesbezüglich enorme Investitionen, lösten aber keine kapitalistische Revolution aus.2 Auch der Historiker Joel Mokyr ist der Meinung, dass »der Anbeginn des langsam zunehmenden Glaubens an die transformative Kraft, das soziale Prestige und die Tugendhaftigkeit des nützlichen Wissens als Geschichte der Wirtschaft angesehen wurde.«3
Zwei Paradoxe kennzeichnen die Geschichte des Kapitalismus und sind seit 1989 deutlich sichtbar in Erscheinung getreten: Erstens beruht der Kapitalismus auf dezentralen Entscheidungsprozessen aus einer Ansammlung Millionen voneinander unabhängiger Einzelentscheidungen, doch mit dem Kapital konzentrieren sich auch dessen Entscheidungsprozesse. Zweitens braucht ein funktionierender Kapitalismus eine externe Ordnung, die normalerweise von Regierungen in Kraft gesetzt wird, doch mit zunehmender Kapitalkonzentration versuchen Großkapitalisten, die Regierung für sich einzunehmen (eine Art kapitalistischer Vetternwirtschaft).
Die Institutionalisierung des Tauschaktes
Der Kapitalismus beruht auf zahlreichen Tauschhandlungen und der Mechanismus dieser Tauschhandlungen wird institutionell komplexer, jedoch wird immer Geld benötigt. Ein zweifelhafter oder unsicherer Geldstandard behindert den Tauschprozess und kann den Tausch illegitim erscheinen lassen – eher als Raubüberfall denn als freiwilligen Handel.
Kapitalismusdefinitionen sind nicht nur teils empirisch, sondern haben manchmal auch ein normatives Element, wenn auch oft ambiger Natur. Als Kritik konzipierte Konzepte können plötzlich eine neutrale oder sogar affirmative Bedeutung gewinnen, nur um dann manchmal wieder zur kritischen Ursprungsbedeutung zurückzukehren. In der Mitte des 19. Jahrhunderts wurde der Begriff des Kapitalismus von Revolutionären und Gesellschaftskritikern geprägt, um zu beschreiben, dass die Menschheit auf unmenschliche Weise abstrakten Kräften unterworfen wird. In Max Webers Untersuchungen gegen Ende des Jahrhunderts jedoch stand der Begriff schlicht für eine neue, rationalisierte Lebensweise, die Institutionalisierung des Tausches und die Loslösung des Tauschhandels von traditionellen Werten (und symbolischem Kapital).