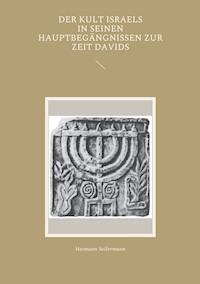
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Sprache: Deutsch
Die vorliegende Schrift ist das Ergebnis des jahrzehntelangen Forschens im Rahmen dieser Lehr- und Vortragstätigkeit. Kurz vor dem Erscheinen dieses Manuskriptes, dessen Veröffentlichung er bejahte, ist der Autor gestorben. Die Bearbeitung zur Drucklegung haben seine langjährigen Mitarbeiterinnen Agnes Bohlen und Agathe Strohmayer besorgt. Herausgeber: Hans-Jürgen Sträter, Adlerstein Verlag
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 125
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Zum Autor
Hermann Seifermann, geboren 1925 in Neusatz (Bühl, Mittelbaden), seit 1959 Mitglied des Oratoriums des hl. Philipp Neri in München, lehrte zunächst am Münchner Institut für Katechetik, Erwachsenenbildung und Homiletik, anschließend bis 1990 an der katholischen Stiftungsfachhochschule in Eichstätt „Exegese des Alten Testaments und Didaktik des Bibelunterrichts“. Darüberhinaus engagierte er sich jahrzehntelang in bibeltheologischer Erwachsenenbildung u.a. in Freising, Neustadt (Weinstraße), Würzburg-Himmelspforten und Burg Rothenfels.
Die vorliegende Schrift ist das Ergebnis des jahrzehntelangen Forschens im Rahmen dieser Lehr- und Vortragstätigkeit. Kurz vor dem Erscheinen dieses Manuskriptes, dessen Veröffentlichung er bejahte, ist der Autor gestorben. Die Bearbeitung zur Drucklegung haben seine langjährigen Mitarbeiterinnen Agnes Bohlen (Schmelz-Michelbach) und Agathe Strohmayer (München) besorgt.
Zugrundegelegt wurden die Bibelübersetzung von Martin Buber (Verlag Lambert Schneider, Heidelberg) und die hebräische Umschrift nach Jenni/Westermann (Theologisches Handwörterbuch zum Alten Testament, Chr. Kaiser Verlag München 1978).
Titelbild: Relief der Synagoge von Priene, Grabstele mit siebenarmigem Leuchter, Ident. Nr:. 4691, Staatliche Museen zu Berlin.
München, im Mai 2014
Alle Rechte bei Patmos e.V.
Inhalt
Einführung
Teil ADer geographische-geschichtliche-theologische Hintergrund des Kultes in Jerusalem
I Der Aufbruch Israels
Präisraelitische Überlieferungen
1. Die sogenannte Lea-Gruppe und ihre Überlieferungen
- Die Israel-Überlieferung
Israel als Rechtsprechungsverband in der südlichen Wüste
Israel als Kultverband in Sichem
- Die Jahwäh-Überlieferung
Der Berg in der Wüsste
Die Hebräer als die Verehrer des Jahwäh vom Berg in der Wüste
Der Berg in der Wüste als Wallfahrtsort
2. Die sogenannte Rahel-Gruppe und ihre Überlieferungen
- Die Schilfmeer-Überlieferung
Das Pessach in Schittim und seine Bedeutung
Das Durchschreiten des Jordan als rituales Gedenken an das Schilfmeergeschehen
- Die Kriegsüberlieferung
Das geschichtliche Ereignis
Die theologische Erfassung dieses Geschehens
Das Kultritual zum Gedächtnisbegehen an den Josua-Sieg bei Gibeon im Tale Ajalon
Die Überlieferung von der „Führung durch die Wüste“
Die Gründung Israels auf dem Landtag von Sichem
1. Die Zentralisierung Israels
Das Baumheiligtum (die Steineiche) von Sichem als Zentralort für Israel
Israel als Gemeinde
Die Verkündigung von Gesetz und Recht
2. Die Dienstämter Israels in Sichem
Das Amt der Abgeordneten
Das Amt des „Richters in Israel“
Das Amt der Jünglinge
3. Jahwäh als der gemeinsam verehrte Gott
Die Anregung Josuas und ihr Sinn
Die Auswirkungen im Blick auf Jahwäh und Israel
Jahwäh als „Gott Israels“
Jahwäh als „Gott Jakobs“
Die Lewiten als die geeigneten Liturgen Israels im Jahwäh-Kult von Sichem
Die Israelitisierung und Jahweisierung vorhandener Orte und Kulte
1. Der Stierbild-Kult von Bet El (bēt 'ēl
)
- Der ursprüngliche Kult in Bet El
Die Heiligtumslegenda
Die Fest-Agenda
- Die Israelitisierung und Jahweisierung des Stierbild-Kults von Bet El
- Die Einbringung des Stierbilds in das Heilsgeschichtsbegängnis von Gilgal
- Die Entstehung der Ätiologie des Stierbilds in Israel
2. Der Kult der Lade in Schilo (šilō) und seine Einbeziehung in den Zusammenhang der Heilsgeschichte
Die Lade als kanaanäisches Heiligtum in Schilo
Der Lade-Kult von Schilo
- Die Israelitisierung und Jahweisierung des Kultes der Lade in Schilo und ihre Folgen
- Die kultische Verknüpfung des Ladeheiligtums von Schilo mit dem Heilsgeschichtsbegängnis in Gilgal
Die Stammwerdung Israels mit Stammeskönigtum
II Der Aufstieg Israels
Der Aufstieg Davids
Die Vorgeschichte des David
1. Die Schaffung des davidischen Großreichs und Weltreichs
- Die Schaffung einer Hausmacht durch David
- Davids unverhohlener Treubruch gegenüber dem Philisterkönig Achis:
Er nimmt das Angebot, König über Nord-lsrael zu sein, an
Er besiegt die Philister, setzt die Stadtstaatenkönige ab und Gouverneure ein
Er erobert Jerusalem und macht es zur „Davidsstadt“
- David als Herr über Kanaan:
Er faßt die Kanaanäerstadtstaaten zu Verwaltungseinheiten zusammen und vereinigt sie mit seinen Königtümern Juda und Nord-lsrael mit Jerusalem als gemeinsamer Zentrale
Er holt die Lade nach Jerusalem
- David als Oberherr über den Kreis der Stämme:
Er macht die Stammeskönige zu dienstpflichtigen Vasallen nach dem Vorbild der altorientalischen Herrscher
- Ausweitung zum Weltreich
2. Die sprachliche Erfassung der Gegebenheiten des davidischen Großreichs und Weltreichs
a) anthropologisch-politisch
b) theologisch-mythisch
3. Der Aufstieg Davids in der Sicht Israels
a) Die Bedeutung der Taten Davids für Israel
b) Das Eingehen Davids auf die Sicht Israels (die Kehre Davids
)
4. Die sprachliche Erfassung der Kehre Davids
:
Das Bundesformular
5. Jahwäh als Herr (Die Personalität Gottes
)
a) Das Besondere Jahwähs in seiner Rolle als Herr
b) Das Besondere des Jahwähbundes
III Der Aufstieg Davids und Israels als Neuaufbruch und Vollendung der Heilsgeschichte
1. Der Aufstieg Davids und Israels als ein Neuaufbruch
a) Jahwäh hat Israel aus der Vernichtung durch die Philister gerettet
b) Jahwäh hat Israel zu etwas Neuem gemacht
2. Die Erzählung vom Aufstieg Davids und Israels im Sinn einer „Sage“ von der Vollendung der Heilsgeschichte
Teil BDas Kultbegängnis Israels beim Laubhüttenfest im Herbst in Jerusalem
Vorbemerkung
1. Die Bedeutung der Entstehung des Kultes in der Hauptstadt Jerusalem
2. Der Stand der exegetischen Kenntnis betreffend den Kult in Jerusalem zur hohen Königszeit
3. Erläuterung der Arbeitshypothese zur Anzahl der Festtage
Versuch der Darstellung des Kultes beim Laubhüttenfest in Jerusalem
Zeitliche Abfolge
Die Geographie des Kultes
Die Geographie des Tempels zu Jerusalem
Die Geographie Jerusalems z. Zt. des David/Salomo
ERSTE FESTWOCHE
Laubhüttenfest
Erster Tag
Zweiter Tag
Dritter Tag, erster Teil
Dritter Tag, zweiter Teil
Dritter Tag, dritter Teil
Vierter Tag am Vorabend
Vierter Tag am Morgen
Fünfter Tag
Sechster Tag: Tag der Prüfung
Siebter Tag: Tag des Bundesmahles
ZWEITE FESTWOCHE
Neujahrsfest
ERSTER TAG Tag Jahwähs
Am Vorabend
Am Morgen
ZWEITER TAG Tag des ’ādām
DRITTER TAG Tag der Erstehung (Epiphanie) des ’ādām vor dem Volk
VIERTER TAG Tag Israels als Segen für die Völker
FÜNFTER TAG Tag der Völkerwallfahrt zum Zion
SECHSTER TAG Tag der Völkerunterweisung
SIEBTER TAG Tag des Völkermahles (Hosianna-Tag
)
ACHTER TAG Tag der Entlassung
Nachwort
Literaturverzeichnis
Register der Bibelstellen
Verzeichnis der hebräischen Wörter
Impressum
Der Kult Israels in seinen Hauptbegängnissen zur Zeit Davids
Das Kultbegängnis in Jerusalem als Aufsammlung, Deutung und Darstellung erfahrener Geschichte, als Vorgang der Sprache, als Verpflichtung der Generationen, als Hütung des Lebens in all-einräumender Feier
Einführung
Es gilt, den geographisch-geschichtlich-theologischen Hintergrund des Kultes in Jerusalem zu kennen, um ihn zu verstehen. Darin spiegelt sich wieder die aufgesammelte, sprachlich dargestellte und gedeutete Erfahrung Israels mit seinem Gott inmitten der Geschichte. Es ist neben dem p<b>sah (Pessach) im Frühjahr und dem Pfingstfest im Frühsommer in der Hauptsache das große Herbstfest, das Laubhüttenfest mit dem Reichtum seiner Einzelbegängnisse, das uns interessieren soll, weil es im Grunde die Kultfeier ist, in der Israel die Fülle der Zeit feiert. Alles Feiern Israels hat eine Geschichtsnote, ist Geschichtsbegängnis. Das bedeutet, dass wir über die Geschichte Israels Bescheid wissen müssen, wenn wir uns mit dem Kult befassen. Man kann vom Kult Israels nicht sprechen ohne Kenntnis der Vorgeschichte Israels, wie sie in der Bibel festgehalten ist, z. B. in den Büchern Exodus, 1-2 Samuel, 1-2 Könige, Josua und den Propheten. Darum müssen wir uns die Geschichte Israels wieder in Erinnerung rufen. Was in Teil A dieses Skriptums erarbeitet ist, befaßt sich mit der Vorgeschichte des Kults in Jerusalem.
Teil A
Der geographische-geschichtliche-theologische Hintergrund des Kultes in Jerusalem
I Der Aufbruch Israels
Präisraelitische Überlieferungen
1. Die sogenannte Lea-Gruppe und ihre Überlieferungen
- Die Israel-Überlieferung:
„Israel" als Rechtsprechungsverband in der südlichen Wüste
Es gab in der südlichen Wüste eine Oase mit Namen Kadesch-Barnea. Die Hebräer der südlichen Wüste kamen dort zusammen, um Rechtsstreitigkeiten zu schlichten. Recht ist mišpā, das sind kasuistische Rechtsmaximen, nie unbedingt, nie selbstverständlich. Streit ist merībāh (Ex 17,7; Dtn 33,8; Num 20,13). Die Leute, die sich dahin gebunden sahen, nannte man im Verband "Israel", jiśrā'ēl. Es gab also in Kadesch-Barnea einen Rechtsprechungsverband zwecks Schlichtung von Rechtsstreitigkeiten namens „Israel". Das ist die früheste Bedeutung dieses Wortes, die bekannt ist; von der Struktur her ist es kein israelitisches Wort. Das ist noch nicht das biblische Israel.
"Israel" als Kultverband in Sichem (šekæm)
Einige von denen, die diese Rechtsprechungspraxis kannten, sind seßhaft geworden in Kanaan und hatten in Sichem ihren Ort. Sie kommen nach Sichem zum Baum von Sichem, erfahren dort Mehr, Anderes, von dort her haben sie Raum, Heimat, Gegend. Gemeinde bildet sich, ('ēdāh). Sie machen in Sichem Kult dem Gott am Ort, dem ’ēl am Ort: Ein Liturge tritt vor die Gemeinde mit dem Spruch „Ich bin der Gott dieses Ortes", es folgt die Verkündigung des Gesetzes dieses Ortes. Gesetz (ōq) ist apodiktisch, unbedingt, selbstverständlich, du bist es inne. Der Baum von Sichem ward ihnen zum Gottort, māqōm, zu einer „Erstehung". Der Vollzug der Gottesverehrung am Ort ist Ehrfurcht.
Auch nach der Seßhaftwerdung haben sie Rechtsstreitigkeiten. Um nach Kadesch-Barnea zurückzugehen, ist der Weg zu weit. Sie nehmen den Ort Sichem anstelle von Kadesch-Barnea und machen hier genau das, was sie dort gemacht haben: Rechtsprechungspraxis. Und sie nennen sich, wie sie sich in Kadesch-Barnea genannt haben: "Israel".
Die Rechtsprechung geschieht also jetzt im Ehrfurchtsbereich des Gottes am Ort und der Name "Israel" wird zum Namen für einen Verband, der zugleich Kultverband und Rechtsprechungsverband ist, ein Verband, der als Liturgie hat "Verkündigung vom Gesetz des Gottes" und als Praxis hat "Rechtsprechung".
Unter den seßhaft Gewordenen entstehen allmählich größere Verbände: die sechs Stäbe Ruben, Simeon, Lewi, Juda, Zabulon und Issachar mit Sitzen im Hinterland, nicht in den Ebenen. Da sie dort ständig ihre Gemeinschaft haben, bilden sie eine kultische Verehrerschaft des Gottes des Baums von Sichem, eine kultische Umwohnerschaft (Amphiktyonie) um den Baum von Sichem.
Zwischen den drei Stäben Ruben, Simeon und Lewi, die ihre Sitze um Sichem herum hatten, und der amoritischen Bewohnerschaft von Sichem kam es über die verschiedenen Heirats-und Handelssitten zur Kollision mit dem Ergebnis, dass diese drei Stäbe von Sichem weg versprengt werden: Ruben nach Ostjordanien östlich der Nordhälfte des Toten Meers, Simeon im Süden eingesprengt unter den Stab Juda, und Lewi wurde ganz zersprengt, hat kein geschlossenes Siedlungsgebiet mehr.
- Die Jahwäh-Überlieferung:
Der Berg in der Wüste
Der Name Jahwäh haftet, wenn er in der Bibel auftaucht, am "Berg in der Wüste", der südlichen Wüste, dem Sinai (sīnaj): Jahwäh als der 'ēl, der Gott des Berges. Jahwäh ist der Name des Gottes des Bergs in der Wüste.
Jahwäh ist ein Ortsgott: Hier ist māqōm, Heimat, Gegend, Raum, es gilt ortsgotthafte Frömmigkeit: einräumen, vertraut werden, Gesetz wissen, Ehrfurcht haben, innehalten, feiern Sabbat (šabbāt).
(Die Frage, woher der Name Jahwäh stammt und was er bedeutet, ist für die Forschung bis heute ein Rätsel. Die Schreibweise ist meist "Jahwe", hebräisch: Jahw<a>h, s. S. 23. Die Deutung in der Dornbuschgeschichte (Ex 3) ist keine wissenschaftliche, sondern eine volksetymologische oder in diesem Fall eine theologisch-etymologische Ausdeutung des Wortes.)
Die Hebräer als die Verehrer des Jahwäh vom Berg in der Wüste.
Die Verehrer dieses Gottes, die in seinem Raum, in dieser Gegend, in dieser Heimat orientiert sind, die den Kult besorgen, die um sein Gesetz sich kümmern, die wissen, was man hier tut und was man nicht tut, das sind die Hebräer, Nomaden der südlichen Wüste, eine völkischnational nicht abgegrenzte Gruppe. Der Name ist ein Name im Mund der Kulturlandbewohner, was die Beduinen nicht hindert, sich selbst im Umgang mit Kulturlandbewohnern Hebräer zu nennen.
Der Berg in der Wüste als Wallfahrtsort:
Die Wallfahrtspraxis der seßhaft gewordenen Hebräer
In der Phantasie beherrscht dieser Berg die Gemüter: Das ist die Heimat, die Gegend, der Ort. Die anderswo Seßhaftgewordenen zieht es immer wieder dorthin. So kommt es zu einer Wallfahrtspraxis der seßhaft gewordenen Hebräer zum Berg in der Wüste von Kanaan aus.
Dabei bekommt Beerscheba (be'ēr š<b>ba', Siebenquell), am Südrand des Kulturlands gelegen, als letzte Station vor dem Weg durch die Wüste eine eigentümliche Bedeutung: Hier weiß man besonders gut Bescheid über die Verehrung des „Jahwäh vom Berg in der Wüste". Auch die Bewohner von Beerscheba werden da hereingezogen, bekommen also einen eigenen Rang im Zusammenhang mit der Verehrung des Jahwäh vom Berg in der Wüste. Damit eng verbunden ist die Sonderrolle der Lewiten.
Pflege von Geschichte im Gedächtnis der Gruppe
- Die Schilfmeer-Überlieferung
Das Pessach (p<b>sah, von pāsá, überspringen, hinken) in Schittim und seine Bedeutung
Die Rahel-Leute, die aus Ägypten kommen, gehen nach der Seßhaftwerdung jährlich zum Frühjahrstermin nach Schittim an den Rand der ostjordanischen Wüste, um ihr Heilsgeschichtsfest zu begehen. Sie versammeln sich dort, begreifen sich als ihres Rettergottes Gruppe vom Delta her, vom Schilfmeer her. Dabei gedenken sie auch des letzten Pessach-Mahles vor ihrem endgültigen Eintreten ins Land.
Für das Pessach-Gedächtnis haben sie ein bei allen Nomaden geübtes Ritual, aber für das Großereignis der Rettung am Meer, dessen sie bei der Gelegenheit auch gedenken wollen, haben sie hier kein Ritual. Die Pessach-Bräuche gegen einen šēd (Dämon) taugen dazu nicht. So können sie die Rettungstat nicht begehen, haben nur eine Legenda, aber keine entsprechende Agenda.
Das Durchschreiten des Jordan als rituales Gedenken an das Schilfmeergeschehen
Auf dem Heimweg von dem Begängnis in Schittim müssen sie über den Jordan. Sie haben am Rand der Wüste des Aufbruchs aus dem Delta gedacht und gedenken nun am Jordan dessen, was danach am Meer geschehen ist. Der Jordan wird ihnen damit agendahaft zum Schilfmeer. Sie durchqueren den Jordan auf einer Furt. Die geprägte Bezeichnung für das Durchschreiten einer Furt ist 'ābár. Das Durchschreiten einer Furt geschieht auf Sandgrund, hārābāh.
In ihrer Agenda wird das Schilfmeer ein Wasser, das man auf einer Furt durchschreiten kann. Sie tragen also die Anschaulichkeit einer Jordanfurt ein in ihre Vorstellung vom Schilfmeer. Die Ausgestaltung des Durchschreitens der Jordanwasser wird zu einem Ritual des Gedenkens an das Schilfmeergeschehen.
Die Neuerfassung des Schilfmeergeschehens als eines Durchschreitens ('ābár) im Sinn und nach der Anschaulichkeit des Durchschreitens der Jordanwasser an einer Furt geschieht also auf Sandgrund.
Die bisherige theologische Aussage bleibt gültig. Früher hat sie geheißen: Unser Gott hat uns gerettet. Jetzt heißt sie: Unser Gott hat uns durchschreiten lassen die Wasser des Schilfmeers. So entstehen Texte, die jordanhaft reden vom Schilfmeer (vgl. Jos 2,10; Jos 3,17; Jos 4,23; Ex 14,21; Ps 66,6; Ps 114,3: „Das Meer sah es und floh, der Jordan bäumte sich"). Da wird die Liturgie besungen.
- Die Kriegsüberlieferung
Das geschichtliche Ereignis_
Kleinviehnomaden kennen keinen Krieg. Die Seßhaftwerdung ist prinzipiell ein friedlicher Vorgang. Früher oder später kommt es aber zur Berührung mit den Kanaanäern, zum Aufeinanderprallen zweier grundverschiedener Welten. Diese friedliche Seßhaftwerdung geht über in eine Reihe von Kämpfen (Richterzeit). Die erste namhafte Kriegsaktion ist die Schlacht Josuas bei Gibeon im Tale Ajalon gegen fünf Amoriter-Kanaanäer-Könige (Jos 10,12-14).
Die theologische Erfassung dieses Geschehens





























