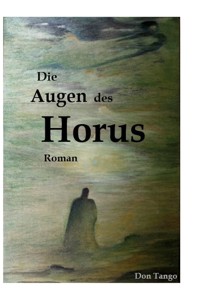Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Dirk Zipfel
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Der Protagonist schreibt über seine Zerrissenheit und Verzweiflung, dem absurden modernen Leben täglich in den Rachen zu schauen, er prangert dekadente und autokratische Gesellschaften an, ihre Gier nach Reichtum und Macht, ihr ewiges Streben nach Höher, Weiter und Mehr - der gesicherte Untergang, all dieser Zivilisationen, von den Sumerern, bis ins Amerika von Donald Trump des 21.Jahrhunderts. Ein brandaktuelles Buch, verstörend und erschütternd zugleich, weil der Protagonist selbst die dunkelsten Schächte seines Selbst zeigt. Seine spätere Rekonvaleszenz ist nichts für schwache Nerven, ein ungefiltertes Gemälde einer zerrütteten Existenz, das der Protagonist immer wieder erneut versucht, sein Leben zu nennen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 276
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Widmung & Dank
„Dieses Buch widme ich dem Leben und allen meinen Freunden.“
D.T.
„Mein Dank gilt allen, die mir halfen weiterzumachen.
Hochachtung & Respekt allen, die es täglich versuchen.
In den Olymp mit allen, die scheitern.“
D.T.
Story
Ein Leben im Sturm - fallen und aufstehen – fürchte dich nicht vor der Dunkelheit, mit ihren düsteren Schächten, respektiere dich selbst, nehme an, was du immer gewesen bist. Wann und wo treffen wir Nofretete?
Über den Autor
Don Tango wurde in Lissabon geboren und lebt seit seinem zehnten Lebensjahr auf Mallorca. Nachdem er als Schäfer, Olivenbauer und in Abdeckereien gearbeitet hatte, begann er zu schreiben und veröffentlichte erste Kurzgeschichten. Viele Jahre später, veröffentlichte er sein erstes Buch „Brennende Krokodile löscht man nicht“. Der Erfolg motivierte ihn weiterzumachen. Dies Buch handelt von seiner Zerrissenheit und seiner Verzweiflung, dem absurden Leben täglich in den Rachen zu schauen, und sei es für Sekunden.
„Was zum Teufel ist die Realität? Ist es eine Verabredung, liebe Leserin, lieber Leser? Was machen wir hier? Und warum tun wir, was wir tun? Oder sind wir nur eine aneinandergereihte Kette von süßen und bitteren Erinnerungen, vor denen wir erfolglos Reißausnehmen?
Wie auch immer: Ich versichere Ihnen, dass Ähnlichkeiten, mögen vereinzelte Ereignisse, Namen, Gestalten und Situationen, einer möglichen Wirklichkeit auch noch so sehr ähneln, einzig und allein meiner Fantasie entsprungen sind. Niemand ist wirklich umgekommen, oder verloren gegangen. Alle tun weiterhin brav, was ihnen ihr Programm auferlegt.“
D.T.
Inhaltsverzeichnis
Der Gesang der Fürstin
Vertrauen nur in Freiheit
0,1s
0,2s
0,3s
0,5s
0,6s
0,7s
0,8s
0,9s
1,0s
1,2s
1,3s
1,4s
1,6s
1,8s
1,9s
2,1s
2,2s
2,3s
2,4s
2,5s
2,6s
2,7s
2,8s
3,3s
3,4s
Der Gesang der Fürstin
Vor sehr langer Zeit fing alles an. Anfangs habe ich es nicht gemerkt, ist ja normal, wir sind jung, haben keine Ahnung. Doch ur-plötzlich, quasi aus dem Nichts war er da, der kaum sichtbare Vorhang, der alles verhüllt, der mich mit feinem Hauch umnebelte, mich nach und nach, immer mehr einwickelte, wie ein nasses Tuch. Ich behielt es für mich, erzählte niemandem davon. Bald spürte ich, wie es an mir nagte. Erst langsam, dann immer tiefer und stärker. Irgendwann so tief, dass es überall zuhause zu sein schien. Lange wehrte ich mich, doch bald schon spürte ich es und gab auf. Mir war klar, was ich zu tun hatte. Ich kam an einen Punkt, an dem ich erkannte, dass das Leben ein Puzzle mit fehlenden Teilen ist.
Man meint das Ergebnis, das fertige Bild zu kennen und doch stochern wir all die Zeit im Dunkeln herum, plagen und mühen uns ab, tagein und tagaus, mitten drin im Hamsterrad, ohne die leiseste Ahnung warum. Ist es Genetik? Mein schütteres Haar, Papa, der Lump hat das auch, und so alles, ja? Oder doch eher Pathologie, die Summe meiner Defekte, eine Kollektion wunderbarer Neurosen, inklusive unbegrenzter Wachstumsmöglichkeiten? Niemand erinnert sich, wie es dazu gekommen, wie man in diesen Schlamassel geraten war. Hatten wir nicht alle gute Vorsätze? Wie konnte das geschehen. Bin ich nicht erst gestern noch ein rosiges Kind, mit lustigem Schnuller gewesen? Meine Eltern, sogar die mittlerweile seligen Großeltern suchten wie Trüffelschweine nach familiären Ähnlichkeiten in meinem lächelnden Putten-Gesicht, zumeist hinein-fantasiert, als wirklich erkennend. Irgendwann schien ich ein Jugendlicher, bald wie‘n Erwachsener zu fühlen, was auch immer das bedeutete, Bezeichnungen aus der bunten Schilderfabrik, dem Katalog der welkenden Vergangenheit. Ich hatte keinen blassen Schimmer, dass sie mich heimlich still und leise in die gleiche Knochenmühle lockten, wie sich selbst. Wie ist sowas möglich?
Ist es Ahnungslosigkeit, gar böse Absicht? Ist sowas rechtzeitig zu erkennen, wenn wir lange genug hinsehen? All ihre unterschwellige unbewusste Bosheit, ihr unbändiger tiefsitzender Neid auf die Jugend, ihre nur schwer versteckbare Missgunst, ihre gnadenlose Unfähigkeit, Wärme, wahre Barmherzigkeit und Verständnis zu geben, ein gnadenloses Desaster.
Wahrhaftig sprachlos machend, ihre verzweifelte Ideenlosigkeit, ihr daraus resultierender manischer Wahnsinn. Von wegen, meine Kinder sollen es besser haben und so’n Kram, alles Bullshit, eine vermaledeite Lüge. Selbstbetrug scheuen sie genauso wenig, wie die mehr oder weniger offen ausgesprochenen Lügen. Was scheuten sie überhaupt? Eher schien es das Gegenteil. Mit größtmöglicher Genugtuung steuerten sie mich durch ihre nicht immer unsichtbaren Drähte, traurige Marionette wiederkehrender Einfallslosigkeit. Ihr ewiges Drängen, ihren jämmerlich gleichen Mist nachzumachen, damit ich, oh welch wunderschöne Überraschung, so werde wie sie, obwohl sie sich geschworen hatten, genau das niemals zuzulassen. Natürlich bedarf es nicht unerheblich charakterlicher Größe, eben dies zuzugeben, weswegen sie es sich eben nicht eingestehen konnten, eher das Gegenteil.
„Edelste Absichten haben wir, Junge, siehst du das denn nicht? Sieh dich um, wie gut es dir geht. Dämmert es dir endlich? Alles dir zu liebe!“
Gratulation und toi-toi-toi, Abziehbild Ihresgleichen, wie lange habe ich das gewollt, mich darauf gefreut, schönen Dank. Individualität? Einfach lächerlich. Man geht irgendeinen Weg, irgendwie geht es halt immer weiter und weiter.
Eine Zeit folgt man den Wegen der Eltern, später eventuell jenen von Vertrauten, manchmal den von Bekannten, doch den eigenen garantiert nicht, oder doch? Wie können wir uns sicher sein?
Wecker klingeln, Mist, wieder früh aufstehen. Nun aber flott Zähneputzen, husch-husch Frühstücken. Im Stau stehen, sein täglich Brot verdienen. Abends in Hetze Einkaufen. Nach dem Abendbrot fernsehen, Lagerfeuer müder Zivil-Spione. Fair kauft, wer kann. Vegan, möglichst Bio essen, warum nicht sozial engagieren?
„Ist doch eine gute Sache, oder nicht, irgendwas mit helfen, Kirche oder so, ist doch wichtig, wo denen die Mitglieder weglaufen, würdet ihr das nicht auch machen?“ Eines Tages sehe ich die Wahrheit glasklar vor mir. Schockiert, richtig kitschig, mit Panik und alles, pralle ich zurück.
Fremdbestimmt! lautet die Diagnose. Nichts gehört mir, weder antrainierte Eigenschaften, geliehene Meinungen, noch seltene Erden, wie die vermeintlich eigene Zeit.
„Keine Sorge, hast du nicht, nur im Schlaf oder aufm Klo“, funktionieren wie ein braver Soldat, statt leben, wie ein Mensch. Schnell steht mein Entschluss fest. Als ich in die Wanne steige überrollt mich eine gnadenlose Erkenntnis. Zum allerersten Mal im Leben das eigene Ich zu bekommen.
Tränen der Freude laufen mir über‘s Gesicht. Es tut gar nicht weh, als ich mir die Arme öffne, ich finde, es erinnert ein wenig daran, wie wenn man gekochte Nudeln schneidet, so ein bisschen fest, ein wenig zäh, seltsamerweise ganz ohne Schmerzen.
Ich lächle selig und bekomme meinen geheimen Schlüssel zum Tor in eine andere Welt. Ungeduldig läuft die dicke Suppe, als versuchte sie meine verlorene Welt zurückerobern, so als verteile ich mich mit einem Mal in der ganzen weiten Welt, weiter und weiter, als dürfte ich sie ganz für mich alleine einnehmen, während ich immer leichter und schwereloser durch die Stille schwebe, um der Unendlichkeit des Universums entgegenzugleiten.
Man ist ganz bei sich, sieht wie ein Zuschauer von außen zu, wenn einem der dicke Nektar rausläuft, wenn sich klares Wasser zu schwerem Brombeersirup verwandelt.
Irgendwann überkommt einen der Dämmerzustand, was für ein beeindruckender Rausch. Plötzlich sehe ich verrückte Dinge, all die schönen unbeschreiblichen Sachen, Fantasie und Wirklichkeit vermischend, als sitze ich staunend vor einem geflügelten Einhorn, das ich immer verschwommener sehe, bis es im gleichen Nebel verschwindet, aus dem es gekommen ist.
Unbeschreiblich schön, wie das Öffnen einer magischen Tür, wie Orgasmus in Zeitlupe. Man ist high, müde und erleichtert zugleich.
Irgendwann schlägt mein Kopf matt auf den Wannenrand. Es klingt schwer, ernst, endgültig. Aus den Augenwinkeln sehe ich, wie die dunkle Brühe über den Rand läuft.
Als die Feuerwehr an die Tür hämmert, bin ich sofort in Alarmbereitschaft, bis oben hin voll mit Adrenalin. Das darf doch nicht wahr sein, wo kommen die so schnell her? Später erfahre ich, dass die Nachbarn unter mir, zu Salzsäulen erstarrten, als die blutrote Suppe, an ihren Wänden herunterlief.
Mühsam schlepp ich mich hoch. Ständig klebt meine Zunge in meinem vertrockneten Mund fest. Mehrere Male taumle, falle ich hin, raffe mich mühsam auf und schlurfe mit letzter Kraft in die Küche, um das große Fleischermesser zu holen.
Lautes Scheppern, Herumwühlen in der Schublade, Menschen können selbst in unmöglichsten Situationen Idioten sein. „Im Messerblock, du Trottel!“ Hastig kippe ich ihn aus, endlich, da ist es. Liegt ganz schön schwer in der Hand. Halte es kurz ans Licht, drehe es mit der Spitze auf meine Brust. „Hab sowas noch nicht gemacht“, denke ich, aber heute. Jetzt, mit ordentlich Schwung und hole aus. Ka-Wumm! „Verdammt, tut das weh, so eine Scheiße, was habe ich denn getroffen? Hab doch keine Metallplatten unter der Haut, ist meine Kraft weg? Kann ich nicht mal das?“
Taumelnd, mit schwerster Schlagseite schlingere ich durch die Küche. Das mehrmalige An-die-Tür-Wummern der Feuerwehr verdränge ich erfolgreich. Mein Herz pocht, galoppiert aufgeregt herum. Plötzlich donnerndes Krachen, Männerstiefel, die Holz zertreten. Lautes Brüllen. Klingt militärisch.
Mit letzter Verzweiflung ramme ich mir das Messer in den Torso, einmal, zweimal, viermal, sechsmal, keine Ahnung wie oft. Vergeblich. Das Brustbein siegt. Erschossen und zerlegt, wie auseinandergesägte Schweinehälften, falle ich auf die Knie und rolle, wie von unsichtbaren Kugeln durchsiebt zu Boden, während mir die Klinge aus der Hand gleitet.
Lachen, weinen, schluchzen, alles zur gleichen Zeit. Dann Dunkelheit. Keine Ahnung, wie lange ich ohne Bewusstsein war. Irgendwann ist es hell. Mein Körper ist übersät mit Schläuchen. Ein paar Stöpsel stecken in Ohren und Nase. Der Verband um meinen Kopf erinnert an nen Turban.
Kalt lächelnde Neonröhren knurren mich von der Decke an. „Schön gefliest!“, schreien die Kacheln glänzend zurück. Alles ist hell und grell. Klinisches Knall-Weiß. Mein Bettgestell ist aus kräftigem Stahlrohr zusammengeschweißt, in mehreren Schichten mit widerspenstigem Pinsel lackiert. Robuste Industriefarbe, ideal zur schonenden Genesung. Komfort-Hospiz mit Aussicht. Einfühlsam geht die Bettwäsche mit meinen Gebeinen zu Werke. Bretthart gestärkt, scheuert sich die Baumwolle in mein Herz, robust, zäh wie Leder, das jedes Schwein aushält, das sich dran aufhängt.
Erbärmlich riecht es an diesem Ort. Eine Mischung aus Antiseptikum, Linoleum, Baumwolle, Latex, Kot und Tot. Blumensträuße leuchten um die Wette, versuchen den Raum und mich mit ihren Düften zu verzaubern.
„Sind die alle für mich?“ Geradezu unheimlich still ist es hier, als hätten sie Angst, dass wir dünnhäutigen Patienten bei den kleinsten Geräuschen aufeinander losgehen. Wunderbar die Stille, brauche sie wie die Luft zum Atmen. Meine Seele ist wund, meine Knochen tun mir weh.
Wie brennender Zunder fällt mein Fleisch von ihnen herab. An den abgeschürften Stellen schmerzt meine Haut um die Wette und schmatzt das Laken voll. Meine Handgelenke hat man gründlich verbunden, um die Venen vor mir zu beschützen.
Ständig sind Familie und Freunde zu Besuch. Alle sind schockiert. Ich frage mich warum. Man lebt doch nur für sich, das ganze Leben gehört einem alleine, was jedoch niemanden davon abhält, die gleiche Platte runter-zu-nudeln, als wär ich ein Verrückter, mit ‘nem Sprung in der Schüssel, oder einem unheilbaren, vielleicht ansteckenden Defekt. Was für Heuchler, nichts kapieren sie. Eingesperrte, die aus Gefängnissen winken, die einen bedauern, dass man draußen ist. Dann folgt das unvermeidlich Übliche. Öde Sitzungen mit verständnisvollen Psychologen, die mehr Probleme mit sich haben, als mit mir.
Sie wollen sich absichern, dass sich so etwas „bitte nicht wiederholt“ und wenn, „dann nicht in unserem Haus, ja? Wir sind ein renommiertes, ein bekanntes Institut, mit einem erstklassigen Ruf, damit das klar ist, ja?“ Natürlich versuchen sie zu helfen, aber wenn man tiefer bohrt, stimmt das nicht.
Sie tun es, weil sie hier arbeiten können und es auf dem Plan steht, aber vor allen Dingen, um herauszufinden, ob sie mich wegschließen müssen, mir ordentlich Medikamente verabreichen.
„Was, wenn der Patient beim nächsten Mal Erfolg hat? Nicht auszudenken!“ Ihre Sorgen sind überflüssig. Ich bin lieb und brav, wie kurz vor Weihnachten. Sie verabreichen mir Tabletten, leckere Tropfen und schwer verträgliche Mengen an gütigem Verständnis.
Psychopharmaka schmeckt.
Sie bewahren einem das letzte bisschen Menschenwürde. „Finde es herrlich, im Bett zu liegen, zugedröhnt herumzufliegen und meinem inneren Gedächtnispalast zuzusehen, wie er in satten überschwänglichen Farben Karneval feiert, bis nichts übrig bleibt, außer einem seligen Lächeln, das mich vor den Menschen beschützt!“ Nach einiger Zeit komme ich raus. Alles hat sich verändert. Sämtliche Freunde und Bekannte packen mich in Watte. Ihre Gesichtsmuskeln zucken nervös, wenn sie mich anlächeln und mich von Optimismus und Zuversicht zu überzeugen versuchen, was für eine tolle Zukunft ich noch vor mir habe. Leider hören sie sich selber nicht reden und merken nicht, dass sie wie Krankenschwestern mit mir sprechen.
„Natürlich, kommt alles wieder in Ordnung, wirst schon sehen, die Zeit heilt alle Wunden“, sowas und noch einigen Unsinn mehr. Blödes Geplärre, Goldfische, die vom weiten Meer reden. Anstrengend und steinerweichend sind sie, so wie Käfer, die unter meine Haut krabbeln, keinen Augenblick auslassen, mich in Angst und Schrecken zu versetzen.
Ständig umkreist mich ihr hysterisches Herumgewusel, als wäre ich ein Verfolgter, ein Gesetzloser ohne Rechte. Ihre matten Augen, die mich mit gähnender Leere und pittoresker Gleichgültigkeit anstarren, mich mit bewusster Abwesenheit und unbewusster Beliebigkeit entsetzen, wenn ihr glanzloser Blick mich abtastet, obwohl sie keinen Unterschied zwischen ihren Körpern und leerem Raum machen, wie sie mich mit Werten und Vorstellungen bedrängen und einengen, obwohl sie ihre Begriffe und Bedeutungen nur auswendig lernten, Lebensinhalte, von glänzenden Bürgerkopien komisch dupliziert, ohne das eigene Profil aus dem Fels der Erkenntnis herausgeschlagen zu haben, ohne den eigenen Feinschliff zu vollenden.
Wenn ihre Erwartungen, Meteoritenschwärmen gleich, auf mich einprasseln, wenn sie ihre Forderungen wie nassen Sand vor meine Füße kippen, ihre alltäglichen Probleme größer und größer machen, um vor dem endlosen Nichts ihres musealen Lebens abzulenken und nachdem das geglückt ist, diese mit vertrocknetem Wohlstand längst vergangener Jahre aufzufüllen versuchen.
Wenn sie wie ziellose Ameisen herumirren, alles vereinnahmen, ohne das Kleinste zu geben, wenn sie an verregneten Tagen in meinem Garten stehen, ohne Erlaubnis mein heiliges Reich entern und die Sonne vertreiben und mich ihr mechanisches Leben an die Wand drückt, dann wünschte ich, mein erster Versuch wäre geglückt!
In der Schlange beim Fleischer, ihn immer wieder aufs Neue in eine Schwätzerei zu verwickeln, ignorant zu erkennen, das zehn Menschen längst mit ihren unsichtbaren Fingern trommeln, mit stumpfer, an Lethargie erinnernder Gleichgültigkeit darüber hinwegsehend, nicht allein auf der Welt zu sein.
Ewiglange Monologe haltend, als wären sie Robinson Crusoe, sich selbst dabei um den Verstand bringend, weil ihre opportunistischen Meinungen schneller die Färbung wechseln, als ein hysterisches Chamäleon, ohne einen einzigen Beitrag zu leisten, ihr UNESCO geschütztes Lächeln, dass sie wie einen Schutzschild tragen, alles übertrieben gut und richtig finden, Unbekanntes dennoch reflektorisch ablehnend, dabei unfähig eigene Meinungen zu ergründen, gar zu äußern.
Wenn ich zu spät bemerke, dass meine anwachsende Ablehnung im Stande ist den Grand Canyon mit dem Klappsparten auszuheben, dann fühle ich, dass ich konsequent sein muss, um nicht Spielball ihres Hologramms zu sein, dass sie ihre Welt, ihr Leben nennen.
Ich höre ihre Worte, auch jene der Unausgesprochenen. Masken aus angepasster Hektik. Ihr verzerrtes Lächeln, wie es vermeintlich Anteil nimmt, zuhören um zu antworten, nicht um zu verstehen, immer unbarmherzig richtend, sie interessieren sich nicht für dich, wollen stattdessen aber, dass du Mitglied ihrer Sekte wirst.
Gleiche Kleidung, Wohnungen und Lebensplanung. Vereine sind wie Militär, manchmal sogar schlimmer. Uniformen erschaffen uniformelles Leben. Befohlene Fröhlichkeit, komatöse, nie enden wollende Saufgelage, mit Grölerei und urgroßväterlichem Liedergut.
Völkisch-soziale Gemütlichkeit mit nationallokaler Gerechtigkeit, maßgeschneidert für‘s globale Dorf. Nie sind sie zufrieden, immer fehlt ihnen was, obwohl sie Alles haben. Unstillbar ihr Hunger. Mit jedem Bissen brauchen sie mehr, heute Einen, übermorgen vier.
Wie Unkraut wachsen Defizite auf dem eigens dafür bestellten Feld, sorgfältig gedüngt mit der Gülle der Eitelkeiten. Ständig wollen sie einem was verkaufen, weil das, was aus ihrer Sicht zu tun ist, mir nicht im Traum einfallen würde.
Immer müssen sie belehren, im Zweifel überreden. Die Welt ist ein Sklavenmarkt. Nichts kann ich mehr ertragen. Ein Kater, der überraschend Zehn, statt neun Leben hat, zur Belohnung ins Körbchen am Ofen darf, wo man ihn zu Tode streichelt. Unerträglich, ich muss hier weg. Als die Tage wieder sorglos vor sich hinplätschern, bekomme ich einen Nervenzusammenbruch.
Diesmal liefere ich mich in eine geschlossene Anstalt ein. Sollen mir beim Geradebiegen helfen. Haben dort gute Fachleute. Ein renommiertes Haus, weithin bekannt, haben schon ganz andere Kaliber gehabt.
Aus ein paar Wochen, werden vier Monate. Als ich raus komme, warte ich, dass Glanz und Glorie wiederkommen, vergebens, ist alles nur schlimmer geworden.
Mehr als matt glänzt nichts mehr. Es muss endlich ein Ende haben. Menschen, Städte, alles macht mich krank, ein sich ewig wiederholender Kreislauf. Nichts Neues kommt mehr hinzu, verflucht sollen sie sein.
Vertrauen nur in Freiheit
Nur kurz sieht er mich an. Eine trauernde Wolke umnebelt sein Gesicht. Tränen laufen. Er hat Angst vor dem Morgen, steigt ins Auto und rollt vorsichtig, wie auf Katzenpfoten die Brücke runter. Seine Schlusslichter entschwinden still, immer kleiner werdend, wie kleine Sonnen, die das Sternenfirmament dunkler scheinen lassen, bis sie mit dem teigigen suppen-grau der Stadt verschmelzen und langsam untergehen, als hätte es sie nie gegeben.
Atemberaubend, die Aussicht, so viele glitzernde Lichter, all die pulsierend-glimmenden Punkte, wie unzählige klitzekleine Herzen, als schwirrten Millionen Glühwürmchen herum, um dem riesigen Körper zu dienen, der sich rekelt, stöhnt und ächzt, mit seinen kaltblitzenden Augen, gierig nach Lebensraum spähend, um seinen nimmersatten Appetit zu stillen.
Sie raucht, qualmt, frisst und scheißt, verschlingt ihre Menschen, nachdem sie sie gebar. Stinken tut sie erbärmlich, wie die tausend Jahre alten Kloaken von Galaxien-Vögeln. Ständig geht sie fremd, manchmal bekannt. Vor nichts scheut sie zurück, solange es schmutzig genug ist, um sich durchs Leben zu ficken, wie es ihr gefällt.
Gierig schluckt sie, ohne zu kauen, gleich einer tobsüchtigen Kinds-Hure, die an der eigenen Neugier erstickt, als sie begreift, dass das Leben sie überfährt, wie Millionen, Milliarden vor ihr. Vorbei die Zeit, als alles nach Provinz, Tante Emma und Eckkneipe roch. Heute glänzt sie großartig, fantastisch-formidabel, ein hysterisch-blinkender Ballsaal, Ausstellungsraum des pervertierten Wahnsinns.
Bin aufs Tiefste entsetzt von ihrem schäbigen Charakter, wie sie frisst und säuft, sich fortpflanzt, sich mit ihren Menschen-Bürgern den Hintern wischt. Dumpf ist ihr Sumpf, ihre grausame Verkommenheit, ihr verzweifelt schwitzender Körper, um jeden Preis am Leben erhaltend, ihr provinzielles Aufdonnern, einfach abscheulich, fürchterlich.
„Ständig schminkst du dich, immerzu in den Spiegel schauend, dich tiefer und tiefer in deinen narzisstischen, selbstbefriedigenden Wahnsinn hinab masturbierend, schon lange merkst du nicht mehr, dass du eine nimmersatte Großstadthure bist, längst verloren all dein Taktgefühl, leicht daran zu erkennen, wenn du dir mehrmals über deine schmierige Visage wischt, alles großflächig verteilst, ohne es zu merken; natürlich stolzierst du ohne Unterlass herum, als seist du das Orakel des Universums, nicht begreifend, dass Reichtum und Glamour eine trashige Straßen-Dirne aus dir machten; längst vorbei deine großen Zeiten, wo man dich vornehm hofierte, als du elegant und nonchalant durch die Welt flaniertest, ständig der gewöhnlichen Welt zulächelnd, nicht minder stolz, wie Apothekerinnen darauf bedacht, diskret und zurückhaltend zu bleiben.
Nun schau, was aus dir geworden ist. Alles willst du haben, heute, hier und jetzt, nie kannst du warten. Deine ewigen Bedürfnisse, Handlanger deiner nimmersatten Gier. Höflinge und Speichellecker, die dir deine Löcher lecken, sich dir unterwürfig mit Haut und Haaren verkaufen; wie du mich anekelst, wie ich deine Borniertheit und Selbstverliebtheit hasse, zum Kotzen, deine Blindheit gegenüber dem eigenen Makel, hast alle pervertiert, restlos, bis aufs letzte Hemd, wie es nur der Leibhaftige tut, du ach so modernes Babylon.
Ja, bestimmt versteht ihr euch blendend, seid ihr doch zwei räudige Verführer, alles ausmergeln und aussaugen, bis auf den letzten Tropfen, das alles zu Staub zerfällt, sobald du fertig bist, nachdem du alles im Ganzen schlucktest, wie süße Trauben vom heiligen Baum, nur zum Spaß, weil du es kannst.
Hast sie gründlich verdaut, bis nichts mehr übrig blieb, außer einem kleinen seelenlosen Häufchen Elend, das dein schmutziger Hinterausgang ins dumpfe Moor des Lebens platschen ließ. Dein falscher Glanz, deine schönen Kleider, die vermeintlich elegante Architektur und die schönen Düfte, können nicht darüber hinwegtäuschen, dass du zum materialistischen Monster mutiertest.
Ich will weg, zu lange plag ich mich mit euch herum, zu lang habe ich es nicht gemerkt, nicht wahrhaben wollen. Irgendwann fing ich an ein Teil von euch zu werden, fast schien es, als kämen meine Entschlüsse zu spät, doch zum Glück bin ich jetzt erwacht; ausgerechnet eure ewig-grinsenden Abziehbilder, haben mir geholfen; welche Ironie, wie schön vorhersehbar, dass es dir am Ende wie all den Imperien, Königreichen und Monarchien geht. Geschichte, eine ewige Wiederholung von Gleichem, mit wechselnden Kleidern. Seelenlose Konsum.- und Industrie-Sklaven. Erfolg, Reichtum und Macht, um die Wette glänzend, mit viel Glorie, in Wahrheit nur triviale Oberfläche spiegelnd, während drinnen furchtbare Stürme toben, die alles aushöhlen und vertilgen, bis auf den stillen Mantel der Nacht.
„Erloschene Augen, wohin man auch sieht. Schwarze Vogelnester toter Einsamkeit, hinter allem hinterherhechelnd, ihr macht mich krank. Eure endlosen Versuche mir euer Gift in die Venen zu spritzen, verzweifelte Junkies, die ihre Droge rücksichtslos verbreiten. Jeden Tag höre ich ihr endloses Klopfen an meiner Tür. Nein danke, wird weder als Antwort noch Zahlungsmittel akzeptiert, als hätte sich alles gegen mich verschworen; eure ewigen Intrigen, dauerndes Geflüster, nie enden-wollender Wüstenwind; deine Lichter, wie sie hässlich-dunkel-eklig in der Dunkelheit lachen, ich rieche das Wasser unter mir, fühle wie die Kälte des metallenen Geländers in Hände und Beine kriecht und Wärme aus mir zieht, so wie ihr.
Wind bläst mir durchs Haar.
Ist stürmisch heute. Blinkende Lichter vom Container-Terminal grüßen mit automatisch herumfahrenden Blechkisten, heute hier, morgen dort, bald irgendwo, warum nicht nirgendwo? Was macht es, was änderte es, wen interessiert es, was soll das, wo ist der Sinn? Ist schön hier oben, schön still, niemand der was von mir will, ganz anders als in der Klinik. Wind, der um Pfeiler und Seile pfeift, wie sie fröhlich miteinander summen, wie eine riesige Harfe, vor langer Zeit gespannt, mittlerweile längst verstimmt, wie meine Nerven; fühle mich frei und glücklich, nichts kann mehr an mir zerren, endlich mein eigener Herr.
Niemals werdet ihr mich kriegen, ich bestimme selber. Geht sowieso alles vor die Hunde, worauf also warten? Dass es besser wird? Sieh dich mal um, haben alle die Wahl und was machen sie? Wählen alle den Henker, ihren eigenen Untergang, wie traurig und öde ist der Mensch. Was ist bloß aus ihm geworden.
Ist all das, was du liebtest, was dir wichtig schien, all deine Werte, deine Kultur, ist dir all das nichts mehr wert? Bist du komplett beliebig und paranoid geworden?
Hast du Angst?
Ist es möglich, dass du dich vor etwas fürchtest, was es in Wirklichkeit nicht gibt? Hat irgendjemand etwas von dem erlebt, was man hier und dort zeigt? Faschistoide Ordnung, ist es wirklich was du willst, damit du saubere, am besten, reine Korridore hast, in denen Weiße, wie eh und je miteinander fremdgehen, während man im Ghetto nebenan indisch und chinesisch kocht? Soll das deine Zukunft sein?
Ich kann und will nicht begreifen, dass nach all den Jahrtausenden, voller untergehender Imperien, Diktaturen und Königshäuser, auch heute noch, als hätte man nichts, rein gar nichts aus der Vergangenheit gelernt, dass auch heute noch eine Handvoll reicher egomanische Alphatiere, unsere Welt umkrempeln, dass man unbezahlbar wertvolle Jahre mit ein wenig Rücksicht und Toleranz, in den Ausguss der Zeit kippt, als wär nichts gewesen, als wär alles ein zufälliger Irrtum.
Mattschwarz glänzt das Wasser unter mir. Es sieht gar nicht so weit weg aus. Ein paar Schiffe fahren unter der Brücke durch. Wassertaxis, ein paar Hafenfähren, irgendwo schippern ein paar Barkassen herum, starten Flugzeuge, alles mechanisch gut organisiert. Niemand nimmt Notiz, oder ist an Irgendetwas interessiert.
Seelenlose, bitten Menschenkopien zur Kasse, was hat das bitte mit Leben zu tun? Ich will es nicht mehr, kann das Leben nicht mehr ertragen, meine Seele ist wund. Ich will nur noch schlafen, ganz weit weg, wo es still und friedlich ist, wo man mich in Ruhe lässt, wo niemand mehr Brocken aus meinem Körper herausbeißt. Ich sehe nochmal runter und pendle mit meinen Beinen, wie früher auf der Schaukel.
Endlich schlafen, endlich Stille. Ich wippe mehr, hole kräftig Schwung, niemand, der mich hindert, sich daran stört, ein lauwarmes Lüftchen sagt mir Gute Nacht, jetzt ist ein schöner Moment,
jetzt soll es sein, jetzt, ja - jetzt!
0,1s
Ich spiele heute zum allerersten Male draußen und fühle mich groß und frei, so ganz ohne Aufsicht. Es ist stürmisch. Duft von verbranntem Holz liegt in der Luft. Hin und wieder spucken Schornsteine Rauch aus, der sich in mehligen Wolken von energischem Wind zu Boden werfen lässt, bevor er friedlich über den Boden krabbelt und sich langsam verflüchtigt, in Nichts auflöst.
Gräser und Blumen biegen sich auf den Wiesen, wie ein buntes Meer, wie das Fell eines schlafenden Berges, der nicht wachsen will. Sand faucht die Straße entlang. Unbekümmert und friedlich sitze ich in meiner Sandkiste, ein paar wilde Häuschen, erste Luftschlösser bauend.
Hin und wieder verschmiert Scheuermilch meine Augen. Kühl der Sand, unschuldig mein Herz. Plötzlich sehe ich in großer Entfernung bedrohliche Wolken heranziehen, die sich nach und nach in schwere Dunkelheit verwandeln. Schnell ist es gruselig finster und das mitten am Nachmittag.
Erste Tropfen pusten heran, durchnässen mich von der Seite. Ängstlich geduckt fährt jemand mit dem Rad an mir vorbei. Fast übersehe ich, dass es unsere dicke Nachbarin ist, winkend, wie auf einer Schwarz-Weiß-Postkarte. Tolle Waffeln macht sie, mit feinem Puderzucker, mit knuspriger Gitter-Oberfläche, die etwas brüchig aber tief drinnen, und das ist das Fantastische, unglaublich Leckere daran, saftig-zart bleiben. Weit entfernt höre ich donnerndes Rauschen, irgendwo Mamas Rufen, „Komm sofort rein!“, befiehlt sie mit energischem Ton an der Tür stehend.
Höre ich ein Zittern in ihrer Stimme? Hat sie Angst, gar Wut? Ich bekomme keine Antwort und sehe sie in der Küche verschwinden. Bestimmt steht etwas auf dem Herd. Gerade erreiche ich unser Haus und klopfe mir Sand von den Knien, als ich fühle, wie die heranstürmenden, braun-violetten Wolken, wie flüssige Steine den Himmel bedecken.
Nur kurz blicke ich zur offenen Küchentür, drehe mich widerspenstig um und renne in die entgegengesetzte Richtung. Zu heiß kocht die Neugier in mir. Wie von Sinnen springe ich aufs Laufrad und strample die bleiche bucklige Straße entlang, hinunter an die zackigbrüchigen Klippen, in die Arme der bedrohlich-zornigen Wolken.
Immer stärker spielt der nahende Sturm mit seinen gewaltigen Muskeln, wird stärker, immer stärker, bekommt eine eigene Stimme. Immer flacher liege ich auf dem Laufrad, trete und laufe so schnell ich kann. Bergab bekomme ich viel Fahrt drauf. Zweimal verliere ich das Gleichgewicht und taumle über den knorrigen Weg. Darauf hat der brüllende Wind gewartet und stößt mich mit tückischen Böen zu Boden.
Schnell wie ein Kaninchen rapple ich mich auf, schüttle den Kopf und spring wieder aufs Rad. Endlich erreich ich das brüchige Klippenmaul. Fasziniert bleibe ich stehen. Ohrenbetäubend krachen beeindruckende Brecher auf die Küste, gehen scheppernd wie flüssige Keramikberge zu Bruch, während der Orkan neue, gewaltig-schäumende Wellen hinterherschickt.
Manche brechen kraftlos früh, doch einige sind stark, immer stärker und größer werdend und schieben sich weit über die Felsen, explodieren markerschütternd wie Wasser-Monster an den schlotternden Klippen.
Wie angewurzelt bleibe ich stehen, fasziniert von dieser unvorstellbaren Kraft. Obwohl es nur wenige Meter vor meinen kleinen Füßen geschieht, habe ich keine Angst, im Gegenteil.
Weißer Sprühregen wirbelt weiß-glitzernd in den Himmel empor, Gischt, spritzt neblig in die Höhe, versprüht feine Perlen auf meine glücklich-glänzenden Wangen. Donnernd knallen gewaltige Wassermassen in die Bucht, fauchen entfesselt wie hunderte Furien, tausende Meeres-Ungeheuer.
Leuchtend-weiß, violett-bordeaux der Horizont. Voller Bewunderung stehe ich vor der alles beherrschenden Kraft und Macht, das muss eine Naturgewalt sein, ich bin mir ganz sicher, schön und beängstigend zugleich, Feuer, Wind und Wasser, das also ist das Meer, wovor Mama und Papa mich täglich warnen. In weiter Ferne schimmern zwei blinkende alte Leuchttürme, die störrisch in der tobenden See stehen.
Gebannt stehe ich vor dem Naturschauspiel, will gerade noch ein wenig dichter ran-treten, als mich etwas an der Schulter packt und energisch herumreißt. Bevor ich Mama erkenne, bekomme ich eine Ohrfeige. Sie zerrt mich energisch hoch und schleppt ihren störrischen Esel hinter sich her. Stumm sitzen wir beim Abendbrot. Wind-Gespenster heulen ums Haus. Es riecht nach Holz, Tee und Wein. Das Küchenradio krächzt blechern wie eine alte Hafensirene.
Man versteht überhaupt nichts und doch klingt es schön, irgendwie gemütlich. Ich blicke auf das Holzbrett vor mir, zähle die Maserungen, all die feinen Risse. Abwechselnd blicken meine Eltern zu mir rüber, dicht gefolgt von Mamas Schluchzen und Schnäuzen ins Taschentuch, das sie in ihrem linken Ärmel bei sich trägt. Kurz darauf ein leises Plätschern in ihrer Tasse, dumpfes Gluckern in Papas Glas.
Dann Stille.
Schweigsames Kauen und Lauschen, zusammen und doch jeder alleine für sich. Nach einer Weile muss ich auf Klo. Papa nickt, Mama lächelt. Langsam gehe ich den Flur entlang, öffne die Toilettentür, stell mich auf die Zehenspitzen und schalte das Licht an. Mit kratzendem Geräusch ziehe ich den Plastiktopf aus der Ecke und setz mich vorsichtig drauf.
Ich hasse ihn, weil er immer eiskalt ist. Erleichtert gehe ich in mein Zimmer, ziehe mir den Schlafanzug mit dem Katzenmuster an, schnapp mir mein Kuscheltier und warte auf Gute-Nacht-Geschichte und Kuss.
Strahlend schön der neue Morgen, warm und leuchtend, mit neuen Farben und Gerüchen. Schnell ziehe ich mich an und krabble wie ein bunter Käfer über Wiesen und Felder. Magisch, wie sich die vielen Gräser und borstigen Flechten im Boden verankern, untereinander festhalten, wie eine starke Familie, die in den Sonnenuntergang schunkelt, ein bunter Teppich aus Pflanzen, Blumen und Sträuchern, dazwischen Möwengeschrei.
Zufriedene Schafe blöken hier und da. Hin und wieder tutet ein Schiff. Leichter Wind streicht aufmerksam um die Häuser und zerzaust grasende Schafe. Heut will ich wieder das Meer besuchen und radle die altersgekrümmte Straße entlang.
Ich hatte Geburtstag und ein Fahrrad geschenkt bekommen, mit einer richtigen Kette zum Drehen. Geschwind fahre ich die Asphaltachterbahn runter zum Meer. Wie ein glänzender blauweißer Spiegel liegt sie da. Leicht gekräuselt, mit weißen Kronen.
Kleine Wellen umgarnen fröhliche Felsen, umgurgeln geheimnisvoll die zwei Leuchttürme, als wollten sie sich entschuldigen für die Wildheit der letzten Tage, für die Brocken, die sie aus ihnen herausfraßen. Schlafend erholt sich die Klippe, döst müde in der strahlenden Sonne und blickt sich nach mir um, als ich mich dazulege und an Mittagessen denke.
0,2s
Mama steht am Herd und rührt etwas um, vielleicht Suppe, Teig oder Sauce. Ihre Füße sind zart und schlank, mit Zehen wie eine Panflöte und rotlackierten Nägeln, die wie kleine Ampeln leuchten.
Sie trägt Sandalen, irgendetwas Gesundes, vielleicht Leder und Kork, oder so. Jemand macht sich an der Haustür zu schaffen, steckt einen Schlüssel rein, Papa kommt von der Arbeit.
„Hallo, wie war euer Tag?“, lächelt er müde, hängt Jacke und Tasche weg, steigt aus seinen Schuhen, schlüpft in seine Latschen und nimmt mich in den Arm. Seine Bartstoppeln kratzen. Zwei Kater die schmusen. Kurze Zeit später stellt er mich wie einen Zinnsoldaten auf den Boden, lächelt warm, seufzt und geht in die Küche.
Mama bekommt auch Einen.
Sie sehen müde und zufrieden aus, unterhalten sich leise. Oft ist Mama erschöpft, als wenn ich eine Katze wär, mit der sie versucht zu reden und vorher weiß, dass sie nicht antwortet, wie eine Möwe, der sie einen Stift gibt und weiß, dass der Vogel ihn fallen lassen wird.
Wieder ein neuer Tag.
Heute schimmert das Meer wie aufgeschäumtes Metall mit dem Himmel um die Wette und wäscht sich mit den Sternen die Hände. Wellen spritzen angeberisch. Schon den ganzen Nachmittag sitze ich am Meer und spiele mit den borstigen Pflanzen, als plötzlich stürmischer Wind meine Augenlieder hochzieht. Wetterumschwung, schon donnert Wind in meine Hose und pustet sie zu prallen Röhren auf.
Sand prasselt in meine Kugelseen, ich kneif sie zusammen, blinzle unzählige Male, bis Kokosmakronen meine Augenwinkel verzieren und die Zähne knirschen. Irgendwann will ich wieder nachhause.
Noch länger und hügeliger als sonst, kommt mir heute unsere Straße vor, meine Beine brennen wie Feuer. Ich trete und trete und stehe auf dem Fleck. Im Zeitlupentempo keuch ich an Weißbarts Haus vorbei. Heute knattern seine Flaggen besonders fröhlich im Wind. Jeden Morgen zieht er sie zum Himmel blickend hoch, als hoffe er Gott zu erblicken.
Zerklüftet, runzelig-braun ist sein Gesicht, das wie ein mit Leder bezogenes sehnsüchtiges Korallenschiff durch die Welt schwimmt, nur hin und wieder das Meer erblickt, meist des Abends, wenn er sehnsüchtige Perlen vergießt, wenn es seine dunklen Murmeln liebkosen.
Oft singt er, hin und wieder sogar Opern-Arien, manchmal auch deftige Seemannslieder. Wenn Weißbart und ich zusammen singen, fühle ich mich wie ein fröhlicher Vogel, wie eine kleine Orgel, als ob ich größer und größer werde, anfange zu fliegen und bunter Sternenstaub aus mir strömt, der auf die Welt, mit all seinen Tieren und Pflanzen herabrieselt. Fast bin ich an Weißbarts Haus vorbei, als er mit seinem alten Auto vorbeigefahren kommt, freudestrahlend winkt und herüberruft, „Ahoi, Leichtmatrose!“, und sich mit seiner vierrädrigen Hafenbarkasse an unserem Haus vorbeiräuchert, während er an seiner Pfeife kaut und seine Hände unhörbare Melodien singen.
Mama hat mich kommen hören.
Die Haustür ist leicht geöffnet. Alles macht Mama diskret, als wolle sie der Welt nicht zur Last fallen, unter allen Umständen verhindern, sich von irgendwem, irgendwas abhängig zu machen, oder gar aus Versehen, im Vorgarten eines Menschen zu stehen.