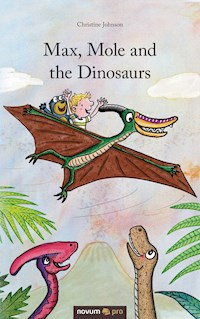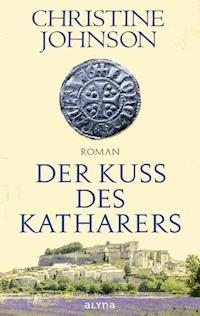
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Europa Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
"Als Lia Carrer eineinhalb Jahre nach dem Unfalltod ihres geliebten Mannes auch noch ihren Job an der Universität in Seattle verliert, kehrt sie Amerika endgültig den Rücken. Sie zieht nach Südfrankreich zurück, wo sie früher ihre Ferien bei den Großeltern verbrachte. Im ruhig gelegenen Landhaus ihrer besten Freunde will sie ihr Leben neu ordnen und ihre Forschungsarbeiten über die Katharer wieder aufnehmen. Noch in der Nacht ihrer Ankunft, als sie erschöpft von der Reise am Fenster steht, erscheint das Gesicht eines Mannes in der Dunkelheit – eine Vision, die ihr jedoch nur wenige Tage später leibhaftig gegenüber tritt! Der geheimnisvolle Raoul, von dem sie sich bald magisch angezogen fühlt, hat ein ebenso großes Interesse an den sagenumwobenen Katharern wie sie. Bald muss Lia erfahren, dass ihre Recherchen über einen Mordfall aus dem 13. Jahrhundert, der zur Vernichtung der Katharer führte, sie und ihre neue Liebe in Gefahr bringen, und die Geister der Vergangenheit lebendiger sind, als sie es sich je träumen ließ"
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 428
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
aLYna ist ein Imprint der Europa Verlag GmbH & Co. KG, herausgegeben von Michael Görden
© 2016 by Julie Christine JohnsonAll Rights reserved. This edition published by arrangement with Sourcebook Inc., Illinois and Arrowsmith Agency, Hamburg.Titel der amerikanischen Originalausgabe: In Another Time
1. eBook-Ausgabe 2016 ©2016 der deutschen AusgabeAlyna Verlag in der Europa Verlag GmbH & Co. KG, Berlin • MünchenUmschlaggestaltung: Hauptmann & Kompanie Werbeagentur, ZürichLayout und Satz: BuchHaus Robert Gigler, MünchenKonvertierung: Brockhaus/CommissionePub-ISBN: 978-3-95890-070-7
Das eBook einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des Verlags unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen. Der Nutzer verpflichtet sich, die Urheberrechte anzuerkennen und einzuhalten.Alle Rechte vorbehalten.
www.alyna-verlag.de
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlags wiedergegeben werden.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von §44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Ansprechpartner für ProduktsicherheitEuropa Verlage GmbHMonika RoleffJohannisplatz 1581667 Mü[email protected]+49 89 18 94 [email protected]
Für Brendan
HISTORISCHE ANMERKUNG
Vor achthundert Jahren erstreckte sich zwischen Pyrenäen, Zentralmassiv und Mittelmeer ein riesiges Gebiet, das aus lauter einzelnen Lehen bestand. Die Region wurde geeint durch die langue d’oc – den Vorläufer des heutigen okzitanischen Dialekts, der in ganz Südfrankreich und im nordspanischen Katalonien gesprochen wird. Das Languedoc, wie es heute heißt, war weitestgehend unabhängig vom französischen Königreich im Norden. Hier entstand ein neuer Glaube, der auf alten gnostischen Traditionen beruhte. Es war der Katharismus.
Die Katharer glaubten, dass die Seele des Menschen dazu verdammt war, in einem vergänglichen Körper ständig wiedergeboren zu werden, wenn jemand sein irdisches Leben nicht würdig erfüllt hatte – bis Gott die Seele für erlöst erklärte. Der Himmel war demnach eine Erlösung von der Hölle der Reinkarnation.
Der Katharismus unterschied sich radikal vom sozialen und moralischen Kodex der katholischen Kirche. Er wurde daher im 12. Jahrhundert von der Kirche zum häretischen Glauben erklärt. Doch die Katharer wurden immer einflussreicher und zahlreicher. Bis im Januar 1208 ein Mord an der Grenze zwischen der Provence und dem Languedoc alles veränderte.
TEIL I
»Unsere Verstorbenen sind erst tot, wenn wir sie vergessen haben.«George Eliot
1INTERNATIONAL AIRPORT CHARLES DE GAULLE AUSSERHALB VON PARIS – LETZTE WINTERSONNENWENDE
Achtzehn Monate nach dem Tod ihres Mannes kehrte Lia Carrer ins Languedoc zurück, wie ein Schatten auf der Suche nach Licht.
Vom gläsernen Innenhof des Terminals sah die graue Wolkendecke über Paris anders aus als der Himmel über Seattle, wo sie hergekommen war. Aber die Stadt der Lichter war nicht ihr Endziel. Der Hochgeschwindigkeitszug TGV fuhr direkt von Charles de Gaulle und brachte sie in weniger als fünf Stunden nach Narbonne im Süden.
Im TGV sank Lia auf ihren Fensterplatz. In ihrem Kopf hallten noch Flugzeugmotoren und Lautsprecher, aber die Geräusche der Zugfahrt – die Türen, die sich mit pneumatischem Zischen öffneten und schlossen, der Luftdruck beim Vorbeifahren entgegenkommender Züge – waren sichere Anzeichen dafür, dass ihre Reise bald vorüber war. Sie befand sich wieder auf festem Boden. Schläfrig blickte Lia aus dem Fenster auf die vorbeiziehende Landschaft.
Als die winterbraunen Täler langsam den Felsen und Abhängen des Zentralmassivs wichen, stieg Vorfreude in ihr auf. Auf der anderen Seite dieses riesigen Gebiets voller erloschener Vulkane und Felsplateaus lag die Provence und die wilde, einsame Schönheit ihres geliebten Languedoc. Sie dachte an die Sommerhitze in den Tälern der Pyrenäen und an die wilden Winterstürme entlang der Mittelmeerküste.
Es war der 21. Dezember, die letzte der dunkelsten Nächte. Lia hatte zwar nicht absichtlich diesen Tag gewählt, um in Frankreich einzutreffen, aber jetzt kam er ihr vor wie ein gutes Omen. Sie hatte die Wintersonnenwende, wenn die Erde ihr blasses Gesicht der Sonne zuwandte, immer als Zeit der Wiedergeburt empfunden. Vielleicht war diese Reise ihre Wiedergeburt. Zumindest ging es vorwärts.
Aus der goldenen Dämmerung war tiefblauer Nachthimmel geworden, als sie am Bahnhof in Narbonne ihren Mietwagen abholte. Die letzten Kilometer bis nach Minerve fuhr sie über eine leere Landstraße, durch dunkle Täler, in denen an Kreuzpunkten römischer Straßen mittelalterliche Ruinen standen. Die Geräuschkulisse einer Sendung auf Europe 1 und die gelegentliche Erinnerung der körperlosen Stimme aus dem GPS leisteten ihr Gesellschaft. Lia hielt vor Le Pèlerin, einem Steinhaus am Ortsrand, hoch über dem Fluss Cesse. Hier war ihre Reise zu Ende.
Vor drei Jahren hatten ihre liebsten Freunde Rose und Domènec Hivert eine verfallene Ruine in Minerve gekauft, fünfundzwanzig Kilometer nördlich von ihrem Hof in Ferrals-les-Corbières. Sie benannten sie nach den Wanderfalken, die es im ganzen Languedoc gab, Le Pèlerin, und verwandelten das Objekt in eine gîte – ein Feriendomizil, das man mieten konnte –, um ihr Einkommen als Bauern und Winzer ein wenig aufzubessern. Pèlerin bedeutete jedoch auch Pilger. Als Lia anrief und eine Zuflucht suchte, bot Rose ihr das Cottage an, bis sie sich ihre nächsten Schritte überlegt hatte.
In der Diele ließ sie ihre Reisetaschen fallen und schlüpfte aus ihren Schuhen. »Ich bin da!«, verkündete sie dem dunklen, stillen Haus. »Der Pilger auf der Suche nach einem Heim.« Le Pèlerin wirkte auf sie wie ein Nest in einer Baumhöhle – geschützt und ruhig.
Eine Lampe auf einem schmalen Tisch neben der Tür warf einen schwachen Lichtschein auf den Gang zwischen Küche und Diele. Lia war nicht im Le Pèlerin, seit Rose und Dom den Umbau beendet hatten, und was sie jetzt sah, ließ sie vor Freude schnurren.
Der Eingangsbereich trennte Küche und Esszimmer vom gemütlichen Vorderzimmer. Die niedrigen Decken wurden von Holzbalken gehalten, und Teppiche in tiefem Rot und Blau lagen auf dem Boden aus gebeizten, glänzend polierten Kieferndielen. Lia ging durchs Vorderzimmer und fuhr mit den Händen über den rauen Putz an der Wand. An kalten Tagen hielt er die Räume warm, doch in den heißen Sommern im Languedoc würde das Haus kühl und frisch sein. Am anderen Ende des Zimmers war Holz im Kamin aus Flusssteinen aufgestapelt. Sie brauchte nur noch ein Streichholz entzünden, um ein loderndes Feuer zu entfachen. Domènec hatte ihr am Tag zuvor gemailt und versichert, dass Marie-Françoise, eine Haushälterin aus dem Ort, vor Lias Ankunft den Thermostat hochdrehen würde. Und tatsächlich wärmte der Steinboden in der Küche ihr die Füße.
Ihre Freunde feierten verfrüht Weihnachten mit Domènecs Eltern in Perpignan. Sie würden erst in drei Tagen zurückkommen. Bis dahin war Lia allein.
Sie zitterte vor Erschöpfung. Da sie es nicht mehr schaffte, ihre Koffer nach oben zu schleppen, ließ sie sie am Fuß der Treppe zurück und packte lediglich frische Wäsche und bequeme Kleidung aus sowie Shampoo und Duschgel.
Die Wanne mit den Klauenfüßen war so breit und tief, dass ohne Weiteres zwei Personen gemeinsam hineingepasst hätten. Total unpraktisch, Wasserverschwendung, und der wunderbarste Anblick, den Lia sich in diesem Moment vorstellen konnte. Die Wanne stand an einem tiefen, breiten Fenster, durch das sie den zunehmenden Mond sehen konnte. Sie drehte das heiße Wasser voll auf und ließ gleichzeitig kaltes Wasser hinzulaufen; der Wasserdruck war hier so schwach, dass sie genügend Zeit haben würde, bis die Wanne vollgelaufen war. Sie zog sich aus und tappte auf bloßen Füßen in die Küche. Nach sechsunddreißig Stunden in denselben Kleidern strich die kühle Luft wie ein erfrischender Kuss über ihre Haut.
Ein Dreiviertelmond schien durch das Fenster des lang gezogenen Raums und lockte sie zum langen Tisch, der vor der verglasten Wand stand. Lia fühlte sich fast schwerelos vor Müdigkeit und hatte das Gefühl, sie würde gleich durch die Fenster auf die Terrasse und in die Schlucht der Cesse schweben. Aber ihr bleiches Spiegelbild wurde durch das Glas aufgehalten.
Dort, wo früher einmal Rundungen gewesen waren, standen ihr jetzt die Knochen hervor. Unter ihrem Rippenbogen, auf ihren hohlen Wangen und um ihre tief liegenden Augen lagen Schatten. Sie berührte ihren Bauch und die scharfe Kante der Hüfte und legte die Hand auf ihre Rippen. Der Kummer hatte die üppigen Rundungen ihrer Brüste und die Wölbung ihres Bauches, den Gabriel so gerne gestreichelt hatte, verschwinden lassen.
Sie hatte schon lange nicht mehr ihr Spiegelbild betrachtet. Im Yogastudio wandte sie den Blick von den deckenhohen Spiegeln, und wenn sie sich im Badezimmer neben ihrem Büro die Hände wusch, blickte sie ins Waschbecken. Sie hatte hart daran gearbeitet, sich aufzulösen, ein Geist zu werden.
Als sie jetzt ihren weiß schimmernden Körper in der Glasscheibe betrachtete, sah Lia, wie gerade sie sich hielt, als ob es ihr Herz vor Schmerz schützen würde, wenn sie ihre Muskeln stählte. Seit anderthalb Jahren hatte sie keinen Appetit mehr. Seit anderthalb Jahren tat sie alles nur mechanisch. Sie trieb durch ein Leben, in dem es kein Geländer mehr gab, woran sie sich festhalten konnte.
Die Mattigkeit hatte begonnen an einem warmen Tag im Oktober, an dem der Himmel über Seattle blau war wie in der Toskana und der Duft nach getrockneten Rosen die Luft erfüllte. Der Dekan der historischen Fakultät an der Cascade University, wo sie als wissenschaftliche Hilfskraft europäische und mittelalterliche Geschichte unterrichtete, hatte sie in sein Büro gerufen, die Tür geschlossen und ihr mitgeteilt, die Fakultät würde ihren Vertrag nach dem Herbstquartal nicht mehr verlängern. Ihre letzten Studentenbewertungen waren schlecht gewesen, und sie hatte auch in den Komitees der Abteilung nicht mehr mitgearbeitet. Früher hatte der Dekan noch angedeutet, sie könne eine befristete wissenschaftliche Stelle bekommen, wenn sie ihre Dissertation im nächsten Jahr fertigstellen und verteidigen würde. Aber nach Gabriels Tod ruhte die Datei mit ihrer Doktorarbeit über die Rolle von Reinkarnation und Leben nach dem Tod in der katharischen Theologie ungeöffnet in ihrem Rechner. Also musste jemand anderer eine Entscheidung über ihr Leben treffen, damit Lia endlich wieder ein paar Schritte weitergehen konnte.
Mit einem Fluch wich sie von der Scheibe zurück, als es direkt hinter dem Fenster weiß aufblitzte. Im Bruchteil einer Sekunde sah sie das Gesicht eines Mannes. Das Mondlicht enthüllte dunkle Augen und scharfe Wangenknochen. Über die linke Seite seines Gesichts zog sich ein schwarzer Striemen. Lia warf die Hände hoch und schlug gegen die Scheibe. Wie ein Stromstoß löschte das Adrenalin all ihre Erschöpfung aus.
Ein Schrei zerriss die Luft, und das Gesicht draußen vor dem Fenster wirkte auf einmal nicht mehr menschlich. In der Krone einer Schirmpinie, die am Felsen wuchs, saß ein Raubvogel. Der Wind plusterte die Federn an seinem Unterbauch auf. Sie schimmerten weiß im Mondlicht. Sein brauner Kopf neigte sich und seine bernsteinfarbenen Augen richteten sich auf Lias nackte Gestalt. Sie schloss die Flügeltüren auf und trat auf die Terrasse am Haus.
Vor zwei Jahren, bei einer Vogelschau im Château Peyrepertuse, hatte sie einen Bonelli-Adler gesehen. Früher einmal hatte er den Himmel über dem Languedoc beherrscht, aber jetzt war er in Frankreich nahezu ausgestorben. Einen solchen Adler in freier Natur zu sehen, war unglaublich. Tränen traten Lia in die Augen, als ihr klar wurde, was für ein Geschenk dieser majestätische Vogel ihr gemacht hatte.
»Was hat dich hierher gebracht?«, flüsterte sie in Richtung des Adlers, der sie von seinem Ast aus beobachtete.
Er veränderte seine Position und zeigte Lia das Profil seines Kopfes mit dem gebogenen Schnabel. Dann breitete er die Flügel aus und Lia keuchte auf, als sie die mächtigen gefiederten Schwingen sah, die von Spitze zu Spitze gut zwei Meter maßen. Er schwang sich vom Baum, und sie spürte das Rauschen seiner Flügel mehr, als dass sie es tatsächlich hörte. Dann verschluckte ihn die Nacht.
Das kalte Eisengeländer presste sich an ihre nackte Haut, sie spähte in den schwarzen Abgrund unter sich. Der Fluss plätscherte, und der Wind, der durch die Büsche fuhr, antwortete ihm, aber im Mondschein konnte sie nur undeutliche Umrisse erkennen. Sie huschte zurück ins Haus und schloss die Tür hinter sich ab.
»Lia, du brauchst Schlaf«, sagte sie zum leeren Zimmer.
Das Geräusch ihrer Stimme durchbrach den Zauber. Sie hörte Wasser rauschen. Das heiße Bad winkte, ebenso der Wein auf einem Regal auf dem Küchentresen. Domènec und Rose hatten es mit Flaschen aus ihrem eigenen Anbau gefüllt, in dem sie Syrah-, Grenache- und Mourvèdre-Trauben anbauten. Lia zog eine Flasche hervor, nahm ein Glas aus dem Schrank und den Korkenzieher vom Tresen.
Über der Badewanne trieben Dampfschwaden und das Wasser stand schon bis kurz vor dem Rand. Lia drehte die Hähne zu und ließ ein paar Zentimeter ablaufen, während sie die Kerzen auf der Fensterbank anzündete und die Flasche öffnete. Der Wein schimmerte fast schwarz im gedämpften Licht. Langsam ließ sie sich ins heiße Wasser sinken, hielt das Glas hoch und blieb so lange in der Wanne, bis Hitze und Wein den Aufruhr in ihrem Kopf beruhigt und die Schmerzen in ihrem Körper aufgelöst hatten.
Später wickelte sie sich in ein nach Lavendel duftendes Handtuch und ging die Treppe hinauf in das Schlafzimmer, das unter den Holzbalken des Daches lag. Ein Heizkörper an der Wand erfüllte den tiefen, niedrigen Raum klickend und seufzend mit Wärme. Das Handtuch fiel zu Boden und sie schlüpfte unter die Daunendecke in die sanfte Umarmung der Baumwollbettwäsche. Endlich fand sie Schlaf.
2IN DER NÄHE VON MINERVE, LANGUEDOC – WINTERSONNENWENDE 1208
In einer tief in den Kalkstein über der Cesse eingegrabenen Höhle zitterte Raoul d’Aran vor hohem Fieber. Er hatte sich die Hände unter die Achselhöhlen gesteckt, weil ein eisiger Wind wie mit Nadeln durch seinen schweißgetränkten Wollumhang drang. Mit all seiner Kraft klammerte er sich an seine heiße Wut. Aber es war die Trauer, die ihn zu überwältigen drohte. In seinem Fieberwahn sah er Bilder vor sich: Die Dorfbewohner gefangen in der Kirche von Saint-Maurice, wie sie sich gegen die Holztüren drängten, mit den Fäusten auf die Holzläden einschlugen, während der beißende Geruch von Rauch, der in den Altarbereich eindrang, in seiner Nase brannte.
»Paloma.« Raoul rief den Namen seiner Frau in die dunkle Höhle hinein. »Oh, mein Mädchen.« Keuchend versuchte er, das Schluchzen zu unterdrücken, das in seiner Kehle aufstieg. »Warte auf mich«, betete er. »Ich bin fast da.«
Die Büsche und Felsen um ihn herum waren in der Dunkelheit kaum noch zu sehen. Raouls Kopf sank auf seine gebeugten Knie, aber er wurde schlagartig wach, als der raue Stoff seines Umhangs über den tiefen Schnitt in seiner Wange glitt. Er fluchte mit zusammengebissenen Zähnen und betastete die Wunde. Als er ihn zurückzog, war sein Finger voll mit schwarzem Blut. Der Geruch von verfaulendem Fleisch verursachte ihm Übelkeit und er übergab sich auf den Boden neben sich. Bei der heftigen Bewegung wurde ihm schwindlig und er stöhnte vor Schmerzen. Schließlich wurde er bewusstlos und sein Atem ging immer langsamer, bis sich sein Brustkorb nur noch kaum wahrnehmbar hob und senkte.
Sein Fiebertraum führte ihn zu einem Fluss, an dessen Ufern Weiden ihre Äste ins Wasser senkten. Als er das Wasser sah, gaben seine Beine nach und er sank auf die Knie. Ertauchte den Kopf in den Fluss, keuchte und spuckte, als das eisige Wasser seinen Bauch füllte. An einer flacheren Stelle hockte Raoul sich hin und wusch den Schmutz von Gesicht und Händen. Im mondbeschienenen Wasser sah er die tiefen Schatten der Erschöpfung unter seinen Augen und die Wunde auf seiner Wange, die sich zu einer dicken schwarzen Linie geschlossen hatte.
Das Wasser warf kleine Wellen und ein gedämpft beleuchteter Raum, in dem ein langer Tisch auf einem glatten Steinboden stand, kam in Sicht. Eine Gestalt kam ohne Zögern auf Raoul zu. Als die Umrisse klarer wurden, sah er eine Frau, deren nackter Körper im gedämpften Licht schimmerte. Ihre langen Haare fielen wie ein bernsteinfarbener Schleier auf ihre Schultern. Sein Blick fuhr den Umrissen ihrer Rippen unter der Rundung ihrer Brüste nach, glitt über ihre hervorstehenden Hüftknochen und die definierten Muskeln an ihren Oberschenkeln. Kurz vor dem Fenster blieb die Frau stehen und zeigte ihr Gesicht. Erschreckt zuckte Raoul zurück. Dann schoss die Freude in ihm empor, als sei ein Schwarm von Goldfinken ihm unter die Haut geflogen.
»Paloma«, hauchte er staunend und beugte sich näher. Die goldbraunen Locken waren nicht die hellblonden Haare seiner Frau, und auch Augenbrauen und Wimpern waren anders in Form und Farbe, aber aus einem Gesicht, das genauso wie das ihre geformt war, blickten ihn Palomas silbrig grüne Augen an, die die Farbe von Olivenblättern hatten. Sie war so schön und fern wie der Mond.
Die Frau wich zurück und blickte Raoul an. Sie öffnete den Mund, aber sie schrie nicht. Ihre Hände schossen hoch und sie schlug mit den Knöcheln an die Glasscheibe zwischen ihnen.
»Paloma?« Er drückte seine Handfläche flach an die kalte Scheibe, aber eine Windböe kräuselte die Wasseroberfläche, und die Szene verschwand.
In der kalten Höhle öffneten sich Raouls geballte Hände. Aus einer Faust glitt eine Kette mit einem silbernen Anhänger. Der Anhänger fiel flach auf die Erde. Es war ein Kreuz mit offener Mitte und drei miteinander verbundenen Punkten auf jeder Seite: das okzitanische Kreuz, das Symbol des Widerstands im Languedoc. Die Kette hatte einmal seiner Frau gehört. Paloma. Sein Brustkorb hob sich, und er atmete tief die kühle Luft ein. Sein Brustkorb sank und hob sich nicht mehr.
Draußen erfüllten unzählige Sterne die Nacht mit eisigem Licht. Ein großer Raubvogel landete mit leisem Rauschen seiner Schwingen am Eingang der Höhle und ging auf seinen Krallenfüßen auf und ab. Seine scharfen Augen erkannten die schwarze Masse eines Mannes, der zusammengesunken in dem blauen Schatten hockte. Der Kopf des Mannes sank auf die Brust und aus einem Schnitt, der von der Schläfe bis zu seinem Kinn reichte, rann Blut. Der Vogel stieß einen Schrei aus, der die Luft zerriss, und flog vor dem Gespenst des Todes davon.
3LE PÈLERIN, MINERVE – DEZEMBER
Sonnenstrahlen fielen durch das Dachfenster auf die glänzenden Bodendielen und tauchten Lias Bett in helles Licht. Sie vergrub den Kopf in den Kissen, aber Durst und Wärme trieben sie dazu, aufzustehen. Ihre verschwitzte Haut klebte am feuchten Laken und ihre Zunge war geschwollen. Sie hatte gestern Abend dreiviertel der Flasche von dem starken Corbières getrunken, und jetzt pochte ihr Kopf. Lia richtete sich auf und schob die Decke weg. Sie stellte sich aufs Bett und öffnete die Dachluke. Kühle Luft strömte herein. Es roch nach Holzrauch und Frost.
Unten füllte sie die Presskaffeekanne mit gemahlenem Kaffee. Es war mindestens vierundzwanzig Stunden her, seit sie zum letzten Mal Koffein zu sich genommen hatte, und ihre Hände zitterten, als sei sie süchtig. Als das Aroma unter dem kochenden Wasser aufstieg, der Satz schwarz und dick wie die Erde nach einem schweren Regen, seufzte sie vor Erleichterung. Sie füllte einen großen Becher und trank einen kleinen Schluck, dann einen großen. Sie entspannte sich, als das Koffein die Blutgefäße zusammenzog und kleine schmerzende Messerstiche in ihre Schläfen ausstrahlten.
Mit ihrem Kaffeebecher stellte sie sich ans Fenster und blickte auf die Cesse hinaus. Am Abend zuvor war dort nur ein schwarzes Loch gewesen. Heute segelten weiße Wolken am blauen Himmel und das blasse Winterlicht ließ das Katzensilber an den Kalksteinrändern des Canyons glitzern. Sie trat auf die Terrasse, die von einem Eisengeländer umgeben war. Unter ihr ragte der Abhang. Wie ein türkisfarbenes Band schimmerte die Cesse, die sich nach Süden schlängelte.
Als sie sich zum Haus umdrehte, sah sie einen Handabdruck auf der Scheibe, blass wie ein weißes Tattoo. Jede Linie in der Handfläche und in den Fingerspitzen war so fein gezeichnet wie ein Spinnennetz. Lia stellte den Kaffeebecher auf einen kleinen Tisch und legte ihre Hand auf den Abdruck; die Finger des Abdrucks waren wesentlich länger als ihre, die Handfläche viel größer. Es war die Hand eines Mannes.
Das Gesicht von gestern Abend mit der Narbe an einer Seite fiel ihr in dem Moment ein, als ein Sonnenstrahl auf die Scheibe fiel und den Abdruck verschwinden ließ. Lia blieb stehen und starrte in den Flusscanyon, bis sie ihre nackten Zehen nicht mehr spürte.
Danach holte sie ihren Laptop, setzte sich an den Küchentisch und überflog die E-Mails, die sie seit ihrer Abreise aus den Staaten erhalten hatte. Die letzte, deren Betreffzeile auf Okzitanisch geschrieben war, fiel ihr ins Auge. Sie war eingetroffen, als ihr Flieger gerade in Seattle gestartet war.
»Meine liebe Lia«, begann die Nachricht. »Mein Herz schlägt ruhiger, seit ich weiß, dass du bald bei guten Freunden im Languedoc bist. Ich war kürzlich in Ferrals-les-Corbières, um diesen hervorragenden Wein vom Mas Hivert zu kaufen, und Rose Hivert hat mir gesagt, dass du nach Frankreich zurückkehrst.«
Lia konnte die warme Stimme hinter diesen Worten förmlich hören. Sie erinnerte sich schmerzlich an ihre erste Begegnung mit Pater Jordí Bonafé, dem Archivar in der Kathedrale Saint-Just et Saint-Pasteur in Narbonne.
Drei Tage nach Gabriels Tod und noch tief unter Schock hatte Lia darauf bestanden, am Institut de Recherche Cathare – dem Institut für katharische Studien – in Carcassonne einen Vortrag zu halten. Rose und Domènec hatten sie damals zwar angefleht, den Termin abzusagen, aber der Vortrag hatte ihr einen Grund gegeben, weiterzuatmen.
Nach der Diskussion war Pater Bonafé auf sie zugekommen. Bei einem Kaffee hatte er sie getröstet, als sie ihm von ihrer Trauer erzählte. In der darauffolgenden Woche – als der Todesfall untersucht und Gabriels Leiche nach Mexiko zu seiner Familie gebracht wurde – verbrachte Lia viele beruhigende Stunden im Büro des Priesters in der Kathedrale und in den kühlen ruhigen Archiven darunter.
Sie wandte sich wieder Pater Bonafés E-Mail zu und informierte sich über den neuesten Klatsch in der kleinen Welt der französischen Mittelalterforscher im Languedoc. Dann jedoch änderte sich der Tonfall seiner Mail.
»Rose hat mir berichtet, dass dein Lehrauftrag nicht verlängert worden ist. Es ist eine unselige Entscheidung deiner Universität, aber ich hoffe, du hast den Enthusiasmus für deine Forschungen trotzdem nicht verloren.
Ich weiß, es ist schmerzlich, dich an die Umstände unserer ersten Begegnung zu erinnern; bitte verzeih mir, dass ich sie erwähne. Aber ich muss immer an deinen Vortrag am Institut denken und an die Fragen, die du bezüglich Pierre de Castelnaus Tod und die Ursprünge des katharischen Kreuzzuges gestellt hast.
Seit jenem Abend frage ich mich, ob deine Theorien nicht möglich sein könnten. Was wie eine Legende erschien, die über die Jahrhunderte in Volkssagen und Gerüchten weitergegeben wurde, erscheint mir auf einmal historisch plausibel. Ich frage mich, ob du diese Theorien wohl immer noch verfolgst?
Wenn du dich von deiner Reise ausgeruht hast und bereit bist, nach Narbonne zu kommen, können wir uns hoffentlich treffen.«
Lia zog ihre Beine unter sich und legte das Kinn auf die Knie. Warum stellte der Priester gerade jetzt all diese Fragen? Ja, sie hatte Zweifel an der wahren Natur von Pierre de Castelnaus Ermordung – das Ereignis im Jahr 1208, das den blutigen Katharerkreuzzug auslöste. Sie hatte diese Forschungslinie vor Gabriels Tod verfolgt, aber ihr Doktorvater hatte eingegriffen und sie gewarnt, dass mittelalterliche Verschwörungstheorien wenig glaubwürdig waren. Die Popularität von Büchern und Filmen über die Tempelritter – den mächtigen militärischen Orden der religiösen Kreuzritter im Mittelalter – und ihre Verbindung zu der Legende vom Heiligen Gral drohte, die seriöse Forschung auf eine Popkultur mit Schwertern und Schlössern zu reduzieren.
Und tatsächlich war man überall im modernen Languedoc in der letzten Zeit fasziniert von der tragischen Geschichte der Landsleute, die vor achthundert Jahren von diesen legendären Tempelrittern und der katholischen Kirche erobert worden waren. Um das Pays Cathar – das Katharerland – hatte sich eine große Tourismusindustrie entwickelt. Im Sommer waren die Straßen im Languedoc voller Wohnmobile und Radfahrer, die die Route des Cathares zwischen Schlossruinen und den alten befestigten Dörfern, in denen immer noch reger Handel herrschte, befuhren.
Lia hatte sich den Anweisungen ihres Doktorvaters gefügt. Sie war wie er der Meinung, dass sie die Dissertation so gut wie von vorne beginnen müsste, wenn sie jetzt die Richtung ihrer Argumentation änderte; das konnte sie sich nicht leisten – nicht jetzt, wo sie so kurz vor dem Abschluss stand. Sie hatte ihre Gedanken zu Castelnaus Ermordung an jenem Abend vor zwei Sommern nur deshalb am Rande erwähnt, um zu zeigen, wie viel an der katharischen Geschichte unbekannt blieb und wahrscheinlich nie aufgedeckt wurde.
Sie schickte dem Priester in Narbonne eine Antwort und gab ihm ihre Handynummer. Lia konnte keinem Geheimnis widerstehen, das sich im Languedoc bot.
4LE PÈLERIN, MINERVE – WEIHNACHTSABEND
Zwei Tage später tauchte Lia zum ersten Mal seit ihrer Ankunft aus dem Kokon des Hauses auf. Sie hatte die Zeit gebraucht, um den Übergang von einem Leben zum nächsten beginnen zu können. Kühlschrank und Speisekammer des Le Pèlerin waren voll, und Kamin und Bücher hatten ausgereicht, um die kurzen Tage zu füllen. Aber heute war Heiligabend. Rose und Domènec hatten eine ruhige Feier übers Wochenende für ihre kleine Familie und Lia geplant.
Die Kälte trieb ihr die Tränen in die Augen, als sie die kurze Distanz vom Haus zu einer Gemeinschaftsgarage ging. Sie warf ihre Reisetasche auf den Beifahrersitz des Peugeot. Durch die Lüftung drang warme Luft in den kühlen Innenraum des Wagens und aus dem Radio kamen Nachrichten aus aller Welt. Lia schaltete beides aus, um die winterliche Stille zu genießen. Den Weg zum Mas Hivert, dem Weingut von Rose und Domènec außerhalb von Ferrals-les-Corbières, fand sie aus dem Gedächtnis.
Sie wollte gerade die Hand heben, um an die Haustür zu klopfen, als sie schon aufgerissen wurde und sich zwei kohlschwarze Nasen durch den Spalt schoben. Seidig goldene Körper drückten sich an Lias Beine, gefolgt von zwei Kleinkindern, die lautstark nach ihrer Aufmerksamkeit verlangten. Unter Hundegebell und Kinderstimmen wurde sie von zwei vertrauten Armen umarmt. Rose zog sie in die helle Küche, in der es nach Salbei duftete. Der vierjährige Joel und die zweijährige Esmé klammerten sich an ihre Beine.
»Du weißt gar nicht, was es mir bedeutet, wieder hier zu sein«, flüsterte Lia ihrer besten Freundin ins Ohr. Sie bückte sich und nahm Esmé auf den Arm. Das kleine Mädchen legte den Kopf an Lias Schulter. Lia vergrub ihr Gesicht in den hellbraunen Löckchen und atmete tief den süßen Duft der Kinderhaut ein.
Kurz darauf knatterte Domènecs Land Rover in die Einfahrt. Mit einem Einkaufskorb voller Päckchen kam er durch die Hintertür. »Das gesamte Dorf hat in der épicerie eingekauft«, stöhnte er, als Rose und Lia ihm seine Last abnahmen. »Ich habe schon geglaubt, nicht mehr lebend da herauszukommen. Da ist ja endlich unsere Lia!«
Er hieß sie mit Küssen auf beide Wangen willkommen und scheuchte dann den gesamten Zirkus aus der Küche. Rose und Lia packten den Korb aus und stapelten ihre Beute auf der Küchentheke: Oliven aus einer Kooperative im nahe gelegenen Bize-Minervois, fleur de sel – Meersalz – aus Gruissan, leckere Würste, Senf mit Armagnac und Entenbrust in Metzgerpapier. Lia schüttete die Cara-Cara-Orangen in eine Schale, die so blau war wie das Mittelmeer.
»Bist du sicher, dass ich der einzige Gast bin? Wir brauchen das Haus wochenlang nicht zu verlassen!«
»Ein paar Tage hier, und diese Backen werden sich wieder runden.« Rose holte eine Lammkeule aus dem Kühlschrank und schob die Tür mit dem Ellbogen wieder zu. Sie musterte Lia von oben bis unten, schüttelte gespielt angewidert den Kopf und verfiel in ihren Louisiana-Singsang: »Alle vier Backen. Wir müssen diesen knochigen Hintern ein bisschen fetter machen.« Lia deutete ihr den Mittelfinger an und Rose schickte ihr einen Luftkuss über die Theke. »Außerdem bist du kein Gast. Du gehörst zur Familie.«
Ganz alleine war Lia in den Staaten in ihrem ersten Jahr auf der Brown University angekommen – eine der wenigen Studentinnen, die ohne Hilfe ihrer Familie ins Wohnheim einziehen musste. Sie kannte niemanden in den USA und sie trug ihre Einsamkeit wie eine Rüstung. Wenn jemand sie fragte, wo sie herkam, zuckte sie nur die Achseln und sagte: »Aus Afrika und Europa. Es ist eine lange Geschichte.« Es kostete einfach zu viel Mühe, zu erklären, dass Papa in einem großen, weitverzweigten Clan in Venedig aufgewachsen war, während ihre Mutter ein Einzelkind gewesen war, eine Tochter des Languedoc. Lia hielt geheim, dass ihre Eltern als Ärzte für die gleiche Hilfsorganisation gearbeitet hatten, dass sie sich in Mogadischu kennengelernt, ineinander verliebt und geheiratet hatten, und dass sie ein Mädchen – Lia – bekommen hatten, das in seiner Kindheit Somalia für sein Zuhause gehalten hatte.
Es tat zu weh – zu erzählen, dass, als sie zwölf war, eine Bombe in einem Flüchtlingslager explodierte und ihre Eltern tötete. Damit war Lias Kindheit vorbei. Sie musste Somalia verlassen und wurde wie eine Spielkarte in die Familie ihres Vaters in Italien geschoben, verbrachte die Sommer mit ihren Großeltern mütterlicherseits in Südfrankreich, bis ein Stipendium sie schließlich an eine amerikanische Uni brachte. Ihren Akzent konnte niemand einordnen. Lia selbst hatte das Gefühl, zwar überall gelebt zu haben, aber nirgendwo wirklich hinzugehören – vor allem nicht zu den lauten amerikanischen Teenagern um sie herum. Bis sie merkte, dass ihre Wortkargheit und Zurückhaltung als arrogant angesehen wurden und ihre schulterlangen bernsteinfarbenen Locken und ihr gutes Aussehen eine Bedrohung für ihre Mitschülerinnen darstellte, hatte sie das erste Semester bereits alleine verbracht.
Im Januar erschien Rose Chouteau aus New Orleans mit einer Schar ihrer schwarzen Schwestern und Tanten. Sie bewegte sich anmutig wie eine Katze und hatte ein Lachen, in dem Lia am liebsten gewohnt hätte. Rose freundete sich mit ihr an und durchbrach ihre »Ich-bin-eine-einsame-Insel«-Haltung. Sie versprach, ihr Stricken beizubringen, wenn Lia sie Okzitanisch lehrte, die alte Sprache Südfrankreichs und Nordspaniens, die Lia zu Hause mit ihrer Mutter und in Frankreich mit ihren Großeltern gesprochen hatte. Rose sprach akzentfrei Französisch, aber als ihr okzitanisches Vokabular zunahm, begannen sie miteinander in ihrer Geheimsprache zu sprechen. Einige Jahre nach ihrem Examen heiratete Rose einen Weinbauern, der mit ihr ins Languedoc-Roussillon zog, wo er zu Hause war.
»César, Cloé! Laissent tranquilles!«, fuhr Rose die beiden Golden Retriever an, die wieder in die Küche getrottet waren, weil das Lamm so verführerisch duftete. Sofort ließen sich die Hunde auf den sonnigen Stellen auf dem Fliesenboden nieder.
»Wie geht es dir wirklich, Lia?«, fragte Rose auf Englisch. In den Staaten war zwar Okzitanisch ihre Geheimsprache, aber in Frankreich sprachen sie Englisch, wenn sie alleine waren. Lia wusste, dass Rose sich danach sehnte, ihre Muttersprache zu sprechen.
»Ich fühle mich immer noch ein bisschen benommen«, gab sie zu. »Mit Jetlag und meiner üblichen Schlaflosigkeit waren die letzten Nächte anstrengend.« Sie brachte es nicht über sich, das plötzliche Aufblitzen des Männergesichts, den Anblick des Bonelli-Adlers und den Handabdruck auf dem Fenster zu beschreiben. Die Bilder kamen ihr zu absurd vor, und sie hatte den Wunsch, sie für sich zu behalten, bis sie alles mit Jetlag und Müdigkeit erklären konnte. Sie trat zu Rose an die Kücheninsel und begann, rote Kartoffeln und Steckrüben, die zum Lammbraten kamen, in Viertel zu schneiden.
»Aber hier, an diesem Ort, den ich liebe …« Sie schwenkte das Messer und wies damit auf die Aussicht aus den Küchenfenstern. »Hier öffnen sich mein Herz und mein Kopf wieder. Wenn ich meine Dissertation beendet und die Verteidigung hinter mich gebracht habe, suche ich nach einer dauerhaften Anstellung hier.« Sie lächelte, als Rose einen leisen Jubelschrei ausstieß. »Ich muss dir etwas erzählen«, sagte Lia.
Rose drückte den Schalter für den Backofen, und Gas entzündete sich mit einem leisen Zischen. Sie lehnte sich an die Küchentheke. »Was ist passiert?«, fragte sie.
»Kurz vor meiner Abreise habe ich von den Anwälten in Montpellier gehört. Die Polizei stellt die Ermittlungen ein. Es ist jetzt anderthalb Jahre her und sie haben keine Hinweise auf den Mercedes. Wenn nicht neue Beweise auftauchen, wird die Anklage wegen Fahrerflucht fallengelassen.«
»Oh, Lia.«
Sie hatte gewusst, dass es so kommen würde. Gabriel, ein professioneller Mountainbike-Rennfahrer, war mutterseelenallein auf einer Straße nur ein paar Kilometer vom Ziel entfernt bei der Tour d’Arques gestorben. Sein Körper erzählte eine Geschichte: Irgendwie war er vom Rad geschleudert worden und hatte sich bei der Landung das Genick gebrochen. Die Lackteilchen an seinem Fahrrad und die Teile des Scheinwerfers, die auf dem Asphalt lagen, erzählten eine andere Geschichte: Ein alter schwarzer Mercedes hatte den Rahmen aus Karbon und Aluminium plattgefahren. Ein solches Auto war auf den Nebenstraßen in den Pyrenäen eigentlich nicht zu übersehen, aber der Mercedes war verschwunden. Zurück blieben Gabriels zerstörter Körper, Bremsspuren auf dem Asphalt und sein kaputtes Fahrrad.
»Vielleicht ist es das Beste so«, sagte Lia. »Dass sie die Ermittlungen einstellen, meine ich. Ich glaube, es ist Zeit, dass ich mein Leben weiterführe.«
»Was ist mit der Klage?«
Lia zerschnitt weiter das Gemüse. Das hackende Geräusch des Messers unterstrich ihre Worte. »Die Anwälte sagen, die Zivilklage gegen die Fédération bleibt bestehen.« Sie meinte die Fédération des vétéistes – die Vereinigung der Mountainbikefahrer -, die das dreitägige Rennen durch die Hügel am Fuß der Pyrenäen gesponsert hatte. Gabriels letztes Rennen. Die Frage, wie ein Auto während des Rennens auf die Landstraße gekommen und spurlos wieder verschwunden war, hatte zu einer Klage gegen die Fédération geführt. Und niemand konnte erklären, warum Gabriel auf eine Straße über einen Kilometer vom vereinbarten Treffpunkt entfernt abgebogen war. »Je länger das Ganze geht, desto mehr bin ich, ehrlich gesagt, davon überzeugt, dass Gabriel gegen diese Klage wäre. Die Fédération hat ihn von Anfang an gefördert. Geld kann dir nicht die Wahrheit über das, was passiert ist, bringen. Es bringt ihn nicht zurück. Ich habe Gabriels Lebensversicherung – und wenn ich die Wohnung verkauft habe, habe ich das Geld auch noch. Ich brauche nicht noch mehr Geld, Rosie. Um die Details kümmere ich mich später.«
»Liebes, ich will dich nicht drängen. Ich weiß, dass das Geld Gabriel nicht wiederbringt, aber es könnte dir die Möglichkeit geben, so zu leben, wie du willst.«
»So zu leben, wie ich will?« Lia legte das Messer auf den Tresen und stützte sich mit beiden Händen auf. »Ich weiß nicht, wie ich leben will. Mein Herz ist gebrochen und meine Karriere liegt in Trümmern.« Sie umklammerte die Küchentheke. »Ich weiß nicht, ob ich hierhergekommen bin, um neu anzufangen oder um wegzulaufen.«
»Du bist zu Hause, Mädchen. Le Pèlerin gehört dir, solange du es brauchst«, entgegnete Rose mit strenger Zuneigung.
»Sei vorsichtig.« Lia zwinkerte, um die Stimmung ein wenig aufzulockern. »Am Ende nehme ich dich beim Wort.«
Lärm im Esszimmer signalisierte, dass ihr kurzer Moment alleine vorüber war. Domènec und die Kinder kamen zurück. Joel hatte einen Rußstreifen auf der Wange und zwischen den Augen einen schwarzen Punkt. Domènec legte seiner Frau den Arm um die Taille – und Rose begann wieder Französisch zu reden.
»Wenn irgendwo Schmutz ist, dann findet Joel ihn bestimmt.« Sie leckte sich über die Daumenkuppe und bückte sich, um ihrem Sohn den Ruß vom Gesicht zu wischen.
»Chérie, das Feuer brennt, dank meinen Helfern hier«, sagte Domènec. »Ich nehme die Kinder mit, um diese Schlösser für die Spaliere von Alain zu besorgen.«
»Am Weihnachtsabend?«
»Weinreben kennen keinen Feiertag.«
Rose verdrehte die Augen und küsste ihren Mann. »Jo und Esmé müssen vor dem Abendessen schlafen«, sagte sie. »Sei bitte um vier wieder zurück.«
Domènec schnalzte mit der Zunge und die Hunde kamen sofort angesprungen. Die Frauen kamen ebenfalls mit nach draußen und schnallten Joel und Esmé in ihren Kindersitzen im betagten Land Rover an. Die Hunde standen bereits hinten an der Ladeklappe und wedelten aufgeregt mit den Schwänzen. Dann fuhr Domènec hupend und winkend an und die Kinder warfen ihnen Kusshände zu. Rose und Lia zogen sich wieder in die stille Küche zurück.
Rose legte die Lammkeule in die große gusseiserne Kasserolle und schob sie in den heißen Ofen. »Wie wäre es mit einem Tee?« Sie schüttelte eine Dose mit Assam-Teeblättern.
»Bitte. Stark und schwarz«, sagte Lia. »Ich brauche Hilfe, wenn ich ohne Nickerchen bis heute Abend durchhalten will.« Sie gingen ins Vorderzimmer, wo das Kaminfeuer knackte und knisterte. Rose goss den dampfenden Tee in zwei Becher und nahm sich Milch und zwei Würfel Zucker. Lia stellte ihren Tee zum Abkühlen auf den niedrigen Tisch vor dem Sofa und zog die Beine unter sich.
»Es gefällt mir nicht, dass du im Cottage so alleine bist.« Rose warf ihr über den Rand ihres Bechers einen Blick zu-»Nicht, dass es in Minerve nicht sicher wäre, aber ich hasse einfach den Gedanken, dass du da so alleine bist.«
Lia zuckte mit den Schultern. Diese gallische Geste erinnerte sie ebenso an ihre Mutter und ihre Großmutter wie ihre silbrig-grünen Augen, wenn sie in einen Spiegel blickte. »Mir ist es gerade recht, alleine zu sein. Ich kann die Zeit nutzen, um meine Dissertation zu Ende zu bringen und mir überlegen, was ich als Nächstes tun soll.« Sie ergriff ihre Tasse und blies über den heißen Tee. Dann dämmerte es ihr. »Du hast jemanden, den ich kennenlernen soll, oder?«
Rose senkte den Blick, konnte aber ein kleines Grinsen nicht unterdrücken.
»Oh Gott, Rose, allein der Gedanke, jetzt jemanden kennenzulernen, zu versuchen, meinen Verlust und mein Leben zu erklären. Nein, das ertrage ich nicht.«
»Ich weiß, Liebes. Ich mache mir doch nur Sorgen, dass du dich vor allem verschließt. Deine Beziehung mit Gabriel war etwas Kostbares, aber das bedeutet nicht, dass du nie wieder lieben kannst.«
»Wie heißt er?«, fragte Lia, nur um irgendetwas zu sagen.
»Raoul«, erwiderte Rose. »Raoul Arango. Er ist ein Winzer aus Spanien. Dom hat ihn letztes Jahr kennengelernt, als Raoul das alte Logis du Martinet unten in Lagrasse übernommen hat.«
»Wenn das jemand anderer als du, ma copine, vorgeschlagen hätte, wäre ich stinksauer.« Lia umklammerte ihre Tasse. So oft äußerte Rose die Gedanken, die sie sich selbst nicht eingestehen wollte. Und Lia war noch nicht bereit, zuzugeben, dass sie auch nicht alleine sein wollte.
»Er ist herrlich verrückt.«
»Bei dir ist nichts zu machen.« Lia legte ihre Füße gegen Roses Beine und gab ihr einen leichten Schubs. Rose schrie auf und hielt ihre Teetasse hoch, damit sie die heiße Flüssigkeit nicht verschüttete. Mit der anderen Hand drückte sie Lias Zehen.
»Ich weiß einfach, dass er dein Typ ist, und irgendetwas an Raoul erinnert mich auch an Gabriel.« Rose musterte die Freundin vorsichtig, als ob sie Angst hätte, zu weit gegangen zu sein. Lia lächelte ein wenig, um ihr zu zeigen, dass es in Ordnung war. »Er hat vor ein paar Jahren seine Frau und seine Kinder bei einem Unfall verloren«, fuhr Rose fort. »Die Kinder waren Zwillinge, noch ganz klein, ungefähr in Jos Alter, glaube ich.« Sie schauderte. »Ich weiß nicht genau, was passiert ist, aber es muss schrecklich gewesen sein.«
Die Frauen schwiegen, beide in düstere Gedanken versunken.
Lias größter Kummer nach Gabriels Tod war, dass sie keine Kinder gehabt hatten. Frau und Kinder zu verlieren, musste schrecklich sein, aber sie glaubte nicht, dass sie in der Lage war, jemand anderem in seinem Schmerz zu helfen. Wenn Leid der Preis der Liebe war, dann war es wohl besser, allein zu bleiben.
»Ich bin noch nicht bereit dazu, jemanden kennenzulernen, Rosie«, sagte sie nach langem, Schweigen.
»Ich weiß. Ich dränge dich auch nicht. Das verspreche ich. Aber Raoul und Dom sind Freunde geworden. Wenn ich ihn also zu unserer Mittwinter-Party einlade, dann denk bitte nicht, ich will dich verkuppeln. Wir wollen nur alle unsere Freunde dabeihaben.«
Lia seufzte gespielt empört, aber in diesem Moment klingelte Roses Handy und der Augenblick schwesterlicher Intimität war vorbei. Lia ging wieder in die Küche, damit Rose ungestört telefonieren konnte, und im hellen Tageslicht, umgeben vom geschäftigen Treiben auf dem Hof, verblasste ihr Kummer, ebenso wie die Bilder des Mannes und des Adlers.
5NARBONNE – JANUAR
Die Feiertage vergingen, das neue Jahr kam – und Lia erhielt einen Anruf von Jordí Bonafé. An einem kühlen Morgen Mitte Januar fuhr sie nach Narbonne und stellte ihren Wagen am Rand der Innenstadt ab. Da sie erst um zehn Uhr verabredet waren und, schlenderte sie noch durch die kleine Stadt.
Der Winter konnte jederzeit mit eisiger Kälte zurückkehren, aber heute verwandelte die Sonne alles in frühlingshafte Wärme. Weißgolden strahlte sie durch die kahlen Äste der Kastanien und Platanen am Canal de la Robine. Der Wind aus dem Zentralmassiv hatte über Nacht alle Wolken vom Himmel geblasen und ihn leuchtend blau zurückgelassen.
Lia spazierte in die überdachte Markthalle. Der salzige Meeresgeruch von Fisch, der im Morgengrauen gefangen worden war, mischte sich mit dem vanillesüßen Duft des Crêpe-Teigs. Über allem lag ein Hauch von Kumin und Kardamom. Zwischen den langen Kühltheken eines Käsehändlers und eines Wurstverkäufers befand sich der winzige Stand einer pâtisserie, die Gebäck aus Katalonien anbot – dem Gebiet kurz hinter der spanischen Grenze, das mit der Geschichte und Kultur des Languedoc viel gemein hatte. Dort kaufte Lia, was sie brauchte. Von der Markthalle ging sie über den Kanal zum Place de l’Hôtel de Ville.
Die gotische Fassade des Palais des Archevêques leuchtete golden im Morgenlicht. In einem Café am anderen Ende rückten verschlafene Kellner gerade die Tische und Stühle zurecht. Touristen warteten bereits und setzten sich, noch bevor die Tische abgewischt und Salz- und Pfefferstreuer verteilt waren.
Lia setzte sich auf die niedrige Mauer um das erhaltene Stück der Via Domitia, dem ältesten Teil der römischen Straße, die durch Südfrankreich verlief. Von hier aus konnte sie wunderbar beobachten, wie Narbonne den Tag begrüßte. Sie nahm eine kleine Thermosflasche mit Kaffee und eine frische Hefebrioche aus ihrem Korb.
Sie füllte den Verschlussdeckel der Thermosflasche, und als sie den dampfenden Kaffee an die Lippen hob, fiel ihr der Mann an einem Tisch vor dem Café auf. Er trug einen schwarzen Anzug und ein blass violettes Hemd. Einen Arm hatte er über die Rückenlehne des Stuhls gelegt – und da er die Beine übereinandergeschlagen hatte, sah sie seine schwarzen Lederslipper. Auf dem Tisch standen ein Espresso und ein Teller mit einem Croissant wie Requisiten auf einer Bühne. Die leichte Brise fuhr durch seine dunkelblonden Haare. Eine Sonnenbrille schützte seine Augen vor dem grellen Sonnenlicht auf den nassen Steinen. Als er die Espressotasse zum Mund führte, blitze eine Platinuhr auf.
Er blickte auf die Uhr und erhob sich mit lässiger Eleganz. Selbst die unbedeutendsten Gesten – wie er Münzen auf den Tisch warf und sein Jackett glättete – waren sinnlich, und geschützt durch ihre Sonnenbrille musterte Lia seinen trainierten, gut gebauten Körper. Sie stellte sich die Muskeln unter dem eleganten Anzug vor, und eine Welle von Verlangen stieg in ihr auf.
Dem Sehnen ihres Körpers folgte sofort Schuldgefühl, und auf einmal erschien ihr der Tag nicht mehr so hell. Der Kaffee schmeckte bitter – und die Brioche war in der kühlen Luft zusammengefallen. Lia wandte dem Café den Rücken zu und goss den Kaffee auf das Pflaster. Dann wischte sie sich die Krümel von ihrer grauen Wollhose.
»Lia Carrer?« Überrascht blickte sie sich um, wobei sie sich verlegen fragte, ob sie noch Krümel um den Mund hatte. Sie musste sich zwingen, nicht durch ihre Haare zu fahren oder sich die Lippen abzulecken.
»Entschuldigen Sie, dass ich Sie störe.« Der Mann aus dem Café setzte seine Sonnenbrille ab. Er hatte schwarze Augen mit goldenen Sprenkeln. »Ich bin Lucas Moisset, freiberuflicher Fotograf. Ich habe an jenem Tag für die Vereinigung der Mountainbiker in Arques gearbeitet.« Er hatte einen Pariser Akzent. »Ich habe Sie von den Fotos erkannt. Mein Beileid zu Ihrem Verlust.«
Lia begann zu zittern. Sie öffnete den Mund, um sich zu bedanken, brachte aber keine der üblichen Floskeln hervor. Stattdessen sagte sie: »Ein seltsamer Zufall.«
»Ich bin auch begeisterter Mountainbikefahrer«, sagte er. Sein Blick glitt über sie, als suche er etwas. Sein Verhalten war Lia unangenehmer, als wenn er sie offen angestarrt hätte. Er wirkte jedoch so aufrichtig, dass sie nicht einfach weggehen konnte. »Es war ein schrecklicher Unfall. Jeder, der mit der Tour zu tun hatte, empfand so großen Respekt vor Ihrem Mann.«
Der Satz besänftigte sie. »Das ist sehr freundlich von Ihnen«, erwiderte sie. »Ich sollte darauf vorbereitet sein, dass hier im Languedoc die Erinnerungen an den unmöglichsten Stellen auftauchen.« Sie fragte sich, ob sie Lucas Moisset erkennen müsste, ob sie sich vielleicht schon einmal begegnet waren. Aber an einen so attraktiven Mann würde sie sich doch sicher erinnern.
Er zog eine dünne Brieftasche aus seinem Jackett. »Mein Studio ist hier in Narbonne. Wenn Sie etwas brauchen, rufen Sie mich jederzeit an.« Er reichte ihr eine Visitenkarte.
Es dauerte einen Moment, bis Lia das Wasserzeichen hinter seinem Namen erkannte: Ein Wanderfalke. Der gleiche Umriss wie auf der Messingplatte mit dem Namen ihres Cottages in Minerve: Le Pèlerin. Pèlerin, ein Pilger, der an einen heiligen Ort reist;faucon Pèlerin, der majestätische Raubvogel am Himmel des Languedoc. Moisset bedeutete Falke auf Okzitanisch.
»Ein sehr hübsches Wortspiel mit Ihrem Namen«, sagte sie.
Lucas verzog die Mundwinkel. »Natürlich, Sie sprechen Okzitanisch. Ich erinnere mich, gelesen zu haben, dass sie Mittelalterliche Geschichte lehren. Haben Sie familiäre Wurzeln in der Gegend?«
Erneut forschte Lia in den Tiefen ihrer Erinnerung. Vielleicht war sie ihm ja am Tag des Unfalls begegnet. An diese Stunden, als der Krankenwagen von der Ziellinie in Arques losgefahren war und sie eine schreckliche Vorahnung hatte, erinnerte sie sich nur noch dunkel.
»Meine Mutter ist im Languedoc aufgewachsen«, bestätigte Lia. Sie fühlte sich verletzlich vor diesem Fremden, der so viel zu wissen schien. »Aber ich unterrichte nicht mehr. Ich bin nur noch eine ewige Studentin, die versucht, ihre Doktorarbeit fertigzustellen.« Sie schloss die Finger um seine Visitenkarte. »Wenn Sie mich jetzt entschuldigen würden. Ich habe einen Termin.« Sie ergriff den Korb und hielt ihn wie eine Barriere zwischen sich und Lucas Moisset.
»Selbstverständlich, ich verstehe.« Er setzte seine Sonnenbrille wieder auf, und sie sah ihr finsteres Gesicht in den Gläsern. Lucas streckte die Hand aus und Lia ergriff sie instinktiv. Ihre Hand fühlte sich im festen Griff seiner Finger verloren an, und er hielt sie einen Moment zu lange fest. Dann ließ er sie los. »Alles Gute, Lia.« Er ging in Richtung der Rue de l’Ancien Courrier.
Ein Paar im Partnerlook mit Lederjacken und Lederstiefeln trat an das römische Denkmal, wo Lia stand und Lucas nachschaute. Sie plauderten in kastilischem Spanisch und ignorierten Lia. Hinter ihnen diskutierten drei Männer in Businessanzügen in schnellem Französisch über einen Marketingplan. Wie eine Welle stürzten die Geräusche auf sie ein.
Die Absätze von Lias Stiefeln klickten im Staccatorhythmus, als sie in die überdachte Passage d’Ancre ging. Ihr Ziel war die Kathedrale Saint-Just et Saint-Pasteur, das Herzstück der mittelalterlichen Vergangenheit von Narbonne. Sie machte einen kleinen Umweg über den Jardin des Archevêques, um den atemberaubenden Anblick auf die mächtigen Türme der Kathedrale zu genießen, bevor sie den Kreuzgang aus dem 14. Jahrhundert betrat. Sie zog an der Tür der Kathedrale und schloss die Augen, als sie eintrat. Erst als die Tür hinter ihr mit leisem Klicken ins Schloss fiel, öffnete sie sie wieder. Vor ihr entfaltete sich die volle Pracht von Saint-Just et Saint-Pasteur.
Auf jeder Seite vom dunklen Chorgestühl und Steinsäulen gesäumt, mit einer Gewölbedecke, die vierzig Meter hoch aufragte, wirkte der Innenraum düster und mächtig. Hoch an den oberen Wänden leuchteten Buntglasfenster. Jemand hustete, und das Geräusch hallte durch den riesigen Raum.
Über dem uralten Modergeruch lag der Duft nach Weihrauch und Kerzenwachs. Eine kleine dunkelhaarige Frau in geblümtem Kleid und rosafarbener Schürze polierte eine Vertäfelung aus Walnussholz. Eine Glocke erklang, sonor und langsam, und läutete zehn Mal.
Unbemerkt ging Lia hinter den Kapellen entlang in einen Gang, der zu den Verwaltungsbüros führte. Auf der Theke am Empfang dampfte eine Tasse Kaffee, aber das Vorzimmer war leer. Lia wartete kurz, ging aber dann um den Empfangstisch herum in den Korridor. Sie blickte in beide Richtungen, aber der Zerberus der Kathedrale war nirgendwo zu sehen: Die Bürovorsteherin Madame Josephine Isner, die das innere Heiligtum der Kathedrale scharf bewachte. Lia nutzte den Moment und lief rasch den kurzen Flur nach rechts hinunter. Das Neonlicht spiegelte sich auf dem schwarz-weißen Linoleumboden.
Sie klopfte an die Tür, auf der Abbé J. Bonafé stand. Fast augenblicklich ging sie auf und sie fand sich in der Umarmung eines kleinen, korpulenten katalanischen Priesters wieder, der nach alten Büchern und Aftershave roch.
6NARBONNE, KATHEDRALE SAINT-JUST ET SAINT-PASTEUR
»Lia, ma fille.« Die Anspannung, die seit der Begegnung mit Lucas Moisset auf der Place de l’Hôtel de Ville auf ihr lastete, löste sich beim Klang von Jordí Bonafés warmer Stimme auf. »Pater.« Sie beugte sich hinunter, um ihn auf beide Wangen zu küssen. »Es ist wundervoll, Sie wiederzusehen.«
Er hielt sie auf Armlänge von sich weg und musterte sie mit seinen nussbraunen Augen. »Du bist zu dünn«, sagte er. »Aber schön wie eh und je.« Er führte sie in sein Büro, wo Sonnenstrahlen auf die übervollen Bücherregale und den massiven Eichenschreibtisch am anderen Ende des rechteckigen Zimmers fielen. Ein uralter Computer stand mitten auf dem Schreibtisch. Daneben lagen Aktenmappen, die das türkisfarbene Telefon mit Wählscheibe und die altertümliche Gegensprechanlage fast verdeckten. Im Büro sah es noch genauso aus wie vor zwei Jahren.
»Hier ändert sich nie etwas, weder Sie noch die Kathedrale. Das ist so beruhigend«, sagte Lia.
»Ja, nun. Wenn in diesem Heidenland mehr Menschen in die Kirche gingen, wäre vielleicht genug Geld da, um das alles zu renovieren.« Pater Bonafé schnaubte und trat zu einer kleinen Sitzgruppe. Er führte Lia zu einem Sofa hinter einem niedrigen Tisch und setzte sich selber in einen Lehnsessel mit verschossenem Brokatbezug. Auf dem Tisch stand ein Tablett mit zwei Tassen und Untertassen, einer Teekanne in Form eines Elefanten und eine Platte in Delfter Blau, die mit einem gelben Leinentuch abgedeckt war.
»Nun zum drängenderen Problem: Dich ein bisschen zu mästen.« Schmunzelnd rieb er sich die Hände und zog das Tuch weg. Auf der Platte lagen, fein säuberlich in zwei Reihen angeordnet, ein Dutzend goldbraune xuixos, ein mit Vanillecreme gefülltes, frittiertes Hefegebäck, die Spezialität aus Pater Bonafés katalanischer Heimatstadt Girona. Sie dufteten verführerisch nach Zimt und brauner Butter. Mit einem Stöhnen nahm Lia eine Wachspapiertüte aus dem Korb, den sie vor sich gestellt hatte, und reichte sie dem Priester. Sie hatte in der katalanischen Bäckerei ebenfalls ein Dutzend xuixos gekauft. »Anscheinend haben wir beide die gleiche Vorliebe für sündhafte Leckereien.«
Er spähte in die Tüte und verzog erfreut das Gesicht. »Die sind von Iolandas Stand.«
»Vielleicht können Sie sie statt Oblaten bei der Kommunion verteilen«, neckte sie. Der Priester schenkte Tee ein. Er nahm ein Gebäckstück und knabberte genießerisch daran. Dann legte er es auf seine Untertasse und goss Milch in seinen Tee.
»Ich halte mich aber nicht so zurück«, sagte sie und biss die Hälfte eines xuixo ab. Sie hielt eine Hand darunter, weil die Creme heraustropfte. Zuckerkristalle klebten an ihren Lippen und sie schloss kurz die Augen, als die Mischung aus Fett und Süße auf ihrer Zunge zerschmolz. Aber ein Bissen reichte ihr schon, und sie tauschte das süße Gebäck gegen den bitteren schwarzen Tee aus.
»Bist du für immer nach Hause gekommen?« Pater Bonafé rührte in seinem Tee mit einem winzigen Löffel, der in seiner molligen Hand beinahe verschwand.
»Bin ich hier zu Hause?«, sagte Lia. »In Somalia sind nur die Geister meiner Eltern und meine Kindheitserinnerungen. Papas Familie findet es schrecklich, dass ich allein lebe und so weit weg bin, aber wenn ich nach Italien zurückkehre, müsste ich den endlosen Strom von entfernten Verwandten und Freunden der Familie über mich ergehen lassen. Potenzielle Verehrer auch«, fügte sie hinzu, als der Priester sie fragend ansah. Lia lehnte sich gegen die Kissen auf dem Sofa und hielt Tasse und Untertasse in einer Hand. »Der einzige Ort, der geantwortet hat, als ich gefragt habe: Wohin gehöre ich?, war hier. Languedoc. Ich musste aus Seattle raus, Pater. Dort hält mich nichts und niemand.«
»In Amerika wird der Tod so angesehen, als müsse man sich seiner schämen. In Gesellschaft darf man gar nicht davon sprechen«, sagte Pater Bonafé und hob die Teekanne in ihre Richtung. Lia schüttelte den Kopf und er schenkte nur sich selber erneut ein. »Dort spüre ich gar keinen Respekt vor der Trauer.«