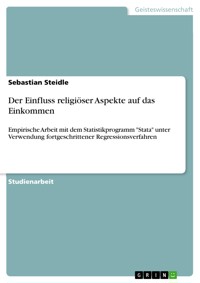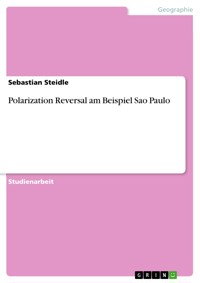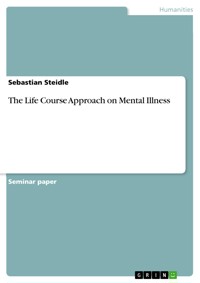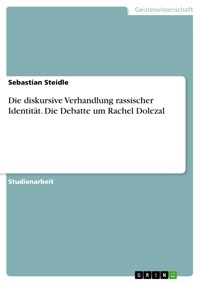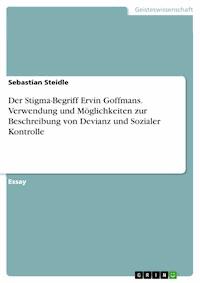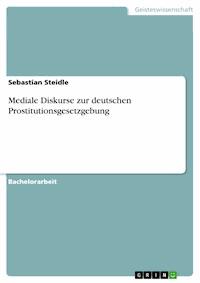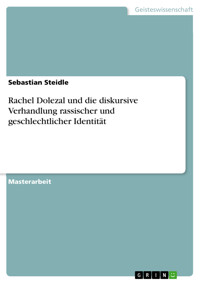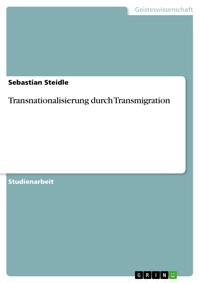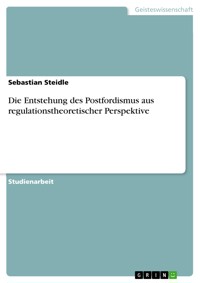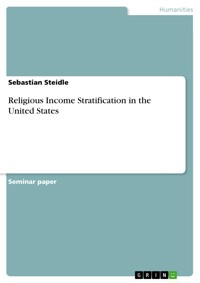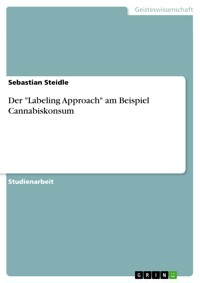
13,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: GRIN Verlag
- Sprache: Deutsch
Studienarbeit aus dem Jahr 2013 im Fachbereich Soziologie - Recht und Kriminalität, Note: 1,3, Universität Augsburg, Veranstaltung: Interpretatives Paradigma, Sprache: Deutsch, Abstract: Im ersten Teil der Arbeit wird der "Labeling Approach" von Howard S. Becker vorgestellt. Es wird aufgezeigt, inwieweit abweichendes Verhalten ein soziales Konstrukt ist. Im zweiten Teil wird dies am Beispiel des Cannabiskonsums erläutert. Kiffen wird hierbei als kulturelle Praktik verstanden, die erst sozial erlernt werden muss und welche als deviant markiert wird. Eine Arbeit die für Kriminologen wie auch für Kiffer interessant ist.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
Impressum:
Copyright (c) 2015 GRIN Verlag / Open Publishing GmbH, alle Inhalte urheberrechtlich geschützt. Kopieren und verbreiten nur mit Genehmigung des Verlags.
Bei GRIN macht sich Ihr Wissen bezahlt! Wir veröffentlichen kostenlos Ihre Haus-, Bachelor- und Masterarbeiten.
Jetzt beiwww.grin.com
Inhaltsverzeichnis
1. Einleitung
2. Der Labeling Approach nach Howard S. Becker
3. Sekundäre Devianz und das Karrieremodell
4. Der Labeling Approach am Beispiel Cannabiskonsums
4.1 Normsetzung
4.2 Konsumkarriere
4.3 Labeling
5. Kritik und eigene Beurteilung
Literaturverzeichnis
Internetquellen
1. Einleitung
„The young delinquent becomes bad, because he is defined as bad“.
2. Der Labeling Approach nach Howard S. Becker
Wenn auch Frank Tannenbaum den Labeling Approach begründet hat, so gilt Howard S. Becker insbesonder mit seinem Werk "Outsiders" von 1963 als dessen bedeutendster Vertreter. Becker kann als gemäßigter Vertreter des Labeling Approach bezeichnet werden, da er primäre Devianz, also die Art des zugrundeliegenden Verhaltens und die psychische Struktur der Person nicht völlig außer acht lässt (Vgl. Lamnek 2007: 230f.).
Becker unterscheidet zwischen regelverletzendem und abweichendem Verhalten. Er sieht Regeln als Objektiv gegeben an. Gegen sie kann jedoch auch Verstoßen werden, ohne dass es von anderen zwingend als abweichend empfunden werden muss. Nicht die Norm macht bestimmte Personen zu Abweichlern, sondern erst die Anwendung der Norm, welche abhängig von Täter, Opfer, den Machtverhältnissen, Ort und Folgen der Handlung ist. Je nach Ausprägung dieser Merkmale kann ein und dieselbe Verhaltensweise als konform oder abweichend definiert werden. Abweichendes Verhalten hängt deshalb zum Teil von der Qualität der Tat, und zum anderen Teil von der Reaktion der Umwelt auf die Tat ab, wobei der Labeling Approach den Analyseschwerpunkt zweitem legt, und der Traditionellen Kriminologie vorwirft genau diesen Aspekt zu sehr zu vernachlässigen (Vgl. Becker 1997:13).
Becker gibt hierfür vier Möglichkeiten zur Etikettierung eines Verhaltens an (Ebd.: S. 20f.)
– ein Verhalten verstößt nicht gegen die Regel und wird nicht als abweichend empfunden (Konformität)
– ein Verhalten verstößt gegen die Regel und wird als abweichend empfunden (z.B. Laden- diebstahl)
– ein Verhalten verstößt gegen die Regel, wird allerdings nicht als abweichend empfunden (Nichtaufgeklärte Verbrechen)
– ein Verhalten verstößt nicht gegen die Regel, wird aber als abweichend empfunden (z.B. fälschlich Beschuldigte, Sündenböcke)
Die Selektionsmechanismen sind von der Macht abhängig "Regeln aufzustellen und sie auf andere anzuwenden" (Lamnek 1999: 213) . Die gesellschaftlichen Regeln dienen
dazu, Handlungen als Richtig oder als Falsch zu definieren (Becker 1997: 1). Nach Becker gibt es in einer Gesellschaft eine Vielzahl von verschiedenen sozialen Gruppen mit konkurierenden Normvorstellungen, die dazu dienen, handeln als richtig oder falsch zu definieren. Welche Normen sich gesamtgesellschaftlich durchsetzen und in Form von Gesetzen institutionalisiert werden, hängt von der Machtstellung der einzelnen Gruppen ab. So können bestimmte Gruppen dank ihrer Machtposition ihre Interessen gesellschaftlich durchsetzen. Gruppen, die über wenig Macht verfügen sind in der Normsetzung- und Anwendung Gruppen mit höheren Machtpositionen ausgeliefert. In den USA sind die Normen deshalb vor allem ein Produkt der weißen, protestantischen, männlichen Oberschicht (Ebd.: 14). Diese hat nicht nur die Macht Normen zu setzen, sonder auch andere mit dem Verdacht der Abweichung zu stigmatisieren.
Wer gegen die gesellschaftlich geltenden Regeln verletzt hat, wird in den Augen seiner Mitmenschen ein besondere Mensch, ein „Outsider“ (Ebd.: 1) Der Außenseiter hingegen hat eine andere Ansicht über die Verletzung der Regel, die von der Gesellschaft aufgestellt wurde. Er wird sein Verhalten für richtig halten und im Gegenzug seinen Urteilern Kompetenz und Bereichtigung absprechen. So kann der Regelverletzer seine Richter als Außenseiter empfinden (Ebd: 225)