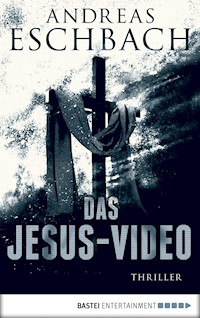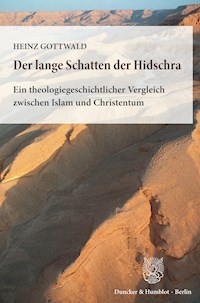
26,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Duncker & Humblot
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Sprache: Deutsch
Die aktuelle Islamdebatte wird oft durch die Frage bestimmt, warum seit Beginn der Neuzeit die soziokulturelle Entwicklung islamisch geprägter Regionen im Vergleich zum christlich geprägten Abendland zurückgeblieben ist. Angesichts vergleichbarer sozioökonomischer Ausgangsbedingungen im Mittelalter liegt die Vermutung nahe, dass die divergente soziokulturelle Entwicklung der beiden Regionen ihre Wurzeln in der unterschiedlichen Mentalität der jeweiligen Bevölkerung haben könnte. Da in traditionalen Gesellschaften die Mentalität entscheidend durch die Religion geprägt war, wird in der vorliegenden Untersuchung die mittelalterliche Theologiegeschichte der beiden Religionen entsprechend befragt und gegenübergestellt. Zunächst wird die mittelalterliche Entwicklung des Kalifenamtes sowie des islamischen Rechts- und Bildungswesens in ihrer Verwobenheit mit islamischen Glaubensvorstellungen präsentiert. Zur Verdeutlichung des theologischen Kontextes folgt eine Darstellung der Vorstellung von Gott und der göttlichen Prädestination. Danach wird die Entwicklung der entsprechenden Themenbereiche im abendländischen Christentum dargestellt. Bei dem anschließenden Vergleich der Entwicklungen im sunnitischen Islam mit denen im abendländischen Christentum wird gleichzeitig nach den Gründen der divergenten Entwicklung gefragt. Der Autor kommt zu dem Schluss, dass die erwähnte soziokulturelle Rückständigkeit islamisch geprägter Regionen auf Entscheidungen der islamischen Theologie während des Mittelalters zurückzuführen ist.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
HEINZ GOTTWALD
Der lange Schatten der Hidschra
Der lange Schatten der Hidschra
Ein theologiegeschichtlicher Vergleich zwischen Islam und Christentum Von Heinz Gottwald
Duncker & Humblot · Berlin
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
Umschlag: Arabische Wüste (© akg-images / FranÇois Guénet) Alle Rechte vorbehalten © 2018 Duncker & Humblot GmbH, Berlin Fremddatenübernahme: 3w+p, Ochsenfurt Druck: Meta Systems Publishing & Printservices GmbH, Wustermark Printed in Germany ISBN 978-3-428-15433-3 (Print) ISBN 978-3-428-55433-1 (E-Book) ISBN 978-3-428-85433-2 (Print & E-Book) Gedruckt auf alterungsbeständigem (säurefreiem) Papier entsprechend ISO 9706 ♾ Internet: http://www.duncker-humblot.de
Für meinen Sohn Thorsten und für meine Enkeltochter Sonja
Vorwort
Anlass für die vorliegende Untersuchung sind die seit einigen Jahren stattfindenden Diskussionen über die Gründe für die relative Rückständigkeit des islamisch geprägten Orients im Vergleich zum christlichen Abendland. Allerdings weiß man auch um die kulturelle Blüte und zeitweise Überlegenheit der islamischen Gebiete gegenüber dem Abendland im Früh- und Hochmittelalter und darum, dass sich dieses Verhältnis in der Neuzeit umkehrte (1). Eine genauere zeitliche Bestimmung dieser Veränderung hing jedoch davon ab, was man als Ursache der Veränderung ansah (2). Ein weitverbreiteter Erklärungsversuch ist der Hinweis auf das Fehlen eines Aufklärungsprozesses, wie er im neuzeitlichen Europa stattgefunden hat. Die Wurzeln dieser Aufklärung werden in der geisteswissenschaftlichen Forschung sehr oft mit der Reformation in Verbindung gebracht, die ihrerseits ihre Wurzeln in spätmittelalterlichen Entwicklungen innerhalb des Christentums hatte und die keinen absoluten Neuanfang darstellte (3). Somit drängt sich die Frage auf, inwiefern das spätmittelalterliche Christentum in Glaubenslehre und -praxis Erscheinungen aufwies, welche die Reformation und damit längerfristig die europäische Aufklärung und eine fortschrittliche Entwicklung möglich machten. Umgekehrt stellt sich in Bezug auf den islamisch geprägten Orient die Frage, ob und warum es in der islamischen Glaubenslehre sowie in deren praktischer Ausgestaltung und Umsetzung zu Entscheidungen kam, die eine fortschrittliche Entwicklung und eine gesellschaftlich wirksame Aufklärung hemmten oder gar ausschlossen. In der gegenwärtigen Diskussion werden hierfür meist die fehlende Trennung von Staat und Religion sowie das wörtliche Verständnis des Korans angeführt. Ziel der vorliegenden Untersuchung ist es nun, die hinsichtlich des Islam aufgeworfenen Fragen mit Hilfe eines Vergleichs mit der entsprechenden Entwicklung im abendländischen Christentum differenziert zu beantworten. Diese Antwort soll Aufschluss darüber geben, wann und warum es im islamisch geprägten Orient zu einer gesellschaftlichen Stagnation kam, die im Laufe der Neuzeit in Rückständigkeit mündete, während im christlichen Abendland spätestens seit dem Übergang vom Spätmittelalter zur Neuzeit ein dynamischer und fortschrittlicher gesellschaftlicher Entwicklungsprozess in Gang kam. Dabei geht es nicht um eine monokausale Erklärung dieser Divergenz, sondern darum, mit Hilfe eines mentalitäts- bzw. theologiegeschichtlichen Ansatzes zur Erklärung der unterschiedlichen gesamtgesellschaftlichen Entwicklung der beiden Großregionen seit Beginn der Neuzeit beizutragen.
Die so präzisierte Fragestellung dieser Untersuchung gibt denn auch den jeweiligen Zeitraum und den geographischen Rahmen der Untersuchung vor. In Bezug auf das Christentum ist demzufolge dessen Entwicklung von der Entstehung bis zum Vorabend der Reformation in den Gebieten der mittelalterlich-katholischen Kirche [8] zu untersuchen. Die orthodoxe Kirche in Griechenland und in Osteuropa bleibt unberücksichtigt, weil sie eine andere Entwicklung genommen hat. Infolgedessen fanden dort auch keine Reformation und auch keine genuine Aufklärung statt, sondern die westliche Aufklärung wurde erst mit einiger Verzögerung in einem längeren Prozess übernommen. Dies hatte dort im Vergleich zum westlichen und ehemals zur römisch-katholischen Kirche gehörenden Teil Europas ebenfalls zu einer relativen Rückständigkeit geführt. Hinsichtlich des Islam wird die Zeit von seiner Entstehung bis zum Ende des Bagdader Kalifats infolge der Eroberung Bagdads durch die Mongolen im Jahre 1258 untersucht. Denn das Ende des Bagdader Kalifats markiert insofern einen Wendepunkt in der Entwicklung des Islam, als spätestens mit dem Ende dieses Kalifats die politische Einheit der Muslime und auch die Doppelfunktion des Kalifen als religiöser und weltlicher Führer des Islam faktisch verloren gegangen waren. Dadurch fehlte ein wichtiger Akteur, von dem als religiösem und politischem Führer Impulse für eine Veränderung von Glaubenslehre und -praxis hätten ausgehen können, die für alle Muslime verbindlich durchgesetzt worden wären. Vor allem war es aber bereits seit der Wende vom 11. zum 12. Jahrhundert zu keinen wesentlichen Veränderungen der dogmatischen und institutionellen Entscheidungen mehr gekommen, die der Sieg der konservativen Form des Sunnismus in der zweiten Hälfte des 11. Jahrhunderts mit sich gebracht hatte. In räumlicher Hinsicht erstreckt sich die Untersuchung auf die Gebiete der damaligen Kalifate von Damaskus (661–750) und Bagdad (750–1258) und damit auf die in diesen Kalifaten dominante sunnitische Form des Islam. Der Schiismus hatte es damals außer zwischenzeitlich in Ägypten unter den Fatimiden (969–1171) zu keiner weiteren nennenswerten Staatsbildung gebracht. In Persien wurde der Schiismus erst 1501 Staatsreligion unter den Safawiden. Ansonsten gab es damals größere Konzentrationen schiitischer Bevökerung lediglich im mittleren und unteren Zweistromland, am Persischen Golf und im südlichen Iran.
Da sich aufgrund der Fragestellung der Fokus der Untersuchung auf die Entwicklung des Islam richtet, wird dessen Entwicklung zuerst dargestellt und gibt auch die Anordnung vor für die Darstellung der vergleichbaren Entwicklungen im abendländischen Christentum. Die Entwicklung im mittelalterlichen Islam wurde in besonderer Weise von den politischen Gegebenheiten in den Kalifaten von Damaskus und Bagdad geprägt. Denn die Entwicklung der islamischen Theologie war in dem zu untersuchenden Zeitraum nicht so sehr das Ergebnis einer systematischen Auseinandersetzung mit der von Mohammed gestifteten Religion als vielmehr Folge der Auseinandersetzung mit Fragen, die vonseiten der Politik an die islamische Religion gestellt worden waren. So stellte sich beispielsweise nach dem Tode Mohammeds die Frage nach den Aufgaben und Anforderungen, die ein Kalif als Nachfolger Mohammeds zu erfüllen habe. So gehörte zur Leitung des damals neu geschaffenen islamischen Gemeinwesens insbesondere auch die Organisation des Rechts- und Bildungswesens. Die Frage nach den Anforderungen, die ein Kalif zu erfüllen hatte, betraf vornehmlich dessen Legitimation und Verantwortlichkeit. Letztere führte zur theologischen Frage nach dem Verhältnis von menschlicher Willensfreiheit und [9] göttlicher Prädestination und markiert den Beginn der theologischen Diskussion im Islam. Die Diskussion des Verhältnisses von menschlicher Willensfreiheit und göttlicher Prädestination leitete zwangsläufig über zur Auseinandersetzung mit der Gottesvorstellung, die ihrerseits die Diskussion des Koranverständnisses nach sich zog. Dies waren gleichzeitig die zentralen Themen der mittelalterlichen islamischen Theologie. Die Art der theologischen Antworten war auch nicht selten durch die politischen Verhältnisse geprägt und im weiteren Verlauf stellte sich eine gewisse Wechselwirkung zwischen politischen Gegebenheiten und theologischer Entwicklung ein. Folglich ist eine Darstellung geboten, die die historische Entwicklung der einzelnen Themenbereiche aufzeigt, um die angesprochenen Zusammenhänge adäquat zu vermitteln. Die Anordnung der Darstellung der ausgewählten Themenbereiche wird dagegen sowohl durch deren logischen Zusammenhang als auch durch den historischen Ablauf der Diskussion dieser Themen bestimmt.
Am Beginn der Darstellung des mittelalterlichen Islam in Teil A. der vorliegenden Untersuchung steht also die Entwicklung des Kalifenamtes einschließlich theologiegeschichtlicher Aspekte, soweit diese in einem wechselseitigen Verhältnis zur Entwicklung des Kalifenamtes standen. Da dem Kalifen qua Amt auch die Aufgabe oblag, die Voraussetzungen für die schariatische Rechtsprechung und die religiöse Unterweisung zu schaffen, schließt sich die Darstellung des mittelalterlichen Rechtsund Bildungswesens an. Darauf folgen die Darstellung der theologischen Auseinandersetzungen mit der Frage nach dem Verhältnis von menschlicher Willensfreiheit und göttlicher Prädestination sowie die Darstellung der Entwicklung des Gottes- und Koranverständnisses. Für die Darstellung der Entwicklung des abendländischen Christentums bis zum Vorabend der Reformation in Teil B. der Untersuchung wird die skizzierte Gliederung der Darstellung des mittelalterlichen sunnitischen Islam beibehalten. Bei der Darstellung der fünf Themenbereiche wird wie zuvor bei der Darstellung des Islam insbesondere auf den historischen Kontext der jeweiligen Veränderungen abgestellt, da dieser Zusammenhang für deren Bewertung von besonderer Bedeutung ist. Im nachfolgenden Teil C. des Hauptteils werden die wichtigsten Unterschiede in der Entwicklung von sunnitischem Islam und abendländischem Christentum herausgearbeitet und im Hinblick auf die Fragestellung der Untersuchung ausgewertet. Im Schlussteil soll kurz auf die negativen Folgen eingegangen werden, die sich aus der festgestellten Verfasstheit des sunnitischen Islam am Ende des Untersuchungszeitraums ergaben und als Ursache für den Übergang der Stagnation in eine relative Rückständigkeit gegenüber dem christlichen Abendland anzusehen sind. In einem Nachwort werden der Geltungsanspruch der vorgelegten Untersuchung einschließlich des mentalitätsgeschichtlichen Ansatzes reflektiert und die Frage nach der möglichen Bedeutung des vorgelegten Erklärungsversuches für die aktuelle Diskussion gestellt.
Da diese Untersuchung sich an ein breiteres Publikum als beispielsweise eine akademische Arbeit richtet, wird auf einen umfänglichen Anmerkungsapparat verzichtet. Um der Leserfreundlichkeit willen verweise ich auf die zugrunde liegende Sekundärliteratur im Allgemeinen nur in summarischer Form zu Beginn entspre[10]chender thematischer Einheiten. Lediglich in Ausnahmefällen, und zwar bei konkreter Bezugnahme auf einen Sekundärtext sowie bei einer besonderen argumentativen Bedeutung des dargestellten Sachverhalts, wird unmittelbar an entsprechender Stelle auf den konsultierten Text hingewiesen. Um der Leserfreundlichkeit willen wird auch weitgehend auf die Verwendung wörtlicher Zitate verzichtet. Koranzitate folgen der Reclam-Ausgabe aus dem Jahre 1960, einer Neuausgabe der früheren Übersetzung Max Hennings; Bibelzitate sind der Herder-Ausgabe der Einheitsübersetzung aus dem Jahr 1980 entnommen. Zum Schluss sei noch darauf hingewiesen, dass die Transkription orientalischer Namen und Begriffe in der Weise erfolgt, wie es in einschlägigen deutschsprachigen Darstellungen üblich ist.
Sinntal, im Januar 2018
Heinz Gottwald
Inhaltsverzeichnis
Einleitung
1.
Beispiele für die Unzulänglichkeit bisher vorgelegter Erklärungsansätze
2.
Dan Diners ,Versiegelte Zeit‘ als Beispiel für die ,Fruchtbarkeit‘ des mentalitätsgeschichtlichen Erklärungsansatzes
3.
Begründung für Methode und Anlage der vorliegenden Untersuchung
A.
Entwicklung des mittelalterlichen Islam bis zum Ende des Bagdader Kalifats 1258
I.
Die Entwicklung des Kalifenamtes
1.
Mögliche Vorbilder für die Doppelfunktion Mohammeds im medinensischen Gemeinwesen und deren realgeschichtliche Genese
2.
Zeit der ersten vier ,rechtgeleiteten Kalifen‘
3.
Entwicklung des Kalifenamtes zur Zeit der Umaiyaden
4.
Wandel des Einsetzungsverfahrens und der Legitimation eines Kalifen bis zum Beginn des abbasidischen Kalifats
5.
Entwicklung des Kalifenamtes in der Frühphase der Abbasiden
6.
Entwicklung des Kalifenamtes während der buyidischen und seldschukischen Oberherrschaft (945–1055/1055–1157)
7.
Kalifenamt in der Spätphase des Bagdader Kalifats unter an-Nasir (1180 – 1225)
8.
Kalifatstheorien
II.
Entwicklung des sunnitischen Rechtswesens
1.
Formen der Gerichtsbarkeit sowie Verfahrens- und Beweisrecht
2.
Rechtsstatus der Nicht-Muslime und der Sklaven
3.
Entstehung und Entwicklung des schariatischen Rechts einschließlich der Methoden der Rechtsfindung
4.
Entstehung und Entwicklung der Rechtsschulen
5.
Gegenstand des schariatischen Rechts
6.
Unterscheidung zwischen göttlichem und menschlichem Recht und deren Folgen
III.
Entwicklung des islamischen Bildungswesens
1.
Organisation der Koranschulen und Gegenstand des Unterrichts
2.
Formen weiterführender Ausbildung
3.
Nizam al-Mulks neue Organisationsform der Madrasen und deren Bedeutung
4.
al-Mamuns ,Haus der Weisheit‘ (,bait al-hikma‘)
IV.
Verhältnis von göttlicher Prädestination und menschlicher Willensfreiheit
1.
Ausgangspunkt der theologischen Diskussion über das Verhältnis von göttlicher Prädestination und menschlicher Willensfreiheit
2.
Diskussion des Verhältnisses zwischen göttlicher Prädestination und menschlicher Willensfreiheit in umaiyadischer Zeit
3.
Fortführung der Diskussion über das Verhältnis von göttlicher Prädestination und menschlicher Willensfreiheit im 9. Jahrhundert
4.
al-Ascharis Position als Vermittlungsversuch zwischen Mutaziliten und Hanbaliten
5.
Ursachen für die Niederlage der ,rationalen Theologie‘ in der Prädestinationsfrage
6.
Relativierung der radikalen Position der Prädestinatianer
V.
Entwicklung des Gottes- und Koranverständnisses
1.
Ausgangspunkt und Hintergrund der Diskussion über das Gottesverständnis
2.
Die koranische Gottesvorstellung
3.
Die Kritik Dschahm b. Safwans (gest. 746) und Dschad b. Dirhams (gest. 743) an der koranischen Gottesvorstellung
4.
Dirar ibn Amrs versuchter Ausgleich zwischen koranischer Gottesvorstellung sowie den Vorstellungen Dschahms und Dschads
5.
Abu l-Hudails Koranverständnis und Gottesvorstellung sowie die mutazilitische Attributenlehre
6.
Ahmad b. Hanbals Vorstellungen als Beispiel für das damalige traditionelle Gottes- und Koranverständnis
7.
Verschärfung der Auseinandersetzungen um das Gottes- und Koranverständnis zwischen Traditionariern und Mutaziliten
8.
al-Ascharis Gottesvorstellung und Koranverständnis
9.
Präzisierung und Weiterentwicklung der Lehre al-Ascharis
B.
Entwicklung des abendländischen Christentums bis zum Vorabend der Reformation
I.
Entwicklung des Verhältnisses zwischen geistlicher und weltlicher Obrigkeit .
1.
Außenseiterposition der Jesusbewegung und der frühen Christenheit
2.
Verhältnis zwischen (ost-)römischen Kaisern und Christentum seit der ,Konstantinischen Wende‘
3.
Verhältnis zwischen weltlicher und geistlicher Obrigkeit in germanischer Zeit bis zum Investiturstreit
4.
Cluniazensische Reformbewegung und Investiturstreit in ihrer Bedeutung für das Verhältnis zwischen weltlicher Herrschaft und Kirche
5.
Konflikte zwischen weltlicher Obrigkeit und Papsttum infolge des papalen Anspruchs auf die indirekte Suprematie
6.
Auseinandersetzungen zwischen dem Papsttum und der spätmittelalterlichen konziliaren Bewegung
II.
Spätantike und mittelalterliche Entwicklung des weltlichen und geistlichen Rechtswesens im westkirchlichen Christentum
1.
Entstehung der geistlichen Gerichtsbarkeit in Abgrenzung zur weltlichen Gerichtsbarkeit
2.
Mittelalterliche Entwicklung der bischöflichen Gerichtsbarkeit
3.
Entwicklung der päpstlichen Gerichtsbarkeit im Mittelalter
4.
Mittelalterliche Entwicklung der weltlichen Gerichtsbarkeit
5.
Entwicklung des materiellen Rechts am Beispiel des Rechtsstatus der Sklaven und der Frauen
III.
Entwicklung des mittelalterlichen Bildungswesens im westkirchlichen Christentum
1.
Entwicklung des Schulwesens
2.
Entstehung und Organisationsform der Pariser ,Professorenuniversität‘
3.
Entstehung und Organisationsform der ,Studentenuniversität‘ in Bologna . .
4.
Gründung einer ,obrigkeitlichen Universität‘ in Neapel durch Kaiser Friedrich II
IV.
Entwicklung des Verhältnisses von göttlicher Prädestination und menschlicher Willensfreiheit im westkirchlichen Christentum
1.
Augustins Prädestinationslehre als Ausgangspunkt der entsprechenden Kontroversen in der Westkirche
2.
Beschlüsse der Synode von Orange im Jahre 529 und deren Bestätigung auf der Synode von Quierzy 853 als Grundlage der westkirchlichen Prädestinationslehre
3.
Hochmittelalterliche Präzisierungen bzw. Modifikationen der Prädestinationslehre
4.
Spätmittelalterliche Entwürfe zum Verhältnis von göttlicher Prädestination und menschlicher Willensfreiheit
5.
Entwicklung des Bußsakramentes und dessen Bedeutung für die Vorstellung von der menschlichen Willensfreiheit
V.
Entwicklung des christlichen Gottesverständnisses in Antike und Mittelalter
1.
Die jesuanische Gottesvorstellung im Neuen Testament
2.
Entwicklung der Gottesvorstellung bis zum Konzil von Nizäa
3.
Entscheidung der trinitarischen Frage auf den Konzilien von Nizäa (325) und Konstantinopel (381)
4.
Frage nach der ,Gott- und Menschheit Jesu Christi‘ als Gegenstand von Auseinandersetzungen bis zum Konzil von Konstantinopel (680/681)
5.
Scheitern der neuplatonischen Kritik des Johannes Scotus Eriugena (gest. 877) an der dogmatisierten Gotteslehre
Exkurs: Christliche Bibelexegese in Antike und Mittelalter
6.
Hochmittelalterliche Beiträge zur Trinitätslehre und Christologie
7.
Neue Ansätze in Bezug auf die Gottesvorstellung bei Duns Scotus und Wilhelm von Ockham
C.
Vergleichende Analyse der dargestellten Entwicklungen im mittelalterlichen Islam sowie im abendländischen Christentum und Auswertung der Ergebnisse dieser Analyse
I.
Vergleichende Analyse der Entwicklungen in den fünf Themenfeldern
1.
Vergleichende Analyse der Entwicklung des Kalifenamtes und des Verhältnisses von weltlicher und geistlicher Obrigkeit im westkirchlichen Christentum
a)
Wahrung sowohl der Trennung von weltlicher und geistlicher Gewalt im westkirchlichen Christentum als auch der Einheit beider Gewalten im Amt des Kalifen
b)
Gründe für die Veränderungen in Bezug auf das Amt des Kalifen
c)
Gründe für die Veränderungen in Bezug auf das Verhältnis von weltlicher und geistlicher Obrigkeit im westkirchlichen Christentum
d)
Vergleich der Gründe für die Entwicklung des Kalifenamtes und des Verhältnisses von weltlicher und geistlicher Obrigkeit im westkirchlichen Christentum
2.
Vergleichende Analyse der mittelalterlichen Entwicklung des Rechtswesens im sunnitischen Islam und im westkirchlichen Christentum
a)
Wichtige Ergebnisse der mittelalterlichen Entwicklung des Rechtswesens im sunnitischen Islam und Gründe für die Stagnation in diesem Bereich
b)
Wichtige Ergebnisse der Entwicklung des Rechtswesens im westkirchlichen Christentum und Gründe für die relative Dynamik des Rechtswesens im westkirchlichen Bereich
3.
Vergleichende Analyse der Entwicklung des Bildungswesens im Damaszener und Bagdader Kalifat mit der im westkirchlichen Christentum
a)
,Studentenuniversität‘ in Bologna und ,Professorenuniversität‘ in Paris als Beispiele für das Zurückdrängen der Kirche im hochmittelalterlichen Hochschulwesen
b)
Formen der islamischen Hochschulausbildung mit ihren ausgeprägten Abhängigkeitsverhältnissen und ihrer fehlenden Offenheit
c)
Trennung und Einheit der beiden obersten Gewalten als Grund für die unterschiedlichen Strukturen im westkirchlichen und islamischen Hochschulwesen des Mittelalters
4.
Vergleichende Analyse der Entwicklung des Verhältnisses von göttlicher Prädestination und menschlicher Willensfreiheit im sunnitischen Islam und im abendländischen Christentum
a)
Entwicklung der sunnitischen Vorstellung von der göttlichen Prädestination und die Gründe für den Erfolg der ,Prädestinatianer‘
b)
Entwicklung der christlichen Vorstellung vom Verhältnis zwischen göttlicher Allmacht und menschlicher Willensfreiheit und die Gründe für den Erfolg des synergistischen Modells
c)
Vergleich der Gründe für die unterschiedliche Antwort auf die Frage nach dem Verhältnis von göttlicher Prädestination und menschlicher Willensfreiheit im sunnitischen Islam und im westkirchlichen Christentum
5.
Vergleichende Analyse der Entwicklung der Gottesvorstellung im sunnitischen Islam und im abendländischen Christentum
a)
Entwicklung des sunnitischen Gottesverständnisses und ihre Bestimmungsfaktoren
b)
Entwicklung des christlichen Gottesverständnisses und ihre Bestimmungsfaktoren
c)
Ausprägung anthropomorph(-istisch-)er Züge in der sunnitischen und christlichen Gottesvorstellung
d)
Bedeutung der ,Ein(s)heit Gottes‘ in der christlichen und islamischen Theologiegeschichte sowie des damit verbundenen unterschiedlichen Verständnisses von Bibel und Koran
II.
Zusammenführung der Teilergebnisse des Vergleichs und deren abschließende Auswertung
1.
Bedeutung der unterschiedlichen Ausgangssituation von Christentum und Islam
2.
Unterschiedliche Entwicklung als Resultat einer ausgeprägten Traditionsgebundenheit im Islam und einer relativen Offenheit im Christentum
Schlussteil: Ausblick auf die negativen Folgen der spätmittelalterlichen Verfasstheit des sunnitischen Islam für die neuzeitliche Entwicklung in dessen damaligem Verbreitungsgebiet
Nachwort: Geltungsanspruch und aktuelle Bedeutung der Untersuchung
Anhang
Anhang 1: Dekret des Kalifen al-Qadir aus dem Jahre 1017
Anhang 2: ,Dictatus Papae‘ Papst Gregors VII. (1073–1085)
Anhang 3: Stammtafel zu Mohammed sowie zu wichtigen Clans und Familien in der Zeit des Damaszener und Bagdader Kalifats
Anmerkungen
Literaturverzeichnis
I.
Quellen
II.
Nachschlagewerke
III.
Sekundärliteratur
Personen- und Sachregister
Einleitung
1. Beispiele für die Unzulänglichkeit bisher vorgelegter Erklärungsansätze
Wie im Vorwort angedeutet, war die Frage nach den Ursachen für die in der Neuzeit sich allmählich ausbildende Rückständigkeit des islamischen Orients im Vergleich zum christlichen Abendland schon oft Gegenstand entsprechender Untersuchungen, die zu unterschiedlichen Antworten auf diese Frage gekommen sind (1). Deshalb scheint es sinnvoll, vorweg auf einige wichtige Erklärungsversuche einzugehen, um den mentalitätsgeschichtlichen Ansatz der vorliegenden Untersuchung zu begründen und entsprechend einordnen zu können. Eine oft gegebene Antwort ist der Hinweis auf die Entdeckung des Seeweges nach Indien um das Kap der guten Hoffnung im Jahre 1498 durch den Portugiesen Vasco da Gama. Dies habe dazu geführt, dass die vormaligen Handelswege durch den Orient an Bedeutung verloren und dies im Orient erhebliche wirtschaftliche Nachteile und finanzielle Einbußen zur Folge gehabt habe, was seinerseits zum gesamtgesellschaftlichen Niedergang dieser Region geführt haben solle. Hier drängt sich allerdings die weitergehende Frage auf, warum es nicht gelungen ist, diese Einbußen durch eine entsprechende ökonomische Umorientierung zu kompensieren, zumal die von den Europäern vorgenommene Umstellung des Transportes von den Landwegen auf den neu entdeckten Seeweg ein sich länger hinziehender Prozess war. Eine Antwort könnte sein, dass es den potentiellen islamischen Akteuren an der hierfür notwendigen mentalen Flexibilität oder an einer entsprechenden Motivation gefehlt habe. In beiden Fällen hätte dies angesichts der Bedeutung von Religion in den damaligen Kulturen durchaus religiös bedingt sein können.
Eine andere Antwort könnte sein, dass potentiellen Akteuren das notwendige Kapital gefehlt habe, um auf eine andere Erwerbsgrundlage umzustellen, beispielsweise vom landgebundenen Warentransport mit Kamelen auf den Schiffstransport. Für den Mangel an privatem Kapital gibt es tatsächlich auch Hinweise in der Geschichte des islamischen Orients, und zwar in Form von Klagen über zu hohe und zum Teil auch über willkürliche Steuerforderungen vonseiten des Staates, die eine ausreichende Kapitalbildung verhinderten (2). Eine Reaktion wohlhabender Bürger auf die hohen und zuweilen willkürlichen staatlichen Steuern war denn auch die Flucht in gemeinnützige Stiftungen. Auf diese Weise versuchte man, das eigene Kapital vor dem Fiskus zu schützen, konnte aber trotzdem aufgrund der entsprechenden Regelungen die Kontrolle über das in die Stiftung eingebrachte Kapital behalten. Dieses Kapital fehlte dann natürlich für nicht-gemeinnützige Kapitalan[18]lagen und Investitionen. Diese Umleitung des Kapitals wurde vor allem auch dadurch begünstigt, dass gemeinnützige Stiftungen, die meist der Finanzierung von Moscheen, Madrasen, Koranschulen und Krankenhäuser dienten, als fromme Werke galten. Vor allem im Spätmittelalter und zu Beginn der Neuzeit sollen die religiös begründeten Stiftungen auf nicht unerhebliche Weise Kapital zu Lasten größerer privatwirtschaftlicher Investitionen gebunden haben. Wie in Bezug auf die mentale Flexibilität und die Motivation hinsichtlich möglicher Investitionen kommt also auch hinsichtlich des angesprochenen Kapitalmangels die Religion als mögliche Erklärung in Betracht. Dies zeigt, dass ein religions- bzw. mentalitätsgeschichtlicher Erklärungsansatz zu weitergehenden Erkenntnissen führen könnte.
Außer der dargestellten Erklärung für die sich zu Beginn der Neuzeit allmählich ausbildende Rückständigkeit des islamischen Orients gegenüber dem christlichen Okzident werden in der historischen Islamwissenschaft noch weitere Erklärungen diskutiert. So machen einige Vertreter derselben auch die sich seit Mitte des 9. Jahrhunderts ausbildende Wehrverfassung und die damit verbundene ,Feudalisierung des Militärs‘ für den Niedergang des Bagdader Kalifats verantwortlich (3). Zu dieser Wehrverfassung kam es unter anderem infolge einer Veränderung der Rekrutierungsbasis des Heeres. Stellten in der Frühzeit des Islam und während des Damaszener Kalifats die Araber das Gros des Heeres, so änderte sich dies mit der sogenannten ,abbasidischen Revolution‘ gegen die Umaiyaden in der Mitte des 8. Jahrhunderts (4). Zum Erfolg der Revolution der Abbasiden, bei der es letztlich um den Kampf zweier Clane um das Amt des Kalifen ging, hatten vor allem chorasanische Truppen beigetragen, die aus dem östlichen Iran stammten. Der Sieg der Abbasiden mit Hilfe der chorasanischen Truppen führte zu einem Verlust der militärischen Bedeutung der Araber, die die Träger der ursprünglichen Expansion des Islam gewesen waren, und zu einer entsprechenden Rivalität zwischen ihnen und den Chorasaniern. Da sich später jedoch die Chorasanier nicht immer bereitwillig in den Dienst der Politik der abbasidischen Kalifen stellten, wurden auch sie seit al-Mutasim (833–842) allmählich im stehenden Heer zurückgedrängt und durch turkstämmige Truppen ersetzt. Zunächst hatte sich al-Mutasim wegen der innerislamischen Unruhen in Bagdad, in die auch die ostiranischen Chorasanier verwickelt waren, eine ihm persönlich ergebene Garde aus turkstämmigen Sklaven geschaffen. Diese zeichneten sich durch besondere militärische Tugenden und Fähigkeiten aus und stellten folglich auch im stehenden Heer einen immer größer werdenden Teil der Truppen. Gegen Ende des 9. Jahrhunderts war man nicht mehr in der Lage, die Kosten für das reguläre Heer und die Garde des Kalifen aus dem Staatshaushalt zu finanzieren (5), zumal die Zeit der großen Eroberungen vorbei war, sodass Beute und Ansiedlung im eroberten Land als Besoldung der Soldaten kaum noch in Frage kamen. Deshalb ging man dazu über, vor allem die Offiziere in Form der Überlassung von Staatsland zu besolden. Dieses Land, das grundsätzlich von der jeweiligen einheimischen Bevölkerung oder von Sklaven bearbeitet wurde, oder die darauf erhobene Grundsteuer (arab. ,haradsch‘) überließ man den Offizieren, damit diese daraus ihren eigenen Unterhalt und den ihrer Truppen finanzieren konnten. Ange[19]sichts der Befristung dieser ,Lehen‘ bis zum Ende der jeweiligen Dienstzeit strebten die Offiziere nach größtmöglichem Nutzen in kurzer Zeit und beuteten die auf ihrem Land ansässigen Bauern entsprechend aus. Diese ,Feudalisierung des Militärs‘ hatte also einen ökonomischen Niedergang zur Folge, da den Offizieren im Allgemeinen nicht an Innovationen gelegen war und die sozialen Folgen dieser feudalen Strukturen kaum in ihr Blickfeld gerieten, zumal sie meist einer anderen Ethnie angehörten als die einheimische bäuerliche Bevölkerung. In der Frühphase dieses ,iqta‘-Systems zu Beginn des 10. Jahrhunderts mussten die Offiziere von dem ihnen überlassenen Land oder von den erhobenen Grundsteuern noch den ,Zehnten‘ des Ertrages oder der eingenommenen Grundsteuern als obligatorische Armensteuer (arab. ,zakat‘) an den Fiskus abführen. Diese Regelung wurde später aufgegeben, was dazu führte, dass der Zentralstaat langfristig den Einblick in die steuerlichen Verhältnisse des jeweiligen Gebietes verlor. Die Offiziere bzw. deren Verwalter nahmen mit der Zeit ausgehend von der Steuererhebung auch staatliche Verwaltungsfunktionen wahr. Hinzu kam, dass vor allem in der Zeit der seldschukischen Oberherrschaft (1055 – Mitte des 12. Jh.s) immer öfter die jeweils höchsten Offiziere in einer Provinz als Militärgouverneure eingesetzt wurden.
In der 2. Hälfte des 12. Jahrhunderts während des Niedergangs der seldschukischen Oberherrschaft über das Bagdader Kalifat verstärkten sich auch schon vorher anzutreffende partikulare Interessen der Militärgouverneure. Diese strebten tendenziell nach einer möglichst großen Unabhängigkeit gegenüber der Zentralgewalt und begriffen sich als Regent eines Fürstentums. Sie versuchten, sich dem unmittelbaren Einfluss oder Zugriff der Zentralgewalt zu entziehen, die während der seldschukischen Oberherrschaft vom Sultan und danach wieder vom abbasidischen Kalifen ausgeübt wurde. Darüber hinaus versuchten die Militärgouverneure ihre Provinz bzw. ihr Herrschaftsgebiet zu vergrößern und okkupierten in der Regel kleinere ,Pseudo-Fürstentümer‘, die oft auch ihren Ursprung in der ,Feudalisierung des hohen Militärs‘ hatten. Auf diese Weise gewannen die Militärgouverneure an Macht und Einfluss, setzten die Erblichkeit ihrer Position durch und es entstanden neue dynastische Herrschaften. Diese Vorgänge waren von ständigen militärischen Auseinandersetzungen begleitet und zehrten an der Kraft des Zentralstaates. Unter den ständigen militärischen Auseinandersetzungen infolge der Schwäche der Zentralgewalt litten insbesondere die Städte. Da sich in der nachfolgenden Zeit an dieser durch die Wehrverfassung begründeten Feudal- und Herrschaftsstruktur nichts Wesentliches veränderte, erlag das Bagdader Kalifat folglich dem Ansturm der Mongolen und fand 1258 mit der Zerstörung Bagdads sein Ende.
Die dargestellten Folgen der Wehrverfassung samt der ,Feudalisierung des Militärs‘ veranlassten – wie bereits erwähnt – einige Vertreter der historischen Islamwissenschaft, in der Wehrverfassung und deren Folgen die Ursache für das Ende des Bagdader Kalifats zu sehen. Darüber hinaus sahen diese Wissenschaftler in den langfristigen Folgen der Wehrverfassung auch eine Ursache für die sich zu Beginn der Neuzeit ausbildende Rückständigkeit des islamischen Orients im Vergleich zum christlichen Abendland. Zu diesen langfristigen Folgen gehörten insbesondere die [20] ökonomischen und mentalen Folgen der Ausbeutung der bäuerlichen Landbevölkerung und der Niedergang der urbanen Kultur infolge der militärischen Auseinandersetzungen mit ihren großen Verlusten an Menschen und materiellen Gütern. An dieser Stelle soll es jedoch nicht um eine ausführliche kritische Würdigung dieser Erklärungsansätze gehen. Es sei lediglich darauf hingewiesen, dass es im mittelalterlichen Europa ähnliche feudale Strukturen gab. Es wäre folglich eine höchst differenzierte vergleichende Analyse der jeweiligen feudalen Strukturen vonnöten, um zu validen Ergebnissen zu kommen, was bislang m.W. noch nicht geschehen ist. Des Weiteren sei daran erinnert, dass der Ausgangspunkt der Wehrverfassung mit ihren sich ausbildenden feudalen Strukturen in den religiösen Auseinandersetzungen in der Mitte des 8. Jahrhunderts begründet lag. In diesen Auseinandersetzungen ging es um die Legitimität des Anspruchs auf das Amt des Kalifen, den die Abbasiden mit Hilfe der chorasanischen Truppen durchsetzten. Hier nahm der Rückgriff auf nichtarabische Truppen seinen Anfang. Hinzu kam, dass die Politik der Bagdader Kalifen wie zuvor schon die der Damaszener Kalifen durch das Selbstverständnis bestimmt wurde, den Islam zu verbreiten und Schutzherr aller Muslime zu sein, was ein entsprechend großes und schlagkräftiges Heer notwendig machte. Dieses Selbstverständnis trug insofern aber auch zum Niedergang des Bagdader Kalifats und letztlich auch zu dessen Untergang bei, als es zu einem Ausgreifen weit in den innerasiatischen und nordafrikanischen Raum führte, was eine ,Überdehnung‘ der eigenen Möglichkeiten zur Folge hatte.
Die bisher vorgestellten Erklärungsansätze zeichnen sich dadurch aus, dass weder die islamische Religiosität noch andere Aspekte der Mentalität als Ursache für die spätere Rückständigkeit des islamischen Orients im Vergleich zum christlichen Okzident in den Blick geraten. Im nachfolgenden Erklärungsansatz wird dagegen die allgemeine muslimische Mentalität als Ursache für den ,Niedergang der islamischen Wissenschaft‘ angesehen, der seinerseits für die angesprochene Rückständigkeit des islamischen Orients verantwortlich gemacht wird (6). So geht Eberhard Serauky davon aus, dass bereits im Laufe des 12. Jahrhunderts das Interesse an der Wissenschaft und damit auch an Neuerungen und Erfindungen nachgelassen habe. Dies lasse sich unter anderem daran ablesen, dass eine 1387 abgefasste Art Enzyklopädie für die wichtigsten Wissensgebiete der damaligen Zeit erhebliche Mängel aufweise (7). So fänden die wissenschaftlichen Leistungen der sogenannten klassischen Zeit von der Regierungszeit des Kalifen Harun ar-Raschid (786–809) bis zum Beginn des 12. Jahrhunderts kaum Berücksichtigung und die Beiträge zu Mathematik, Geometrie und Naturwissenschaften seien laut Serauky unausgewogen und undifferenziert. Des Weiteren seien im 12. und 13. Jahrhundert vermehrt unzureichend ausgebildete oder gar unfähige Ärzte in Erscheinung getreten (8). Allerdings bietet Serauky keine Erklärung für das nachlassende Interesse an einer guten Ausbildung und an der Wissenschaft.
Der deutsch-ägyptische Politikwissenschaftler Hamed Abdel-Samad sieht dagegen in der seit Ende des 9. Jahrhunderts feststellbaren Verunsicherung aufseiten der damaligen Muslime die Ursache für die seit dem Spätmittelalter feststellbare [21] Stagnation in der islamischen Wissenschaft (9). Er liest diese Verunsicherung an der Fixierung auf eine ,buchstabengetreue Auslegung des Korans‘ ab und konstatiert, dass sie sich in der nachfolgenden Zeit in Krisensituationen wie dem Eindringen der Kreuzritter und der Mongolen verstärkt und zu einer immer stärkeren Fokussierung auf die Religion geführt habe. Man habe sich folglich auch im Bereich der Wissenschaften auf die Theologie und Rechtswissenschaft konzentriert, während Medizin, Mathematik, Geometrie und Naturwissenschaften in den Hintergrund gedrängt worden seien. Folglich habe nach Abdel-Samad bereits im Spätmittelalter im wissenschaftlichen und technischen Bereich die spätere Überlegenheit der Europäer gegenüber den Orientalen ihren Anfang genommen. In der ,Frühen Neuzeit‘ sei es im Großen und Ganzen bei dieser Konstellation geblieben und die Überlegenheit der Europäer habe sich nach und nach vergrößert. Aufgrund des geringen Interesses an Naturwissenschaften und Technik seien selbst ,importierte Neuerungen und Erfindungen‘ auf Vorbehalte gestoßen und hätten zuweilen trotz ihrer Nützlichkeit keine Anwendung gefunden (10). Diese Geisteshaltung habe im Laufe der Zeit beispielsweise dazu geführt, dass vor der in Erwägung gezogenen Anwendung ,importierter Technik‘ des Öfteren eine Begutachtung durch Religions- bzw. Rechtsgelehrte vorgenommen worden sei. Dabei wurde überprüft, ob die Anwendung dieser Technik auch im Einklang mit dem islamischen Glauben gestanden habe. Angesichts der konservativen Ausrichtung des sunnitischen Islam seit Ende des 11. Jahrhunderts habe sich eine solche Begutachtung tendenziell hinderlich auf die Anwendung bekannt gewordener technischer Innovationen in den islamischen Kerngebieten ausgewirkt. Ausgenommen seien nur Neuerungen oder Erfindungen gewesen, die für den militärischen Bereich hätten von Nutzen sein können.
2. Dan Diners ,Versiegelte Zeit‘ als Beispiel für die ,Fruchtbarkeit‘ des mentalitätsgeschichtlichen Erklärungsansatzes
Einen ähnlichen Ansatz wie den eben referierten mentalitätsgeschichtlichen Erklärungsansatz Abdel-Samads verfolgt auch Dan Diner in seiner Untersuchung ,Versiegelte Zeit‘ aus dem Jahr 2007. Er geht davon aus, dass verschiedene dogmatische Festlegungen der islamischen Glaubenslehre gesellschaftliche Wirkungen zeitigten, die er für die neuzeitliche Rückständigkeit des islamischen Orients gegenüber dem westlichen Europa verantwortlich macht. Dan Diner verfolgt also auch insofern einen mentalitätsgeschichtlichen Ansatz, als er nach den Folgen theologischer Entscheidungen fragt, die ihrerseits Ausdruck des damaligen religiösen Bewusstseins – als einem Aspekt der allgemeinen Mentalität – waren. Da in seinen Ergebnissen die ,Fruchtbarkeit‘ des mentalitätsgeschichtlichen Ansatzes auf beeindruckende Weise zum Vorschein kommt, werden einige Ergebnisse der Untersuchung Diners ausführlicher referiert. Sein Vorgehen besteht darin, dass er verschiedene dogmatische Festlegungen des spätmittelalterlichen Islam hinsichtlich [22] ihrer Folgen für die neuzeitliche gesamtgesellschaftliche Entwicklung überprüft. So greift er beispielsweise die dogmatische Vorstellung auf, dass der Koran nach spätmittelalterlicher sunnitischer Vorstellung als ,Rede Gottes‘ verstanden worden sei und deshalb dem im Koran vorfindbaren Arabisch ein sakraler Charakter eigne (11). Diese Sakralität des koranischen Arabisch habe in der Folgezeit nach Diner dazu geführt, dass das koranische Arabisch vor Veränderungen bewahrt worden sei und in seiner damaligen Form sich im arabischsprachigen Kerngebiet des Islam als alleinige Schriftsprache etabliert habe. Neben dieser Schriftsprache habe es natürlich die gesprochene Sprache gegeben, die der Kommunikation im Alltag gedient habe. Die koranische Schriftsprache habe hingegen als Kommunikationsmittel in religiösen und theologischen Fragen fungiert und habe sich aufgrund ihres sakralen Charakters zur unveränderlichen Hochsprache der Muslime entwickelt. Mit der Zeit haben sich nach Diner im arabischsprachigen Kerngebiet des Islam zwei getrennte Sprachsphären entwickelt, zwischen denen es nur in einem geringen Maße zu einem Austausch gekommen sei. So hätten Alltagserfahrungen kaum Eingang in die arabische Schriftsprache gefunden, sodass ihre Verbreitung und damit ihre allgemeine Nutzanwendung erschwert worden seien. Dies sei für die gesamtgesellschaftliche Entwicklung natürlich von Nachteil gewesen, da es sich bei diesen Alltagserfahrungen durchaus auch um technische Neuerungen gehandelt habe. Bis zum Zeitpunkt der Abfassung seines Buches seien nach Diner in arabischsprachigen Ländern Versuche einer offiziellen Verschriftlichung der Kolloquial- bzw. Volkssprachen verhindert worden.
Des Weiteren habe die Vorstellung, dass es sich beim Koran um ,göttliche Rede‘ handele, nach Diner die Einführung des Buchdrucks erschwert. Denn diese Vorstellung impliziere neben der Sakralität der koranischen Sprache und Schrift als solche auch die Exklusivität des Korans als Buch insgesamt, was nach orthodoxer Auffassung den Druck des Korans ausschließe (12). Dies habe darüber hinaus zu einer grundsätzlichen Abneigung gegenüber der Verschriftlichung sowie zur Ablehnung der Herstellung von Büchern und stattdessen zur Entwicklung einer ausgeprägten Kultur des Mündlichen geführt. Als dann doch ungefähr 300 Jahre nach der Erfindung des Buchdrucks in Europa erstmals 1727 im Osmanischen Reich eine Buchdruckerei erlaubt worden sei, seien sakrale Texte ausdrücklich vom Druck ausgenommen worden. Folglich seien Auswirkungen auf die islamische Religion und auf die durch diese geprägte Gesellschaft ausgeblieben, zumal diese in Istanbul gegründete Druckerei bereits 1747 mangels Nachfrage wieder geschlossen worden sei. Ganz anders sei nach Diner die Entwicklung des Buchdrucks im christlichen Abendland verlaufen. So hätten sich insbesondere die Träger der Reformation ausgiebig dieses neuen Mediums bedient. Nach Diner wäre die Reformation ohne dieses Medium nicht erfolgreich gewesen, weil sie auf die ungestörte und massenhafte Verbreitung ihrer reformatorischen Lehren angewiesen gewesen sei. Umgekehrt habe die Reformation auch dem Buchdruck einen mächtigen Impuls gegeben, der noch kraftvoller gewesen sei als der, den zuvor die Renaissance und der Humanismus ausgelöst hätten (13). Dadurch seien eine Art öffentliche Meinung her[23]gestellt und Wissen zu einem öffentlichen Gut gemacht worden, was allererst die europäische Aufklärung ermöglicht habe und für den Aufstieg des Abendlandes von zentraler Bedeutung gewesen sei.
Im Orient bzw. im Osmanischen Reich sei nach Diner eine vergleichbare Entwicklung wegen der bis tief ins 18. Jahrhundert ungebrochenen Ablehnung des Buchdrucks ausgeschlossen gewesen. Diese Ablehnung habe letztlich ihre Ursachen in den erwähnten religiösen bzw. mentalen Vorbehalten gegenüber der Verschriftlichung und in der positiven Haltung gegenüber der mündlichen Überlieferung. Zu diesen Vorbehalten habe auch die Erfahrung beigetragen, dass in der frühen arabischen Schrift kurze Vokale, Vokallosigkeit und Verdoppelung der Konsonanten nicht gekennzeichnet waren und so die Gefahr von Missverständnissen relativ groß gewesen sei. Bei einer durchgängig mündlichen Tradierung eines solchen Textes sei eine derartige Gefahr kaum gegeben, denn durch die richtig überlieferte und immer wieder richtig weitergegebene Intonierung werde das richtige Verständnis des Korans sichergestellt. Aus diesem Grunde sei der Koran denn auch zu rezitieren, wozu der einzelne Muslim von Lehrern angeleitet werde. Auf diese Weise werde er in die ,Tradition der richtigen Intonierung‘ und damit auch des richtigen Koranverständnisses gestellt. Außerdem stelle die mündliche Tradierung eine größere Nähe zum Ursprung des Überlieferten her und ermögliche eine Art spiritueller Verbindung mit dem Urheber der Überlieferung. In diesem Zusammenhang verweist Diner auch auf die unterschiedlichen mentalen Wirkungen der schriftlichen Rezeption im Vergleich zur mündlichen Rezeption (14). Bei der mündlichen Tradierung bzw. Rezeption fühlten sich der Tradent und der Rezipient eingebunden in eine Überlieferungskette und empfänden sich ,lediglich‘ als ein Glied in dieser Kette. Bei der Rezeption schriftlich fixierter Texte erlebe sich der Leser nach Diner hingegen als Einzelner, der sich den Text aneigne und bei diesem Verstehensversuch auf sich selbst verwiesen sei. Insofern begünstige die Verschriftlichung die Entstehung und Entwicklung des Individualismus, während in Gesellschaften mit überwiegend mündlicher Tradition durch diese Form der Tradierung das Zusammengehörigkeitsgefühl der Menschen gestärkt werde. Diese unterschiedliche Überlieferungskultur bringe eine entsprechend unterschiedliche Akzentuierung von Individualität und Sozialität mit sich, was einen wichtigen Unterschied zwischen dem neuzeitlichen Abendland und den Gebieten des Osmanischen Reiches dargestellt habe und auch für den Aufstieg respektive Niedergang in der jeweiligen Region verantwortlich gewesen sei.
Der sich im Abendland seit der Renaissance und der Reformation ausbildende Individualismus habe nach Diner insbesondere auch im ökonomischen Bereich seine dynamische Kraft entfaltet, was in den islamischen Kerngebieten bzw. im Osmanischen Reich auch deshalb nicht möglich gewesen sei, weil es keine Trennung zwischen Religion und politischer Macht gegeben habe (15). Infolge dieser fehlenden Trennung habe beispielsweise der islamische Staat mit Hilfe von Institutionen und Regularien religiöser Provenienz in das ökonomische Leben eingegriffen und die individuelle Entfaltung der verschiedenen Wirtschaftssubjekte tendenziell eingeschränkt. So habe es bereits seit frühislamischer Zeit eine Marktaufsicht (,hisba‘) [24] gegeben, die Maße, Gewichte, die Qualität der Waren und deren Preise kontrollierte. Sie habe auch darüber gewacht, dass religiöse Vorschriften, zum Beispiel die Art der Kleidung, die Einhaltung der Gebetszeiten und die Wahrung der Trennung der Geschlechter, während des Marktgeschehens beachtet worden seien. In der Überwachung der Einhaltung der religiösen Vorschriften durch den von der staatlichen Macht eingesetzten Marktaufseher (,muhtasib‘) sieht Diner einmal mehr seine zentrale These von der im Islam anzutreffenden ,sakralen Imprägnierung des gesamten Lebens‘ bestätigt. In dieser Kontrollfunktion des Marktaufsehers spiegelten sich zwei dogmenartige Lehraussagen des Islam wider, die Einheit von religiöser und profaner Sphäre sowie die religiöse Bestimmtheit des gesamten Lebens durch die Scharia.
Die ,sakrale Imprägnierung‘ habe sich nach Diner im frühneuzeitlichen Osmanischen Reich zum Beispiel auch in der zentralen Vorgabe manifestiert, dass eine allgemeine Bedarfsdeckung das oberste Ziel wirtschaftlichen Handelns zu sein habe. Um dieses Ziel zu erreichen, habe man im Osmanischen Reich auch zur Preisregulierung gegriffen, was aber zu Umgehungstatbeständen und zu weiteren obrigkeitsstaatlichen Reglementierungen geführt habe. Dies sei natürlich einer positiven ökonomischen Entwicklung abträglich gewesen, sei aber letztlich aufgrund religiöser Vorgaben geschehen und eben auch damit legitimiert worden, auch wenn dies andererseits im Widerspruch zur im Islam grundsätzlich anerkannten Vertragsfreiheit des Einzelnen gestanden habe. Um der Preisregulierung im Interesse der allgemeinen Bedarfsdeckung willen sei eine Aussetzung der Vertragsfreiheit jedoch in Ausnahmefällen vorgenommen worden. Dass es sich im Osmanischen Reich bei der Preisregulierung im Sinne einer Festsetzung von Maximalpreisen jedoch nicht nur um eine vorübergehende Erscheinung gehandelt habe, zeige die Einrichtung einer Art Preisregulierungsbehörde (,narh‘), die bis ins 19. Jahrhundert als eine wichtige Institution zur Regulierung des Wirtschaftslebens fungiert habe. Diese staatliche Kontrolle sei nach Diner auch der Grund dafür gewesen, dass im Osmanischen Reich die Entstehung und Entwicklung des Verlagssystems, das in Europa eine Art Vorstufe in der Entwicklung hin zum Merkantilismus dargestellt habe, unterbunden worden sei. Denn man habe befürchtet, über dieses System, in das ja auch der ländliche Raum einbezogen gewesen wäre, keine ausreichende Kontrolle ausüben zu können, wie dies im städtischen Bereich einigermaßen effizient möglich gewesen sei. Nach Diner waren also diese staatlichen Kontrollfunktionen der angemessenen Bedarfsdeckung als religiös fundiertem Ziel wirtschaftlichen Handelns geschuldet. Desgleichen sieht Diner diese angestrebte Bedarfsdeckung auch als Grund dafür an, dass im Osmanischen Reich auf Handelsprotektionismus gegenüber den Europäern verzichtet worden sei, für die dagegen ein solcher Protektionismus in der Zeit des Merkantilismus selbstverständlicher Bestandteil ihrer Wirtschaftspolitik gewesen sei. Auch dies habe sich langfristig als Nachteil für die ökonomische Entwicklung im Osmanischen Reich erwiesen.
[25]3. Begründung für Methode und Anlage der vorliegenden Untersuchung
Wie an den referierten Erklärungsversuchen Dan Diners deutlich geworden ist, sieht er in der ,sakralen Imprägnierung‘ der islamischen Gesellschaften einen Grund für die neuzeitliche Rückständigkeit des islamischen Orients gegenüber dem christlichen Abendland. Diner geht von der ,sakralen Imprägnierung‘ als Faktum aus und zeigt deren negative Folgen in dem ehemaligen Kerngebiet des Islam bzw. im nachfolgenden Osmanischen Reich auf. Er geht jedoch nicht näher auf den Ursprung dieser ,Imprägnierung‘ ein, die sich aus verschiedenen dogmatisierten Glaubensüberzeugungen ergeben habe, zum Beispiel aus dem Verständnis des Korans als ,göttliche Rede‘ sowie aus der Vorstellung von der Einheit von religiöser und profaner Sphäre. Um aber den Sinn dieser Glaubensvorstellungen verstehen und deren reklamierten Geltungsanspruch ermessen zu können, bedarf es der Kenntnis des historischen Kontextes ihrer Entstehung und ihrer definitiven Festlegung als Glaubensdogma. Die vorliegende Untersuchung stellt sich dieser Aufgabe und versucht, diesen Kontext zu ermitteln. Auf diese Weise kann eventuell auch geklärt werden, ob die von Diner postulierte ,sakrale Imprägnierung‘ in den von ihm thematisierten Ausformungen tatsächlich auch ursprünglich in der von ihm angenommenen Weise religiös motiviert war oder ob sie möglicherweise der kulturellen Tradition oder machtpolitischen Interessen bestimmter Gruppen geschuldet war. Darüber hinaus werden neben den von Diner vorausgesetzten Glaubensvorstellungen auch andere wie beispielsweise die von der göttlichen Prädestination menschlichen Handelns einbezogen. Auf diese Weise soll eine möglichst breite Faktenbasis geschaffen werden, um daraus eine zuverlässige Aussage zur Frage nach den Ursachen für die relative Rückständigkeit der ehemaligen Kernländer des Islam ableiten zu können. Des Weiteren werden auch noch das Rechts- und das Bildungssystem einbezogen, da diese Bereiche in beiden untersuchten Regionen entscheidend durch die jeweilige Religion geprägt wurden und für die gesamtgesellschaftliche Entwicklung grundsätzlich von zentraler Bedeutung sind. Außer durch diese thematische Erweiterung unterscheidet sich die vorliegende Untersuchung von der Diners – wie erwähnt – vor allem dadurch, dass es nicht um die Folgen der ,sakralen Imprägnierung‘ geht, sondern um deren Ursachen.
Auch die zuvor erwähnten Erklärungsansätze für die seit Beginn der Neuzeit sich ausbildende Rückständigkeit des islamischen Orients im Vergleich zum christlichen Abendland machen Erweiterungen notwendig, wie die kurzen Kommentierungen zu diesen Ansätzen deutlich gemacht haben. Zum einen wäre um der Überzeugungskraft und Validität einzelner Erklärungen willen ein direkter Vergleich mit der entsprechenden Problematik im christlichen Abendland notwendig, das von der lateinisch-katholischen Form des christlichen Glaubens geprägt wurde. Deshalb werden die Entwicklungen in den Kerngebieten des sunnitischen Islam mit den entsprechenden Vorgängen im abendländischen Christentum verglichen. Zum anderen mangelt es vielen Erklärungsversuchen insofern an einer profunden Analyse, [26] als nicht bedacht wird, dass für das Verhalten der Menschen respektive einer Gesellschaft eine bestimmte Mentalität oder auch religiöse Vorstellung verantwortlich sein könnte. Denn derartige Verhaltensänderungen resultieren nicht immer aus praktischen, politischen oder ökonomischen Erwägungen, sondern sind – zumal in traditionalen Gesellschaften – oft auch von der vorgängigen Mentalität und damit auch von religiösen Vorstellungen geprägt. Die erwähnten Einwände gegenüber den vorgestellten Erklärungsansätzen legen also nicht nur einen Vergleich mit dem abendländischen Christentum nahe, sondern auch den gewählten mentalitäts- bzw. theologiegeschichtlichen Ansatz.
[27]A. Entwicklung des mittelalterlichen Islam bis zum Ende des Bagdader Kalifats 1258
I. Die Entwicklung des Kalifenamtes
1. Mögliche Vorbilder für die Doppelfunktion Mohammeds im medinensischen Gemeinwesen und deren realgeschichtliche Genese
Wie im Vorwort erwähnt wurde, beginnt die vorliegende Untersuchung mit der Darstellung der Entwicklung des Kalifenamtes, in dem sich in besonderer Weise die zentrale islamische Vorstellung von der Einheit des Religiösen und des Weltlich- Profanen manifestiert. Denn ebenso wie Mohammed nahmen die Kalifen als dessen Nachfolger die Doppelfunktion der religiös-geistlichen und der weltlich-politischen Führerschaft wahr. Um dieses Verständnis des Kalifenamtes einordnen zu können, sei zunächst kurz auf die entsprechenden vorislamischen Verhältnisse im Vorderen Orient eingegangen, die Mohammeds Vorstellungen beeinflusst haben könnten. Nach derzeitigem Kenntnisstand kam es im nicht-städtischen Raum des vorislamischen Innerarabiens einschließlich des Hedschaz, dem Ursprungsgebiet des Islam, zu keinerlei Staatenbildung (1). Anders stellte sich die Situation im Süden der arabischen Halbinsel dar, wo es beispielsweise zu Beginn des 6. Jahrhunderts die selbständigen Königreiche Saba und Himyar gab, die aber 525 zunächst abessinische Satrapie und dann 575 bzw. 597 sassanidische Provinz wurden. Auch im Norden und im Nordosten gab es im 6. Jahrhundert zwei halbstaatliche Gebilde, die zwischen dem byzantinischen und dem sassanidischen Reich auf der einen und den innerarabischen Beduinenstämmen auf der anderen Seite eine Art Puffer bildeten. Diese ,Pufferstaaten‘ der Ghassaniden und der Lachmiden standen unter byzantinischer bzw. sassanidischer Oberhoheit, wiesen lediglich halbstaatliche Strukturen auf und mussten 582 bzw. 602 der direkten Herrschaft der Byzantiner und Sassaniden weichen. Eine ähnliche Funktion wie diese beiden halbstaatlichen Gebilde besaß eine Konföderation innerarabischer Stämme unter Führung des südarabischen Stammes der Kinda im Übergangsgebiet zwischen Innerarabien und den jemenitischen Königreichen im Süden der Arabischen Halbinsel. Diese Konföderation bestand nur relativ kurze Zeit und zerbrach ungefähr 10 Jahre nach dem Ende der jemenitischen Königreiche.
Einen anderen Charakter als der Hedschaz und Innerarabien wies die politische Organisation Mekkas auf, in die der spätere Prophet Mohammed hineingeboren wurde. ,Regiert‘ wurde Mekka von den angesehensten Clanführern des Stammes der [28] Quraischiten, bei denen meist der Handel eine wichtige Einkommensquelle darstellte, sodass Historiker diese Clanführer als eine Art ,Kaufmannsadel‘ bezeichnet haben. Durch diesen Handel gelangten sie vor allem auch deshalb zu besonderem Reichtum, weil bereits das vorislamische Heiligtum der Kaaba und die damit verbundenen Friedenszeiten, die zu bestimmten Zeiten für die Pilger eingerichtet worden waren, ihnen floriende Geschäfte bescherten. Nichtsdestoweniger schuf dieser Kaufmannsadel keinen Stadtstaat im eigentlichen Sinne, weil wichtige staatliche Funktionen von den einzelnen Stämmen bzw. Clans wahrgenommen wurden. So lag beispielsweise die Strafverfolgung, die auf dem Prinzip der Vergeltung (,lex talionis‘) bzw. gleichwertigen Entschädigung bis hin zur Blutrache beruhte, in den Händen des Clans der jeweils betroffenen Personen. Auch Aufgaben, die für die gesamte Gemeinschaft von besonderer Bedeutung waren wie zum Beispiel die Wasserversorgung, oblagen bestimmten Clans. Gleiches galt für die Sorge um das Heiligtum der Kaaba (2). Sowohl die gesellschaftlichen Organisationsformen in Mekka – mutatis mutandis darf man diese auch für Medina annehmen – als auch die fehlende Staatlichkeit im Inneren der Arabischen Halbinsel erlauben die Annahme, dass es für die von Mohammed wahrgenommene Doppelfunktion von religiös- geistlicher und weltlich-politischer Führerschaft in seinem unmittelbaren Erfahrungsbereich kein entsprechendes reales Vorbild und keine entsprechende Tradition gab.
Allerdings lebten in der Erinnerung der mekkanischen Bevölkerung Vorstellungen von einer stadtstaatähnlichen Vergangenheit Mekkas. Diese Vergangenheit verknüpften die Mekkaner in ihrer Vorstellung mit Qusayy, dem angeblichen Ahnherrn der Quraisch. Nach diesen Vorstellungen solle Qusayy als Inhaber des wichtigen Priesteramtes an der Kaaba (3) verschiedene Gruppen zum Stamm der Quraisch vereinigt haben. Aufgrund dieser historischen Leistung seien ihm neben den religiösen auch politische Funktionen und Kompetenzen zugewachsen. So sei auch die Obhut über die Kaaba an den vereinigten Stamm der Quraisch gelangt. Er selbst habe auch den militärischen Oberbefehl und die Kontrolle über das von ihm geschaffene Versammlungshaus besessen, wo die politischen Angelegenheiten Mekkas wahrscheinlich von eine Art Ältestenrat (arab. ,mala‘) beraten und entschieden wurden. In diesem Versammlungshaus fanden auch wichtige soziale Rituale sowie Gastmähler statt; Heiratsverträge wurden hier abgeschlossen sowie wichtige ökonomische Verträge der mekkanischen Kaufleute aufbewahrt. Die Qusayy zugewachsenen Kompetenzen veranlassten den Islamwissenschaftler W. Dostal dazu, Qusayy als ,sakralen Stammeshäuptling‘ zu bezeichnen, weil dieser über politische und religiöse Kompetenzen, also über eine Doppelfunktion, verfügt habe. Mekka büßte seinen stadtstaatähnlichen Charakter allerdings wieder ein, weil Qusayys Erbschaftsregelung nach Dostal zu einer Aufteilung der verschiedenen Funktionen auf seine Söhne und damit zu einer Dekonstruktion seines Amtes und der Organisationsstruktur des damaligen mekkanischen Gemeinwesens geführt habe.
Neben diesen Erinnerungen an eine stadtstaatähnliche Vergangenheit Mekkas und an die Doppelfunktion Qusayys gab es entsprechende reale Vorbilder und Tradi[29]tionen auch im weiteren Umfeld Mekkas. So verstand sich der oströmische Kaiser als von Gott eingesetzter Herrscher, der sich über die Funktion als weltliche Obrigkeit hinaus von Gott beauftragt sah, für den Erhalt des wahren christlichen Glaubens zu sorgen. Um dies zu erreichen, sah er sich ermächtigt, Abweichungen vom Glauben bzw. Häresien im Vorfeld solcher Entwicklungen durch Einberufung und zielführende Leitung von Konzilien zu verhindern. Diesen Konzilsentscheidungen hatte er denn auch zur Not unter Einsatz staatlicher Gewaltmittel Geltung zu verschaffen. Ein ähnliches Selbstverständnis hatten die sassanidischen Könige, die Regenten der anderen damaligen Großmacht im vorderasiatischen Raum, zur Zeit der Stiftung der islamischen Religion durch Mohammed. Auch hier oblag es dem Regenten, der sich von dem zoroastrischen Hochgott Ahuramazda (pers. ,Ormuzd‘) eingesetzt und mit göttlichen Eigenschaften ausgestattet sah, zusammen mit der zoroastrischen Priesterschaft die Rechtgläubigkeit eventuell auch mit staatlichen Zwangsmitteln durchzusetzen. Sowohl der oströmische Kaiser als auch der sassanidische König verfügten jedoch nicht über die Lehrautorität, die in beiden Fällen der jeweiligen Priesterschaft in ihrer Gesamtheit zustand. Dies unterschied folglich die Position dieser beiden Regenten von der Mohammeds, der über die Funktion der weltlichen Obrigkeit hinaus die religiös-geistliche Führerschaft einschließlich der Lehrautorität in religiösen Fragen beanspruchte und auch ausübte. Insofern gab es für diese Mohammed zugestandene Doppelfunktion weder in seinem näheren noch in seinem weiteren zeitgenössischen Umfeld ein entsprechendes reales Vorbild oder eine entsprechende Tradition. Somit konnte lediglich die Erinnerung an Qusayys Position in gewisser Hinsicht als Folie für Mohammeds Führerschaft dienen. Unsicher ist jedoch, ob Qusayy außer der Obhut über den Kaabakult noch weitere darüber hinausgehende religiös-geistliche Kompetenzen besaß. Im Übrigen sei darauf hingewiesen, dass es sich bei den altarabischen Religionen nicht um Schriftreligionen handelte, sondern um auf langer mündlicher Tradition basierende religiöse Vorstellungen. Folglich stellte sich damals auch nicht die für Schriftreligionen zentrale Frage der Interpretation der heiligen Texte, sondern es galt in vorislamischer Zeit ,lediglich‘, die Authentizität der mündlich tradierten Religion in der jeweiligen religiösen Praxis zu bewahren. Diese Funktion hatte jedoch einen völlig anderen Charakter als die Interpretation heiliger Schriften und die Umsetzung dieser Interpretation in die religiöse Praxis einer Glaubensgemeinschaft. Andererseits waren Mohammed die jüdische und die christliche Schriftreligion, insbesondere auch die alttestamentliche Figur des Moses und dessen Doppelfunktion, bestens bekannt. Moses könnte also am ehesten Mohammed als Vorbild gedient haben.
Die angesprochene Doppelfunktion Mohammeds hatte faktisch ihren Ursprung in den religiösen Vorstellungen des Propheten Mohammed und in dessen praktischpolitischem Verhalten in Medina nach der Hidschra aus Mekka im Jahre 622 (4). Gerade zu dieser Zeit war es wieder einmal zu Auseinandersetzungen zwischen den in Medina ansässigen arabischen Stämmen Aus und Hazradsch gekommen, weshalb Anhänger dieser Stämme nach islamischer Überlieferung Mohammed als Gesandten Gottes und möglichen Vermittler begrüßten. Diesen Erwartungen entsprechend [30] sorgte Mohammed für einen Ausgleich zwischen den verfeindeten Gruppen. Er schuf in Medina ein Staatswesen auf der Grundlage einer von ihm entworfenen ,Konstitution‘, die allseits akzeptiert wurde und alle fürderhin zur Beachtung ihrer Regelungen verpflichtete. Auf diese Weise wurde Mohammed zum Staatsmann und regierte 10 Jahre lang das muslimische Staatswesen von Medina, dem sich im Verlauf dieser 10 Jahre auch große Teile der Bevölkerung der übrigen Arabischen Halbinsel mit ihrem Übertritt zum Islam unterstellten. Die Legitimation für diese Funktion als Staatsoberhaupt leitete Mohammed aus seiner prophetischen Funktion ab, die ihm offenbarten religiösen Vorstellungen zu verbreiten und ein islamisches Gemeinwesen zu begründen. Aufgrund seiner Erfahrungen in Mekka hielt er eine wirkungsvolle Verbreitung seiner Botschaft nur für möglich, wenn die Leitung des zu begründenden Gemeinwesens in seinen Händen lag oder von ihm und seinen Anhängern entscheidend beeinflusst werden konnte. In diese medinensische Zeit fällt nach allgemeiner Auffassung in der Koranforschung folglich der überwiegende Teil der im Koran überlieferten Offenbarungen, die politischer und rechtlicher Natur sind und die die religiöse Begründung für Mohammeds politische Funktion lieferten. Religiös-geistliche und weltlich-politische Funktion verschmolzen zu einem unteilbaren Ganzen, was von nun an für Mohammeds Position bestimmend war. Er konnte foglich nicht nur als religiös-geistliche, sondern auch als weltlich-politische Autorität Gehorsam einfordern. Dieser Gehorsam gebühre nach Sure 4,62 auch Personen, ,die zu befehlen haben‘, also über eine göttliche Ermächtigung oder eine des Propheten verfügen. Dies lässt auf ein Herrschaftsverständnis schließen, das als Theokratie bezeichnet werden kann.
2. Zeit der ersten vier ,rechtgeleiteten Kalifen‘
Nach dem Tode Mohammeds stand das von ihm konstituierte Verhältnis von Religion und politischer Herrschaft zwangsläufig vor entscheidenden Veränderungen (5). Denn Mohammeds prophetische Funktion und die daraus resultierende religiöse und auch politische Autorität fehlten jedem denkbaren Nachfolger. Da Mohammed selbst keine Regelungen für die Zeit nach seinem Ableben getroffen hatte, mussten sich seine getreuesten Anhänger sofort dieser Aufgabe stellen. So versammelte sich die Gruppe der sogenannten medinensischen Helfer (,ansar‘) an dem Ort Banu Saide, um einen aus ihrer Mitte zum Oberhaupt des Gemeinwesens von Medina zu wählen. Davon erfahrend intervenierte die Gruppe um Abu Bakr, einen der frühesten Anhänger Mohammeds und dessen Schwiegervater. Abu Bakr reklamierte auf einer Versammlung dieser Gruppe das Amt der Nachfolge Mohammeds für einen der Ihren, da nur sie zum Stamm der Quraisch gehörten und Mohammeds Erbe nur einem solchen Stammesmitglied zustehe. Abu Bakr argumentierte also im Sinne der vorislamischen arabischen Tradition und stellte Stammesinteressen in den Vordergrund. Er selbst wurde danach mehrheitlich zum Nachfolger Mohammeds gewählt und erhielt den Titel ,Nachfolger des Gesandten [31] Gottes‘ bzw. ,Kalif‘. Ihm sollte ebenso wie Mohammed die Funktion eines religiösgeistlichen und weltlich-politischen Führers des islamischen Gemeinwesens obliegen.