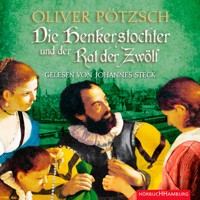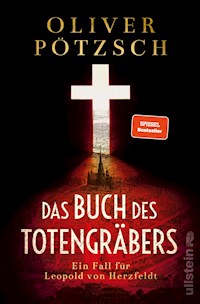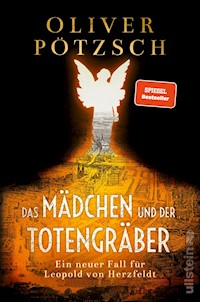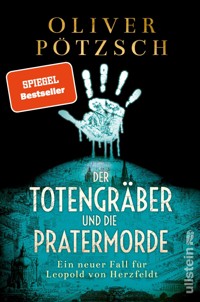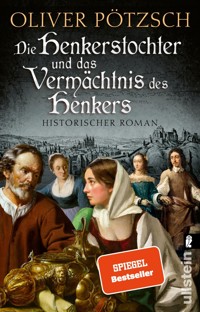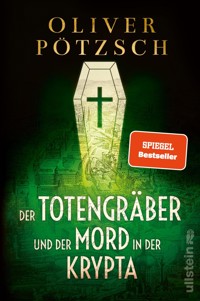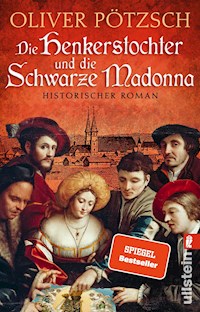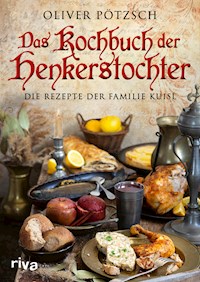12,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 12,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Ullstein eBooks
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Der Weg zum Licht führt durch die Dunkelheit Der goldene Herbst 1518 neigt sich dem Ende. Sechs Jahre sind vergangen, seitdem der berühmte Magier Johann Georg Faustus aus Nürnberg geflohen ist. Sein Ruhm ist gewachsen, selbst an den Höfen von Herzögen, Grafen und Bischöfen sucht man seinen Rat. So als würde der Herrgott – oder sein böser Gegenspieler? – eine schützende Hand über ihn halten. Gemeinsam mit seinem neuen Gefährten Karl Wagner und der jungen Gauklerin Greta, seiner Ziehtochter, reist er als Quacksalber und Astrologe durch die Lande. Doch Johann spürt, dass dies nur die Ruhe vor dem Sturm ist. Sein Erzfeind Tonio ist noch nicht besiegt. Tief im Inneren weiß Johann, dass das Böse zurückkehren und erneut seine Hand nach ihm ausstrecken wird … »Bereits im ersten Band ist Oliver Pötzsch die Mischung aus Fiktion und historischen Fakten famos gelungen.« Süddeutsche Zeitung
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 1126
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
„Buchcover: ‚Der Lehrmeister‘ von Oliver Pötzsch. Mittelalterliche Illustration mit Menschen, Burg, Hund und Kuh.“
Der Autor
Oliver Pötzsch, Jahrgang 1970, arbeitete nach dem Studium zunächst als Journalist und Filmautor beim Bayerischen Rundfunk. Heute lebt er als Autor mit seiner Familie in München. Seine historischen Romane haben ihn weit über die Grenzen Deutschlands bekannt gemacht: Die Bände der Henkerstochter-Serie sind internationale Bestseller und wurden in mehr als 20 Sprachen übersetzt.
Homepage des Autors: www.oliver-poetzsch.de
Das Buch
1494 hat Johann Georg als Sechzehnjähriger seine Heimatstadt Knittlingen verlassen. Mit vierzig Jahren kehrt er noch einmal dorthin zurück. Wie er sich damals bei seiner Flucht geschworen hat, ist er ein berühmter Mann geworden; er nennt sich »Doktor Faustus« und zieht als Heiler und Astrologe von Stadt zu Stadt. Doch ein Glücklicher, wie es der Name »Faustus« besagt, ist Johann nicht. Menschen, die ihm nahestanden, hat er durch eigene Schuld verloren, er hat verraten, gelogen und betrogen. Was niemand ahnt: Um sein enormes Wissen, seine ungewöhnlichen Fähigkeiten zu erwerben, hat Johann einst dem geheimnisvollen Magier Tonio del Moravia die Hand gereicht. Längst weiß er, dass Tonio weit mehr ist als bloß ein geschickter Zauberkünstler, dass er zahllose Masken trägt und eine Spur aus Gift, Tränen und Blut hinter sich herzieht. Immer wieder ist Johann vor seinem grausamen Lehrmeister geflohen, doch nun, am Grab seiner Mutter, wird ihm klar, dass er Tonio keineswegs entkommen ist. Die dunkle Macht, die ihn in den Abgrund ziehen will, hat ihn erneut in eine Falle gelockt. Wenn er sich und alles, was ihm lieb ist, retten will, muss er sich dem Bösen stellen.
Nach dem erfolgreichen Roman »Der Spielmann«, der von HISTOcouch.de als »Buch des Jahres« ausgezeichnet wurde, führt Bestseller-Autor Oliver Pötzsch das Abenteuer seines Doktor Faustus einem dramatischen Höhepunkt entgegen.
Oliver Pötzsch
Der Lehrmeister
Roman
Ullstein
Besuchen Sie uns im Internet:www.ullstein-buchverlage.de
List ist ein Verlag der Ullstein Buchverlage GmbH
© 2019 by Ullstein Buchverlage GmbH, BerlinDieses Werk wurde vermittelt von derAutoren- und Projektagentur Gerd F. Rumler.E-Book-Konvertierung powered by pepyrus.comAlle Rechte vorbehalten.
ISBN 978-3-8437-1879-0
Emojis werden bereitgestellt von openmoji.org unter der Lizenz CC BY-SA 4.0.
Auf einigen Lesegeräten erzeugt das Öffnen dieses E-Books in der aktuellen Formatversion EPUB3 einen Warnhinweis, der auf ein nicht unterstütztes Dateiformat hinweist und vor Darstellungs- und Systemfehlern warnt. Das Öffnen dieses E-Books stellt demgegenüber auf sämtlichen Lesegeräten keine Gefahr dar und ist unbedenklich. Bitte ignorieren Sie etwaige Warnhinweise und wenden sich bei Fragen vertrauensvoll an unseren Verlag! Wir wünschen viel Lesevergnügen.
Hinweis zu UrheberrechtenSämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten. Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken, deshalb ist die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.In diesem E-Book befinden sich Verlinkungen zu Webseiten Dritter. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass sich die Ullstein Buchverlage GmbH die Inhalte Dritter nicht zu eigen macht, für die Inhalte nicht verantwortlich ist und keine Haftung übernimmt.
Inhalt
Titelei
Der Autor / Das Buch
Titelseite
Impressum
Prolog
Erster Akt: Der Atem des Biests
1
2
3
4
5
Zweiter Akt: Der Fluss der Könige
6
7
8
9
10
Dritter Akt: Die Höhle des Ogers
11
12
13
14
15
16
17
18
Vierter Akt: Die Hure Rom
19
20
21
22
23
24
25
26
27
Fünfter Akt: Dantes Inferno
28
29
Epilog
Anhang
Nachwort
Reiseführer auf Fausts Spuren
Faust für Besserwisser
Leseprobe: Die Henkerstochter und der Fluch der Pest
Social Media
Vorablesen.de
Cover
Titelseite
Inhalt
Prolog
Widmung
Für meine Kinder Niklas und Lily.Lieben heißt auch Loslassen.
Motto
»Please allow me to introduce myselfI’m a man of wealth and tasteI’ve been around for a long, long yearStole many a man’s soul to waste.«
Rolling Stones: Sympathy For The Devil
Prolog
15. September, Anno Domini 1518, Rom, in den Kerkern der Engelsburg
Der Heilige Vater folgte den Schreien, die ihm den Weg durch die Katakomben wiesen. Sie waren schrill und hoch und zeigten Papst Leo X., dass die Zeit gekommen war.
Mit eingezogenem Kopf eilte er durch die niedrigen Gänge, wobei seine rote Samthaube gelegentlich die schmutzige Decke streifte. Leo keuchte, er zitterte vor Vorfreude, wie immer, wenn er hier unten war, um die letzte Vernehmung persönlich vorzunehmen. Die Engelsburg am Tiberufer war ein Labyrinth aus Kammern, Sälen und Gängen, vor über tausend Jahren erbaut als Mausoleum römischer Kaiser, mit Fluchttunneln, Geheimtüren und Grabkammern. Auch jetzt noch war sie das Grab vieler bekannter und unbekannter Gefangener. Doch mittlerweile diente der Palast den Päpsten als Festung und Fluchtburg, er galt als uneinnehmbar. In den oberen Stockwerken befanden sich die päpstlichen Gemächer, herrschaftliche Zimmer, bis zur Decke vollgehängt mit Ölgemälden der berühmtesten Maler, so als wären es Tapeten. Aus bronzenen Hähnen quoll kaltes oder warmes Wasser, Diener reichten kandiertes Obst sowie Eis, geschlagen in den fernen Bergen nördlich des Apennin und gesüßt mit dem sündhaft teuren Zucker, der aus den erst jüngst entdeckten Ländern jenseits des Meeres kam, jedes Gramm davon so wertvoll wie Gold. In den oberen Sälen roch es nach Veilchen und Parfum, um den Gestank der römischen Gassen zu vertreiben, und die Mauern atmeten den Geist Gottes.
Hier unten jedoch, tief in den Katakomben, herrschten Tod und Verderben.
Papst Leo X. lauschte, als ein erneuter Schrei ertönte, diesmal noch spitzer und höher, fast wie von einem Kind. Er war eindeutig auf dem richtigen Weg. Mit vor Aufregung klopfendem Herzen beschleunigte er seine Schritte und wandte sich nach rechts, wo eine Treppe noch tiefer hinabführte. Leo war fett, er wog weit über zweihundert Pfund, seit den Tagen seiner Thronbesteigung hatte er ständig zugenommen. Ihn plagten Kurzatmigkeit und ständig wiederkehrende schmerzhafte Fisteln am Hintern. Er mochte gar nicht daran denken, wie anstrengend es erst werden würde, all die Treppen wieder hinaufzugehen. Doch die wachsende Vorfreude trieb ihn voran.
Vielleicht würde er jetzt endlich die Wahrheit erfahren!
Blakende Fackeln beleuchteten einen engen, von Ruß verdreckten Gang, gelegentlich begegnete dem Papst ein Wachmann der Schweizer Garde, der sich tief vor ihm verneigte. Leo würdigte ihn keines Blickes. Es war ohnehin nicht von Vorteil, wenn man ihn hier unten sah. Doch manchmal ließ es sich eben nicht vermeiden.
Etwa dann, wenn ein Geheimnis nicht bis an die Oberfläche dringen durfte.
Eine weitere Treppe führte noch tiefer hinab in die Finsternis. An ihrem Ende tauchten im Zwielicht des Ganges zwei Wachsoldaten auf. Sie standen links und rechts von einer mit mehreren Eisenbändern verstärkten Tür, in die auf Kopfhöhe ein kleines Gitterfenster eingelassen war. Von dort kamen die Schreie, die nun wieder anschwollen, so als wollte derjenige, der sie ausstieß, den Heiligen Vater auf eine besonders intime Weise begrüßen.
Leo verzog das Gesicht, das Geheul war wirklich kaum auszuhalten. Glücklicherweise endete es ebenso abrupt, wie es begonnen hatte.
Der vor Anstrengung keuchende Papst gab den beiden Wachen ein Zeichen, woraufhin diese die schwere Tür öffneten. Dahinter war ein Raum zu erkennen, der nur mäßig von Fackellicht erhellt wurde, ein süßlicher, rauchiger Geruch ging davon aus, der sich nun auch im Gang davor ausbreitete. Brennende Glutpfannen standen in den Ecken der nahezu quadratischen, aus groben Steinen erbauten Kammer, daran lehnten Zangen und andere Utensilien, deren Zweck Leo nur erraten konnte, auch wenn er sie hier und dort bereits gesehen hatte, zum Beispiel in Florenz, wo er herstammte. Leo nickte anerkennend. Er hatte das feiste Gesicht und auch den Starrsinn eines Bauern, sein Verstand jedoch war der eines Gelehrten. Zugleich war er skrupellos und gerissen wie alle in seiner Familie.
Wir haben die Wahrheit gut versteckt, dachte er. Am tiefsten Punkt Roms.
Giovanni, so sein weltlicher Name, entstammte dem Geschlecht der Medici, jener reichen Dynastie, die seit über hundert Jahren die Geschicke von Florenz, ja, von ganz Norditalien bestimmte. Sein Vater war Lorenzo de Medici, genannt »Il Magnifico«, der Prächtige. Als zweitem Sohn der Familie war für Giovanni eine kirchliche Karriere vorgezeichnet, bereits mit sieben Jahren war er zum Domherrn von Florenz ernannt worden, mit vierzehn Jahren folgte der Posten eines Kardinals. Nach dem Tod seines älteren Bruders Piero stieg er zum Herrscher der Toskana auf. Im Grunde hatte es noch erstaunlich lange gedauert, bis Giovannis Ehrgeiz, seine Machtgier, vor allem aber der Einfluss seiner Familie ihn Papst werden ließen. Fünf Jahre war das nun her, seitdem hatte Giovanni endlich die Stellung inne, die sich seine Familie, die er selbst sich seit seiner Kindheit ersehnt hatte.
Er war der mächtigste und reichste Mann der christlichen Welt.
Giovanni hatte vor, jeden einzelnen Tag seiner hoffentlich noch langen Amtszeit zu genießen. Er wollte in die Geschichte eingehen als der Papst, der Rom zu neuer Blüte verholfen hatte, indem er den neuen gewaltigen Petersdom vollendete. Die ihn preisenden Denkmäler würden aus Gold und Silber geschmiedet werden.
Für all das hatte Leo einiges auf sich genommen, auch Dinge, die ihm nachts den Schweiß auf die Stirn trieben und ihn nicht schlafen ließen. Dinge, so grausam und unsäglich, dass er hoffte, Gott werde seinetwegen die Augen davor verschließen – und sie stillschweigend billigen.
Alles geschieht zum Wohle der Kirche!Zum Wohle der Kirche und natürlich auch zu meinem Wohl. Aber gibt es da überhaupt einen Unterschied?
Der Papst rümpfte die Nase, um sich auf den zu erwartenden Gestank vorzubereiten, dann betrat er den Kerker, wobei er sein rotes Gewand raffte, damit es so wenig wie möglich mit dem mit Asche und Blut verdreckten Steinboden in Berührung kam. Der Geruch in der Kammer warf ihn fast um. Es roch warm und süßlich nach Blut, Kot und Erbrochenem.
Der Gestank der Angst. Der Angst und der Wahrheit …
Leo blickte hinüber zu der Streckbank, die sich in der Mitte des Raums befand. Darauf lag ein dürrer, leblos wirkender Mann, einzig mit einem zerrissenen Lendenschurz bekleidet. Die Arme und Beine waren mit Brandmalen von den vorhergegangenen Befragungen übersät, sein von einem struppigen Bart bedecktes Antlitz war schmerzvoll verzogen. Leo kamen Leidensdarstellungen Christi in den Sinn, denen der Gemarterte glich, er schob den Gedanken aber schnell beiseite.
»Und?«, fragte er den bulligen, stiernackigen Mann, der mit blutbefleckter Schürze und einem Schürhaken in der Hand neben der Streckbank stand. »Hast du etwas aus ihm herausbekommen?« Leo unterdrückte seine Aufregung.
»Leider nein, Heiliger Vater.« Der Kerkermeister schüttelte den Kopf. Leo kannte ihn von früheren Torturen her, er stammte aus den Marken, wo er schon dem berüchtigten Cesare Borgia zu Diensten gewesen war. Der Mann galt als einer der Besten seines Fachs, noch dazu verschwiegen wie ein Grab, doch offensichtlich war auch er mit seinem Latein am Ende.
»Er brabbelt nur noch sinnloses Zeug«, erklärte der Kerkermeister schulterzuckend. »Ehrlich gesagt, glaube ich nicht, dass er wirklich etwas gewusst hat. Er ist ein Betrüger, wie so viele vor ihm.«
»Ein Betrüger, hm? Nichts als ein verdammter, dreckiger Betrüger …«
Der Papst gab sich Mühe, seine Enttäuschung zu verbergen. Er trat näher und musterte das von schwärenden Wunden und blauen Flecken entstellte Gesicht des Gefangenen. Sämtliche Zähne waren ihm gezogen worden, einer nach dem anderen, ebenso wie die Finger- und die Fußnägel. Er hatte nichts mehr gemein mit jenem hochfahrenden, lautsprecherischen Kerl, der noch vor Kurzem auf den römischen Plätzen sein Können angepriesen hatte. Zitternd öffnete er den Mund und lallte etwas, ein dünner Faden von Speichel und Blut rann aus seinem Mundwinkel.
»Ver … Vergebung, Herr …«, brachte er mühsam hervor. »Vergebung …«
Angeekelt wandte sich Leo ab. Am liebsten hätte er der jämmerlichen Kreatur einen Tritt verpasst, doch das gehörte sich nicht für den mächtigsten Mann der christlichen Welt. Dabei hätte er sich eigentlich denken können, dass sich auch dieser Versuch am Ende als Sackgasse herausstellen würde, so wie so viele zuvor! Aber die Quellen waren vielversprechend gewesen, und er hatte sichergehen wollen. Er musste jeder möglichen Spur folgen.
Leo atmete tief durch und versuchte dabei, den infernalischen Gestank zu ignorieren. Nun, glücklicherweise gab es immer noch Hoffnung. Erst vor ein paar Tagen hatte sich ein neuer Weg aufgetan, ein besonders verheißungsvoller. Trotz der eben erlittenen Niederlage spürte Leo tief im Herzen, dass er seinem Ziel ganz nahe war. Ihm war, als hätte Gott im Traum zu ihm gesprochen. Ja, schon bald würde er das Geheimnis erfahren, er hatte es sozusagen aus erster Hand. Und nun, nachdem dieser letzte Pfad sich als Irrtum erwiesen hatte, gab es ohnehin keine andere Möglichkeit mehr. Leo konnte nur hoffen, dass keiner den Mann, den er so sehnlichst suchte, vor ihm aufspürte.
Jenen Mann, der wohl als Einziger auf der Welt das so gut gehütete Geheimnis kannte.
Nur noch kurze Zeit, dachte der Papst wehmütig. Der Herr prüft meine Geduld …
»Schafft das hier weg«, befahl er dem Kerkermeister und deutete auf das zitternde Bündel auf der Streckbank. »Und sorgt dafür, dass ihn keiner findet.«
»Gnade!«, schrie der Gefangene und rüttelte an seinen Ketten. Er versuchte, sich aufzurichten, woraufhin er vor Schmerzen erneut laut aufschrie. »Gnade! Ich … ich weiß es! Bei Gott, ich schwöre, ich weiß es! Bitte …«
»Du hattest deine Chance«, murmelte Leo im Weggehen. Gleichzeitig dachte er daran, dass er kein Risiko eingehen durfte, nicht das geringste. Die Sache war zu wichtig – für ihn, für die heilige Mutter Kirche, für die ganze Welt. Als er die Wachen passierte, winkte er einen der Soldaten zu sich heran.
Mit einer leichten Handbewegung deutete Leo auf den stämmigen Kerkermeister, der eben den Schürhaken in die Glutpfanne tauchte.
»Sein Dienst ist beendet«, raunte er dem Soldaten zu. »Für immer. Kümmert euch darum, und es soll euer Schaden nicht sein. Seinen Leichnam versenkt mit dem anderen im Tiber, verstanden? Eingenäht in einen Sack mit Steinen. Es muss so sein, als hätte er nie gelebt.«
Der Wachmann nickte schweigend, und Leo drückte ihm ein glitzerndes Goldstück in die Hand. Dann stieg er schnaufend und schwitzend die vielen Treppen wieder nach oben, wo ihn Licht, betörender Veilchenduft und die Gnade Gottes erwarteten.
O ja, es gab noch viel zu tun.
Erster Akt: Der Atem des Biests
1
20. Oktober, Anno Domini 1518, Bretten im Kraichgau
Mit einem schrillen Pfeifen schoss der Feuerpfeil in den Abendhimmel und versprühte seine orangegelbe Ladung. Unter den Schreien der Zuschauer zog er einen funkensprühenden Schweif hinter sich her, der sich wie die Schrift eines zornigen Gottes als gebrochene Linie vor den Wolken abzeichnete. Weit oben, über den Dächern der Stadt und dem Turm der Stiftskirche, explodierte der Pfeil mit einem berstenden Knall, und glitzernde Funken regneten herab wie gefallene Sterne. Die Brettener Bürger stöhnten vor Entsetzen und wohligem Schauder.
Von ihrem Versteck hinter der Bühne aus betrachtete Greta die Gesichter der Zuschauer. Es mochten einige Hundert sein, die sich auf dem Brettener Marktplatz nahe des Brunnens versammelt hatten. Ihre Münder waren weit aufgerissen, manche hielten sich die Hände vor die Augen, doch die meisten starrten nur ungläubig auf das Schauspiel über ihnen. Unwillkürlich lächelte Greta. Der Feuerpfeil war jedes Mal aufs Neue eine Sensation, er markierte den Beginn ihrer täglichen Abendvorstellung und sorgte sofort für die nötige Aufmerksamkeit. Der Doktor stellte jeden der Pfeile eigenhändig her, nicht einmal Greta wusste, was sich im Inneren der aus geleimtem Tuch bestehenden Röhren genau befand. Sie vermutete Schwarzpulver mit verschiedenen, streng geheimen Zutaten. An den adligen Höfen des Reichs und auch in Italien und Frankreich waren diese sogenannten Raketen der letzte Schrei, nur wenige kannten das Geheimnis ihrer Herstellung, das ursprünglich wohl aus einem Land weit im Osten stammte. Es waren Dinge wie diese, welche die Vorstellungen des Doktors so erfolgreich machten, dass sich sogar Grafen und Bischöfe darum rissen, ihnen beizuwohnen. Oder eben die reichen Brettener Bürger, die ihre Blicke nun wieder auf die Bühne neben dem Brunnen richteten und unter ehrfurchtsvollem Gemurmel zusahen, wie ein einzelner Mann hinter dem Vorhang hervortrat.
»Das ist er!«, flüsterte eine ältere Frau mit Haube und hielt sich die Hand vor den Mund. »Gott steh uns bei! Es heißt, sein schwarzer Hund ist der Teufel selbst. Er hat ihn mit einem Drudenfuß beschworen, nun muss Satan ihm dienen!«
»Wie unheimlich er aussieht!«, stöhnte ein neben ihr stehendes Mädchen und fröstelte sichtlich. »Fast so, als wäre er der Teufel selbst. In Erfurt hat er die schöne Helena herbeigehext, sodass die Studenten ihr alle nachgerannt sind, bis hinaus auf die Straße. Und den alten, buckligen Dekan hat er wieder jung gezaubert.«
»Wenn er das doch nur auch bei meinem Hans machen würde!«, seufzte die Ältere und zupfte an ihrer Bluse. Dann blickte sie wieder gebannt nach vorne, wo der Mann soeben den vorderen Bühnenrand erreicht hatte.
Der Doktor war groß gewachsen und hager, er trug einen schwarzblauen Mantel, der mit im Licht der Fackeln glitzernden Sternen bestickt war. Sein nicht mehr ganz junges Gesicht, aus dem die Wangenknochen hervorstachen, wurde von einem Schlapphut beschattet. Zwei stechend schwarze Augen leuchteten aus dem Dunkel, wobei besonders das linke bedrohlich zu funkeln schien. Die Hände steckten in glatten Lederhandschuhen, was ihnen etwas Krallenhaftes gab. Nun hob er beide Arme, wie ein Priester bei der heiligen Kommunion. Irgendwo aus dem Hintergrund ertönte dazu eine laute Stimme, die nicht seine eigene war.
»Sehet und staunet, verehrte Bürger, denn kein Geringerer ist in eure Stadt gekommen als der weltberühmte Doktor Johann Georg Faustus!«, verkündete der Sprecher. »Er hat die heißen Länder jenseits des großen Meeres bereist, bei Avicenna und dem großen Albertus Magnus studiert, er entkam dem höllischen Atem der Sphinx und durfte unserem geliebten Kaiser Maximilian ein langes Leben prophezeien. Und nun ist er hier in Bretten, um auch euch seine Künste darzubieten! Wer sein zukünftiges Schicksal erfahren möchte, der mag jetzt hervortreten. Schon für zwei Heller erstellt der Doktor euer Horoskop! Denn, potz Blitz, die Sterne lügen nicht!«
Auf das vereinbarte Zeichen hin schlug Greta auf ein Stück Blech, und ein lauter Donner ertönte, mit der linken Hand drehte sie dazu eine knatternde Ratsche. Die Bühne bestand aus einigen zusammengestellten Kisten und wurde an drei Seiten von dunkelblauen, mit Pentagrammen und Fabelwesen geschmückten Stoffbahnen verhüllt.
Seit fast einer Woche gastierten sie nun schon in Bretten, etwa dreißig Meilen südlich von Heidelberg, und jede ihrer Vorstellungen auf dem Marktplatz war bis auf den letzten Platz besucht. Keiner sah, wie Greta im Schutz der Stoffbahnen mit Blech, Ratsche, Zimbeln und einer Sackpfeife den Vortrag von Fausts jungem Assistenten Karl Wagner akustisch untermalte.
»Tretet nur vor, ihr Tapferen!«, fuhr Karl fort. »Wer zaudert, wird es später bitterlich bereuen!«
Karl hatte mittlerweile von der Seite her die Bühne betreten. Der Adlatus des Doktors war Mitte zwanzig, mit glattem schulterlangen Haar, gut rasiert und von so angenehmer Gestalt, dass ein paar junge Frauen im Publikum bereits zu tuscheln begannen. Vielleicht rochen sie auch das Duftwässerchen aus Veilchenessenz, das Karl immer ein wenig zu reichlich auftrug.
»Die Ersten bekommen ein Fläschchen ›Doktor Faustus’ʼ Original Theriak‹ gratis und außerdem eine goldene Zukunft prophezeit!«, rief Karl und zwinkerte den schmachtenden Damen zu. »Wer weiß, möglicherweise erwartet die eine oder andere von euch noch in diesem Jahr ein fescher Bräutigam.«
Ehrfürchtig betraten nun einzelne Zuschauer die Bühne und ließen sich von dem berühmten Doktor Faustus, der auf einem Schemel Platz genommen hatte, aus der Hand lesen.
Greta legte Blech und Ratsche weg und bereitete sich hinter der Bühne auf ihren Auftritt vor. Sie strich ihren Rock glatt, der nach Art der Gaukler aus bunten Stoffstücken zusammengenäht war; dann schnürte sie das enge Mieder und band ihr oft störrisches blondes Haar mit einem Tuch nach hinten. Ihr Kostüm war wie eine Rüstung, ein Panzer, der ihr Inneres verbarg. Erst im letzten Frühling war sie zwanzig geworden. Manchmal, wenn keiner zusah, betrachtete Greta ihr Antlitz in dem polierten Stück Blech und fragte sich, was sie von dieser jungen Frau vor sich halten sollte. Sie mochte die Sommersprossen nicht, die vor allem in den Sommermonaten ihre Haut wie Jauchespritzer sprenkelten. Doch sie hatte einen hübsch geschwungenen Mund und eine zierliche Nase; in dem körperbetonten Mieder, das sie für die Vorstellungen trug, wirkte sie weiblicher, als sie sich eigentlich fühlte. Der Doktor sagte ihr oft, er liebe ihr Lachen. Dabei ging sein Blick manchmal ins Leere, so als hinge er einer fernen Erinnerung nach.
»Ich sehe eine große Veränderung auf dich zukommen«, raunte Faust soeben einem jungen zitternden Ding zu, wobei er die Hand des Mädchens so fest umschloss wie mit einer Kralle. »Halte dich von den falschen Kerlen fern. Der Richtige wird kommen, und zwar schon bald!« Er zog sie ganz nah zu sich heran. »Und meide die Scheunen auf den Feldern, ihre Wände sind dünner, als du denkst.« Faust zwinkerte, und wie auf frischer Tat ertappt, wich das Mädchen vor ihm zurück.
Greta kannte den Doktor nun seit über sechs Jahren. Als er sie damals in Nürnberg aus dem Kerker gerettet hatte, war sie fast noch ein Kind gewesen. Wer ihre Mutter und ihr Vater waren, wusste sie nicht. Seit jener Zeit zog sie nun mit dem berühmten Doktor Faustus durch die Lande. Für Greta war der unheimliche Mann, von dem viele glaubten, er sei mit dem Teufel im Bunde, eine Art Vater geworden, sie nannte ihn Onkel Johann. Sie hatte viel gelernt von ihm in den letzten Jahren, sie war eine geschickte Trickserin und eine wendige Akrobatin geworden, sie spielte die Sackpfeife, die Laute und die Flöte. Die Leute liebten sie für ihre freche Art, ihren anmutigen Tanz und die Kunst, noch auf dem dünnsten Seil zu balancieren. Wer sie wirklich war, wussten die Menschen nicht. Und eigentlich wusste Greta es auch selbst nicht, vieles war ihr nach wie vor ein Rätsel. Dazu gehörte auch jene unheimliche Gabe, von der sie bis heute nicht sagen konnte, ob sie Segen oder Fluch war.
In den letzten Wochen war sie ihr eher wie ein Fluch vorgekommen.
Die großen schwarzen Schwingen …
Greta schüttelte die düsteren Gedanken ab und trat hinter der Leinwand hervor. Ein kurzer Blick hinauf zum verhangenen Herbsthimmel zeigte ihr, dass es wohl bald regnen würde. Sie durften froh sein, wenn sie die Vorstellung noch vor dem Wolkenbruch beenden konnten. Gerade las Doktor Faustus einem bunt gewandeten, sichtlich ängstlichen Patrizier aus der Hand.
»Eure Schicksalslinie zeigt einen Wendepunkt in Euren Geschäften noch in diesem Jahr«, sagte Faust mit der für ihn typischen knarrenden Stimme, und die Umstehenden schwiegen ehrfurchtsvoll. »Auch die Sterne deuten darauf hin. Noch kann ich nicht sagen, ob dieser Wendepunkt Gutes oder Schlechtes bringen wird. Ich sehe …«, er schloss kurz die Augen, »eine Stadt mit goldenen Dächern …«
»Venedig!«, hauchte der Patrizier. »Mein Gott, meine kostbare Tuchlieferung, die nach Venedig geht! Ob die Preise wohl gesunken sind?« Er stürzte davon, nicht ohne Faust noch ein paar silberne Münzen in die Hand zu drücken.
Greta hob stolz den Kopf, während sie sich unter die vielen Wartenden vor der Bühne mischte. Sie liebte diese Atmosphäre, das war die Welt, in der sie zu Hause war. Sobald sie vor den Vorhang trat, war sie jemand anders, nicht mehr das in sich gekehrte, manchmal schwermütige Mädchen, sondern Greta, die vorlaute Gauklerin, die junge Gefährtin des weitgerühmten Doktor Faustus.
Die Zuschauer musterten sie mit einer Mischung aus Respekt und Abscheu. Greta kannte diesen Blick, den die braven Bürger stets für Leute wie sie bereithielten – für Spielleute, Gaukler, Tänzerinnen, Vaganten, Jongleure, Reliquienhändler, Bärendompteure und anderes fahrendes Volk, gemieden und doch bewundert. Sie waren ehrlos und unberührbar, lebten heute hier und morgen dort, ohne Vergangenheit und Zukunft – gerade das mochte Greta so daran.
Mit einem Lächeln näherte sie sich einem Bauernburschen in den vorderen Zuschauerreihen und verneigte sich leicht. »Lust auf ein Würfelspiel, junger Herr?« Der Kerl war Greta bereits vor der Vorstellung aufgefallen, und die Blicke, die er ihr zugeworfen hatte, waren ihr nicht unangenehm gewesen. Sein verschmitztes, fast verschlagen wirkendes Gesicht war auf seltsame Weise anziehend, er hatte volles braunes Haar und einen Körper, an dem sich wohlproportionierte Muskelstränge abzeichneten.
Greta zeigte ihm ihre leeren Hände, dann griff sie in ihr rechtes Ohr und holte dort einen aus einem Rinderknochen geschnitzten Würfel hervor, aus dem linken Ohr pulte sie eine Münze. Der junge Mann lachte überrascht auf.
»Wie soll ich mit dir würfeln, wenn du die Würfel jederzeit wieder verschwinden lassen kannst?«
Greta zwinkerte ihm zu. »Keine Angst, mein Freund, du hast dein Glück selbst in der Hand.« Ihre Stimme hatte jetzt den anpreisenden, fast betörenden Klang aller Schausteller. »Du würfelst, und ich errate deine Zahl. Wenn ich recht habe, bekomme ich einen Heller, wenn du recht hast, bekommst du einen Kuss von mir. Wollen wir?« Sie hielt ihm den Würfel hin.
Der Bursche wiegte den Kopf, sein Blick glitt über ihren eigentlich eher kleinen Busen, den das eng geschnürte Mieder jedoch hervorquellen ließ. Greta wusste, dass die Männer ihr in dieser Aufmachung oft aus der Hand fraßen, ein Umstand, den sie bei den Vorstellungen durchaus gewinnbringend einsetzte.
»Ein faires Angebot, wie mir scheint«, sagte der junge Mann grinsend. Dann hob er den Finger und machte eine wichtigtuerische Miene. »Aber ich will erst ein paar Mal würfeln, damit ich sehe, dass dies kein getürktes Spiel ist.«
Greta nickte. Manche Gaukler verwendeten Würfel, in die kleine Eisenteile eingearbeitet waren, sodass sie immer auf die gleiche Seite fielen. Der Bursche knobelte ein paar Mal, schließlich verbarg er den Würfel in der Hand.
»Und nun rate«, forderte er sie auf.
»Hm, eine Eins ist es schon mal nicht, nicht wahr?«, begann Greta und kratzte sich am Kopf. »Vielleicht eine Zwei? Nein, die auch nicht. Eine Drei …?« Plötzlich hellte sich ihre Miene auf. »Nun, ich denke, es ist eine Sechs.«
Verblüfft hob der Jüngling die obere Hand. Es war tatsächlich eine Sechs.
»Verflixt, das war Glück, nichts weiter!« Er schob ihr die versprochene Münze zu. »Ich will es gleich noch einmal versuchen.«
Wieder begann Greta ihr Ratespiel, und auch diesmal lag sie richtig. Als sie auch das dritte Mal die richtige Zahl erriet, sah der Bursche sie argwöhnisch an.
»Da ist Zauberei im Spiel«, brummte er. »Ihr ehrlosen Gaukler seid doch alle gleich, Spielleute des Teufels. Gib mir mein Geld zurück, Betrügerin!«
Gretas Lächeln verschwand. Sie hatte sich auf ein harmloses Stelldichein gefreut, doch diese Begegnung entwickelte sich eindeutig nicht in die von ihr gewünschte Richtung.
»Nein, ich denke, ich werde es morgen lieber in der Kirche spenden und dreißig Vaterunser für dein Seelenheil beten. Gott schütze dich.« Sie steckte die Münzen ein und verabschiedete sich mit einer angedeuteten Verbeugung.
Gaukler galten vielen als Abgesandte des Satans. Es gab Kirchengelehrte, die behaupteten, sie stammten von gefallenen Engeln ab, die auf der Erde Unheil anrichteten. Wie hätte Greta dem ungebildeten Klotz auch erklären sollen, dass es keine Zauberei war, was sie tat, sondern Einfühlungsvermögen und schlichtes Handwerk. Greta beobachtete genau, achtete auf jede Veränderung in der Mimik oder Gestik ihres Gegenübers. Deshalb lag sie beim Erraten der Zahlen auch fast immer richtig. Sie und Karl setzten diese Technik bei etlichen Vorstellungen ein. Greta erriet, was die Leute in ihren Taschen hatten, während ihr Karl heimlich gewisse Hinweise zuspielte.
Allerdings war da manchmal noch etwas anderes. Etwas, was sie sich lange nicht hatte eingestehen wollen: Bisweilen sah sie die Zahlen tatsächlich vor sich.
Greta war hinter die Bühne getreten, wo sie neben ihrem Wagen ein kleines Zelt aufgebaut hatten, in dem sich einige Kisten und Truhen befanden. Es diente zudem als Umkleide, etliche zweifarbige Kleidungsstücke mit Glöckchen und Fransen, wie sie bei Gauklern und Spielleuten üblich waren, lagen auf dem Boden verstreut. Obwohl es bereits Oktober war, war es im Zelt schwül und heiß, seit Stunden schon lag ein Gewitter in der Luft. Von draußen erklang der Applaus der Brettener Bürger, die Vorstellung war wohl eben zu Ende gegangen.
Das Mieder drückte Greta die Luft ab, sie lockerte es. Eben löste sie die Schnürung ihrer Bluse, als hinter ihr ein Geräusch ertönte. Sie wandte sich um und verfluchte im gleichen Moment ihre Unvorsichtigkeit vorhin. Vor ihr stand mit verschränkten Armen der ausgetrickste Bursche. Er lächelte, doch in seinem Blick lag etwas Hungriges, Gieriges, sein wohlgestaltes Gesicht kam ihr plötzlich nur noch roh und verschlagen vor.
»Wenn ich schon mein Geld nicht wiederbekomme, dann hole ich mir eben etwas anderes«, knurrte er. »So leicht kommst du mir nicht davon, du Flittchen.«
Greta wich einen Schritt zurück. Es war immer das Gleiche. Die Männer sahen sie in ihrer Rolle als freche, sich anzüglich gebende Gauklerin und verwechselten Spiel und Wirklichkeit. Sie glaubten, dass sie wirklich leicht zu haben war.
Der Kerl trat vor, griff nach ihren Brüsten und machte Anstalten, sie nach hinten auf eine der Truhen zu ziehen. Doch Greta war gewappnet. Mit einem Ruck zog sie ihr Knie hoch und stieß es ihm genau zwischen die Beine. Es war nicht das erste Mal, dass sie sich gegen aufdringliche Mannsbilder zur Wehr setzen musste, oft reichte ein einziger Tritt, um die Kerle in ihre Grenzen zu verweisen. Greta war eher zierlich, jedoch durchaus athletisch, die Muskeln gestählt in den jahrelangen Übungen mit Seil, Kegel und Bällen.
Der Bursche stöhnte laut auf, doch er blieb stehen. Offenbar war er aus härterem Holz geschnitzt, als sie angenommen hatte.
»Na warte, du Dirne, dafür nehme ich dich besonders hart ran!« Er wischte sich den Schweiß von der Stirn und breitete seine starken, behaarten Arme aus.
Wie ein Bär warf er sich auf sie, und diesmal gelang es ihm tatsächlich, sie zu Boden zu werfen. Greta wollte schreien, doch der Kerl drückte ihr die Hand auf den Mund, sie roch den Odem von Stall und Dung. Während er ihr den Rock hochschob, suchte sie verzweifelt unter dem Mieder nach dem kleinen Messer, das sie immer bei sich führte. Da war es! Doch der Bursche drückte ihre Hände zur Seite, und die Klinge entglitt ihr. Mittlerweile hatte er seine Beinlinge bis zu den Knien hinuntergezogen, sie konnte sein steifes Glied zwischen den Beinen spüren wie einen Knüppel. Greta wand, drehte und streckte sich, endlich bekam sie eine Hand frei und griff erneut nach dem Messer.
»Ich hatte dir einen Kuss versprochen«, zischte sie. »Hier ist er!«
Mit einer schnellen Bewegung zog sie ihrem Gegner die rasiermesserscharfe Klinge über Wange und Nase, der Kerl heulte schmerzerfüllt auf.
»Du … du verfluchte Hexe!«
Augenblicklich ließ er von ihr ab und hielt sich die Nase, unter seinen Händen quoll ein breiter Strom Blut hervor. Das Blut war überall, in seinem Gesicht, auf seinen Händen, auf seinem Wams, im Zelt sah es aus wie nach einer Schlachtung.
Greta bemerkte es mit Genugtuung.
»Sieht ganz so aus, als hättest du heute keine Glückssträhne«, sagte sie und rappelte sich auf. »Und jetzt scher dich raus und such dir irgendein Bauernmädchen, bevor …«
Ein tiefes, bedrohliches Knurren ließ Greta innehalten. Sie blickte zum Zelteingang, wo ein schwarzer, fast kalbsgroßer Hund stand. Es war der Hund des Doktors, ein Monstrum von einem Tier, mit mächtigem Wolfsgebiss und roten, dämonisch glühenden Augen. Manche Leute hielten ihn tatsächlich für den Teufel, weshalb der Doktor ihn auch ›Kleiner Satan‹ getauft hatte.
Auch auf den heftig blutenden Bauernburschen verfehlte Kleiner Satan seine Wirkung nicht.
»Himmel hilf!«, keuchte er. »Was in Gottes Namen …?«
Zitternd nahm der junge Mann die Hände vom Gesicht und verschnürte hastig seine Beinlinge. Er wollte davonlaufen, strauchelte aber und fiel der Länge nach hin.
»Was hast du hier verloren?«, erklang nun eine Stimme, so tief und bedrohlich wie aus dem Reich der Hölle. »Sprich schnell, bevor dich mein Hund wie einen Feldhasen zerfleischt!«
Hinter Kleiner Satan hatte jetzt auch der Doktor das Zelt betreten, dicht gefolgt von Karl Wagner, der einige verkorkte Theriakflaschen in den Händen hielt.
»Ich … ich …«, stammelte der Bursche. Noch immer tropfte ihm das Blut von Nase und Wange, wo sich ein langer Schnitt abzeichnete. Greta hoffte, dass ihm zur Erinnerung eine Narbe zurückbleiben würde.
»Du besudelst mein Zelt.« Faust deutete auf den Boden. »Und das Blut macht den Hund rasend. Rasend und hungrig, sieh selbst.« Wie zur Bestätigung zog Kleiner Satan die Lefzen hoch und zeigte seine spitzen gelben Zähne, jeder einzelne von der Größe eines kleinen Messers.
Ein Blick hinüber zu Greta reichte dem Doktor, um die Situation zu erfassen. Er wurde kalkweiß im Gesicht, statt kühlem Verstand regierte plötzlich die nackte Wut.
»Bei den finsteren Mächten und dem fahlen Licht des Mondes«, flüsterte Faust, und seine Augen blitzten wie kleine dunkle Sterne. »Wenn du ihr irgendein Leid angetan hast, nur das geringste, dann …« Seine Stimme zitterte vor Zorn.
»Es ist nicht dazu gekommen, Onkel«, fuhr Greta dazwischen. Mittlerweile tat ihr der junge Kerl fast leid. »Er ist auch so gestraft genug. Lass ihn gehen.«
Der Doktor atmete tief durch. Kurz schien er gewillt, den Hund loszulassen. Dann stieß er einen leisen Pfiff aus, und Kleiner Satan legte sich auf den Boden.
»Ich gebe dir genau drei Wimpernschläge, um dieses Zelt zu verlassen«, sagte Faust leise und dabei so kalt wie der Nordwind. »Und noch einmal drei Wimpernschläge, um dich in ein sehr tiefes Loch zu verkriechen. Denn glaube mir, wenn ich dich dort draußen noch einmal sehe, wird Kleiner Satan dich auf einen Happs verspeisen. Aber erst, nachdem ich dich noch in eine Ratte verwandelt habe. Denn nichts anderes bist du: eine Ratte auf zwei Beinen. UND JETZT RAUS HIER!!!«
Die letzten Worte hallten wie Donner. Greta staunte immer wieder, wie der Doktor mit seiner Stimme ganze Welten bersten lassen konnte.
Wimmernd und blutend stolperte der Bursche an Faust, Karl und dem knurrenden Hund vorbei ins Freie. Seine hastigen Schritte entfernten sich schlurfend.
Schließlich richtete Faust das Wort an Greta. Er bebte noch immer vor Wut.
»Wie oft muss ich dir noch sagen, dass du den Burschen keine schönen Augen machen sollst! Nun siehst du, wohin das führt! Eine Minute später, und dieser Kerl hätte dich bestiegen wie ein Bock.«
»Ich wäre mit dem Jungspund schon alleine fertiggeworden«, entgegnete Greta, wobei sie gelassener klang, als sie war. Sie verschnürte ihr blutbeflecktes Mieder. »Ich kann mich durchaus wehren, wie du weißt. Ihr zwei habt mir in den letzten Jahren so einiges beigebracht.«
Karl grinste. »In der Tat. Der Junge sah aus, als hätten ihn gleich drei Wirtshausschläger in der Mangel gehabt. Der kommt so schnell nicht wieder.« Im Gegensatz zum Doktor trug er ein schlichtes schwarzes Gewand, das seine zierliche Figur noch schmaler wirken ließ. Seine klugen Augen in dem fast weiblich weichen, bartlosen Antlitz verrieten einen wachen Geist. In den letzten Jahren war Karl zu Gretas engstem, ja einzigem Freund und Vertrauten geworden, er war wie ein großer Bruder für sie. Außerdem konnte Greta bei Karl sicher sein, dass er sich nicht für ihre weiblichen Vorzüge interessierte – einfach deshalb, weil ihn Frauen generell nicht anzogen, zumindest nicht in sexueller Hinsicht.
Karls Miene wurde schnell wieder ernst. »Ich fürchte, der Rüpel könnte uns noch Probleme bereiten, bestimmt hat er ein paar Freunde in der Stadt. Wenn er uns nicht gleich beim Rat als Hexer anschwärzt.« Er wandte sich an den Doktor. »Möglicherweise war es nicht besonders klug, dem Kerl zu drohen, ihn in eine Ratte zu verwandeln.«
»Die Mühe wäre vergebens, er ist bereits eine.« Faust zuckte mit den Schultern. »Außerdem werden wir ohnehin nicht länger in Bretten bleiben.«
»Wie das?«, fragte Karl und hob erstaunt die Augenbraue.
»Nun, ich habe eine Einladung erhalten, die ich wohl besser nicht ablehnen sollte. Der Brief kam per Boten, schon vor ein paar Tagen. Bislang war ich mir nicht sicher, ob ich ihr tatsächlich Folge leisten will, deshalb habe ich euch auch noch nichts gesagt.« Faust lachte leise. »Aber es ist ohnehin mehr ein Befehl.«
»Von wem sprichst du?«, fragte Greta.
Der Doktor seufzte. »Es ist eine Einladung des hochwohlgeborenen Bamberger Fürstbischofs, dem ich wohl ein Horoskop stellen soll. Er spricht von einem fürstlichen Salär, trotzdem ist mir das Ganze zuwider. So etwas wirbelt zu viel Staub auf! Und das können wir zurzeit wahrlich nicht brauchen.« Er deutete nach draußen. »Habt ihr gehört, was die Leute sich zuflüstern? Mein Ruf in dieser Gegend ist nicht der beste. Auch hier in Bretten gibt es nicht wenige, die mich einen Schwarzmagier nennen und meinen Hund den Leibhaftigen. Und jetzt legt sich Greta auch noch mit so einem Idioten an!«
»He!«, protestierte Greta. »Das klingt fast so, als hätte ich den Kerl eingeladen, mich zu vergewaltigen.«
»Ich sage ja nur, dass du dich besser in Acht nehmen solltest. Ich kann dich nicht immer heraushauen.«
»Das sollst du auch nicht«, entgegnete Greta kühl.
Faust winkte ab. »Nun, vielleicht ist Bamberg gar nicht das schlechteste Ziel. Wir brauchen ohnehin ein Winterquartier. Und es gibt wahrlich unangenehmere Unterkünfte als die Bamberger Altenburg, wo der Fürstbischof residiert.«
Greta biss sich auf die Lippen. Noch immer taten ihr die Glieder weh von dem Kampf mit dem jungen Burschen, auf ihrer Haut zeichneten sich Striemen ab. Aber fast mehr noch schmerzte die Schande, der sie nur um Haaresbreite entkommen war. Männer waren wie Tiere, vielleicht hatte sie sich auch deshalb im Grunde nie wirklich mit einem von ihnen eingelassen, auch wenn Onkel Johann etwas anderes vermutete.
»Wann willst du denn nach Bamberg aufbrechen?«, erkundigte sie sich. »Eigentlich gedachten wir ja, bis zum kommenden Markttag zu bleiben …« Auch wenn sie es nicht zugeben wollte und ihr die Einladung des Fürstbischofs nicht ganz geheuer war, war sie nach dem Vorfall doch ganz froh, nicht mehr länger in Bretten verweilen zu müssen.
»Am besten schon morgen in aller Frühe«, erwiderte Faust. »Allerdings muss ich in der Gegend noch etwas erledigen.« Seine Miene wurde düster. »Etwas, was ich schon viel zu lange aufgeschoben habe.« Ohne ein weiteres Wort verließ er das Zelt.
Greta sah Karl fragend an, doch er verdrehte nur die Augen.
»Jetzt kenne ich den Doktor schon so lange«, sagte er mit einem Seufzen. »Aber im Grunde kenne ich ihn überhaupt nicht.«
Einmal mehr fiel Greta auf, dass es ihr ebenso erging. Nach all den Jahren wusste sie noch immer nicht zu sagen, was für ein Mensch Faust eigentlich war. Der Doktor konnte sich einfühlsam und zuvorkommend zeigen und im nächsten Moment wieder kühl und abweisend sein, sein geschliffener Verstand überstrahlte alles andere, seine Arroganz war sprichwörtlich. Immer wenn Greta versucht hatte, von ihm mehr über ihn selbst, und damit auch über sich, zu erfahren, war er ihr ausgewichen. Keiner wusste, was sich hinter Fausts dunklen Augen wirklich abspielte.
Greta griff nach Karls Hand und drückte sie fest. Vermutlich konnte Karl spüren, dass sie wegen des Vorfalls gerade eben immer noch zitterte. Aber das war in Ordnung, Karl war der Einzige, dem sie voll und ganz vertraute.
»Johann Georg Faustus bleibt für uns alle wohl immer ein Buch mit sieben Siegeln«, murmelte sie und sah durch die Zeltöffnung hinaus in den regenschwangeren Abendhimmel.
Tief in ihrem Inneren musste Greta sich allerdings eingestehen, dass dies wohl auch für sie selbst galt.
Ferner Donner grollte, im Westen schoben sich die Wolken zu finsteren Klumpen zusammen. Sie schienen sich noch nicht einig zu sein, wann sie ihre schwere nasse Last herniederprasseln lassen wollten. Kein Lüftchen regte sich in den Bäumen, so als hielte die Natur den Atem an.
Den Kopf tief über den Nacken des Pferdes gebeugt, galoppierte Johann auf die kleine Stadt Knittlingen zu, die nur wenige Meilen von Bretten entfernt lag. Gleich nach dem Gespräch mit Greta und Karl war er in Begleitung von Kleiner Satan aufgebrochen, durch das Weißhofer Tor und immer an der Weißach entlang. Er schloss die Augen und versuchte, die Erinnerungen an früher auszublenden, doch es gelang ihm nicht.
Baden im Fluss, Weidenäste, die tief herabreichen … Ich ziehe mich daran hoch und springe ins Wasser. Schau her, Margarethe, schau doch, ich bin ein böser Wassermann …
Schon bald tauchte im fiebrigen Gewitterdunst die Knittlinger Stadtmauer auf, dahinter erhoben sich sanft geschwungene Weinhügel, als hätte die Zeit all die Jahre stillgestanden. Das Westtor war noch offen, der einsame Wächter winkte den unbekannten Reiter einfach durch, offensichtlich froh, angesichts des drohenden Regens nicht sein Wachhäuschen verlassen zu müssen. Vielleicht war ihm auch der große schwarze Hund nicht geheuer, der neben dem Fremden hertrabte.
Johann hielt den Kopf weiterhin gesenkt, er hob ihn erst, als er merkte, dass er der einzige Mensch in der Gasse war. Vermutlich arbeiteten die meisten Knittlinger trotz der späten Stunde draußen in den Weinhängen, um noch rechtzeitig, bevor das Gewitter losbrach, die Körbe mit den geernteten Trauben in Sicherheit zu bringen. Aus dem Augenwinkel sah Johann hinüber zum Hof des Pflegverwalters mit den Weinkeltern, dahinter lagen der Marktplatz und die kleine Leonhartskirche. Auch den Hof der Gerlachs gleich neben der Kirche konnte er sehen, jenes Haus, in dem er vor einer Ewigkeit auf die Welt gekommen war. Das zweistöckige Gebäude war frisch verputzt, die Läden waren anders gestrichen, doch ansonsten hatte sich nichts verändert.
So viele Erinnerungen …
Johann spürte einen Stich in der Brust. Seit beinahe einem Vierteljahrhundert war er nicht mehr in Knittlingen gewesen, er hatte den Ort gemieden, weil er ihn daran erinnerte, wie alles angefangen hatte. Weder Karl noch Greta wussten, dass dieser Ort seine Heimat war, im Grunde wussten sie nichts über ihn. Keiner wusste etwas. Nur einen Steinwurf weit entfernt war er aufgewachsen, zusammen mit drei Brüdern, von denen die beiden Älteren tumbe Bauerntölpel gewesen waren, und mit einem Stiefvater, der ihn immer gehasst hatte. Wer sein richtiger Vater war, wusste Johann bis heute nicht. So wie auch Greta keine Ahnung hatte, wer ihr Vater war.
Ich muss es ihr sagen, bevor es zu spät ist …
Zur Linken tauchte das altvertraute Gasthaus »Zum Löwen« auf, aus dem leises Stimmengewirr drang. An einem Balken rechts vom Eingang waren einige Pferde angebunden, in einem offenen Schuppen daneben stand ein Wagen mit rostiger Deichsel.
Unwillkürlich hielt Johann sein eigenes Pferd an und lauschte. Knittlingen lag an der Poststraße, die von den Niederlanden bis nach Innsbruck in den Alpen und darüber hinaus führte. Der greise Kaiser Maximilian hatte sie in jungen Jahren errichten lassen, um sein riesiges Reich besser kontrollieren zu können. Daher stiegen im »Löwen« oft Reisende aus fernen Ländern ab. Wie oft hatte Johann als kleiner Junge hier unter den Tischen gesessen und ihren Erzählungen gelauscht! Später hatte er diese Geschichten dann der kranken Mutter zu Hause erzählt.
Der »Löwe« war sein Fenster zur Welt gewesen, einer Welt, von der er später mehr kennenlernen durfte, als er sich je erträumt hatte. Johann hatte sich geschworen, erst dann zurückzukommen, wenn er ein gelehrter und erfolgreicher Mann war. Und eben dies war eingetroffen, wenn auch gänzlich anders als erwartet.
Aus dem kleinen, vorlauten Johann Gerlach aus Knittlingen war der berühmte Doktor Johann Georg Faustus geworden, der mächtigste Zauberer des Reiches, ein Astrologe, Chiromant und Alchimist, bewundert viel und viel gescholten.
Johann zögerte, schließlich stieg er ab und band sein Pferd neben den anderen fest. Zwar war er wegen etwas anderem nach Knittlingen gekommen, doch das Wirtshaus zog ihn beinahe magisch an, wie ein lieblicher, wehmütiger Ruf aus der Vergangenheit.
»Du bleibst hier draußen, sitz!«, befahl er Kleiner Satan, der sich augenblicklich niederlegte. Dann betrat Johann mit klopfendem Herzen das Wirtshaus. Er zog die fellgepolsterte Kappe tief ins Gesicht, obwohl es äußerst unwahrscheinlich war, dass ihn nach all den Jahren jemand erkannte. Johann hatte bereits in Erfahrung gebracht, dass sowohl seine Brüder wie auch sein Stiefvater schon vor etlichen Jahren an einem Fieber gestorben waren. Seine Familie gab es nicht mehr, das Haus war verkauft worden. Sosehr er in sich auch hineinhorchte, nie hatte er deshalb Trauer verspürt.
Weil ich immer ein Fremder gewesen bin …
Sofort, als Johann die vertraute Wirtsstube betrat, verstummten ringsum die Gespräche. An den Tischen saßen einige Reisende und wohl auch Knittlinger Bürger, die ihn aufmerksam musterten. Johann kannte keinen von ihnen, und auch sie schienen ihn nicht zu erkennen. Schnell wandten sich die Blicke wieder ab, und die Gäste widmeten sich ihren Weinbechern. Er war nur irgendein weiterer Reisender. Der junge Wirt kam an seinen Tisch.
»Was darf es sein, hoher Herr?«, fragte der Mann und machte dabei einen Diener. Johann hatte zwar nicht seinen berühmten Sternenmantel an, trug jedoch einen weiten Mantel aus Seide und Barchent und dazu die pelzgefütterte Kappe, wie sie sich nur reiche Händler oder Patrizier leisten konnten.
»Lebt denn der alte Hans Harschauber nicht mehr?«, fragte Johann, wobei er seiner Stimme einen fremdartigen Klang gab, um kein unnötiges Risiko einzugehen. »Der frühere Wirt«, fügte er erklärend hinzu. »Ich war vor Jahren schon mal hier auf Durchreise und hab ihn kennengelernt. Ein guter Mann, wusste viel von der Welt.«
»Ach, der.« Der Wirt machte eine entschuldigende Geste. »Der ist schon vor längerer Zeit gestorben. Es gab da mal ein böses Fieber …«
Johann nickte. Es war wohl das gleiche Fieber, das auch seine Familie hinweggerafft hatte. Er hatte den alten Harschauber gemocht, er war einer der wenigen im Ort gewesen, die ihn respektierten, obwohl Johann immer anders als die übrigen Knittlinger gewesen war. Aber so war es vermutlich besser. Je weniger Menschen ihn noch von früher her kannten, umso weniger lief er Gefahr, erkannt zu werden.
»Bring mir Wein«, befahl er. »Aber nicht den Fusel von den hiesigen Weinhängen. Ich will was Besseres!«
Der Wirt verschwand katzbuckelnd und kehrte schon bald mit einem Krug zurück, in dem es rötlich schimmerte. Johann schenkte sich ein und versuchte dabei, das Zittern zu unterdrücken, das wie eine Woge durch seinen Körper lief. In den letzten Tagen war es wieder schlimmer geworden, manchmal glaubte er, es nicht mehr unter Kontrolle zu bekommen. Das Zittern und die Steifheit in den Gliedern, die ihn wie ein Räuber in der Nacht überfielen. Er hoffte inständig, dass es noch keiner bemerkt hatte. Langsam stellte er den Becher wieder ab und atmete tief durch.
Immer wenn das Zittern besonders schlimm war, zog er sich in den Wagen zurück und erzählte Karl und Greta, ihn quälten Kopfschmerzen, wie so oft. Und das war nicht einmal gelogen. Das Glasauge, das er sich für teures Geld von einem venezianischen Glaser hatte machen lassen, drückte und piesackte ihn von Zeit zu Zeit. Seit jenen unheimlichen Geschehnissen vor sechs Jahren in Nürnberg fehlten Johann das linke Auge und ein Finger der rechten Hand. Aber er wusste selbst, dass das Zittern nicht daher rührte.
Er vermutete etwas ganz anderes, weitaus Schlimmeres. Wenn er doch nur …
»Ich … ich … kenne Euch …«
Johann war so in Gedanken versunken, dass ihm entgangen war, wie sich jemand genähert hatte. Es war ein Greis mit schlohweißem Haar, den Rücken schwer gebeugt, als habe er sein Leben lang die Kraxen mit den reifen prallen Trauben getragen. Er war ausgezehrt wie von einer langen Krankheit, seine Finger bebten, als er nun auf Johann deutete.
»Ich … kenne Euch«, wiederholte er leise.
Johann lächelte verkrampft. »Gut möglich. Ich reise öfter durch diesen Ort, da kann es schon sein, dass …«
»Johann!«, flüsterte der Alte, und die kleinen Augen zwischen den Runzeln blitzten kurz auf. »Du bist der kleine Johann, nicht wahr? Natürlich, du bist es!«
Johann zuckte zusammen. Konnte es wirklich sein, dass ihn der Mann erkannt hatte? Verstohlen musterte er den Greis. Und ganz plötzlich wusste er, wer der Alte war! Er sah es an seinen Augen, sie hatten sich nicht verändert. In ihnen stand eine unaussprechliche Trauer, ein Schmerz, der seinen Ursprung vor über zwanzig Jahren hatte. Eine Schuld, die nicht wiedergutzumachen war. Johann dachte an einen dunklen Wald, an eine Teufelsrune und an wispernde Stimmen in der Dunkelheit.
Wer hat Angst vorm Schwarzen Mann …
Von einem Augenblick auf den anderen wurde ihm kalt wie in einem Eiskeller.
Mein Gott …
»Was hast du damals mit meiner Margarethe gemacht?«, fragte der Greis leise. »Meine Tochter … mein geliebter Augenstern …«
»Ihr … Ihr müsst mich verwechseln.« Johann stand abrupt auf. Es war ein Fehler gewesen, das Gasthaus aufzusuchen. Er hätte niemals herkommen dürfen! Er ließ eine Münze auf den Tisch rollen und wandte sich ab. »Ich kenne Euch nicht.« Doch die zittrige Hand des Alten packte ihn an der Schulter.
»Was hast du mit meiner Tochter gemacht?«, wiederholte er, nun schon lauter. Die ersten Gäste sahen zu ihnen herüber. »Welchen Teufel habt ihr damals im Wald gesehen?«
»Ich weiß wirklich nicht, wovon Ihr sprecht«, erwiderte Johann. »Und jetzt lasst mich los. Mein Pferd braucht Futter.«
Er eilte zum Ausgang, während die Stimme des Alten in ihm nachhallte.
Was hast du mit meiner Tochter gemacht? Welchen Teufel habt ihr damals im Wald gesehen?
Als er draußen stand, glaubte er, durch eine der Butzenglasscheiben noch einmal das zerfurchte Gesicht zu erkennen. Es war das Gesicht des alten Knittlinger Pflegverwalters, jenes Mannes, dem er damals das Herz gebrochen hatte. In den letzten zwanzig Jahren war er zum Greis gealtert.
Der Vater von Margarethe.
Was hast du mit meiner Tochter gemacht?
Das Gesicht hinter dem Fenster verschwand, und just in diesem Augenblick krachte ein gewaltiger Donner.
Gleich darauf setzte der Regen ein.
Johann blickte erst wieder auf, als er den Friedhof erreicht hatte. Wie in Trance hatte er das Pferd losgebunden und war davongaloppiert. Der Regen strömte mittlerweile so dicht, dass von den Häusern fast nichts mehr zu sehen war.
Er hätte die Wirtschaft niemals aufsuchen sollen! Von allen noch lebenden Knittlingern war der alte Pflegverwalter derjenige, dem zu begegnen er am meisten gefürchtet hatte. Furchtbare Dinge waren damals geschehen. Im Schillingswald, nicht weit von Knittlingen, hatte Johann damals seine Unschuld verloren – vor allem aber seinen kleinen Bruder Martin und das Mädchen, das er über alles geliebt hatte. Das er bis heute liebte.
Margarethe.
Was damals geschehen war, versuchte er seitdem zu vergessen. Doch es war ihm nie gelungen. In seinen Träumen holte ihn die Vergangenheit immer wieder ein.
Welchen Teufel habt ihr gesehen?
Das war eine Frage, die auch ihn bis heute quälte – obwohl er die Antwort inzwischen ahnte. Damals war der Teufel in sein Leben getreten, er hatte ihm Geld und Ruhm gebracht, er hatte ihn zu dem gemacht, was er heute war. Doch zu welchem Preis?
Johann hielt sein Gesicht in den Regen, und die Tropfen spülten die Erinnerungen fort, auch die an den alten Pflegverwalter. Die nasse Kälte tat ihm gut, sie löschte das Feuer in ihm. Sein eigentliches Ziel war der Friedhof gewesen, da wollte er hin, seit vielen Jahren schon.
Am Gatter band er das Pferd fest und betrat den Gottesacker, wo sich einzelne schiefe Grabsteine in der Dämmerung abzeichneten. Kein Mensch war um diese Stunde zu sehen, der Regen prasselte unaufhörlich, es klang wie Kiesel auf einer Trommel.
Ungeduldig drehte Johann sich zu dem großen schwarzen Wolfshund um, der ihm in einigem Abstand folgte.
»Nun komm schon, Kleiner Satan! Ich muss von jemandem Abschied nehmen, ich versprech dir auch, es wird nicht lang dauern.«
Der Hund schien kurz zu zögern, so als röche er den Tod, der an diesem Ort zu Hause war. Dann folgte er willig seinem Herrn. Johanns Mantel war mittlerweile klitschnass, das Wasser tropfte von der Krempe seines Huts wie aus einer Traufe, die feinen Lederstiefel waren schlamm- und kotbespritzt. Doch all dies nahm er nicht wahr. Mit gesenktem Kopf ging er über den Friedhof und blieb schließlich vor einem kleinen, unscheinbaren Grabstein gleich neben der Friedhofsmauer stehen. Der Stein war vermoost und stand schief, als wäre er bereits viele Hundert Jahre alt. Efeu rankte daran empor, schon lange hatte keiner mehr das Grab gepflegt. Johann bückte sich und wischte Dreck und Zweige beiseite, sodass zumindest der Name darauf lesbar war.
Elisabeth Gerlach, gestorben am 12. August, im Jahre des Herrn 1494
24 Jahre …
Johann konnte kaum glauben, dass seitdem so viel Zeit vergangen war. Damals war er ein junger sechzehnjähriger Bursche gewesen, den Kopf voller Flausen, erfüllt mit Träumen und Hoffnungen, der Stolz seiner Mutter, die hier begraben lag – und von der er ein letztes Mal Abschied nehmen wollte. Er hatte ein Mädchen aus Knittlingen geliebt und mit seinem kleinen Bruder Martin in den Weinhängen westlich der Stadt gespielt. Und nun? Das Mädchen und der Bruder waren ebenso tot wie die Mutter, und seine Träume und Hoffnungen zerstoben wie Blätter im Herbstwind. Die geliebte Mutter, vor deren Grab er nun stand, hatte ihm damals eine große Zukunft prophezeit, eine Zukunft, die ihr jemand in den Sternen gelesen hatte; sie war es auch gewesen, die ihn als Erste Faustus genannt hatte.
Faustus, der Glückliche …
Johann lachte traurig und leise, während er den Blick unverwandt auf das Grab seiner Mutter gerichtet hielt. Für dieses Glück hatte er einen hohen Preis bezahlt.
Und seit einigen Monaten glaubte er zu wissen, dass der Preis noch viel höher ausfallen würde als befürchtet.
»Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit, in Ewigkeit, Amen.«
Mühsam richtete Johann sich auf. Beten war ihm nie leichtgefallen, wohl auch deshalb, weil er nicht wirklich daran glaubte. Außerdem kam das verfluchte Zittern zurück. Trotzdem fühlte er sich nun leichter, der Besuch hatte ihm gutgetan.
Der Hund knurrte und riss Johann aus seinen Gedanken.
»Ruhig, Kleiner Satan!« Argwöhnisch sah er sich um und bemerkte eine Bewegung hinter einem der weiter entfernten Grabsteine. Ein Schemen zeichnete sich dort ab, im Rauschen des Regens glaubte Johann, ein hartes, schürfendes Geräusch zu hören. Erst nach einer Weile erkannte er das Geräusch einer Schaufel, die gegen Erde und Steine schlug.
»Wer ist da?«, rief er gegen den Wind an. Er hatte keine Lust, noch jemandem aus dem Ort zu begegnen. Das Zusammentreffen mit dem alten Pflegverwalter hatte ihm gereicht. »Wer auch immer es ist – ich habe einen Hund bei mir. Einen sehr großen Hund, der keine Überraschungen mag!«
Hinter dem Grabstein richtete sich ein Mann auf. Er hielt eine kleine, im Wind flackernde Laterne in der Hand, sodass sich seine dürre Gestalt wie ein Scherenschnitt vor dem dunklen Hintergrund abzeichnete. Ebenso wie Johann trug er einen Schlapphut, an seinem steckte eine rote Hahnenfeder. Sein Gesicht blieb unter der Krempe verborgen, am Grabstein neben ihm lehnte eine Schaufel.
Nur der Totengräber, dachte Johann erleichtert. Gestorben wird immer, bei jedem Wetter.
»Gott grüße Euch!«, sagte er und hob die Hand.
Der Mann verharrte kurz, dann kam er mit der Laterne langsam auf ihn zu. Er war hager wie eine Vogelscheuche, dabei ging er leicht gebückt, als hätte er einen Buckel. Eine schmutzige Augenklappe bedeckte die rechte Gesichtshälfte.
»Keine gute Zeit für einen Friedhofsbesuch«, brummte er. Seine Stimme war weich und wohltönend, und Johann fiel auf, dass sie nicht so klang, als sei er aus dem Kraichgau.
»Ein … alter Freund von mir liegt hier«, erwiderte Johann und deutete auf die Grabsteine vor sich. »Ich war auf der Durchreise, da wollte ich ein kurzes Gebet für ihn sprechen.«
Der Mann nickte, ohne die Grabsteine anzusehen. Dann musterte er schweigend sein Gegenüber.
»Ihr seid wohl nicht von hier«, stellte der Mann schließlich fest.
»Das ist wahr.« Johann zuckte mit den Schultern. »Aber ich habe früher …« Er zögerte. »Nun, ich habe früher einige Leute in Knittlingen gekannt.«
Wieder sah er das runzlige Gesicht des Pflegverwalters vor sich, und er hörte dessen Stimme.
Was hast du mit meiner Tochter gemacht? Welchen Teufel habt ihr damals im Wald gesehen?
O ja, er hatte damals große Schuld auf sich geladen …
»Ist mit Euch alles in Ordnung, mein Herr?« Der Totengräber kam noch einen Schritt auf ihn zu, und Kleiner Satan knurrte, wie er es immer tat, wenn sich Fremde seinem Herrn näherten.
Doch nun geschah etwas Seltsames: Der Totengräber beugte sich zu Kleiner Satan hinunter und tätschelte ihm den Kopf, als wäre er ein niedliches Schoßhündchen, und dieser ließ es sich zu Johanns Erstaunen gefallen. Noch nie hatte Johann gesehen, dass Kleiner Satan sich von einem anderen als ihm selbst oder vielleicht noch Greta streicheln ließ.
»Dieser … alte Freund stand Euch wohl sehr nah?«, erkundigte sich der Mann, während er den Hund hinter den Ohren kraulte.
»Näher als jeder andere Mensch«, sagte Johann zögerlich.
»Ha!« Der Mann grinste und zeigte sein erstaunlich weißes, noch völlig intaktes Gebiss. »Und trotzdem ist er jetzt nur ein Haufen modriger Knochen. Ist es nicht traurig, was aus uns wird? Gott hat uns als sein Ebenbild erschaffen, und am Ende sind wir nichts weiter als stinkende Madensäcke. Egal, ob Kaiser, Papst oder Bettler.« Der Totengräber seufzte und richtete sich wieder auf. Er sah wirklich erschreckend mager aus, so als wäre er selbst nur ein Haufen Knochen.
»Ich habe so viele Menschen in die Grube gesenkt, alte, junge, Greise und Kinder … Bei den Kindern ist es am schlimmsten.« Er zuckte die Achseln. »Ich meine, warum lässt Gott so etwas zu? Warum hat er uns nicht Mittel und Wege aufgezeigt, wie wir das Sterben aufhalten können? Vom Tag unserer Geburt an beginnen wir zu verfaulen und abzusterben. Spürt Ihr es auch? Wir sterben ständig, jeden Tag ein wenig mehr.«
Johann schwieg, wobei er sein Gegenüber aufmerksam betrachtete. Plötzlich war er sich nicht mehr sicher, ob es sich bei dem Mann mit der Augenklappe wirklich um den Knittlinger Totengräber handelte. Dafür redete er im Grunde viel zu gewählt, eher wie ein Pfarrer, wobei ein Pfaffe niemals so über Gott gesprochen hätte. Der Mann kam nun noch ein Stück näher, und Johann glaubte, einen leichten Geruch von Schwefel wahrzunehmen.
»Wisst Ihr was?«, flüsterte ihm der Fremde ins Ohr, sein Atem war feucht und stickig wie ein schmutziger Lappen. »Ich denke, das Sterben ist der Preis, den wir alle zahlen müssen, der Preis für das Leben. Alles hat seinen Preis, und jeder muss einmal bezahlen. Irgendwann, aber zahlen muss er. Begreift Ihr, wovon ich spreche?«
»Ich … ich denke, ja«, krächzte Johann. Ihn schauderte. Dieses Gespräch wurde immer unheimlicher. Nervös sah Johann sich nach Kleiner Satan um, der hinter einen der Grabsteine gekrochen war, so als hätte er große Angst. Was war nur mit dem verdammten Köter los?
Der Mann trat wieder einen Schritt zurück und lächelte breit. In seinem Mund waren spitze Zähne zu sehen, die an einen Wolf denken ließen.
»Ha! Wusste ich es doch! Es gibt nicht viele, die mich verstehen. Nicht viele, die bereit sind, weiter zu gehen als die anderen, die mehr sehen wollen, die niemals ruhen.« Er senkte die Stimme. »Seid Ihr bereit, Euren Preis endlich zu zahlen, Doktor Faustus? Seid Ihr bereit?«
Ohne auf eine Antwort zu warten, wandte sich der Mann ab und stapfte, die Laterne in der Hand, durch den Regen davon.
Johann war so verblüfft, dass er ihm erst nach einer Weile nachrief: »He! Woher kennt Ihr meinen Namen? Wer … wer seid Ihr?«
Doch in diesem Augenblick verlosch das Licht der Laterne, der Fremde war so plötzlich verschwunden, wie er erschienen war. Johann lauschte. Im plätschernden Regen glaubte er, ganz entfernt eine leise Melodie zu hören. Einzelne Flötentöne wehten von jenseits der Friedhofsmauer zu ihm herüber, vielleicht kamen sie auch aus dem Gasthaus. Es waren die Klänge eines Kinderlieds.
Suse, liebe Suse, was raschelt im Stroh? Es sind die lieben Gänslein, die haben keine Schuh …
Wie erstarrt stand Johann am Grabstein seiner Mutter. Erst nach einer Weile schrak er auf wie aus einem bösen Traum und machte sich auf den Heimweg. Er stieg auf sein Pferd und preschte durch das Unwetter, vorbei an dem verdutzten Torwächter, so schnell, als wäre ihm der Teufel auf den Fersen. Der Hund hetzte hinterher. Erst viel später fiel Johann auf, dass er sich nicht daran erinnern konnte, wie das Gesicht des Mannes eigentlich ausgesehen hatte.
Es war, als hätte der Regen es einfach weggespült.
Weit oben, zwischen Hagelwolken und dunklen Regenschwaden, zogen drei Vögel ihre Bahn. Es waren zwei Krähen und ein großer alter Rabe mit zerrupftem Gefieder und schartigem Schnabel. Als sie die leise Melodie irgendwo unter sich hörten, flogen sie krächzend zurück zu ihrem Herrn. Der hagere Mann stand noch immer zwischen den Grabsteinen, am äußersten Ende des Friedhofs, weit entfernt von der Kirche. Er mochte Kirchen nicht. Mit seinen langen, fast insektenartigen Fingern spielte er die Flöte und entlockte ihr jene Töne, denen der Rabe und die Krähen seit so vielen Jahren folgen mussten.
»Er hat sich nicht verändert, nicht wahr?«, sagte der Meister, während die Vögel auf einem frischen, dampfenden Grabhügel nach Würmern und Maden pickten. »Für mich ist er immer noch der gleiche vorlaute Bengel, auch wenn jetzt alle Welt vom großen, ach so berühmten Doktor Faustus spricht und sich dabei in die Hosen scheißt. Das Schaudern ist der Menschheit bestes Teil.« Er lachte leise. »Mein kleiner Faustus! Wann wirst du endlich begreifen, dass die Würfel längst gefallen sind? Die Sterne lügen nicht.«
Er steckte die Flöte ein, dann nahm er den Schlapphut ab, der bislang sein Gesicht verborgen hatte, entfernte die Augenklappe und wischte die Schminke fort. Schon so vieles war er gewesen, Zauberer, Spielmann, Söldner, Quacksalber, Graf, Baron und Bettler. Nun eben auch Totengräber. Im Grunde eine Rolle, die ihm ohnehin lag.