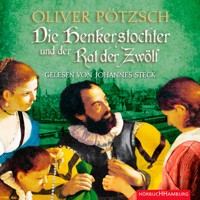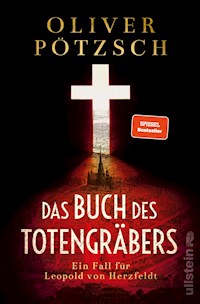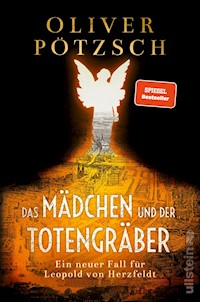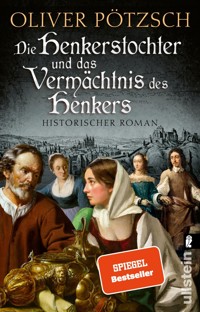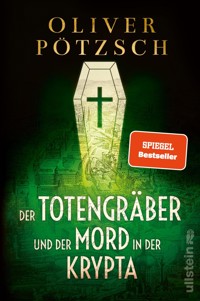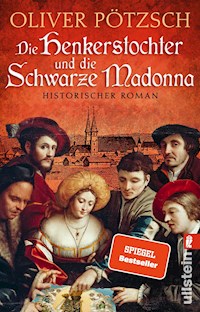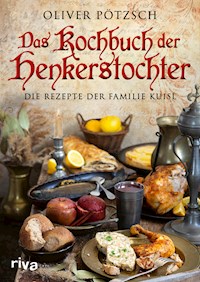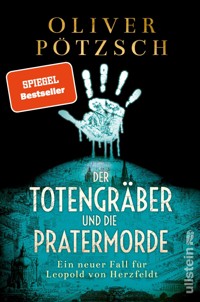
13,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Ullstein eBooks
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
Hinter Wiener Schmäh und Zauberkunst lauert ein grausamer Mörder Wien, 1896: Ausgerechnet bei dem Zaubertrick »Die zersägte Jungfrau« stirbt die junge Bühnendarstellerin vor dem schockierten Publikum. Inspektor Leopold von Herzfeldt ermittelt, ihm dicht auf den Fersen ist die Reporterin Julia Wolf, seine unglückliche große Liebe. Rund um den Prater werden weitere Frauen getötet. Junge Dirnen und Dienstmädchen, die keiner groß vermisst. Jede der Toten ist anders verkleidet. Ist es ein und derselbe Mörder? Leo braucht Unterstützung und wendet sich an seinen Freund Augustin Rothmayer. Der Totengräber des Wiener Zentralfriedhofs schreibt an einem neuen Buch, »Was uns die Toten erzählen«, und ist in Experimente vertieft. Doch nur gemeinsam können Leo, Julia und Augustin das grausame Spiel des Mörders aufhalten.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Der Totengräber und die Pratermorde
OLIVER PÖTZSCH, Jahrgang 1970, arbeitete nach dem Studium zunächst als Journalist und Filmautor beim Bayerischen Rundfunk. Heute lebt er als Autor mit seiner Familie in München. Seine historischen Romane haben ihn weit über die Grenzen Deutschlands bekannt gemacht: Die Bände der Henkerstochter-Serie sind internationale Bestseller und wurden in mehr als 20 Sprachen übersetzt. Auch seine Totengräber-Serie landet regelmäßig auf der Spiegel-Bestsellerliste.
Die Wiener liegen zwei weltbekannten Zauberkünstlern zu Füßen: Hans Sobers, genannt der Große Bellini, und Charles Banton, bekannt für seine spektakulären Showeinlagen. Bei einer neuartigen Nummer, der »Zersägten Jungfrau«, geschieht Furchtbares: Bantons Assistentin wird tatsächlich zersägt. Jemand hat den Apparat manipuliert.Inspektor Leopold von Herzfeldt ermittelt im Prater zwischen Artisten, Schaustellern und Vergnügungswütigen. Doch nicht alle vertrauen ihm. Die Reporterin Julia Wolf kommt an Informationen, die Leo verschlossen bleiben. So erfährt nur Julia, dass auf dem Prater seit einigen Monaten immer wieder Mädchen verschwinden. Und sie findet auch den ersten Hinweis auf eine Frauenleiche. Es bleibt nicht bei der einen Toten.Bei der anschließenden Obduktion helfen die wissenschaftlichen Studien des Totengräbers Augustin Rothmayers. Er schreibt ein neues Buch und hat keine Zeit, Inspektor Herzfeldt und Julia Wolf zu unterstützen. Doch ohne ihn geht es nicht.
Oliver Pötzsch
Der Totengräber und die Pratermorde
Ein neuer Fall für Leopold von Herzfeldt
Ullstein
Besuchen Sie uns im Internet:www.ullstein.de
© Ullstein Buchverlage GmbH, Friedrichstraße 126 10117 Berlin 2025 Wir behalten uns die Nutzung unserer Inhalte für Text und Data Mining im Sinne von § 44b UrhG ausdrücklich vor. Bei Fragen zur Produktsicherheit wenden Sie sich bitte an [email protected]: zero-media.net, MünchenTitelabbildungen: © Granger / Bridgeman Images (Stadtansicht Wien); © FinePic®, München (Hand)Karten von Wien: © Peter Palm, Berlin
Emojis werden bereitgestellt von openmoji.org unter der Lizenz CC BY-SA 4.0.
Auf einigen Lesegeräten erzeugt das Öffnen dieses E-Books in der aktuellen Formatversion EPUB3 einen Warnhinweis, der auf ein nicht unterstütztes Dateiformat hinweist und vor Darstellungs- und Systemfehlern warnt. Das Öffnen dieses E-Books stellt demgegenüber auf sämtlichen Lesegeräten keine Gefahr dar und ist unbedenklich. Bitte ignorieren Sie etwaige Warnhinweise und wenden sich bei Fragen vertrauensvoll an unseren Verlag! Wir wünschen viel Lesevergnügen.
Hinweis zu UrheberrechtenSämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten. Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken, deshalb ist die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.In diesem E-Book befinden sich Verlinkungen zu Webseiten Dritter. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass sich die Ullstein Buchverlage GmbH die Inhalte Dritter nicht zu eigen macht, für die Inhalte nicht verantwortlich ist und keine Haftung übernimmt.
Inhalt
Das Buch
Titelseite
Impressum
Karte von Wien
Dramatis Personae
Prolog
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
Kapitel 28
Kapitel 29
Kapitel 30
Kapitel 31
Kapitel 32
Epilog
Nachwort
Glossar
Social Media
Vorablesen.de
Cover
Titelseite
Inhalt
Karte von Wien
Widmung
Für meine Großväter Karl-Heinz Werner und Heinz Pötzsch, von denen ich die Lust zum Fabulieren und zum Musizieren erbte
»Wie da Calafati auf’m Prater Ringelspü’, steh’ i do und i waß net, wie ma gschiecht,
Wie da Calafati auf’m Prater Ringelspü’,
Alles draht si um mei gelb’s Chineseng’sicht.«
(Peter Cornelius)
Karte von Wien
Dramatis Personae
Wiener Polizeidirektion
Oberinspektor Leopold von HerzfeldtInspektor Erich LoiblOberinspektor Paul LeinkirchnerOberpolizeirat Moritz Stukart
Wiener Zentralfriedhof
Augustin Rothmayer, Totengräber
Anna, ein Waisenmädchen
Neues Wiener Journal
Julia Wolf, Reporterin und Fotografin
Harry Sommer, Chefreporter
Jakob Lippowitz, Verleger
Im Prater
Mathias Kratky-Baschik, Besitzer des Zaubertheaters im Prater
Paul Busch, Zirkusdirektor
Adele Steinhäuser, sogenannte Bürgermeisterin des Volkspraters
Billa, Akrobatin im Zirkus Busch
Messer-Charlie, Messerwerfer im Zirkus Busch
Amanda von Oeser, Zauberkünstlerin und Schlangenfrau
Weitere Personen
Charles Banton, amerikanischer Zauberer
Pascal Chabrice, Bantons Assistent
Hans Sobers alias »Der Große Bellini«, Zauberer
Laurenz Wilhelm Waldmann, Besitzer des Ronacher-Theaters
Professor Eduard Hofmann, Leiter des Instituts für Gerichtliche Medizin
Adelheid Rinsinger, Leos Vermieterin
Die Fette Elli, Bordellbesitzerin vom
Dragoner
Bruno, Türsteher im
Dragoner
Roter Emil, ein Freund Annas
Margarethe, eine Freundin Julias
Fritz Hartkämper, Pianist und ein Freund Julias
Cäcilie Vondraczek, Julias Vermieterin
Max Malchow, Torwart der First Vienna
Nathaniel Meyer von Rothschild, Baron
Esther, seine Nichte
Prolog
Wiener Prater, in der Nacht zum Donnerstag, den 7. Mai 1896
Die Squaw hörte ihren eigenen Atem, so laut, als wäre es das einzige Geräusch auf der Welt. Ihren Atem und das Klatschen der weichen Ledermokassins auf dem matschigen Boden.
In den Pfützen zu ihren Füßen lagen schimmlige Reste von alten Semmeln, der Zipfel einer Bratwurst, aufgeweichte Papiertüten … Um sie herum waberte die Dunkelheit, es gab nur eine Notbeleuchtung, ein paar Gaslaternen, die sich im Abstand von etwa fünfzig Metern schwach glimmend entlang der Prater-Ausstellungsstraße reihten. Und dahinter tiefe Schwärze.
Diese Schwärze war ihr Ziel. Dort, so hoffte sie, konnten ihre Verfolger sie nicht finden.
Die Squaw rutschte aus, fiel in eine der Pfützen und richtete sich keuchend wieder auf. Die Perücke mit den beiden schwarzen Zöpfen hing ihr schief ins Gesicht. Jeder Schritt tat ihr weh, die Lunge schmerzte, vor allem aber war da diese unendliche Müdigkeit. Nur die nackte Todesangst ließ sie noch weiterlaufen.
Weg von den Männern, weg von der Hölle, in der sie sich eben noch befunden hatte!
Marie wusste selbst nicht genau, wie ihr die Flucht gelungen war. Vermutlich war die Dosis, die sie ihr verabreicht hatten, nicht stark genug gewesen. Irgendein verfluchtes Zeug, das sie schläfrig und willenlos gemacht hatte. Die Männer hatten geglaubt, sie wäre ohnmächtig, und hatten sie einfach liegen lassen, während sie die weiteren Schritte besprachen. Das Nächste, woran Marie sich erinnern konnte, war, dass sie rannte, die Treppe hinauf, hinaus ins Freie. Und nun war sie hier, nachts, zwischen den vielen Praterbuden mit den verrammelten Fenstern und verriegelten Läden.
Es herrschte Totenstille.
Der Volksprater, der vor ein paar Stunden noch so heimelig und einladend angemutet hatte, voll mit Tausenden von Besuchern, kam ihr jetzt, zur Wolfsstunde gegen drei Uhr früh, wie ein großes Ungeheuer vor. Kein Mensch war unterwegs, nirgendwo war ein Wachmann zu entdecken. Irgendwo hinter Marie ragte monströs die Figur des großen Chinesen auf, des sogenannten Calafati, der über das berühmte Ringelspiel wachte. In Maries von Drogen vernebelter Vorstellung stakte der Chinese auf seinen langen hölzernen Beinen, mit wehendem Umhang und ausgestreckten Armen, hinter ihr her. Auf den Dächern der Buden kauerten Teufeln gleich krumme Gestalten, ein böser Kasper winkte vom Kindertheater neben dem Hippodrom zu ihr herüber.
Huhu, Marie! Komm her, schöne Squaw, ich hab ein Geschenk für dich …
In weiter Ferne glaubte Marie das Klingeln einer Pferdetramway zu hören, das Klackern von Hufen … Hoffnung keimte in ihr auf. Wenn sie es nicht in die schützende Dunkelheit des Praterparks schaffte, dann ja vielleicht bis auf die große Hauptallee, wo auch mitten in der Nacht noch Kutschen verkehrten. Oder sie stieß auf eines der vielen Pärchen, die die Büsche gerne als Liebesnest nutzten …
Erst jetzt spürte sie, wie sehr sie fror. Sie trug nur einen kurzen Lederrock und darüber eine Art Korsett aus Lederriemen. Ihre billigen Mokassins waren längst durchweicht, die Kriegsbemalung im Gesicht verschmiert, die Perücke klebte nass auf ihrem Kopf. Vorhin bei dem Sturz hatte sie sich die Knie blutig geschrammt, der Schmerz kroch langsam in ihr Bewusstsein. Wohin sollte sie sich wenden, wohin fliehen? Vielleicht in eine der schmalen Seitengassen oder …
In diesem Augenblick hörte sie Schritte.
Einen Moment lang glaubte sie noch, es seien ihre eigenen. Doch als sie kurz innehielt, hörte das Geräusch nicht auf.
Schlapp, schlapp, schlapp …
Es war das Trapsen schwerer Männerschuhe. Und sie kamen näher, immer näher.
Schlapp, schlapp, schlapp …
Marie unterdrückte einen Schrei und taumelte weiter. Die Müdigkeit wurde nun immer größer, eine bleierne Schwere breitete sich in ihr aus, sie musste sich ausruhen, irgendwo …
Intuitiv wandte sie sich nach links, wo ein fast unsichtbarer schlammiger Pfad an einem größeren Gebäude entlangführte. Marie glaubte, das Gebäude zu kennen, doch der Name fiel ihr partout nicht ein. Schwer atmend lehnte sie sich gegen die Holzwand in der Hoffnung, dass die Männer vorbeirennen würden.
Nur kurz ausruhen …
Es gab ein quietschendes Geräusch. Sie keuchte stöhnend, als die Wand hinter ihr plötzlich nachgab. Erst jetzt bemerkte Marie, dass da eine Tür war, die offenbar jemand nicht richtig verschlossen hatte. Ihre Rettung! Sie stürzte hinein und machte die Tür leise hinter sich zu.
Sofort war es merklich wärmer, dafür noch dunkler als draußen, so als wäre die Dunkelheit um sie herum schwarze Tinte, die ihr über die Finger floss. Marie tappte suchend herum, bis sie einen Schalter ertastete. Als sie ihn herunterdrückte, ertönte ein Klacken, dann ein Brizzeln, schließlich leuchtete flackernd eine einzelne elektrische Birne oben an der Decke auf. Offenbar war das Gebäude bereits elektrifiziert, es musste also etwas Bedeutendes sein, keine einfache Wurfbude, sondern …
Als sie sich umwandte, entfuhr ihr ein leiser, kieksender Schrei. Direkt unter der zuckenden Glühbirne stand eine Gruppe Menschen, die sie allesamt böse anstarrten. Sie trugen altertümliche Kostüme und Ritterrüstungen, manche hatten Perücken auf, hielten Bücher, Fernrohre oder Schwerter in den Händen. Eine Dame mit turmhoher Frisur saß auf einem Thron, mit so hochmütigem Blick, als wollte sie fragen, was sich dieses junge verkleidete Mädchen eigentlich herausnahm, so einfach hereinzuplatzen.
Die Menschen rührten sich nicht, sie standen wie erstarrt. Nun wusste Marie auch, wo sie war. Sie befand sich in Präuschers Panoptikum, und zwar in der berühmten Abteilung mit dem Wachsfigurenkabinett, das wohl die meisten Wiener schon mal besucht hatten. Auch sie selbst war als Kind hier gewesen. Bereits damals hatte sie sich furchtbar gegruselt beim Anblick all der steifen Figuren vergangener Zeiten, doch das war tagsüber gewesen. Jetzt in der Nacht, beleuchtet nur durch eine einzelne Glühbirne, da …
Marie zuckte zusammen.
Verdammt, die Glühbirne! Du bist so dumm, so schrecklich dumm!
Wenn es irgendwo Fenster gab, dann war das Leuchten sicherlich durch die Schlitze draußen zu sehen. Außerdem brummte irgendwo ein Generator, das Geräusch erschien ihr plötzlich ohrenbetäubend laut.
Doch es war nicht so laut, dass es das Quietschen übertönt hätte, das nun von der Tür her kam. Kurz darauf erklangen wieder die vertrauten Schritte.
Schlapp, schlapp, schlapp …
Marie wimmerte leise. Sie waren hier! Irgendwo hinter ihr waren sie … Nur weg, weg, sich verstecken, irgendein Mauseloch finden, in das sie sich verkriechen konnte!
Bitte, lieber Herrgott, hilf mir, bitte, bitte …
Das Wachsfigurenkabinett war groß, es nahm fast die Hälfte des Panoptikums ein. Marie hetzte vorbei an römischen Gladiatoren und mumifizierten Inkapriestern, stolperte beinahe über einen Sarg, aus dem eine Hand ragte, streifte einen Erhängten, der an einem Galgen baumelte, und prallte schließlich auf eine Gruppe zornig aussehender Männer, von denen einige Pistolen trugen, andere große Messer, einer ein im Licht der Glühbirne glänzendes Schlachterbeil. Unter jeder Figur war ein Namensschild angebracht. Maries Blick streifte eines der Schilder ganz links, zu Füßen eines galanten Herrn mit geöltem Schnauzer und feschem Anzug.
Hugo Schenk, Hochstapler und Frauenmörder.
Der Mörder lächelte ihr zu.
Und auch eine der anderen Figuren lächelte jetzt. Sie spitzte hinter Hugo Schenk hervor, wackelte schelmisch mit dem Kopf und zog dabei eine Grimasse.
»Guckguck, Marie, hab ich dich!«, kicherte sie. »Wir sind noch nicht fertig. O nein, noch lange nicht. Na, kleine Indianersquaw, wo ist dein Tomahawk? Lääääächeln …«
Dann stürzte sich der Mann mit dem Schlachterbeil auf sein schreiendes Opfer.
Kapitel 1
Am darauffolgenden Abend, im 1. Bezirk
Über ganz Wien lag ein Zauber.
Eben noch hatte es wie aus Kübeln geregnet, die Menschen in der Himmelpfortgasse hatten in Hausnischen und unter den Vordächern der umliegenden Geschäfte Zuflucht gesucht. Junge Männer in Frack und Zylinder boten herbeieilenden Damen ihren Schirm an, teure Frisuren sanken zu nassen Haarknäueln zusammen, Fiaker preschten durch das Wasser des Rinnsteins und bespritzten knöchellange Röcke, gestreifte Hosen, aufwendig drapierte Blumenhüte und bauschige Ballkleider.
Doch so abrupt, wie der Regen gekommen war, hörte er auch wieder auf. Fast im gleichen Moment flammten im 1. Bezirk die zahlreichen elektrifizierten Kohlebogenlampen auf, ihr heller Schein spiegelte sich in den Pfützen und ließ ausgelaufenes Schmieröl in bunten Farben schimmern. Im Nebel der aufsteigenden Feuchtigkeit sahen die herabhängenden milchigen Glaskolben aus wie monströse Leuchtkäfer.
Julia blickte hinüber zu einer der Lampen, lauschte dem Brizzeln der darin gefangenen Elektrizität. Verträumt schloss sie die Augen.
Das Geräusch der neuen Zeit, dachte sie.
Noch vor ein paar Jahren waren nur der Wiener Volksgarten und einige ausgesuchte Plätze elektrisch beleuchtet gewesen, mittlerweile strahlte die ganze Innere Stadt. Auch der sie umgebende Ring mit Oper, Burgtheater, Rathaus und Parlament war elektrifiziert. Und selbst in den Vororten und Vorstädten war der Vormarsch einer neuen, helleren Zeit nicht mehr aufzuhalten. Für Julia, die aus dem düsteren Innviertel stammte und die ersten Jahre ihres Lebens noch im Schein von Glimmspänen und rußigen Petroleumlampen verbracht hatte, war das immer noch ein Wunder, eine Form von Magie. So wie auch die von den Kutschern verfluchten Automobile, die man jetzt vereinzelt in Wien sah, die Grammophone mit ihren laut krächzenden Trichtern in den Tanzlokalen oder die komischen Segelapparate, mit denen sich dieser verrückte Deutsche namens Lilienthal von den Hängen rund um Berlin stürzte.
»Bereit, dich verzaubern zu lassen?«, ertönte eine Stimme neben ihr.
Julia zuckte zusammen. Für ein paar Sekunden hatte sie völlig vergessen, dass sie nicht allein auf dem Gehsteig stand. Sie sah hinüber zu dem jungen Mann mit den buschigen Augenbrauen und den weichen, gutmütigen Augen, der ihr eben die Hand reichte. Es waren Augen, die sie in manchen Momenten an einen treuen Cockerspaniel erinnerten. Und tatsächlich wusste sie, dass sie sich auf Fritz hundertprozentig verlassen konnte.
Anders als auf Leo.
Sie lächelte. »Solange mich dieser Amerikaner nicht mit seinem Säbel in Stücke schneidet, gerne!«
»Oh, keine Sorge, er bevorzugt wohl Jungfrauen, was man so hört.« Fritz grinste und hob die Augenbraue. »Oder bist du etwa …?«
»Das solltest du eigentlich wissen«, gab Julia zurück. Nebeneinander gingen sie über das nasse Trottoir auf das Theater zu, wo sich bereits eine größere Traube von Menschen gebildet hatte. Offenbar versuchten noch etliche Verzweifelte, eine Karte zu ergattern, dabei war die Premiere seit Wochen ausverkauft, ebenso wie alle weiteren Vorstellungen im Mai und im Juni.
Julia betrachtete das Plakat über dem Eingang, von dem ein streng blickender Herr mit hohem Zylinder auf die Menge herunterblickte. Darunter stand in altertümlichen, geschwungenen Buchstaben: The Great Magician Banton, zum ersten Mal in Europa! Versäumen Sie nicht die einmalige Zauber-Show– eine Weltsensation!
Tatsächlich war Bantons Show schon Wochen vor der ersten Aufführung Tagesgespräch in Wien gewesen. Sein Ruf war ihm vorausgeeilt. Charles Banton hatte bereits in London, Rom und eben erst in Paris gastiert. Die Zeitungen überschlugen sich mit Sensationsmeldungen, zumal derzeit neben dem Amerikaner auch noch ein weiterer bekannter Zauberer in Wien gastierte: der Große Bellini, der »Meister der Illusionen«. Auf den Straßen und in den einschlägigen Blättern sprach man bereits von einem »Duell der Zauberer«.
Dass Julia überhaupt Karten für die Premiere hatte, lag an ihrer neuen Tätigkeit. Vor einem halben Jahr erst hatte sie ihre Anstellung als Tatortfotografin beim Wiener Polizeipräsidium gekündigt und war zur Zeitung gewechselt. Ihr alter Freund Harry Sommer hatte ihr einen Posten als Fotografin beim Neuen Wiener Journal beschafft. Seitdem war Julia voll und ganz damit beschäftigt, ihre Bilder von beleibten Operettensängerinnen, bleichen Choleraopfern, entführten Rassepudeln, Kaufhauseröffnungen und Verkehrsunfällen zu entwickeln. Erst gestern war eines dieser neuen Automobile in eine voll besetzte Pferdetramway gerauscht. Es hatte drei Schwerverletzte gegeben, die Pferde musste man notschlachten – kein schöner Anblick, aber Harry hatte ihr eingetrichtert, dass Verkehrsunfälle sich nun mal besonders gut verkauften.
Fast so gut wie eine Zaubershow, bei der eine Jungfrau durchlöchert wird, dachte sie.
»Was verschafft mir eigentlich die Ehre dieses außergewöhnlichen Ereignisses?«, fragte Fritz, während sie sich in die Schlange vor dem Theatereingang einreihten. »Ich meine, ich hab ja nichts gegen Kaninchen aus dem Hut und solche Sachen, aber …«
»Charles Banton ist derzeit der bekannteste Zauberer der Welt«, unterbrach ihn Julia. »Und er kommt aus Amerika. Mit Kaninchen hält der sich nicht auf. Dort ist alles eben eine Nummer größer als bei uns in Europa.« Sie zuckte mit den Schultern. »Aber wenn du es genau wissen willst: Eigentlich wollte Harry mitgehen, er ist immerhin der Chefreporter vom Journal. Doch der Verleger hat ihn kurzfristig nach Budapest geschickt, wo eben eine Untergrundbahn eröffnet werden soll. Eine Untergrundbahn, wie in London!« Julia seufzte. »Da können wir in Wien wohl noch lange drauf warten! Vermutlich liegen hier überall so viele alte Knochen im Boden, dass man gar nicht tief genug graben kann.«
»Ich bin also wieder mal nur eine Verlegenheitslösung«, sagte Fritz stirnrunzelnd.
»Ach, Fritz, nun sei doch nicht gleich beleidigt!« Julia wies auf die vielen Menschen um sie herum. »Sieh’s doch mal so. Ganz Wien will sehen, wie dieser Banton Menschen verschwinden lässt, verbrennt und durchlöchert. Und du darfst dabei sein.«
»Ich kann mir nichts Schöneres vorstellen«, brummelte Fritz und reichte ihr sein Taschentuch. »Dein Hut tropft übrigens, Frau Reporterin.«
Julia nahm das Tuch und trocknete sich Hut und Haare. Es war rührend, wie Fritz sich um sie kümmerte. Seit gut zwei Monaten waren sie jetzt ein Paar, was bedeutete, dass sie miteinander ausgingen, Fritz sie gelegentlich zum Essen einlud und sie einmal jede Woche gemeinsam Tango tanzten. Ja, im Bett waren sie ein paar Mal gewesen, und auch dort hatte Fritz sich als … nun ja … besonders liebevoll herausgestellt. Das Ganze hatte mehr einem geschwisterlichen Gekuschel geähnelt.
Eben ein treuer Cockerspaniel, dachte Julia. Doch im Grunde hatte sie auch nicht mehr gewollt.
Fritz Hartkämper war der Pianist in der Kaverne, jener Spelunke im 16. Bezirk, wo Julia gelegentlich auftrat, tanzte und sang. In den letzten Monaten nach Julias Trennung von Leo waren Fritz und sie sich nähergekommen. Noch immer konnte sie es nicht fassen, dass sie sich tatsächlich von Leo gelöst hatte. Manchmal wachte sie nachts auf und glaubte, Leo liege neben ihr, doch da war nur ihre schlafende Tochter. Die wenigen Male, die sie bei Fritz übernachtet hatte, fürchtete sie, im Schlaf vielleicht Leos Namen zu murmeln. Sie kam noch immer nicht von ihm los! Auch wenn sie wusste, dass es besser für sie beide wäre. Die Jahre mit Leo waren zwar aufregend gewesen, aber er hatte sich nie so ganz auf sie eingelassen. Wie ein Spuk war er durch ihr Leben gegeistert, ein ständiges Kommen und Gehen. Leo hatte ihr … nicht gutgetan. Außerdem entstammten sie völlig unterschiedlichen Welten, sie ein armes Mädchen aus dem Innviertel, er der Sohn eines Grazer Bankers mit einem »von« im Namen und einem mit seinem Monogramm bestickten Taschentuch in der gebügelten Westentasche.
Es war Julia, die schließlich auf eine Trennung gedrungen hatte. Und da sie auch nicht mehr im Polizeipräsidium arbeitete, waren sie einander seitdem kaum mehr begegnet. Manchmal wünschte sie sich, er würde nach ihr fragen, sich erkundigen, wie es ihr ging. Doch außer zwei, drei larmoyanten Briefen zu Anfang, in denen er vornehmlich sein eigenes Schicksal beklagte, hatte sie nichts mehr von ihm gehört. Fritz half ihr über die Trennung hinweg, aber er spürte wohl, dass er nur ein Lückenbüßer war. Es tat Julia leid, denn Fritz war wirklich nett, zuvorkommend und noch dazu gut aussehend. Auch mit ihrer Tochter Sisi verstand er sich blendend. Eigentlich ein Traum von einem Mann.
Aber er ist eben nicht Leo, dachte sie, während sie noch immer in der Schlange warteten. Herrgott, ist Liebe kompliziert … Armer Fritz!
Endlich kamen sie zum Eingang, wo ein Billeteur in roter Pagenuniform ihre Karten abriss und sie mit wichtiger Geste durchwinkte.
»Hast du den Sanitätswagen draußen vor der Tür gesehen?«, flüsterte ihr Fritz zu. »Anscheinend ist der große Magier nicht hundertprozentig von seinen Nummern überzeugt.«
Julia winkte ab. »Das ist Teil der Show, in London hat er das wohl auch schon gemacht. Die Leute gieren eben nach Blut.«
»Und was ist mit der Überraschung, die Banton über die Zeitungen großspurig angekündigt hat? Irgendeine Weltneuheit, die er heute zum ersten Mal aufführen will …«
»Der Mann kann sich eben gut verkaufen, wie alle Amerikaner.« Julia sah sich in dem brechend vollen Wintergarten um, der an das Theater anschloss. Livrierte Kellner eilten mit Tabletts durch den Raum und reichten Sekt, Wein und kleine Häppchen. »Und das scheint ja auch gut zu klappen«, fügte sie hinzu.
Tatsächlich hatte Charles Banton für Wien eine Sensation angekündigt, irgendeine neue Zauberei. Die Leute munkelten, es habe irgendetwas mit seiner berühmten Säbelnummer zu tun. Bislang war sie stets der Höhepunkt der Show gewesen, die insgesamt als ziemlich blutig und unheimlich galt. Zum Entsetzen der Zuschauer sperrte Banton dabei eine seiner hübschen Assistentinnen in einen Kleiderschrank, den er dann äußerst theatralisch mit einem Dutzend Säbeln durchlöcherte. Kurze Zeit später entstieg die Dame dem Schrank wieder, wie durch ein Wunder unverletzt. Das Ganze wurde von der Musik eines ungarischen Säbeltanzes begleitet, wobei Banton wie ein Derwisch herumwirbelte. Die Zuschauer liebten diese Nummer, vor allem wohl das Frivole, da die Assistentin nur sehr leicht bekleidet war – und ihr Kostüm bei ihrem Wiedererscheinen Löcher und Risse an höchst appetitlichen Stellen zeigte. Die Kirche und konservative Kreise hatten sich bereits mehrmals beschwert, was den Kartenverkauf nur noch weiter ankurbelte.
Charles Banton hatte das Ronacher gleich für zwei Monate gemietet. Das Theater in der Himmelpfortgasse bot Platz für fast fünfhundert Gäste, außerdem war es als eines der ersten Theater elektrifiziert. Mit stiller Wehmut dachte Julia daran, dass sie auch mit Leo schon einmal hier gewesen war. Doch dann fiel ihr ein, dass Leo sie damals wie so oft hatte sitzen lassen, wegen eines komplizierten Falles.
Beinahe trotzig drückte sie Fritz’ Hand und ging mit ihm am Wintergarten entlang und durch den großen Theatersaal, in dem überall kleine, mit weißen Tüchern und Servietten gedeckte Tische standen. In den mit Putten und Girlanden verzierten Logen brannten milchige Glühbirnen, ebenso in dem großen Kronleuchter, der von der Decke hing. An der Kopfseite des Theaters befand sich die Bühne, die von einem schweren samtschwarzen Vorhang, auf dem silberne Monde und Sterne zu sehen waren, verdeckt wurde. Der Vorhang bewegte sich leicht, als ob dahinter noch irgendwelche letzten Vorbereitungen getroffen würden. Die Zuschauer, die hinter ihnen den Saal betraten, murmelten aufgeregt und begaben sich auf ihre Plätze.
»Alle Achtung«, sagte Fritz anerkennend, als sie einen Tisch nahe an der Bühne ansteuerten. »Der Platz war sicher nicht billig. Deine Zeitung muss Geld wie Heu haben.«
»Der Verleger will, dass ich Banton ein wenig über die Schulter schaue, wenn ich über seine Tricks schreibe«, erklärte Julia. »Aufnahmen darf ich keine machen. Also wird später ein Zeichner beschäftigt, und der will sicher auch Details von mir wissen.« Sie setzte sich und kramte Notizblock und Bleistift aus ihrer Damenhandtasche.
Tatsächlich freute sich Julia, dass sie bei dieser Geschichte einmal nicht für die Fotografien zuständig war, sondern den Artikel selbst schreiben würde. Es sollte sogar ein Dreispalter für die Aufmacherseite des Feuilletons werden! Nicht nur ihr alter Freund Harry schien gemerkt zu haben, dass sie ein Talent fürs Schreiben besaß. Bislang waren es nur ein paar kleine Geschichten im Regionalteil gewesen, kaum mehr als längere Bildzeilen, doch Julia hoffte, dass Harry ihr irgendwann auch größere Artikel anvertraute. Diese Zaubergeschichte könnte ihre Eintrittskarte dazu werden, das spürte sie. Julia träumte von aufrüttelnden Sozialreportagen, so wie sie in der Arbeiter-Zeitung der Wiener Sozialdemokraten erschienen. Doch bislang hatten sich weder Chefreporter Harry Sommer noch Verleger Lippowitz mit dieser Idee anfreunden können.
Sie hatten einen Tisch für sich allein. Unaufgefordert brachte ihnen ein Ober zwei Flöten mit prickelndem Sekt, und sie prosteten sich zu. Julia sah sich um. Der Saal war bis auf den letzten Platz besetzt, es war die typische Mischung gehobenen Wiener Bürgertums. Das Ronacher war ziemlich teuer, sodass Julia vor allem Männer in exquisiten schwarzen Smokings und Frauen mit überdimensionierten Hüten erblickte. Sie selbst hatte ein dunkelgrünes, hochgeschlossenes Kleid gewählt, dazu eine zierliche Damenweste und lange Handschuhe. Den dünnen Wollmantel, die Federboa und ihren nassen Hut hatte sie an der Garderobe abgegeben.
Eine gespannte Atmosphäre lag über dem Theatersaal. Die Gespräche verebbten nach und nach, alle blickten gebannt nach vorne, als der elektrifizierte Kronleuchter an der Decke schlagartig ausging. Einen Moment lang herrschte absolute Finsternis, ein paar Damen schrien erschrocken auf, dann hob sich der Vorhang langsam und gab den Blick frei auf eine unheimliche Landschaft. Im Hintergrund der Bühne war eine Burgruine zu sehen, vor der ein paar schiefe Grabsteine standen, außerdem gab es eine Kapelle und einen Galgen, dessen Strick mit der Henkersschlinge im Takt einer dröhnenden Glocke hin und her pendelte. Dazu ertönte aus dem Orchestergraben das Klagen von Geigen, begleitet von einer Art Spieluhr.
Die Zuschauer murmelten anerkennend, und auch Julia spürte, wie die Atmosphäre auf sie übergriff. Die Kulisse war geschickt gewählt. Das deutsche Mittelalter war gerade stark in Mode, es versprach den nötigen Grusel, den man für eine solche Vorstellung offenbar benötigte. Außerdem sahen Ruine, Kapelle und Grabsteine täuschend echt aus. Durch das elektrische Licht erstrahlte die Szenerie in einem grünlich-bläulichen Schimmer. Dergleichen hatte Julia noch nie gesehen, die Dekoration war wirklich perfekt! Viel besser als bei den üblichen Varieté-Zauberern im Prater mit Kaninchen, Spielkarten und flatternden Tauben, die den betrunkenen, grölenden Besuchern auf den Kopf kackten.
Plötzlich donnerte eine Pauke, ein Blitz zuckte. Rauch quoll aus dem Bühnenboden, und mit ihm stieg ein groß gewachsener, hagerer Mann in schwarzem Umhang aus der Mitte der Bühne hervor. Die Menschen im Saal schrien überrascht auf.
Der Mann trug einen altertümlichen hohen Zylinder wie der frühere amerikanische Präsident Abraham Lincoln und hielt in der Hand einen knotigen Stecken, an dessen Spitze der Schädel eines Vogels steckte. Sein schwarzer Schnurrbart war sorgfältig gezwirbelt und gewachst, er reichte ihm fast bis zu den Ohren. Der Zauberer verbeugte sich leicht, lüpfte die Kopfbedeckung und klopfte mit dem Stab auf den Boden. Im gleichen Moment flogen zwei Krähen aus seinem Hut und landeten krächzend auf den Zinnen der Burgruine.
Die Zuschauer stöhnten wohlig, und Julia musste grinsen.
Also keine Tauben, sondern Krähen, dachte sie.
»Willkommen auf Castle Ravensteen!«, ertönte die knarrende Stimme des Zauberers mit starkem amerikanischem Akzent. Mit großer Gebärde warf er Zylinder und Umhang von sich und trat nach vorne an den Rand der Bühne, die Hände zur Decke erhoben. »Let the Show begin!«
Es waren die einzigen Worte, die Charles Banton in der nächsten Stunde sprach. In dieser Zeit erlebte Julia eine Vorstellung, die die Zuschauer im wahrsten Sinne des Wortes verzauberte.
Ohne Zweifel beherrschte Banton sein Handwerk, darüber hinaus aber nutzte er geschickt die gruselige mittelalterliche Atmosphäre für seine Show. Er ließ eine Grabplatte schweben, erschien erst plötzlich oben im Turm der Burgruine, um dann im nächsten Moment unten vor der Kapelle zu stehen. Eine hübsche junge Frau im Gewand einer Hexe, mit spitzem Hut und Besen, flog an einem unsichtbaren Seil über die vorderen Reihen hinweg. Später leuchtete im Hintergrund ein Scheiterhaufen, von dem die höchst ansehnliche Hexe mit einem großen, lauten Knall verschwand, und ein Mönch in schwarzer Kutte verwandelte sich in ein Skelett. Das Ganze wurde begleitet von der beklemmenden Musik eines Orchesters, das mit ungewöhnlichen Instrumenten arbeitete. Julia hörte das Wimmern von Gläsern, deren Rand mit dem Finger gerieben wurde, sogar eine singende Säge kam zum Einsatz.
Sie hatte vorher ein wenig recherchiert und wusste bei einigen der Tricks deshalb ungefähr, wie sie funktionierten. Banton arbeitete viel mit einer Laterna Magica, wie sie schon vor einigen Hundert Jahren eingesetzt worden war, hatte aber auch neuere Tricks auf Lager, darunter »Peppers Geist«, ein Illusionszauber, der zunächst in England Furore gemacht hatte. Vermutlich gab es auf der Bühne etliche Spiegel und transparente Glasscheiben und darüber hinaus einen Haufen Technik, die Julia nicht verstand.
Wichtig war aber ohnehin nicht die Technik, sondern die unheimliche Stimmung, mit der Banton spielte. Die Technik war dabei nur das Vehikel. Die Leute gruselten sich fast zu Tode, Frauen kreischten, selbst Männer sprangen gelegentlich entsetzt von ihren Stühlen auf. Eine der Ohnmacht nahe ältere Dame, die nur zwei Reihen entfernt saß, schnüffelte immer wieder an ihrem Riechsalz.
Ab und zu blickte Julia hinüber zu Fritz, der völlig fasziniert schien. Sein anfänglicher Argwohn war offenbar verflogen. Bereits jetzt konnte Julia feststellen, dass die Vorstellung ein voller Erfolg war. In ein paar Tagen würde sie auch die Show des Großen Bellini besuchen. Bantons Konkurrent würde sich schon sehr anstrengen müssen, wenn er in diesem Duell der Zauberer nicht das Nachsehen haben wollte.
Sie selbst hatte sich in der letzten Stunde kaum Notizen gemacht, dafür waren die Nummern zu schnell hintereinander gekommen. Aber auch so würde es ein guter Artikel werden. Eigentlich schrieb er sich von ganz allein, sie musste nur ihre vielen Eindrücke ordnen.
Schließlich klopfte Banton erneut mit seinem Zauberstab auf den Boden, ein Trommelwirbel setzte ein. Gleichzeitig senkte sich ein zweiter schwarzer Vorhang vor der Burgkulisse, sodass die Bühne nun völlig schwarz war.
Der Zauberer vollführte mit dem Stab einige Lockbewegungen, woraufhin von der Bühnenseite ein Sarg hereinschwebte. Direkt vor Banton kam er zum Stehen. Der Zauberer schnippte mit dem Finger, und in einer Rauchwolke erschien erneut die hübsche Hexe von vorhin. Nur war sie nun noch leichter bekleidet, ihr Kleid lag so eng an, dass sie beinahe nackt wirkte. Ein kalkulierter Skandal, der sicher noch mehr ausverkaufte Vorstellungen garantierte.
Wenn die Show nicht vorher vom Wiener Hof verboten wird, dachte Julia. Banton spielt mit dem Feuer. Gespannt wartete sie, was nun als Nächstes geschehen würde.
»Was Sie nun sehen werden«, erhob sich die Stimme des Zauberers, »ist völlig einzigartig. Extraordinary! Noch nie wurde dergleichen auf einer Bühne aufgeführt! Eine Weltneuheit! Ich werde diese junge hübsche Lady …« Er machte eine dramatische Pause und deutete auf seine knicksende Assistentin. »Zersägen!«
Mit dem letzten Wort verschwand der Zauberstab, und in den Händen hielt Banton plötzlich eine lange, gezackte Säge. Einige Frauen im Publikum kreischten entsetzt, ansonsten herrschte gebannte Stille.
Wieder setzte die unheimliche Musik ein, die Geigen kratzten ein nervtötendes Crescendo. Gleichzeitig öffnete Banton den Sargdeckel, und die junge Frau stieg mit einem Lächeln hinein. Kurze Zeit später spitzten ihre Schuhe an der Fußseite aus dem Sarg, ihr Kopf war auf der anderen Seite zu sehen. Die Musik steigerte sich, wurde lauter und lauter, während Charles Banton oben am Sarg die Säge ansetzte …
Und zu sägen begann.
Julia spürte, wie ihr Gänsehaut über den Rücken kroch. Das hier war packender als alles, was in der ohnehin grandiosen Vorstellung zuvor schon zu sehen gewesen war, und vor allem so … so … real.
Der Kopf der Frau zuckte wild hin und her, ihr Mund stand weit offen; sie begann zu schreien, ja, verzweifelt zu kreischen, doch wegen der lauten Musik ging ihr Geschrei unter. Anerkennend bemerkte Julia, dass das junge Mädchen die Todesangst wirklich hervorragend spielte. Bantons Säge fuhr immer tiefer in den Sarg, wild zuckte das gezackte Blatt vor und zurück. Der Zauberer hatte den länglichen Kasten bereits zur Hälfte in der Mitte durchtrennt, als er plötzlich zurücksprang und ebenfalls schrie.
»O my God, stop, stop it!«
Die Musik ging noch eine kurze Zeit weiter, dann verebbte sie so dissonant, als wären sich die Musiker nicht einig, wie sie aufhören sollten. Banton hatte die Säge fallen lassen und starrte auf den Sarg vor sich. Der Kopf der jungen Frau war nach hinten gekippt, mit offenem Mund und aufgerissenen Augen starrte sie an die Decke. Sie gab keinen Laut mehr von sich.
Im gleichen Moment sah Julia das Blut, das vom Sarg auf den Boden tropfte. Viel Blut, das sich zu einer Pfütze auf der Bühne sammelte.
Und früher als die meisten Zuschauer erkannte sie, was geschehen war.
Das war kein Trick, kein Kunstblut.
Der Zauberer Charles Banton hatte seine Assistentin tatsächlich entzweigesägt.
Im gleichen Moment begriffen es auch weitere Gäste, erst einige wenige, dann immer mehr. Das Schreien, Heulen, Kreischen und Klagen breitete sich von den vorderen bis zu den hinteren Reihen aus, es schwoll an und erreichte schon bald ohrenbetäubende Lautstärke.
Dann stürzten die ersten Menschen aus dem Saal.
Leo starrte auf die dampfende Surstelze vor ihm, und ihm wurde übel.
Er wusste selbst nicht mehr, warum er das fette Stück Fleisch, das auf einem Berg Kraut lag, überhaupt bestellt hatte. Vielleicht, weil er den ganzen Tag noch nichts Vernünftiges gegessen hatte und sicher gewesen war, Hunger zu haben. Doch er verspürte keinerlei Appetit, so wie er eigentlich auch die letzten Tage und Wochen schon keinen rechten Appetit gehabt hatte – sehr zur Beunruhigung seiner Zimmerwirtin, die Leo bereits dem Hungertod nahe sah und ihm deshalb beinahe täglich zuckrige Tortenstücke ins Zimmer stellte.
Nein, er hatte keinen Hunger. Viel lieber trank und rauchte er.
Angewidert schob Leo den Teller mit der Haxe zur Seite und steckte sich eine seiner geliebten Yenidzes an. Er griff zu der Zeitung, die er vom Büro mitgebracht hatte, und vertiefte sich in die neuesten Meldungen. Kaiser Franz Joseph traf die englische Königin Victoria in Nizza, die ersten Olympischen Spiele der Neuzeit würden demnächst in Athen stattfinden, im Ronacher gab es irgendeine Premiere, der Wiener Magistrat beratschlagte, die Sperrstunde im 1. Bezirk von zehn Uhr auf elf Uhr nachts zu verschieben … Bei der letzten Nachricht konnte Leo sich vorstellen, was das bedeutete: mehr Betrunkene, mehr Schlägereien, mehr Tote und damit auch mehr Arbeit für ihn und seine Mitarbeiter vom Wiener Sicherheitsbüro. Als ob es in der Weltstadt Wien nicht schon genug Morde gäbe!
Missmutig winkte Leo dem ebenso schlecht gelaunten Ober und ließ sich ein zweites Viertel Weißgipfler bringen. Er saß im Melker Stiftskeller, jener Gaststätte in der Nähe des Polizeipräsidiums, die ihm in den letzten Monaten so etwas wie ein zweites Zuhause geworden war. Hier war er ungestört, ohne das Genörgel und die gut gemeinten Ratschläge seiner Zimmerwirtin, es gab guten, billigen Wein, außerdem saß man unter den Gewölbebögen im Keller recht gemütlich.
Gelegentlich kam Leo der Gedanke, dass er hier auch saß, weil ihn der Stiftskeller an Julia erinnerte. Zusammen waren sie früher oft hier gewesen, hatten getrunken und gelacht. Wenn die Erinnerungen an ihre gemeinsame Zeit zu mächtig wurden, bestellte Leo schnell ein weiteres Viertel und hüllte sich in Zigarettenrauch.
Noch immer konnte er nicht verstehen, warum Julia ihn verlassen hatte. Aber hatte sie das überhaupt getan, also für immer? Sie hatte von einer vorübergehenden Pause gesprochen, doch auf Leos Briefe hatte sie nicht reagiert, und die wenigen Male, die sie sich über den Weg gelaufen waren, war sie kühl gewesen, wortkarg. Vermutlich hatte das mit dieser neuen Affäre zu tun, die sie ihm verschwieg. Dieses Biest Margarethe aus der Telefonabteilung, eine alte Freundin von Julia, hatte Leo brühwarm davon erzählt, mit einem beinahe lüsternen Ausdruck im Gesicht, so als würde sie sich an Leos Leiden ergötzen. Der Kerl war wohl Musiker. Musiker! Die hatten doch nie Geld. Immerhin schien es nicht der Affe von Reporter zu sein, dieser Harry Sommer. Was man so hörte, war Julia beim Journal gut im Geschäft, sie verdiente ihr eigenes Geld. Das war ihr ja immer wichtig gewesen: dass sie von keinem Mann abhängig war, auch nicht von Leo.
War es deshalb auseinandergegangen? Weil er über Geld verfügte und sie nicht? Dabei war er im Grunde arm wie eine Kirchenmaus, denn sein wohlhabender Vater hatte Leo nach einem unglücklichen Duell in Graz den Geldhahn zugedreht. Würde seine Mutter ihm nicht heimlich jeden Monat eine gewisse Summe überweisen, hätte Leo sich seine teuren Anzüge, die Einstecktücher mit Monogramm, die englischen Lederschuhe, ja nicht mal den Wein im Stiftskeller leisten können. Das Gehalt in der Mordkommission war erbärmlich, nicht wenige Inspektoren verdienten sich unter der Hand etwas hinzu. Auch die erst kürzliche Beförderung zum Oberinspektor, nachdem er einige vertrackte Fälle gelöst hatte, hatte Leo nicht gerade reich gemacht.
Verbittert nahm er einen tiefen Schluck von seinem Glas. Eben wollte er wieder hinter seiner Zeitung verschwinden, als jemand an seinen Tisch trat. Leo blickte auf und ließ die Zeitung wieder sinken.
»Loibl«, brummte er. »Sie haben mir gerade noch gefehlt.«
»Ich freu mich auch, Sie zu sehen, Herr Oberinspektor«, erwiderte sein Kollege grinsend. Erich Loibl arbeitete mit Leo zusammen in der gleichen Abteilung. Als einfacher Inspektor war er Leo untergeordnet, was ihm nur recht war. Erich Loibl war, gelinde gesagt, nicht sonderlich ehrgeizig, manche Kollegen sprachen auch von zum Himmel stinkender Faulheit. Dass der Inspektor nach Feierabend im Stiftskeller auftauchte, war kein gutes Zeichen. Auch nicht, dass er Leo bei seinem neuen Titel nannte.
»Lassen Sie mich raten, es gibt einen Fall«, sagte Leo und seufzte. »Und Sie wissen nicht, was Sie tun sollen. Ich darf Sie daran erinnern, dass Sie heute Spätdienst haben, Loibl. Ich hingegen …«
»Oberpolizeirat Stukart schickt mich«, unterbrach ihn Erich Loibl. »Meinte, er bräuchte Sie bei einem Fall.« Er zwinkerte Leo zu. »Einen Mann von Welt, das waren Stukarts Worte. Einen echten Tschentelmän. Sie können doch Englisch, oder?«
Leos Miene verdüsterte sich zunehmend. Dass der Herr Oberpolizeirat höchstpersönlich nach ihm geschickt hatte, ließ ihm kaum einen Ausweg. Nicht mal, wenn er eigentlich Feierabend hatte und vor seinem zweiten Viertel Wein saß.
»Wieso Englisch?«, fragte Leo. Tatsächlich sprach er neben Englisch auch Französisch und ein wenig Italienisch, alle drei Fremdsprachen hatte er auf einem Internat gelernt, in das ihn sein Vater für teures Geld geschickt hatte. Die einzige Sprache, die Leo nicht beherrschte, war ausgerechnet Wienerisch. Er sprach lupenreines Hochdeutsch wie seine Mutter, die ursprünglich aus Hannover stammte und später einen Grazer Bankdirektor geheiratet hatte. Im Kollegenkreis galt Leo deshalb als Piefke, was die Zusammenarbeit nicht eben einfacher machte.
»Wir sollen einen Amerikaner vernehmen«, erklärte Erich Loibl. Er zuckte mit den Schultern. »Ich kann gerade mal Hällo und Adios.«
»Das Zweite ist Spanisch.«
»Na, sehen Sie.« Loibl deutete auf Leo, der wie so oft einen Zweireiher zu seinem frisch gebügelten Hemd trug. »Außerdem sind Sie für die Vernehmung viel besser angezogen. Wir müssen nämlich ins Theater. Ins Ronacher, um genau zu sein.«
»Ins Ronacher?« Leo stutzte. Hatte er nicht gerade etwas über eine Vorstellung im Ronacher gelesen? Er blätterte durch die Zeitungsseiten. »Da ist doch heute die Premiere von diesem Magier aus Amerika …«
»Charles Banton, ja. Den sollen wir vernehmen. Es gab einen Unfall, wobei nicht so sicher ist, ob es wirklich ein Unfall war. Deshalb hat die Wache auch uns vom Wiener Sicherheitsbüro rufen lassen.« Loibl hob die Augenbraue. »Es heißt, Banton habe eine Frau zersägt. Seine Assistentin, bei lebendigem Leib.«
»Zersägt …? Bei … bei lebendigem Leib?«
»Na, sag ich doch.« Erich Loibl deutete auf die erkaltete Haxe. »Essen Sie das noch, Herr Oberinspektor? Sonst würde ich es mir für die Fahrt einpacken lassen. Ist ja schade drum.«
Kapitel 2
Nur kurze Zeit später saßen die beiden Inspektoren in einer Dienstkutsche, die sie über den Ring zum Theater in der Himmelpfortgasse brachte. Auf der kurzen Strecke erzählte Loibl Leo das Wesentliche, während er mit großem Genuss die Surhaxe verzehrte. Mit einem bereits benutzten Taschentuch wischte er sich schließlich den fettigen Mund ab und warf den Knochen aus dem Fenster.
»Köstlich! Die Haxen im Stiftskeller sind wirklich die besten. Sie haben was verpasst, Herzfeldt!«
»Danke, aber mir ist bei Ihrer Erzählung endgültig der Appetit vergangen«, murmelte Leo und sah aus dem Kutschenfenster, wo an der Ecke schon das Theater auftauchte.
Obwohl es um diese nächtliche Uhrzeit ziemlich kühl war, hielten sich noch viele Menschen in leichter Kleidung auf der Straße auf. Es waren augenscheinlich alles Theaterbesucher. Ein paar uniformierte Wachmänner forderten die Leute zum Gehen auf, doch keiner schien auf sie zu hören. Leo sah, dass einige der Frauen kreideweiß im Gesicht waren und an Riechfläschchen schnupperten, andere schluchzten und klammerten sich an ihre ebenso erschrocken wirkenden Begleiter. Leo stieg aus und winkte einen Wachmann heran, der ihn und Loibl durch die Menge ins Innere des Theaters führte. Dort war es merklich leerer, nur ein paar Kellner liefen herum und klaubten zerbrochene Gläser und zertretene Canapées vom Boden auf. Umgeworfene Stühle und Tische lagen herum, ein großer Spiegel an der Wand war zerbrochen.
»Als es passiert ist, gab’s kein Halten mehr«, erklärte der Wachmann, ein älterer Polizist mit Schlagstock und Tschako, während sie durch den Wintergarten gingen. Offenbar hielt es der Mann nicht für nötig, seinen Helm drinnen abzunehmen. »Zuerst haben alle gedacht, es wär ein Teil der Vorstellung, a rechte Hetz, aber dann haben vorne die Ersten zu schreien begonnen, und dann …« Er deutete auf das Chaos ringsum. »Na ja, Sie sehen’s ja selbst. Fast wie damals beim Brand vom Ringtheater. Nur ohne verkohlte Leichen.«
Mittlerweile wusste Leo über den Tathergang einigermaßen Bescheid. Das Zersägen der Assistentin war wohl ein neuer Trick gewesen, der schrecklich schiefgegangen war. Bantons Säge hatte die Bauchschlagader der jungen Frau durchtrennt, was zum fast augenblicklichen Tod geführt hatte. Die Leiche der Frau, eine gewisse Beatrice Charringham, war bereits ins rechtsmedizinische Institut gebracht worden. Für Leo sah es ganz nach einem Unfall aus, doch offenbar gab es Hinweise, dass etwas manipuliert worden war. Was genau, hatte ihm Loibl nicht sagen können. Charles Banton selbst hatte wohl den Verdacht geäußert.
Mittlerweile standen sie im Theatersaal. Der elektrifizierte Kronleuchter an der Decke war ausgeschaltet, nur ein paar Lampen an der Seite brannten noch. Doch auch so war das Chaos nicht zu übersehen. Auch im Saal waren Stühle und Tische umgeworfen, es sah noch schlimmer aus als im Wintergarten, beinahe, als wäre eine Stampede hindurchgerast. Man konnte von Glück reden, dass niemand zertrampelt worden war.
Vorne auf der Bühne war im düsteren Licht eine Burgkulisse zu erkennen, davor billige Grabsteine aus Pappe und Gips, von denen etliche am Boden lagen. Zwei Männer hielten sich dort auf. Der Größere der beiden saß auf einem Stuhl, er trug einen zerknitterten schwarzen Frack und hatte den Kopf in den Händen vergraben. Neben ihm auf der Bühne lag achtlos ein Zylinder. Der andere, ein Herr im feinen Cutaway und mit viel Brillantine im Haar, marschierte nervös auf und ab. Er war recht klein, was er offenbar mit erhöhten Absätzen zu kompensieren versuchte, die auf dem Holzboden nervtötend klackten. Als der Mann die Inspektoren kommen sah, blieb er stehen und winkte.
»Ah, da sind Sie ja endlich! Die Herren vom Wiener Sicherheitsbüro, nicht wahr? Gott sei Dank! Kommen Sie, nun kommen Sie doch!«
Über eine Seitentreppe stiegen Leo und Erich Loibl auf die Bühne. Erst jetzt sah Leo den Sarg, der mittlerweile geöffnet worden war. Das viele Blut bildete eine klebrige Lache unter dem hölzernen Kasten.
Im Sarg steckten zwei Füße mit Frauenschuhen.
»Mein Gott!«, hauchte Leo. »Ist sie …?«
»Nein, sie ist nicht mehr drin. For heaven’s sake!« Der Mann auf dem Stuhl, der Leo anscheinend gehört hatte, blickte auf. Er hatte einen stattlichen Schnurrbart im Gesicht, der nun jedoch traurig herabhing und fast wie angeklebt aussah. »Die Füße sind nur eine Attrappe«, sagte er mit amerikanischem Akzent. »Not real! Verstehen Sie?«
Leo hob die Augenbraue. »Sie sind wohl …«
»Charles Banton.« Sichtlich zittrig und aschfahl im Gesicht stand der große Mann auf und reichte Leo die Hand. Er war hager und lang wie eine Bohnenstange, was durch den Frack mit seinen Rockschößen noch verstärkt wurde. Im Aussehen erinnerte er Leo an den früheren amerikanischen Präsidenten Abraham Lincoln. »Es ist furchtbar, einfach nur furchtbar …«
»Sie sprechen Deutsch«, stellte Leo fest.
Banton nickte. »Meine Eltern sind aus Hamburg in die USA eingewandert, als ich zehn war. Nach Pennsylvania. Seine Muttersprache verlernt man nicht.«
Leo warf Loibl einen bösen Blick zu, woraufhin dieser nur entschuldigend mit den Schultern zuckte und schwieg.
»Nun also …«, begann Leo. »Können Sie mir …?« Doch der kleinere Mann mit dem Brillantineschädel fiel ihm ins Wort.
»Wir müssen das hier schleunigst aufklären, am besten sofort! Jeder Tag Ausfall kostet mich ein Vermögen!«
»Und Sie sind …?« Leo wandte sich zu dem Mann um.
»Laurenz Wilhelm Waldmann, der Besitzer des Ronacher«, erklärte dieser und wischte sich eine fettige Strähne aus dem Gesicht. Dann blickte er zur Decke, als wollte er den Gott des Theaters höchstpersönlich für das Geschehene anklagen. »Das hier ist das Schlimmste, was unter meiner Leitung im Ronacher je geschehen ist! Das Allerallerschlimmste! Die finanziellen Verluste …«
»Vor allem ja wohl der menschliche Verlust«, erwiderte Leo kühl. »Das meinten Sie doch, oder?«
»Natürlich«, gab Waldmann kleinlaut zu. »Keine Frage. Ein schrecklicher Unfall …«
»Es war kein Unfall«, meldete sich Charles Banton zu Wort. »Das hab ich schon dem Mann von der Wache gesagt. Beatrice ist ermordet worden! Jemand hat den Sarg … wie sagt man?«
»Manipuliert?«, fragte Leo.
Banton nickte. »Kommen Sie. Ich zeige es Ihnen.« Er führte Leo und Erich Loibl zu dem Sarg, auf dem etliche Blutspritzer klebten. »Ich vermute, Sie wissen nicht, wie der Trick funktioniert?«, wandte er sich an die beiden Inspektoren.
»Es ist ein Trick?«, fragte Loibl ein wenig enttäuscht.
Banton sah Loibl an, als zweifle er an dessen geistiger Gesundheit. »Was haben Sie denn gedacht, Herr Inspektor? Natürlich ist es ein Trick. Wenn auch ein ziemlich guter. Jede Zauberei beruht im Grunde auf Geschicklichkeit, langjähriger Übung und Technik. Wir haben diese Nummer sehr lange geübt, bis alles klappte. Eine Weltneuheit, die ich mir habe patentieren lassen!« Charles Banton wirkte trotz der Blässe in seinem Gesicht plötzlich stolz. »Die zersägte Jungfrau. Dieser Zaubertrick wird in die Geschichte eingehen!«
»Ohne Frage«, warf Leo tonlos ein.
Banton bemerkte seinen Fauxpas. Betont sachlich sprach er weiter: »Es ist eine Mischung aus optischer Täuschung und einer im Grunde simplen Technik. Sehen Sie …« Er führte sie um den Sarg herum. »Der Behälter ist tiefer, als man denkt. Die obere Hälfte ist holzbraun gestrichen, die untere Hälfte dagegen schwarz. Vor dem schwarzen Bühnenhintergrund ist sie deshalb im Halbdunkel nicht zu sehen. Übrigens ebenso wenig wie die dünne schwarze Schnur, mit der ich den vermeintlich schwebenden Sarg zu mir herziehe. Blicken Sie jetzt ins Innere«, forderte er sie auf.
Leo schaute in den Sarg, in dem immer noch das Blut klebte. Ihm wurde übel von dem süßlich-metallischen Geruch, den er von vielen Tatorten her kannte.
»An der Fußseite befindet sich eine Klappe«, fuhr Banton mit seiner Erklärung fort. »Drückt man mit den Füßen dagegen, passiert zweierlei: Die künstlichen Füße mit den Frauenschuhen kommen zum Vorschein, außerdem öffnet sich im Sargboden eine Klappe, sodass der- oder diejenige im Sarg mit dem Unterkörper nach unten rutscht und …«
»Und sich damit außerhalb der Reichweite der Säge befindet«, sagte Leo anerkennend. »Wirklich clever. Aber warum …?«
»Warum es trotzdem zu dem Blutbad gekommen ist? Nun, weil … weil …« Banton war sichtlich fassungslos, er rang mit den Worten. »Weil jemand den Mechanismus blockiert hat! Verstehen Sie? Hier!« Er deutete auf eine kleine Schraube, die offenbar im Nachhinein von außen angebracht worden war. »Als Beatrice gegen das Fußteil drückte, kamen zwar die Schuhe heraus. Doch der Boden senkte sich nicht!«
»Aber das muss die Dame doch gemerkt haben«, sagte Loibl, nahm seinen Bowler ab und kratzte sich am Kopf. »Wieso hat sie nicht laut um Hilfe geschrien?«
»Das hat sie ja. Aber das Furchtbare war, dass wir das zuvor so ausgemacht hatten. Beatrice … sie sollte sich verzweifelt geben und laut schreien! Als ich dann merkte, dass ihre Verzweiflung echt war, da … da war es schon zu spät.«
Banton ging zurück zu seinem Stuhl und ließ sich darauf fallen. Er war leichenblass, als hätte er selbst all dieses Blut verloren.
»Das ist das Ende meiner Karriere!«, hauchte er. »Ich werde nie wieder auf einer Bühne stehen.«
»Nun, äh … das muss nicht unbedingt sein«, warf Theaterbesitzer Waldmann nervös ein. »Ich meine, Sie können ja nichts dafür, nicht wahr, Mister Banton? Also, wenn die Polizei den Täter findet, und das wird sie doch …« Waldmann sah Leo eindringlich an. »Dann sehe ich eigentlich keinen Grund, nicht mit den Vorstellungen fortzufahren. Vielleicht nach einer, äh … kurzen Pause der Trauer und Besinnung.« Er hüstelte. »Wie sagt man so schön in Ihrem Amerika? The Show must go on!«
»Haben Sie denn irgendeine Ahnung, wer es auf Ihre Assistentin abgesehen haben könnte?«, fragte Leo Charles Banton, ohne auf Waldmann einzugehen. »Warum jemand Miss Charringham umbringen wollte? Und noch dazu auf so spektakuläre Weise? Ich meine, der Täter hätte ihr ja auch einfach irgendwo auflauern können und …«
»Das ist es ja!«, fuhr Banton aufgeregt dazwischen. »Der Mörder hatte es nicht auf Beatrice abgesehen, sondern auf mich!«
»Moment mal.« Loibl runzelte die Stirn. »Wie kommen Sie denn da drauf? Es war doch diese Beatrice Charringdings, die im Sarg gelegen hat, und Sie haben mit der Säge …«
»Weil eigentlich ich in dem Sarg liegen sollte! Wir haben das erst heute früh spontan geändert.« Banton stöhnte. »Tatsächlich hätte Pascal, mein persönlicher Assistent, mich zersägen sollen. Aber dann fühlte sich Pascal heute Morgen nicht wohl, außerdem bin ich ohnehin zu groß für den Sarg. Also haben wir die Schuhe schnell in Damenschuhe ausgetauscht und Beatrice überredet, das Opfer zu spielen. Im Nachhinein fand ich es eine geniale Idee. Ursprünglich sollte die Nummer ja ›Der zersägte Zauberer‹ heißen, aber es ist viel besser, eine vermeintliche Jungfrau zu zersägen. Der Thrill, die prickelnde Erotik, wenn Sie verstehen …« Banton stockte. »Verzeihen Sie, das war ungehörig. Ich … ich bin nur ziemlich, wie sagt man … confused.«
»Sie sprachen von Ihrem persönlichen Assistenten Pascal«, sagte Leo. »Gibt es denn noch weitere Angestellte?«
Charles Banton schüttelte den Kopf. »Nur mich, Pascal und Beatrice. Wir sind ein kleines Team, allein schon aus Gründen der Geheimhaltung. Das wichtigste Gut eines Zauberers sind seine Tricks, wissen Sie. Ich feile ständig an neuen. Sogar lebende Fotografien wollen wir demnächst verwenden! Diese Show ist ein Feuerwerk an ausgefeilten Zaubertricks, nur das Beste und Modernste!« Wieder ging die Begeisterung mit Banton durch. »Pascal steht hinter der Bühne, aber er ist auch der schwarze Mönch, und manchmal auch mein Double, wenn ich irgendwo verschwinde und woanders wieder auftauche. Einmal spielt er sogar einen Raben, also er krächzt wie einer, und …«
»Wo ist Pascal denn jetzt?«, unterbrach ihn Leo. »Sollte er nicht hier sein, bei Ihnen?«
»Er war vorhin noch da«, erwiderte Laurenz Waldmann. »Aber es geht dem jungen Herrn wohl wirklich nicht besonders gut. Und als er dann das viele Blut sah … Nun, ich denke, er ist unten in Mr. Bantons Garderobe. Ins Hotel gehen durfte er ja nicht. Wir alle durften nicht weg.« Er warf Loibl einen giftigen Blick zu.
»Ich habe die Wachmänner telefonisch entsprechend angewiesen, damit sich keiner vom Personal verdünnisiert«, sagte Loibl mit wichtigtuerischer Miene. »Fluchtgefahr! Sie verstehen?«
»Na, dann will ich mit diesem kranken Pascal mal ein paar Wörtchen wechseln«, meinte Leo. Er wandte sich an Loibl. »Nehmen Sie so lange die Aussage von Mr. Banton auf. Am besten bei uns im Büro, gleich mit Schreibmaschine. Wir sehen uns dann morgen früh im Präsidium.« Er deutete auf den Sarg. »Diese Mordmaschine hier nehmen wir zur näheren Untersuchung in unsere Obhut. Und, Mister Banton …« Leo drehte sich zu dem Zauberer um. »Sie bleiben hier in Wien, bis alles geklärt ist. Mein Kollege zieht Ihren Pass ein, das ist so Vorschrift. Ich hoffe, Sie verstehen.«
»Glauben Sie mir, ich habe selbst das höchste Interesse daran, dass dieser Fall aufgeklärt wird«, erwiderte Charles Banton. »Immerhin hatte es ja wohl jemand auf mich abgesehen.«
An Loibls betrübtem Gesichtsausdruck glaubte Leo zu erkennen, dass das schriftliche Verhör, zumal mit der Schreibmaschine, nicht zu dessen Lieblingsbeschäftigungen gehörte. Aber Loibls dumme Fragerei war ihm gehörig auf die Nerven gegangen. Leo wollte nicht, dass sein Kollege ihm das Verhör mit diesem Pascal vermasselte.
Von Waldmann ließ er sich den Weg zu den Garderoben zeigen. Eine Treppe führte in einen elektrisch beleuchteten Keller, der sich als erstaunlich groß entpuppte. Im Grunde war es eine unterirdische Halle, vollgestellt mit Kisten, Truhen und diversen seltsamen Apparaten, darunter auch ein schwarzer Kasten mit Objektiv, der Leo an einen riesigen Fotoapparat erinnerte. Er blieb erstaunt stehen.
»Himmel, was ist das alles?«
»Das ist die Unterbühne«, erklärte Waldmann. »Also der Raum, der sich direkt unter der Bühne befindet. In dieser Größe hat so was nur das Ronacher.« Sichtlich stolz wies der Theaterbesitzer auf einige Klappen in der Decke, unter einer davon waren ein paar Strohmatten aufgeschichtet. »Zauberkünstler verschwinden gerne. Sie lassen sich durch eines der Löcher im Bühnenboden fallen und landen sicher auf den Matten darunter. Das ganze Zeug gehört zu Bantons Requisiten. Fragen Sie mich nicht, was genau das ist! Mister Banton verwendet in seinen Vorstellungen die unterschiedlichsten Dinge, viele technische Neuigkeiten. Sehen Sie den Glaskasten da?« Während sie weitergingen, vorbei an Koffern und mit Holzwolle ausgekleideten Sperrholzkisten, deutete Waldmann auf ein menschengroßes Aquarium.
»Banton übt an einer Nummer, in der er sich gefesselt in ein Wasserbecken werfen lässt, mit Gewichten an den Beinen. Allerdings ist die Nummer noch nicht ganz ausgereift. Tja, und das hier …« Er zeigte auf eine eiserne, sehr massiv aussehende Kanone. »Da passt ein Mensch rein. Er wird mit lautem Wumms rausgeschossen und taucht dann unversehrt inmitten des Publikums wieder auf. Keine Ahnung, wie das geht! Die Unterbühne ist Requisitenkammer und Übungsraum zugleich. Mister Banton plante ja, länger bei uns in Wien zu verweilen.«
Waldmann wies nach vorn. »Ab hier finden Sie den Weg allein.«
Am Ende der unterirdischen Halle ging ein langer, nur spärlich erleuchteter Gang ab. Darin befanden sich rechts und links Türen mit Schildern; auf einem davon stand Charles Bantons Name. Leo klopfte pro forma an, dann öffnete er die Tür …
Und erstarrte.
Ein junger, kränklich aussehender Mann saß vor einem Schminkspiegel. Vor ihm stand eine attraktive Frau mit Notizblock und Bleistift, die gerade etwas notierte.
Es war Julia.
Einen langen Augenblick blieb Leo unentschlossen auf der Schwelle stehen. Er hatte Julia schon seit einigen Wochen nicht mehr gesehen, das Erste, was ihm auffiel, war, wie gut sie aussah. Dieses eng anliegende grüne Kleid hatte sie auch bei früheren Gelegenheiten schon getragen, wenn sie zusammen ausgegangen waren. Die Erinnerung fuhr ihm wie ein Dolch in die Magengegend. Doch dann zählte er eins und eins zusammen – Julias Anwesenheit hier unten in der Garderobe, in ihren Händen Stift und Notizblock … Offenbar hatte sie gerade mit diesem Pascal gesprochen. Und es war sicher kein belangloser Theaterplausch gewesen.
»Julia! Was … was zum Teufel machst du hier …?«
Auch Julia wirkte kurz verdutzt, doch sie fing sich schneller als er.
»Offensichtlich das Gleiche wie du«, erwiderte sie kühl. »Meine Arbeit. Das Journal hat mich zu Bantons Premiere geschickt. Ich recherchiere …«
»Verflucht, du hast hier unten nichts verloren! Das ist Polizeiarbeit! Ich könnte dich …«
»Einbuchten?«, unterbrach ihn Julia spöttisch. Sie streckte ihm die Hände mit Block und Stift entgegen. »Magst du mir Handschellen anlegen? Die Kollegen schreiben gerne einen Artikel über willkürliche Polizeizensur.«
»Herrgott, Julia, sei nicht kindisch! Du weißt doch selbst genau, was geht und was nicht.«
»Also gut, dann interviewe ich eben dich. So wie es aussieht, bist du ja hier der leitende Ermittler.« Sie zückte Block und Stift und sah ihn herausfordernd an. »Was kann uns die Polizei zum jetzigen Stand mitteilen? War es Unfall? Mord? Charles Bantons Assistent sprach eben davon, dass der Sarg wohl manipuliert wurde …«
Leo stöhnte. Das lief eindeutig nicht so, wie er sich die Befragung vorgestellt hatte.
Der junge Mann, der vor dem Spiegel in der Ecke saß und bislang noch kein Wort gesagt hatte, räusperte sich. Nervös befeuchtete er sich mit der Zunge die leicht bläulichen Lippen.
»Äh, ich verstehe nicht …« Er wandte sich an Leo. »Excusez-moi, Sie … Sie sind von der Polizei?« Er sprach mit französischem Akzent.
»Herrgott, ja doch! Leopold von Herzfeldt, Oberinspektor und Polizeiagent vom Wiener Sicherheitsbüro.« Leo zeigte seine Marke, eine grauschwarze Stoffkokarde mit dem eingenähten Habsburger Doppeladler, dann deutete er auf Julia, die erneut etwas in ihren Notizblock kritzelte. »Diese Dame hat sich als Reporterin einfach hier hereingeschlichen. Ohne Befugnis! Wenn ich Sie also jetzt bitten dürfte, mir zu erzählen …«
»Aber ich habe der Dame doch schon alles erzählt«, sagte der Assistent matt. Er sah tatsächlich nicht gut aus, ganz grün im Gesicht, seine Augen wirkten irgendwie größer als normal. »Ich … ich wäre Ihnen wirklich sehr dankbar, wenn Sie mich gehen ließen. Sie … Sie können ja die junge Dame fragen, sie hat alles haargenau aufgeschrieben.«
»Davon bin ich überzeugt.« Leo überlegte kurz. Dann machte er eine ungeduldige Handbewegung. »Na, dann gehen Sie schon. Erholen Sie sich von Ihrer Magenverstimmung, oder was immer Sie sich da eingefangen haben. Morgen früh um neun melden Sie sich bei mir in meinem Büro im Polizeipräsidium, das ist am Ring gegenüber der Börse.« Er streckte die Hand aus. »Ihr Reisepass bleibt bei mir.«
Der Assistent nickte ergeben. Zitternd wühlte er in den Taschen nach seinem Pass und gab ihn Leo. Dann nahm er seinen Mantel und tappte zur Tür. Dort wandte er sich noch einmal um, er schwitzte stark. Wieder fuhr er sich mit der Zunge über die Lippen.
»Danke für Ihr Verständnis, ich fühle mich wirklich nicht wohl. Ich bin so erschöpft, so schrecklich müde. Am liebsten würde ich eine Woche durchschlafen. Das alles …«
»Ja, ja, schon gut«, knurrte Leo. »Wie gesagt, morgen um neun bei mir im Büro. Stellen Sie sich besser einen Wecker. Und verlassen Sie auf keinen Fall die Stadt!«
Als die Tür sich hinter dem Mann geschlossen hatte, herrschte eine Zeit lang Schweigen. Julia und Leo sahen beide verlegen zu Boden, bis Julia schließlich lächelte.
»Ich gebe zu, ein denkbar schlechter Zeitpunkt für ein Wiedersehen. Aber ich konnte ja nicht ahnen …«
»Herrgott, Julia!« Leo seufzte, sein ganzer Zorn fiel plötzlich in sich zusammen. Er fühlte sich hundeelend. So vieles wollte er Julia sagen, doch es gelang ihm nicht. Nicht in dieser Garderobe, die nach Erbrochenem stank, nicht mitten in einer Ermittlung zu einem möglichen Mordfall. Da kam ihm eine Idee.
»Ich mache dir einen Vorschlag«, sagte er.
»Und der wäre?«, fragte sie misstrauisch.
»Wir vergessen das Ganze hier. Ich habe keine Reporterin in der Garderobe eines Zeugen und möglichen Tatverdächtigen angetroffen, du schreibst nicht darüber …«
»Das kann ich dir nicht garantieren.«
»Lass mich ausreden! Und du gehst mit mir zum Essen. Jetzt. In den Melker Stiftskeller, so wie früher. Dort erzählst du mir alles, was du weißt. Und wir …« Er zögerte. »Nun, vielleicht reden wir auch über uns.« Er schluckte und sah sie bittend an. »Was sagst du dazu?«
Julias Mund verzog sich zu ihrem typisch burschikosen Lächeln, das er so an ihr liebte. »Gerne. Wenn du mich einlädst. Ich habe ziemlich Appetit auf Surstelze mit Kraut.« Sie ging hinüber zum Tisch und griff nach einer offenen Weinflasche, die dort stand.
»Willst du mit mir etwa anstoßen?«, fragte Leo. »Auf frühere Zeiten?«
»Das würde ich dir nicht raten«, erwiderte Julia und verkorkte die Flasche sorgfältig. »Ich glaube, mit diesem Wein hier hat man versucht, Charles Banton zu vergiften. Aber das erzähle ich dir in Ruhe im Stiftskeller.« Sie reichte ihm die Hand. »Und jetzt komm. Nach der ganzen Aufregung hab ich wirklich einen Bärenhunger.«
Eine halbe Stunde später saß Leo mit Julia an dem gleichen Tisch, an dem er erst vor kurzer Zeit noch allein Zeitung gelesen hatte. Diesmal verspürte er mehr Appetit. Sie hatten beim Kellner zwei Haxen bestellt, wobei Julia die ihre schon fast ganz abgefieselt hatte. Es bereitete Leo immer wieder Freude, Julia beim Essen zuzusehen. Wenn sie sich über das fettige, fasrige Fleisch hermachte und sich dabei genüsslich die Lippen leckte, sah sie aus wie eine junge, hungrige Wölfin.
Julia Wolf, dachte Leo wehmütig, ich komme einfach nicht von dir los …
Fast drei Jahre waren vergangen, seit er Julia im Wiener Polizeipräsidium zum ersten Mal gesehen hatte. Sie war damals dort Telefonistin gewesen, später hatte Leo ihr einen Posten als Tatortfotografin verschafft.