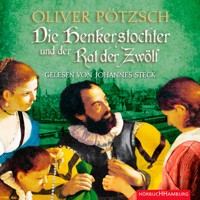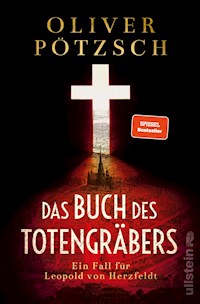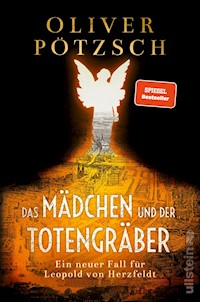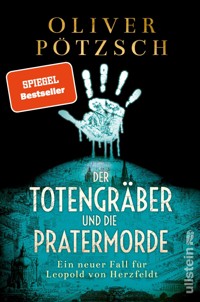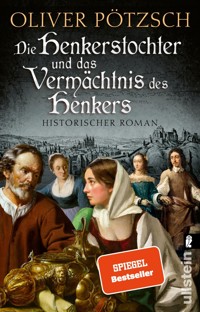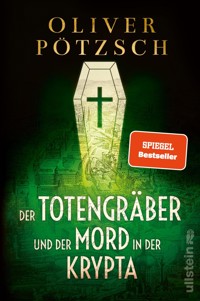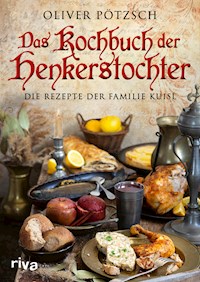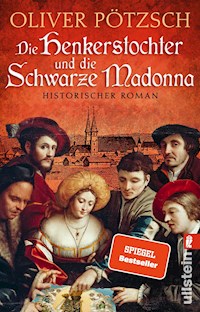
9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 3,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Ullstein eBooks
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Tödliche Pilgerfahrt: Wer mordet unter den Augen der Schwarzen Madonna? 1681: Trotz seines fortgeschrittenen Alters macht der Schongauer Scharfrichter Jakob Kuisl noch einmal eine große Reise mit der Familie, eine Wallfahrt nach Altötting. Zur gleichen Zeit sich hochrangige Gäste im berühmten Pilgerort: Kaiser Leopold I. von Österreich und der Bayerische Kurfürst Max Emanuel wollen im Angesicht der Schwarzen Madonna ihre »Heilige Allianz« schmieden und sich im Kampf gegen die Türken verbünden. Doch dann wird ein Mann ermordet, und Kuisl ahnt, dass die Allianz verhindert werden soll. Zusammen mit seiner Tochter Magdalena und dem Rest der Familie macht er sich auf die Suche nach dem geheimnisvollen Mörder. *** Farbenprächtig und voller Intrigen: In einer perfekten Mischung aus Fakten und Fiktion lädt Oliver Pötzsch Sie ins Bayern des 17. Jahrhunderts ein!
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Die Henkerstochter und die schwarze Madonna
Der Autor
Oliver Pötzsch, Jahrgang 1970, arbeitete nach dem Studium zunächst als Journalist und Filmautor beim Bayerischen Rundfunk. Heute lebt er als Autor mit seiner Familie in München. Seine historischen Romane haben ihn weit über die Grenzen Deutschlands bekannt gemacht: Die Bände der Henkerstochter-Serie sind internationale Bestseller und wurden in mehr als 20 Sprachen übersetzt.
Von dem Autor sind in unserem Hause außerdem erschienen:Die Henkerstochter · Die Henkerstochter und der schwarze Mönch · Die Henkerstochter und der König der Bettler · Der Hexer und die Henkerstochter · Die Henkerstochter und der Teufel von Bamberg · Die Henkerstochter und das Spiel des Todes · Die Henkerstochter und der Rat der Zwölf · Die Henkerstochter und der Fluch der Pest
Die Ludwig-Verschwörung · Die Burg der Könige · Der Spielmann · Der Lehrmeister · Das Buch des Totengräbers · Das Mädchen und der Totengräber
Das Buch
Tödliche Pilgerfahrt
1681: Trotz seines fortgeschrittenen Alters macht der Schongauer Scharfrichter Jakob Kuisl noch einmal eine große Reise mit der Familie, eine Wallfahrt nach Altötting. Gleichzeitig mit den Kuisls befinden sich hochrangige Gäste im berühmten Pilgerort: Kaiser Leopold I. von Österreich und der bayerische Kurfürst Max Emanuel wollen im Angesicht der Schwarzen Madonna ihre »Heilige Allianz« schmieden und sich im Kampf gegen die Türken verbünden. Doch dann wird der Leibarzt der Kaiserin vergiftet, und Jakob Kuisl wird just in der Heiligen Kapelle Zeuge eines versuchten Attentats. Kuisl ist sich sicher, dass die Allianz verhindert werden soll. Zusammen mit seiner Tochter Magdalena und dem Rest der Familie macht er sich auf die Suche nach dem geheimnisvollen Mörder.
Oliver Pötzsch
Die Henkerstochter und die schwarze Madonna
Historischer Roman
Ullstein
Besuchen Sie uns im Internet:www.ullstein.de
Originalausgabe im Ullstein Taschenbuch1. Auflage Dezember 2022
© Ullstein Buchverlage GmbH, Berlin 2022Umschlaggestaltung: zero-media.net, MünchenTitelabbildung: © imageBROKER / Alamy Stock Photo;Hintergrund: Altoetting, Steel engraving, around 1850,drawing and engraving by J. Poppel, Upper Bavaria, Bavaria.Menschengruppe: © akg-images (Florigerio, Sebastianoum 1500 – nach 1543. »Musikalische Unterhaltung«,München, Alte Pinakothek); Schwarze Madonna:© akg-images / INTERFOTO / TV-YesterdayKarte: Peter Palm, BerlinE-Book powered by pepyrus
ISBN 978-3-8437-2796-9
Emojis werden bereitgestellt von openmoji.org unter der Lizenz CC BY-SA 4.0.
Auf einigen Lesegeräten erzeugt das Öffnen dieses E-Books in der aktuellen Formatversion EPUB3 einen Warnhinweis, der auf ein nicht unterstütztes Dateiformat hinweist und vor Darstellungs- und Systemfehlern warnt. Das Öffnen dieses E-Books stellt demgegenüber auf sämtlichen Lesegeräten keine Gefahr dar und ist unbedenklich. Bitte ignorieren Sie etwaige Warnhinweise und wenden sich bei Fragen vertrauensvoll an unseren Verlag! Wir wünschen viel Lesevergnügen.
Hinweis zu UrheberrechtenSämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten. Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken, deshalb ist die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.In diesem E-Book befinden sich Verlinkungen zu Webseiten Dritter. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass sich die Ullstein Buchverlage GmbH die Inhalte Dritter nicht zu eigen macht, für die Inhalte nicht verantwortlich ist und keine Haftung übernimmt.
Inhalt
Der Autor / Das Buch
Titelseite
Impressum
Karte Altötting
Dramatis Personae
Prolog
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
Kapitel 28
Kapitel 29
Kapitel 30
Kapitel 31
Kapitel 32
Kapitel 33
Kapitel 34
Epilog
Nachwort
Kleiner Zeitreiseführer durch meinen Roman
Social Media
Vorablesen.de
Cover
Titelseite
Inhalt
Karte Altötting
Widmung
Für Emma »Emmi« Kuisl (1897 bis 1972)
Meine Urgroßtante, die auf Pferden ritt, nach Lourdes pilgerte, Schlangen im Dschungel mit dem Knüppel erschlug und den brasilianischen Priestern die Messgewänder bestickte.
»Heiliger Antonius, kreuzbraver Mann, führ mich an den Schlüssel / den Geldbeutel / die Brille etc. an!«
Von meiner Urgroßtante oft zitiertes Gebet, das unserer Familie auch heute noch gute Dienste leistet!
»Einer für alle, alle für einen!«
Leitspruch der drei Musketiere aus dem gleichnamigen Roman von Alexandre Dumas
(und auch der Familie Kuisl)
Dramatis Personae
Die Familie Kuisl
Jakob Kuisl, ehemaliger Schongauer Scharfrichter
Magdalena Fronwieser (geborene Kuisl), Jakobs ältere Tochter
Simon Fronwieser, Münchner Arzt und Magdalenas Mann
Peter und Paul, Söhne von Magdalena und Simon
Sophia, ihre Tochter
Georg Kuisl, Schongauer Scharfrichter, Jakob Kuisls Sohn
Crescentia Kuisl, Georgs Frau
Barbara Weisheitinger (geborene Kuisl), Jakob Kuisls jüngere Tochter
Adel und Kirche
Kurfürst Max Emanuel, bayerischer Herrscher
Kaiser Leopold I., deutscher Herrscher
Eleonore Magdalene von Pfalz-Neuburg, Leopolds Gattin
Herzog Maximilian Philipp, Max Emanuels Onkel
Mauritia Febronia, Maximilians Gattin
Albrecht Sigismund von Bayern, Altöttinger Propst
Achatius Viertl, Altöttinger Dekan
Pater Benedikt, Superior der Altöttinger Jesuiten
Johann Ferdinand Graf von Orth, Burghausener Vizedom
Pater Georg, Burgkaplan in Burghausen
Weitere Personen
Lucia, Wallfahrtshändlerin
Alois, kurfürstlicher Küchenjunge
Niklas Engelschall, Neuöttinger Wirt
Drei französische Musketiere
Barnabas und Sven, zwei Herumtreiber und Halunken
Ein dunkelhäutiger Fremder mit Mondaugen
Prolog
September 1680, in der Levante, irgendwo in den Bergen des Dschebel Ansariye
Der Mann ohne Namen sah seiner Haut beim Brennen zu.
Er hielt die linke Hand ausgestreckt, ohne jegliches Zittern, nicht einmal mit den Augenbrauen zuckte er. Sein Blick ging in die Ferne, dorthin, wo sich der Dschebel Ansariye, jenes zerklüftete, undurchdringliche Gebirge, im flimmernden Dunst verlor. Irgendwo dahinter, weit entfernt, lag das Meer. Der Mann schloss die Augen und hörte mit seinem inneren Ohr das Rauschen der Wellen, die an das felsige, mückenverseuchte Ufer schlugen. Das Rauschen übertönte den Schmerz. Es roch nach angesengten Haaren, nach verbranntem Fleisch.
Seinem Fleisch.
Obwohl er die Augen weiterhin geschlossen hielt, spürte der Mann den Blick des Alten. Gemeinsam standen sie am Eingang einer Höhle weit oben in den Bergen. Ein Adler schrie, irgendwo kullerten Steine den Hang hinunter, der Wind strich durch die Zedern unten im Tal. Viele Tage waren sie hierher gewandert, die Sonne hatte wie das Innerste der Hölle vom Himmel gebrannt, ein paar Mal wären sie fast abgestürzt. All dies blendete der Mann ohne Namen aus, er hörte nur das imaginäre Rauschen der Wellen, während der Alte ihm die flackernde Pechfackel unter die ausgestreckte Hand hielt. Schwarze Rauchschwaden zogen zwischen den Fingern hindurch, hoch zur Decke.
»Empfange den Schmerz wie einen Freund«, sagte der Alte. Seine Stimme klang tief und monoton, so als spräche der Fels selbst. »Der Schmerz erinnert dich daran, dass du noch lebst. Dies ist die letzte Prüfung. Allahu akbar.«
Ganz plötzlich zog er die Fackel weg.
»Du kannst deine Hand jetzt in den Kübel mit Wasser dort drüben tauchen. Die Prüfung ist vorüber.«
Der Mann ohne Namen tat wie ihm geheißen. Es zischte kurz, als das Wasser auf seine verbrannte Haut traf. Der Schmerz wich einem Gefühl der Taubheit. Vermutlich würde er die Hand über Wochen hinweg nicht benutzen können, Narben würden bleiben. Doch das war nichts gegen die Narbe in seinem Herzen.
»Setz dich«, befahl der Alte.
Sie setzten sich auf einen Steinvorsprung vor der Höhle, und der Greis schmierte einen übel riechenden Balsam auf die Wunde. Dann bandagierte er die Hand seines Schützlings sorgfältig, während er uralte, von der Welt längst vergessene Worte murmelte. Schließlich nickte er zufrieden.
»Du warst ein guter Schüler. Ich habe dich nie gelobt, weil Lob den Menschen hochmütig macht. Aber jetzt will ich es dir sagen: Es gab nie einen besseren. Wer hätte das gedacht, als du vor Jahren zu uns kamst? Du bist etwas … ganz Besonderes. In jeder Hinsicht.« Der Alte stockte und musterte seinen Schüler aufmerksam. »In dir brennt ein heißes, unersättliches Feuer. Ich spüre, es wird von Hass genährt. Nimm dich in Acht!«
Der Mann ohne Namen wollte etwas erwidern, doch der Alte hob die Hand.
»Was immer es auch ist, ich will es nicht wissen. Ich habe dich ausgewählt, weil ich das Besondere in dir gesehen habe, das Feuer. Schon am ersten Tag, als du zu uns kamst. Du bist jetzt frei. Tue, was du willst. Gehe hin, wo immer du willst. Keiner hindert dich.« Er deutete mit dem Kopf dorthin, wo die späte Nachmittagssonne sich langsam über den kargen braunen Hügeln senkte. »Kehre an den Ort zurück, wo du hergekommen bist, und nimm deinen Hass und deinen Zorn mit dir. Salam aleikum.«
»Salam aleikum«, erwiderte der Mann ohne Namen und verbeugte sich. So viele Sätze auf einmal hatte der Alte in den ganzen letzten zwei Jahren nicht mit ihm gesprochen. Er hatte ihn geprügelt wie einen Hund, ihn draußen vor der Tür in der Kälte schlafen lassen, ihn nackt und ohne Wasser in die Wüste geschickt, ihn ausgelacht und verspottet. Aber er hatte ihm auch gezeigt, wie man den Dolch in einer fließenden Bewegung aus den Falten der Tunika zieht und blind auf ein Ziel wirft. Wie man ohne Seil und Haken an senkrechten Felswänden emporklettert. Auf welche Weise man das Gift der Levanteotter gewinnt, wie man mit einer Repetierarmbrust Pfeile im Abstand eines Augenzwinkerns verschießt, oder wie man eine fadendünne Schlinge unbemerkt um den Hals eines Wächters legt.
All das war Teil der Prüfung gewesen.
Jeden Tag hätte er sterben können, doch er hatte überlebt, als Einziger. Er hatte sogar ihre unheimliche Sprache gelernt, die nur aus kehligen Lauten zu bestehen schien, so als würden diese Menschen Nägel gurgeln und Steine fressen. Der Alte hatte recht: Der Hass hatte das Feuer in ihm am Brennen gehalten. Erst in der Wüste, unter der glutheißen Sonne, hatte er seine Bestimmung gefunden.
Es war Zeit, aufzubrechen.
Nur noch eines, ein Letztes, gab es zu tun.
Der Mann ohne Namen stand auf und trat an den Abgrund vor der Höhle. Steil fiel die Felswand ab, Dohlen kreisten in der Tiefe, weit unter ihm wogten grün die Wälder. Er sah seinen Meister auffordernd an.
Dieser zögerte kurz, dann kramte er unter seiner Tunika einen Dolch hervor. Er war uralt, der Griff war schwarz wie die Nacht, und das Eisen funkelte wie Sternenlicht. In die Klinge war ein Name eingraviert. Der Mann lächelte schmal. Trotz der Schmerzen und der Taubheit in seiner Hand, trotz all der Anstrengungen des langen Tages überkam ihn ein unendliches Glücksgefühl.
Es war sein Name.
»Ich gebe dir deinen Namen zurück«, sagte der Alte und überreichte ihm den Dolch. »Du hast ihn verloren, als du zu uns kamst. Doch du hast dich seiner würdig erwiesen. Nun gehe in …«
Noch bevor der Alte den Satz zu Ende gesprochen hatte, steckte die Klinge des Dolchs bis zum Heft in seinem Bauch. Blut quoll hervor und färbte die weiße Tunika rot. Der Alte stöhnte und krümmte sich, er griff nach dem Dolch. Doch dann straffte er sich, sein Gesichtsausdruck wirkte gelöst, fast zufrieden.
»Die … letzte … Prüfung …«, keuchte er. »Ich … habe immer gewusst, dass du … ein würdiger Schüler bist …«
»Und Ihr wart ein würdiger Meister«, sagte der Mann. »Dafür danke ich Euch. Für alles andere … fahrt zur Hölle!«
Mit diesen Worten griff der Mann noch einmal an den Dolch, drehte ihn langsam und bohrte ihn dann so tief in den Bauch des Alten, dass der Griff fast darin verschwand. Mit einer schnellen Bewegung zog er die Klinge wieder heraus. Es brauchte nicht mehr als einen sanften Schubser, der Alte taumelte, dann stürzte er ohne einen Laut in die Tiefe. Ein paar Kiesel polterten dem Körper hinterher.
Der Mann, der jetzt wieder einen Namen hatte, wandte sich ab und ging, ohne sich noch einmal umzublicken, auf die im Westen untergehende Sonne, auf das Meer zu.
Sein Ziel war ein fernes Land, viele Tausend Meilen entfernt. Es war ein Land, von dem die Bewohner des hiesigen Landstrichs vermutlich nie etwas gehört hatten. Klein und doch mächtig, mit einer ruhmreichen und blutigen Vergangenheit, fast tausend Jahre alt, geplagt von Seuchen und Kriegen, doch nie erobert. Mit stolzen Menschen, treu im Glauben, gefürchtet von seinen Feinden – und dennoch innerlich zerfressen von Machtgier, Zwietracht und Intrige.
Dieses Land hieß Bayern.
Kapitel 1
25. Februar 1681, Schongau, unten am Lech im Gerberviertel
Der Säugling schlief fest und friedlich. Eingewickelt in mehrere Wolldecken lag er in der Wiege, nahe am Ofen. Nur das kleine Köpfchen ragte hervor, milchiger Speichel floss aus seinem Mund, der Atem ging ruhig und regelmäßig. Eben zuckten seine Lippen, fast so, als würde er im Traum über etwas lachen.
Über mich, dachte Paul. Er lacht über mich, der Mistkerl!
Paul wusste selbst nicht, wie er darauf kam. Es war nicht das erste Mal, dass er glaubte, dieses kleine, unschuldige Balg würde ihn verhöhnen. Er saß am zerkratzten Tisch in der Schongauer Henkerstube, vor sich ein Krug mit Dünnbier und eine Schüssel Brotsuppe, und blickte grimmig hinüber zur Wiege. Den ganzen verfluchten Morgen hatte er drüben den Stall ausgemistet und den Schinderkarren mit warmer Lauge geschrubbt, bis die Bretter wie frisch gezimmert glänzten. Sein Onkel Georg hatte ihm außerdem aufgetragen, die Zwickzangen, Ketten und Gluthaken von Asche und Blut zu reinigen. Eine schweißtreibende Arbeit, die Paul in den letzten zwei Stunden hier am Tisch verrichtet hatte. Und die ganze Zeit über hatte dieses kleine … Ding in seiner Wiege gelegen, geschlafen und gelegentlich ein Bäuerchen gemacht. Es war ein Junge, gerade mal drei Monate alt, von eher schwächlichem Wuchs. Seine Eltern hatten ihn auf den Namen Jakob getauft, so wie den Großvater, den ehemaligen Schongauer Henker. Jakobs Mutter Crescentia, die Tochter des Peitinger Baders, nannte den Säugling zärtlich Jockel, was Paul immer an »Gockel« erinnerte. Die Laute, die Crescentia bei ihren ständigen Liebkosungen ausstieß, klangen passenderweise wie das Glucken einer Henne.
Paul hatte seinem Onkel Georg versprochen, für ein paar Stunden auf das Balg aufzupassen. Crescentia kaufte oben in der Stadt auf dem Markt ein, derweil war Georg beim Schongauer Gerichtsschreiber zum Rapport einbestellt worden. Als städtischer Scharfrichter war Georg Kuisl nicht nur für die Hinrichtungen und peinlichen Befragungen in Schongau zuständig, sondern auch für den Müll in den Gassen. Und davon gab es zurzeit in der Stadt reichlich. Vor ein paar Tagen hatte erstes Tauwetter eingesetzt; die dicke Schneedecke, die Schongau in den letzten Wintermonaten bedeckt gehalten hatte, verwandelte sich nach und nach in grauen Matsch. Und der Unrat, der darunter in großen Haufen festgefroren gewesen war, stank zum Gotterbarmen! Paul ahnte, was ihm und dem Onkel in den nächsten Tagen blühte: Sie mussten den Müll aus der Stadt schaffen, vermutlich mit dem Schinderkarren, den er eben erst gründlich gesäubert hatte. In den noch vereisten Boden wurde dann eine mehrere Fuß tiefe Grube gegraben, der Abfall hineingefüllt und dann alles wieder zugeschüttet. Eine Knochenarbeit! So hatte er sich sein Leben als Henkerslehrling nicht vorgestellt.
Pauls Blick ging hinüber zum Herrgottswinkel, wo neben dem Kruzifix und den getrockneten Rosen das frisch geschliffene Richtschwert hing. Seit Generationen war es im Familienbesitz. Schon als kleiner Bub hatte Paul ein Scharfrichter werden wollen, so wie sein berühmter Urahn Jörg Abriel, wie sein Großvater Jakob und jetzt sein Onkel. Paul hatte für Recht und Ordnung sorgen wollen. Dass diese Ordnung sich auch auf das Reinigen der Gassen und das Wegschaffen von Tierkadavern bezog, hatte er zwar gewusst, aber zuvor kaum am eigenen Leib erfahren. Seit zwei Jahren war Paul nun der Lehrling seines Onkels, mittlerweile war er siebzehn. Die Eltern und Geschwister, ja sogar seine Tante, waren längst weggezogen ins herrschaftliche München, wo Pauls Vater es zum angesehenen Arzt gebracht hatte. Sein älterer Bruder Peter war gar ein leibhaftiger Studiosus in Ingolstadt! Und er?
Ich bin ein Nichts, dachte er. Ich bin nirgendwo zu Hause.
Es hatte Zeiten gegeben, da wollte Paul aufgeben, einfach weglaufen, egal wohin; sich vielleicht als Söldner verdingen, bei irgendeiner Armee, von denen jetzt so viele aus dem deutschen Boden sprossen. Doch er hatte sich in Schongau durchgebissen, auch weil er wusste, dass ihm das Handwerk des Henkers lag. Er war kräftig, schnell, ohne Skrupel. Oft fühlte er sich unruhig, nervös und voller Hass – er wusste selbst nicht, warum. Die Arbeit gab ihm Ruhe und Halt, sie befriedigte ihn. Manchmal mehr, als er sich eingestehen wollte.
Vor allem dann, wenn er anderen Schmerzen zufügte.
Warum das so war, wusste er selbst nicht. Er kämpfte dagegen an, aber manchmal kam es über ihn wie ein Gewitter.
Paul beugte sich über die Suppe, die mittlerweile kalt geworden war, als von der Wiege her ein leises Quäken ertönte. Er versuchte, es zu ignorieren. Doch schnell steigerte sich das Quäken zu einem Jammern und schließlich einem ohrenbetäubenden Plärren. Wutentbrannt knallte Paul den Holzlöffel auf den Tisch. Das fehlte ihm noch! Gerade wenn er seine wohlverdiente Mahlzeit einnehmen wollte, fing dieses Balg zu schreien an, als wollte es ihm das Essen nicht gönnen. Er stand auf, näherte sich der Wiege und beugte sich darüber.
»Du brauchst nicht so zu schreien, deine Mutter ist ja gleich wieder da«, versuchte er es im Guten. Doch dem Säugling schien das egal zu sein, er schrie nur umso lauter.
»Psst, sei still!«, befahl Paul. Er gab einige gurrende, beruhigende Laute von sich, so wie Tante Crescentia das immer machte, aber auch das zeigte keinen Erfolg. Schließlich ging er hinüber zum Tisch und nahm die Schüssel mit der Suppe.
»Du hast sicher Hunger«, sagte er und versuchte, den Kleinen mit dem Löffel zu füttern. »Schau her, ich hab dir ein wenig Suppe …«
Das Balg schlug ihm Löffel und Schüssel aus den Händen. Die Schüssel landete in der Wiege, und ihr wässriger Inhalt verteilte sich über die Wolldecken. Der Säugling plärrte nun immer lauter.
»Jetzt schau, was du angerichtet hast!«, schimpfte Paul. »Herrgott, man sollte dich wirklich …« Sein Satz ging im Geschrei unter. Das Gesicht des Säuglings färbte sich vor Anstrengung puterrot. Paul glaubte zu sehen, wie ihn die kleinen Schweinsäuglein beinahe hasserfüllt anglotzten. Gleichzeitig überrollte ihn die Wut, rote Schlieren schoben sich in sein Blickfeld.
Das Gewitter raste heran …
»Verdammt, jetzt hör endlich auf! Hörst du? Hör um Gottes willen auf!« Paul packte das Kleine und riss es aus der Wiege, das Schreien steigerte sich jetzt ins Unerträgliche. Er schüttelte es, der Balg schrie weiter. »Sei still, hab ich gesagt! Oder … oder ich werf dich in den Ofen und …«
Eine schwere Hand legte sich auf seine Schulter. Paul fuhr herum und blickte in das bärtige, faltige Gesicht seines Großvaters. Ihn überkam unendliche Erleichterung, so als hätte die Berührung einen Fluch von ihm genommen.
»Gib ihn mir«, befahl Jakob Kuisl. Obwohl er leise sprach und der Säugling immer noch brüllte, war seine dunkle Bassstimme erstaunlich gut zu verstehen. »Oder willst du ihn wirklich ins Feuer werfen, damit er Ruhe gibt? Der Kleine ist kein Hexer und auch kein verurteilter Falschmünzer, sondern nur ein unschuldiges, greinendes Würmchen. Und jetzt gib ihn mir, bevor noch ein Unglück geschieht.«
Erleichtert drückte Paul dem Großvater das tobende Bündel an die Brust, und beinahe augenblicklich verstummte das Geschrei. Eine besänftigende Melodie brummend, ging der alte Mann mit dem Kind in der Stube auf und ab.
Noch immer leicht zitternd, wischte sich Paul den Schweiß von der Stirn. »Wie … wie hast du das gemacht? Dass er wieder still ist?«
»Ha! Wer weiß, vielleicht bin ich ja ein Hexer?«, entgegnete Kuisl grinsend. Seine Miene wurde schlagartig ernst. »Hab den Jockel weinen gehört, bis nach drüben zu mir. Was wär wohl geschehen, wenn ich geschlafen hätte?«
»Nichts«, sagte Paul kleinlaut. »Der … der hätte sich schon wieder beruhigt. Irgendwann.«
»Soso. Hätte er …« Jakob Kuisl sah seinen Enkel lange und prüfend an, dann winkte er ab. »Ein saublöder Einfall, einen halbstarken Haudrauf auf einen Säugling aufpassen zu lassen! Was treibt sich seine Mutter auch so lange auf dem Markt rum? Nach teuren Stoffen und Tand wird sie Ausschau halten, wie so oft, und dabei schwatzen wie alle depperten Weibsbilder!«
»Das depperte Weibsbild hat Hammelfleisch, Schmalz und Salz gekauft, wie so oft«, erklang eine hohe, leicht schrille Stimme von der Tür her. »Und übrigens auch Stoff für die neue Hose des werten Herrn Schwiegervater. Weil die alte um den dicken Bauch gerissen ist.«
Großvater und Enkel drehten sich um. In der Tür stand Crescentia. Die Tochter des Peitinger Baders war breit gebaut, mit runden, von der Kälte geröteten Wangen und einem gewaltigen, wogenden Busen, den auch das keusche Mieder nicht verdecken konnte. Sie trug einen Korb, der bis obenhin mit Geräuchertem und anderen Leckereien gefüllt war. Ihre Augen funkelten zornig. »Was geht hier vor? Ich hab den Jockel durchs ganze Gerberviertel schreien hören. Dachte schon, es wär was passiert.«
»Nichts ist passiert«, brummte Jakob Kuisl, der den jetzt wieder selig schlummernden Säugling in den Armen hielt. »Der Paul und ich, wir werden mit so einem Dreikäsehoch schon allein fertig. Nicht wahr, Paul?« Er sah hinüber zu Paul, der schweigend nickte. »Davon abgesehen brauch ich keine neue Hose«, fuhr Kuisl fort. »Ich hab meine Lederhose. Die ist unzerstörbar, die kann später sogar noch dein Jockel anziehen.«
»Das möge Gott verhüten!« Crescentia verzog das Gesicht. »Die stinkt wie ein verrottender Eselskadaver. Außerdem wirst du ja wohl kaum in der Lederhose zur Beichte gehen. Wenn du überhaupt einmal zur Beichte gehst! Nötig hättest du’s ja …« Sie streckte die Arme aus. »Und nun gib mir den Kleinen, er braucht seine Mutter.«
Bei diesen Worten fing Jockel erneut zu schreien an, woraufhin Kuisl ihn wieder beruhigend wiegte. »Jetzt schau, was du mit deiner saublöden Schimpferei angestellt hast! Böse, böse Mutter …« Der alte Henker begann, unmelodisch zu brummen, und Paul musste unwillkürlich grinsen.
Seit über einem Jahr nun war Crescentia Georgs Frau. Nach langem Werben hatte sie den neuen Schongauer Henker endlich erhört. Dass es so lange gedauert hatte, hatte sicherlich auch mit ihrem Schwiegervater zu tun, denn der alte Jakob Kuisl hatte zuvor schon etliche von Georgs Heiratskandidatinnen weggebissen. Seit Längerem schon wohnte Kuisl drüben im Austragshäusl, vor zwei Jahren hatte er seinem Sohn die Stelle als Scharfrichter überlassen. Trotzdem ließ er es sich nicht nehmen, täglich im Henkershaus vorbeizuschauen, Ratschläge zu erteilen und seine berüchtigte schlechte Laune zu verbreiten. Außerdem war Kuisl nach wie vor als kundiger Heiler tätig, er verkaufte Salben, sogenanntes Armesünderfett und mumifizierte Diebesdaumen. Vom ersten Tag an hatte es zwischen ihm und seiner Schwiegertochter gekracht, wobei Paul zugeben musste, dass Crescentia eine durchaus würdige Gegnerin war.
Erst jetzt bemerkte Crescentia die schmutzigen Wolldecken in der Wiege. Sie sah Paul streng an und hob den Finger. »Was, um Himmels willen, hast du nur gemacht? Du solltest doch bloß kurz auf den Jockel aufpassen. Die Decken bekomme ich nie mehr sauber!«
»Hab halt versucht, ihn zu füttern«, gab Paul achselzuckend zurück. »Was kann ich dafür, wenn das Balg ständig Hunger hat? Wahrscheinlich bekommt er von dir nicht genügend Milch, so klein und verhutzelt, wie der liebe Jooooockel aussieht.« Er zog den Namen in die Länge, so wie es Crescentia oft machte, wenn sie mit ihrem Kind schmuste.
»Du … du …« Für einen kurzen Moment war Crescentia sprachlos. Paul hatte einen wunden Punkt getroffen. Jockels Geburt, bei der die alte Hebamme Martha Stechlin nach Kräften geholfen hatte, war nicht leicht gewesen. Der Kleine war ein sogenanntes Sternguckerkind gewesen, das im Leib der Mutter nach oben blickte, die Entbindung hatte dementsprechend lange gedauert. Danach waren Mutter und Kind so erschöpft gewesen, dass die Stechlin für eine Nottaufe nach dem Pfarrer geschickt hatte. Es war noch einmal gut gegangen, aber Jockel blieb ein schwächliches Kind.
»Es wird wirklich Zeit, dass du deiner Wege gehst!«, zischte Crescentia schließlich. »Ein so ruppiges Mannsbild wie du hat hier nichts verloren! Außerdem brauchen wir den Platz im Haus. Spätestens dann, wenn ein weiteres Kind kommt.«
»Wohl noch so ein Schwächling!«, höhnte Paul. »Darauf kann der Georg getrost verzichten. Du vergisst, dass ich der Lehrling von deinem lieben Gatten bin und bald sein Geselle. So schnell wirst du mich also nicht los! Ebenso wenig wie den Großvater. Nicht wahr, Großvater?« Er wandte sich an Kuisl, der bekräftigend nickte.
Paul war groß und kräftig gewachsen und kam damit ganz nach dem alten Kuisl. Anders als seinem älteren Bruder Peter wuchs ihm auch bereits ein Bart. Die Schongauer Mädchen sahen ihm scheu hinterher, auch wenn er als ehrloser Henkerslehrling auf den Straßen gemieden wurde. Von Paul wusste man, dass er schnell mit der Faust war und manchmal auch mit dem Messer, wenn keiner hinsah. Einige Schongauer Bürger konnten sich durchaus vorstellen, dass er demnächst selbst zum Kandidaten für eine Hinrichtung wurde, auch wenn er der Lehrling und Neffe des Henkers war. Erst letzte Woche zu Fasching hatte Paul den Schusterlehrling so sehr verprügelt, dass dieser heute noch humpelte. Der betrunkene Bursche hatte die Frechheit besessen, Paul einen ehrlosen Galgenvogel zu nennen, der auf dem Schongauer Fastnachtsumzug nichts verloren habe.
»Diese Unverschämtheiten lass ich mir von dir nicht bieten!«, schrie Crescentia. »Ich … ich werde mit deinem Onkel reden. Der soll dich Mores lehren!«
»Das können wir gleich jetzt und hier tun«, brummte jemand von der Tür aus. »Was ist denn schon wieder los? Müsst ihr denn immerzu streiten?«
Pauls Onkel Georg betrat die Stube. Seine Augen waren müde und gerötet, die letzten zwei Jahre als Schongauer Scharfrichter hatten ihn vorzeitig altern lassen. Missmutig sah er von einem zum anderen: zu Paul, seiner keifenden Gattin und zum alten Kuisl, der noch immer leise singend mit dem Kleinen in der Stube auf und ab ging.
»Und hör gefälligst mit der Katzenmusik auf, Vater!«, fuhr Georg stöhnend fort. »Ich hab einen harten Tag gehabt. Dem Schreiber Lechner fällt immer wieder neuer Papierkram ein, um mich zu malträtieren.« Er schnaubte. »Du kannst froh sein, dass auf schiefes Singen nicht der Pranger steht. Du hättest ihn wahrlich verdient.«
Jakob Kuisl hörte tatsächlich zu singen auf und grinste. »Besser ein schlechter Sänger als ein zaudernder Henker, der sich vom Stadtschreiber den Schneid abkaufen lässt.« Er beugte sein großes bärtiges Haupt zu dem Säugling hinunter. »Nicht wahr, Jooooockel?«
»Was willst du damit schon wieder sagen?«, empörte sich Georg. Er war fast genauso groß und stark wie sein Vater, mit breitem Kreuz, doch trotz seiner fast dreißig Jahre und den ersten tiefen Falten im Gesicht wirkte er neben Jakob Kuisl immer noch wie ein kleiner Bub.
»Geschenkt.« Kuisl winkte ab. »Was anderes will ich euch sagen. Vielleicht ist es ganz gut, dass wir auf diese Weise mal alle zusammen sind, hier in der guten Stube. Ich werde nämlich verreisen.«
Sowohl Georg wie auch Crescentia starrten den Alten entgeistert an.
»Du wirst … was?«, fragte Georg schließlich.
»Hast schon richtig gehört, Filius. Ich reise nach München zu deinen beiden Schwestern und ihrer Sippschaft.« Kuisl nickte grimmig. »Das wollt ich schon lang mal wieder machen. Hab nur drauf gewartet, dass es endlich taut. Seit gestern kann man auf dem Lech wieder reisen. Der Roider Toni von der Floßlände hat’s mir vorhin bei einem Bier erzählt. Der Fluss ist fast eisfrei.«
»Aber in deinem Alter …«, hoben Georg und Crescentia gleichzeitig an.
»Verflucht, ich bin noch keine siebzig! Und ihr tut so, als wär ich der Methusalem.«
»Vater, denk doch mal nach«, wagte Georg einen zweiten Versuch. »Ich hab dich in letzter Zeit beobachtet. Dir geht es nicht gut, das hab ich gesehen. Sitzt oft draußen allein auf der Bank, starrst vor dich hin, und deine Hände …«
»Herrgott, was ist mit meinen Händen, ha?« Kuisl hob seine beiden großen Pranken, die immer noch aussahen, als könnte er damit sämtliches Eis allein aus dem Lech räumen. »Mit diesen Händen hab ich stranguliert, gehenkt und enthauptet! Ich kann noch immer einen Strauchdieb auf die Galgenleiter heben und einen Zentnerstein an die Füße von einem störrischen Verdächtigen hängen. Also komm mir nicht mit meinen Händen!«
Georg schwieg. Doch Paul musste dem Onkel insgeheim recht geben. Der Großvater mochte nach außen hin der Alte sein, doch irgendetwas war … anders in den letzten Wochen. War es das Zittern der Hände, das offenbar auch Georg aufgefallen war? Das leblose Starren oder das Schnaufen und Stöhnen, das nachts vom Austragshäusl bis herüber ins Henkershaus zu hören war? Er erinnerte sich, wie er kürzlich mit dem Großvater gesprochen hatte und dieser nach Worten rang, als ob sie ihm nicht mehr einfallen würden. Einfache Wörter wie Löffel oder Schwert …
»Du kannst nicht nach München, nicht bei dem eisigen, nassen Wetter.« Georg schüttelte den Kopf. »Noch dazu allein! Der Simon, dein Schwiegersohn, mag ja ein guter Arzt sein, aber bis du dort anlangst, hast du dir ein Fieber oder was weiß ich geholt.«
»Ich geh ja nicht allein«, entgegnete Kuisl achselzuckend. Er deutete auf Paul. »Mein Enkel kommt mit und passt auf mich auf. Das kann er auch besser, als auf kleine plärrende Hosenscheißer aufzupassen.« Er zwinkerte Paul zu. »Nicht wahr?«
Paul war genauso verblüfft wie die beiden anderen. Die Aussicht, eine Weile aus Schongau wegzukommen, war verlockend. Ein paar Jahre seiner Kindheit hatte Paul in München verbracht, außerdem lebte dort auch seine kleine Schwester Sophia, die er über alles liebte, ebenso wie seine Mutter. Nur mit dem Vater hatte es immer wieder Ärger gegeben, aber ihm konnte er ja aus dem Weg gehen. Er würde ein paar alte Spezln wiedersehen, mit ihnen wie früher durch die Gassen im Angerviertel ziehen, ein paar Humpen Bier trinken … Alles war besser, als in einem stinkenden Kaff wie Schongau den Müll aus der Stadt zu schleppen.
»Aber das … das geht nicht!«, protestierte Georg. »Ich brauch den Paul, um den Unrat wegzuschaffen. Der Schreiber Lechner tobt jetzt schon. Die Fronveste gehört mal wieder ausgekehrt, die Grube am Katzenweiher ausgehoben, und schon morgen muss ich gleich drei zänkische Weiber an den Pranger …«
»Das kannst du auch allein«, unterbrach ihn Jakob Kuisl unwirsch. »Hab ich früher auch alles allein machen müssen. Ich hatte keinen Lehrling, der mir die Ketten sauber wienert. In den nächsten Tagen wird schon keine zwölfköpfige Räuberbande gehängt werden müssen.«
»Aber …«, versuchte es Georg erneut. Diesmal war es Crescentia, die ihrem Mann ins Wort fiel.
»Vielleicht hat dein Vater ja recht.« Sie lehnte sich an Georg und streichelte ihm zärtlich die bärtige Wange. »Es ist doch nur allzu verständlich, dass er mal wieder seine Töchter sehen möchte. Findest du nicht? Nach der langen Zeit …« Ihr abwägender Blick blieb Paul nicht verborgen. »Und die Fronveste kann auch ich ausfegen. Das vermag ein Weibsbild ohnehin viel besser.«
»Ha! Am Ende hilfst du mir noch beim Hängen und Köpfen!« Georg lachte rau. Er runzelte die Stirn und überlegte, was bei ihm immer ein bisschen länger dauerte als bei den anderen Familienmitgliedern. Doch auch ihm war die Vorstellung, ein, zwei Wochen ohne den knurrigen Vater und den widerborstigen Neffen, allein mit Frau und Kind, zu verbringen, offenbar nicht unangenehm. Schließlich winkte er ab.
»Ach, was soll’s! Dass du nach München reist, kann ich dir ja eh nicht verbieten. Und dann ist es mir wirklich lieber, dass der Paul mitgeht. Beim Unrat kann mir auch der Schinder helfen.« Georg sah den alten Henker besorgt an. »Und du bist wirklich sicher, dass nichts ist?«
»Was soll schon sein?« Kuisl zuckte mit seinen breiten Schultern. »Ich bin ein alter, sturer Ochse. Der trägt sein Joch, bis ihn der Herrgott holt. Und bis dahin ist’s noch lang.« Er bleckte die Zähne und zwinkerte Crescentia zu. »Und wär’s auch bloß, damit ich meine Schwiegertochter noch ein paar Jahre zur Weißglut treiben kann.«
»Weiß Gott, das kannst du, Vater! Das kannst du. Und nicht nur die Crescentia.« Georg lächelte. Doch sein Blick blieb sorgenvoll.
Und auch Paul spürte etwas in der Luft, wie eine unsichtbare Bedrohung, eine dunkle Aura, die den Großvater umgab.
In diesem Augenblick fing Jockel wieder zu schreien an.
»Wann kommt er denn jetzt? Du hast gesagt, mittags. Aber Mittag ist lang vorbei, und ich hab Hunger! Außerdem regnet es in Strömen, und ich muss mal aufs Häusel …«
Magdalena knotete ihr Kopftuch fester, ganz so, als könnte sie auf diese Weise das Schimpfen ihrer Tochter ausblenden. Das war gar nicht so leicht. Sophia konnte ziemlich stur sein, wenn ihr was nicht passte, so stur, wie zehnjährige Mädchen eben nun mal waren. Außerdem hatte sie ja recht. Es war wirklich kein Vergnügen, sich hier vor dem Schwabinger Tor im Norden Münchens die Beine in den Bauch zu stehen. Zwar hatten sie einen halbwegs trockenen Unterstand gefunden, einen heruntergekommenen Pferdestall am Rande der Stadtmauer, der den Wachen offenbar auch als Toilette diente. Aber das Dach war undicht, es tropfte und stank erbärmlich. Der schmucke Hofgarten und die kurfürstliche Residenz waren nur einen Steinwurf weit entfernt, doch durch den Schleier des Regens kaum zu sehen, ebenso wenig wie die Baustelle der Theatinerkirche, des neuen Prunkbaus, vom dem jetzt alle sprachen.
Gedankenverloren beobachtete Magdalena das Kommen und Gehen. Kutschen und Fuhrwerke bildeten eine lange Schlange vor dem Stadttor, in regelmäßigen Abständen durfte eines der Gefährte die niedrige Durchfahrt passieren. Hausierer mit Buckelkraxen liefen durch den knöcheltiefen Dreck und boten unter lautem Krakeelen ihre Waren an, zerlumpte Kinder spielten in den Pfützen, auf denen hier und da noch Eissplitter trieben. Elegante Kavaliere mit Allongeperücken führten ihre Damen an der Hand, wobei die Paare eifrig darauf bedacht waren, sich nicht schmutzig zu machen. Ein sinnloses Unterfangen, wie Magdalena feststellte. Unwillkürlich musste sie grinsen. Sie würde sich wohl nie daran gewöhnen, dass die Mannsbilder neuerdings Perücken trugen, sich das Gesicht mit Puder einrieben und so stark parfümiert waren, dass sie rochen wie ein ganzes Feld voller Veilchen. Ihr eigener Mann Simon mochte ja ein modeversessener Geck sein, aber was diese jungen Herrschaften mittlerweile trieben, ging eindeutig zu weit.
Wenn das die sogenannte neue Zeit ist, dann hat die alte vielleicht nicht besser, aber zumindest ehrlicher gerochen, dachte Magdalena.
»Ich hab Hunger!«, ertönte erneut Sophias Stimme. Ihre Tochter stampfte wütend mit dem Fuß auf. »Kann ich denn nicht solange zur Tante Barbara gehen? Oder zurück nach Hause? Der Paul hat gesagt, er will mir einen Bogen schnitzen, damit wir auf Tauben schießen können.«
»Der Paul soll dir nicht immer so einen Unsinn beibringen.« Magdalena seufzte leise. Sie wusste nur zu gut, dass Sophia ihren großen Bruder über alles liebte.
Völlig überraschend war Paul gestern zusammen mit dem Großvater aus Schongau angekommen. Mit keinem Brief hatte sich der alte Kuisl vorher angekündigt, die beiden hatten plötzlich vor der Tür gestanden, zur großen Freude von Sophia und Magdalena – und zur nicht ganz so großen Freude von Simon. Letzte Woche hatte zudem ihr ältester Sohn Peter geschrieben, er werde für ein paar Tage nach München kommen. Seitdem stand man kopf im Haus der Fronwiesers, es war fast so wie in den alten Schongauer Tagen, die Magdalena so schmerzlich vermisste. Die Familie Kuisl war wieder vereint, wenn auch ohne Georg.
»Willst du denn deinen anderen großen Bruder nicht wiedersehen?«, wandte sie sich an Sophia. »Es ist schon Monate her, seit ihr euch das letzte Mal getroffen habt! Der Peter weiß gar nicht mehr, wie du aussiehst.«
Sophia zog eine Schnute. »Bah! Das findet er auch später bei uns zu Hause raus. Warum müssen wir deswegen im Regen auf ihn warten?«
»Weil man das eben so macht als Familie«, gab Magdalena barsch zurück. Doch im Grunde musste sie Sophia recht geben. Sie hätten, zusammen mit den übrigen Familienmitgliedern, ebenso gut zu Hause auf Peter warten können. Die Postkutsche aus Ingolstadt sollte eigentlich schon gegen Mittag kommen, wie Peter in seinem Brief angekündigt hatte. Aber wegen des Tauwetters und des Regens war sie vermutlich irgendwo im Schlamm stecken geblieben. Es konnte noch Stunden dauern, bis ihr Sohn eintraf. Aber Magdalena hatte eben geglaubt, dass sie ihn abholen müsste.
Weil man das als liebende Mutter macht, wenn der verlorene Sohn heimkehrt, dachte sie. Auch wenn dieser Sohn mittlerweile achtzehn Jahre alt ist, in einer Bücherwelt wohnt und von seiner ihn liebenden Mutter nicht mehr viel wissen will.
Vermutlich war sie auch deshalb vors Schwabinger Tor gekommen, um Peter selbst die frohe Botschaft zu überbringen, dass sein ein Jahr jüngerer Bruder in der Stadt weilte. Als Kinder waren Peter und Paul ein Herz und eine Seele gewesen, doch in den letzten Jahren hatten sie sich mehr und mehr auseinandergelebt, sie waren einfach zu verschieden. Vielleicht konnte so ein überraschendes Wiedersehen ihr Verhältnis ja wieder kitten?
»Wir warten noch eine halbe Stunde, ja?«, schlug Magdalena ihrer Tochter vor. Sie kramte ein paar Münzen unter ihrem Rock hervor. »Hol dir drüben bei der Wurstbraterei am Hofgarten solange eine Rosswurst. Und meinetwegen auch ein paar kandierte Nüsse.«
Das ließ sich Sophia nicht zweimal sagen. Sie steckte die Münzen ein und humpelte über den belebten Platz. Sophia war mit einem Klumpfuß zur Welt gekommen, doch trotz ihrer Behinderung war sie schneller und geschickter als viele andere Kinder ihres Alters. Aber leider mindestens genauso unvorsichtig.
»Und pass um Gottes willen auf die Fuhrwerke auf!«, rief ihr Magdalena hinterher, doch ihre Tochter hörte sie schon nicht mehr. Vermutlich war Magdalena auch deshalb so ängstlich, weil Sophia das einzige ihrer drei Kinder war, welches sie überhaupt noch umsorgen konnte. Magdalena hatte nie gewollt, dass einer ihrer Söhne einmal in die Fußstapfen ihres Vaters, des Schongauer Scharfrichters, trat. Aber Paul hatte den Großvater und dessen Beruf schon als Kind bewundert. Ganz anders als Peter, der ganz nach seinem Vater kam. Nach einer glänzenden Schullaufbahn im Münchner Jesuiten-Kollegium, das Peter wegen seiner herausragenden Leistungen hatte besuchen dürfen, studierte er nun seit letztem Jahr Medizin an der Ingolstädter Universität. Es machte Magdalena stolz, dass der Enkel eines ehrlosen Scharfrichters, ihr Sohn, es irgendwann einmal zu einem angesehenen Doktor bringen würde. Doch sie wusste auch, dass sie drei Kinder hatte, nicht nur eines – und dass jedes sie auf seine eigene Art brauchte.
Auch wenn das manchmal schwerfällt, ging ihr durch den Kopf. Besonders bei dem einen Kind …
Der Regen hatte mittlerweile zugenommen und war in ein kräftiges Prasseln übergegangen. Magdalena fluchte leise, während es durch das undichte Dach auf sie herabtropfte. Sophia hatte recht: Was für ein saublöder Einfall, bei so einem Wetter auf eine Kutsche zu warten! Doch gerade als Magdalena hinüber zur Wurstbraterei gehen wollte, um nach ihrer Tochter zu sehen, ertönte der vertraute Ruf des Posthorns. Kurz darauf näherte sich von Norden her auf der schlammigen Schwabinger Straße eine Kutsche, die von vier Pferden gezogen wurde. Es dauerte noch eine ganze Weile, bis die Postkutsche, deren Dach turmhoch mit Kisten und Säcken beladen war, vor dem Tor zum Halten kam. Dann endlich öffneten sich die Türen, und Magdalenas Herz machte einen Sprung, als sie zwischen den anderen Reisenden ihren ältesten Sohn erkannte.
Im Gegensatz zu Paul ähnelte Peter sehr seinem Vater. Er war klein und eher zierlich, ein noch weicher schwarzer Flaum wuchs über seinen Lippen. Mühsam schulterte der junge Studiosus seinen Reisesack, der, wie Magdalena vermutete, wieder einmal hauptsächlich Bücher enthielt. Seit einiger Zeit trug Peter nun auch eine Brille, was ihn wie einen kindlichen Gelehrten aussehen ließ. Offenbar hatte er in der Kutsche gelesen, jedenfalls machte er einen ziemlich abwesenden Eindruck. Magdalena war schleierhaft, wie man bei all dem Geschaukel überhaupt die Buchstaben erkennen konnte, die Postkutschen wurden nicht umsonst auch Marterkasten oder Knochenhacker genannt. Wie so oft war Peter blass, er wirkte zwischen den vielen Menschen auf dem Platz einsam und verloren. Den prasselnden Regen schien er gar nicht zu bemerken.
Magdalena winkte und lief auf ihn zu. »Peter, Peter! Hier bin ich, hier!«
Er hob den Kopf und schien weniger erfreut als verblüfft, seine Mutter vor dem Stadttor anzutreffen.
»Du hier? Aber das wäre doch nicht nötig gewesen.« Schmunzelnd hob er den schweren Reisesack. »Sag nur nicht, du wolltest mir beim Tragen helfen.« Er sah sich suchend um. »Ist der Vater etwa auch hier?«
»Der Vater hat den ganzen Tag über Patienten, so wie eigentlich jeden Tag. Aber du siehst ihn hoffentlich gleich beim Mittagessen. Ihn und auch noch ein paar andere«, fügte sie geheimnisvoll hinzu. »Ich habe nämlich eine Überraschung für dich.«
»Gut, gut.« Peter nickte gedankenverloren. Er schien ihre Andeutung überhört zu haben. »Es gibt da nämlich ein paar heikle medizinische Fälle, die ich mit dem Vater besprechen wollte.«
Magdalena verdrehte die Augen. »Könnt ihr zwei Mannsbilder denn einmal nicht über die Arbeit reden? Vielleicht freue ich mich ja auch, dich mal wiederzusehen und mit dir zu reden. Das letzte Mal liegt schon ein paar Monate zurück.«
»Ich muss auf meine Prüfungen lernen, Mutter.« Peter sah sie streng an. »Dass ich kommen konnte, liegt nur daran, dass unser Professor für ein paar Wochen nach Heidelberg verreist ist. Und lernen kann ich auch hier.«
Magdalena musterte ihren Ältesten und versuchte, in ihm den kleinen ängstlichen Jungen zu sehen, der sich einst an ihren Rock geklammert hatte. Das schien Ewigkeiten her zu sein.
»Hat dein erfreulicher Besuch in München auch etwas damit zu tun, dass er dich mal wieder treffen will?« Sie sprach den Namen nicht aus, doch beide wussten, wen sie meinte. Peters Freundschaft mit dem jungen bayerischen Kurfürsten war einer ihrer großen Streitpunkte.
Er zuckte mit den Schultern. »Vielleicht will ich Max ja auch sehen. Immerhin ist es eine Ehre, und er ist mein Freund …«
»Er ist nicht dein Freund, Peter! Er ist der bayerische Kurfürst, seit letztem Jahr auch in vollem Amt und ohne Vormund. Ein Fürst kann nicht dein Freund sein. Niemals! Er wird dich nur wieder benutzen und …«
»Du sprachst vorhin von einer Überraschung«, fuhr Peter dazwischen. Er war offensichtlich nicht gewillt, mit ihr über sein Verhältnis zu Kurfürst Max Emanuel zu sprechen.
»Ja, die gibt es …«, hob Magdalena an. Doch bevor sie weitersprechen konnte, kam Sophia auf sie beide zugehumpelt, das Gesicht mit Senf verschmiert.
»Peter!« Im Gegensatz zu ihrer vorherigen Behauptung schien Sophia nun doch froh, ihren großen Bruder zu sehen. Sie warf sich in seine Arme. »Ich hab dich so vermisst!«
»Und ich dich auch.« Lachend fuhr ihr Peter durch das verstrubbelte Haar. »Du bist ja schon wieder größer geworden! Wenn ich nicht aufpasse, überragst du mich noch irgendwann.«
»Und du bleibst ein Zwerg!«, sagte Sophia kichernd. »Fang mich!«
Trotz ihrer Behinderung rannte sie vor ihrem Bruder davon, an den schimpfenden Wachen vorbei und durch das Stadttor. Lachend eilte ihr Peter mit dem Reisesack hinterher.
Magdalena blickte ihnen nach und schüttelte langsam und wortlos den Kopf.
So wie es aussah, musste Peter wohl selbst herausfinden, was die Überraschung war.
Schon kurze Zeit später erreichten sie das Haus der Fronwiesers im gutbürgerlichen Münchner Graggenauer Viertel. Seit letztem Jahr besaß Simon seine eigene Praxis, deshalb waren sie in ein größeres, mehrstöckiges Haus gezogen. Unten im Erdgeschoss befand sich der Behandlungsraum, der auch heute gut besucht war. Bis vor die Tür standen die Patienten in dünner ärmlicher Kleidung, Regen und Kälte schienen ihnen nichts auszumachen. Die meisten von ihnen waren einfache Bürger, Handwerker oder Mägde, aber auch etliche quengelnde, rotznäsige Kinder, die von ihren Müttern getragen wurden, waren darunter. Simon hatte als Arzt einen guten Ruf, auch deshalb, weil er jeden Menschen gleich behandelte, egal ob Flickschuster oder Ratsmitglied. Viele der Münchner Patrizier gingen deshalb lieber zur teureren Konkurrenz im Kreuzviertel, wo man unter sich war.
»Ich bin wirklich gespannt, ob dein Vater Zeit findet für ein Mittagessen«, seufzte Magdalena, als sie an den vielen schniefenden und hustenden Wartenden vorbeigingen. Eine schmale Stiege führte vom Erdgeschoss hinauf in die Wohnräume. »Jetzt, da es anfängt zu tauen, kommen immer besonders viele Kranke. Weiß der Teufel, woran das liegt! Du siehst ja selbst, was hier los ist.«
Peter nickte anerkennend. »Vater hat es wirklich zu etwas gebracht.«
»Ja, das hat er«, sagte Magdalena leise. »Wir alle …« Sie dachte an die Zeit zurück, als Simon noch der arme Sohn des Schongauer Baders gewesen war und sie eine ehrlose Henkerstochter. Sie hatten beide immer von einem besseren Leben geträumt. Und trotzdem – noch immer schmerzte es Magdalena, dass sie ihre Heimat Schongau, wo sie jeden Strauch, jeden Baum, jeden Menschen kannte, hatte verlassen müssen.
Sie öffnete die Tür zu den oberen Gemächern, die ganz im neuen bürgerlichen Stil eingerichtet waren. Hohe Kleiderschränke statt der sperrigen, quietschenden Truhen, durchsichtiges Glas anstelle der dunklen Butzenscheiben, alles wirkte hell und freundlich – und es roch auch nicht nach Rauch und nach dem Vieh im Stall nebenan, so wie früher in Schongau. Manchmal vermisste Magdalena diesen Geruch. Simon hatte schon öfter darauf gedrängt, ein Dienstmädchen einzustellen, aber Magdalena behagte der Gedanke nicht. Sie kam sich schon ohne Dienstmagd oft fremd vor, wie verkleidet. Zumindest die Küchenstube hatte sie sich ein wenig so eingerichtet wie zu Hause in Schongau.
Als Peter hinter ihr und Sophia eintrat, prallte er zurück.
»Was in aller Welt …«, stotterte er.
»Schön, dich mal wieder zu sehen, großer Bruder.« Paul saß neben dem Pfeife schmauchenden Großvater am Küchentisch und grinste über beide Ohren. »Oder sollte ich besser sagen, kleiner Bruder? Bist du geschrumpft? Und was soll dieses Drahtdings da in deinem Gesicht? Du siehst ja aus wie ein Pfaffe.«
»Aber wieso …?« Peter stand vor Staunen der Mund offen. Schließlich wandte er sich an seine Mutter. »Warum hast du mir nichts gesagt?«
»Nichts gesagt?« Sie zuckte die Achseln und lächelte. »Hab ich ja versucht, aber du wolltest nur wissen, wann du mit dem Vater über irgendwelche Krankheiten fachsimpeln kannst. Und dann bist du mit der Sophia davongezogen.«
»Der Großvater will mit dem Paul und mir später Bogen schießen gehen«, krähte Sophia und setzte sich auf Pauls Schoß. »Und dann rupfen wir die Tauben und braten sie, und dann …«
»Warum seid ihr denn hier in München?«, unterbrach Peter seine kleine Schwester und wandte sich an Paul. Er hatte seine Verblüffung noch nicht ganz überwunden. »Ist gar was passiert? Ein Unglück?«
»Warum muss es denn immer gleich ein Unglück sein, wenn man die liebe Verwandtschaft besucht?«, brummte Jakob Kuisl. Er tat einen tiefen Zug von seiner Pfeife. »Ihr besucht uns ja nicht in Schongau. Also kommen wir eben nach München. So weit ist das nicht. Schongau liegt ja nicht hinter dem Mond.«
»Aber fast«, spottete Peter. Er stellte seinen Reisesack ab. »Wie auch immer, ich freue mich, euch alle zu sehen! Wenn jetzt noch die Tante Barbara mit ihrem Mann Valentin vorbeischaut, ist die Familie fast wieder komplett.«
»Ich hab der Barbara schon Bescheid gegeben«, sagte Magdalena schmallippig. »Sie … schaut, wann es sich einrichten lässt.« Zwischen ihrer Schwester und dem Vater war es in den letzten Jahren immer wieder zu Streitereien gekommen. Jakob Kuisl hatte nie akzeptiert, dass seine jüngere Tochter einen Musikanten geheiratet hatte. Wenn, dann kam Barbara wegen ihrer geliebten Neffen auf einen Humpen vorbei, sicher nicht wegen ihres alten, grantigen Vaters.
Magdalena klatschte in die Hände. »Ich hab geschupfte Nudeln mit Kraut und fettem Bauchspeck für uns alle gemacht. Der Paul hat sich das gewünscht.«
»Ich hätt gern noch ein Bier, wenn’s recht ist. Ist gar nicht so übel, euer Münchner Odelwasser.« Ihr Vater schob den leeren Humpen über den Tisch.
Magdalena wollte ihm eben aus dem großen Krug nachschenken, als sie Schritte auf der Stiege hörte. Kurz darauf trat Simon ein, er sah müde und abgearbeitet aus. Doch als er seinen älteren Sohn entdeckte, hellte sich seine Miene auf.
»Peter! So früh hatte ich dich gar nicht erwartet.«
»Der Junge hatte geschrieben, dass er heute mit der Mittagskutsche kommt«, sagte Magdalena. »Erinnerst du dich nicht?«
Simon ließ sich auf einen Stuhl fallen. »Ich muss es wohl vergessen haben. Kein Wunder, bei all den Patienten unten! Irgendein Fieber geht um, dazu der übliche Husten und Schnupfen um die Jahreszeit … Zum Zweiuhrläuten geht es unten schon wieder weiter, es ist ein Irrenhaus!«
»Ich kann dir ja in der Praxis aushelfen«, schlug Peter vor.
»Ich dachte, du musst auf deine Prüfungen lernen?« Simon lächelte. »Aber nun ja, ein bisschen angewandte Theorie kann sicher nicht schaden. Und Hilfe könnte ich wahrlich gut gebrauchen.«
»Ich wollte dich ohnehin zu ein paar Fällen befragen«, sagte Peter. »Was dieser Harvey da zum Blutkreislauf geschrieben hat, ist wirklich erstaunlich! Und dann dieser andere Engländer, dieser Richard Lower. Ich frage mich, ob man wirklich das Blut anderer …«
»Vielleicht können wir erst mal essen, ja?«, knurrte Paul. Er hob seinen Krug. »Und ich brauch, glaub ich, auch noch ein frisches Bier.«
Die nächsten Stunden verbrachten die Kuisls fast so wie früher. Zechend, schmausend, lachend und streitend … Es tat Magdalena gut, zu sehen, wie die Familie mal wieder beisammensaß, auch wenn Georg und Barbara fehlten. Mit leiser Wehmut bemerkte sie, wie düster Paul dreinblickte, weil Peter und Simon immer wieder die Köpfe zusammensteckten und fachsimpelten. Warum sprach Simon nicht auch mal mit seinem jüngeren Sohn! Es war immer schwer gewesen mit den beiden, sie waren einfach zu verschieden. Aber Himmelherrgott, Paul war ebenso Simons Sohn wie Peter, auch wenn Paul nicht wusste, was ein Blutkreislauf war, und nicht jeden Knochen auf Lateinisch herbeten konnte! Magdalena hoffte, dass sich Paul zumindest in Schongau wieder eingelebt hatte. Als sie ihn gestern zu seinem Onkel, der Tante und dem kleinen Jockel befragt hatte, war er ziemlich einsilbig gewesen.
Jakob Kuisl saß die meiste Zeit still da, seine Enkelin auf dem Schoß. Aus dem Augenwinkel beobachtete Magdalena ihren schweigsamen Vater. Er ging jetzt auf die siebzig zu, seine einst schwarzen Haare waren grau und weiß geworden, ebenso der immer noch mächtige Vollbart. Die Hakennase ragte aus dem Gesicht hervor, mehr noch als früher, was auch daran lag, dass Kuisls Wangen schlaff geworden waren. Er war immer noch ein stämmiger Mann, aber ihm fehlte das Feuer von früher. Seine Augen schimmerten leer und müde, selbst wenn er von Zeit zu Zeit grimmig lächelte oder an seiner langen Stielpfeife zog. Und dann fiel Magdalena noch etwas auf: Kuisls Hände zitterten. Er versuchte es zu verbergen, aber vor seiner Tochter gelang ihm das nicht. Dafür kannte sie ihn zu gut.
»Nun hast du uns immer noch nicht verraten, was dich nach München treibt, Vater«, sagte Magdalena, als sie die schmutzigen Zinnteller wegräumte. Auch das war so eine neue Gewohnheit. Früher, in Schongau, hatten sie meist alle zusammen aus einer großen gusseisernen Pfanne gegessen. »Du hättest ja wenigstens vorher schreiben können.«
»Weißt doch, das Schreiben liegt mir nicht so«, brummte Kuisl. Er kramte seinen Tabakbeutel hervor und stopfte sich eine neue Pfeife. Auch dabei zitterten seine Hände leicht. »Im Grunde hab ich es auch wegen dem Paul gemacht.«
»Wegen dem Paul?« Simon runzelte die Stirn. Er warf seinem Sohn einen misstrauischen Blick zu. »Hast du etwa wieder etwas angestellt?«
»Das geht nicht mehr lang gut mit ihm und der Crescentia und dem Georg«, fuhr Kuisl fort. »Die sind jetzt eine Familie, mit dem Jockel und wohl bald einem weiteren Kind …«
»Und du bist der Lehrling deines Onkels«, wandte sich Magdalena an Paul. »Das wolltest du doch immer: ein Scharfrichter werden. Was geht da nicht gut?«
Paul nahm mürrisch einen Schluck Bier, wischte sich über den beginnenden Bart. »Das ist doch nur Drecksarbeit, die ich für den Onkel mach. Schrubben, kehren, den Unrat und die Kadaver aus der Stadt bringen … Ich kann froh sein, wenn er mich mal einen Strauchdieb aufhängen lässt! Und die Crescentia ist ein Drachen …«
»Sie ist deine angeheiratete Tante, Paul«, mahnte Magdalena. »Außerdem ist es doch eine Binsenweisheit, dass man als Lehrling nicht gleich das Handwerk des Meisters verrichtet.«
»Der Onkel traut mir nicht, er hat mir nie getraut. Da kann ich noch so viele Jahre schuften, nie lässt der mich ans Richtschwert!« An seiner Stimme merkte Magdalena, dass Paul schon mehr Bier getrunken hatte, als ihm guttat. »Ihr redet leicht! Sitzt euch hier in eurem schönen Haus die gepuderten Ärsche breit. Das Schongauer Henkershaus dagegen ist eine stinkende Kate, es zieht und qualmt, dieser verfluchte Balg schreit tagein, tagaus …«
»Himmelherrgott, jetzt reicht es mir aber!« Simon schlug auf den Tisch. »Jahrelang haben wir deine Eskapaden geduldet. Immer sind die anderen schuld, nie bist du zufrieden!«
»Oho, jetzt kommt die alte Leier, ja?« Paul verdrehte die Augen. »Der enttäuschte Herr Vater! Was kann ich denn dafür, dass ich mich nicht um Arzneien und lateinischen Hokuspokus schere. Dass ich nicht so bin wie der da!« Bei den letzten, geradezu ausgespuckten Worten nickte er zu seinem Bruder hinüber.
Peter seufzte und schob seinen nur halb ausgetrunkenen Krug zur Seite.
»Paul, was soll das? Immer musst du mit dem Kopf durch die Wand. Es bringt doch nichts, wenn wir …«
In einer wütenden Bewegung fegte Paul Peters Bierkrug vom Tisch, dass es spritzte. »Ach, wischt euch doch alle mit euren Büchern den Arsch ab! Ich kann eure Litaneien nicht mehr hören!« Sophia fing zu wimmern an und versteckte sich unter der Joppe ihres Großvaters. »Jetzt tut ihr so vornehm«, spottete Paul mit schwerer Stimme. »Dabei seid ihr doch auch nichts Besseres als ich! Henkerskinder, Musikanten, ein lausiger Bader … Allesamt Ehrlose! Wir Kuisls bleiben Ehrlose, egal, was wir anziehen und wie blasiert wir daherreden!«
»Paul, ich bitte dich …«, versuchte Magdalena, ihn zu besänftigen. Doch ihr Mann fuhr dazwischen.
»Vielleicht kann der junge Herr ja mal erklären, was er denn so machen möchte in seinem Leben«, sagte er mit schneidender Stimme. »Gott hat uns allen einen Platz auf Erden gegeben. Welcher Platz ist deiner, Paul? Welcher, na? Vielleicht der unter der Brücke oder in einem Schafstall? Oder gar auf dem Schafott?«
»Sicher kein Platz hier am Tisch! Das hast du mir ja gerade mehr als deutlich zu verstehen gegeben.« Paul stand wankend auf, er stieß den Stuhl um. »Ich geh zur Tante Barbara. Da ist die Gesellschaft allemal lustiger, und musiziert wird auch. Ich versteh gar nicht, warum ich überhaupt hergekommen bin. Ich hätte es wissen müssen! Du hast dich nicht geändert, Vater. Du bist immer noch der gleiche eitle Geck …«
»Herrschaftszeiten und Kreuzsakrament, jetzt ist aber eine Ruh!« Jakob Kuisl schlug mit seiner Pfeife so fest auf den Tisch, dass der Stiel abbrach. Es war das erste Mal, dass er in dem Streit die Stimme erhob, dafür war sie nun umso gewaltiger. Sophia sprang von seinem Schoß und flüchtete zu ihrer Mutter.
»Dieses ganze Gezanke und Geplärre macht mich noch ganz damisch!«, schimpfte Kuisl. »Ihr gspinnerten Streithansln!« Mit dem abgebrochenen Stiel deutete er auf jeden Einzelnen am Tisch, er zitterte vor Zorn. »Was hat die Kuisls immer stark gemacht? Dass wir zusammengehalten haben, zu allen Zeiten, gegen jeden! Nicht allein, sondern gemeinsam …« Er schnaufte tief, bevor er weitersprach, während die anderen beschämt schwiegen.
»Die Menschen haben auf uns gespuckt, sie haben drei Kreuze geschlagen, wenn sie uns begegnet sind. Sie haben uns nicht in ihre Häuser gelassen, obwohl wir ihnen die Dreckarbeit abgenommen haben. Aber hat uns das was ausgemacht? Nein! Weil … weil wir eine Familie waren, ein … ein Stamm, der zusammenhält! Gottverdammt, wenn euer Urgroßvater sehen könnte, wie ihr euch … wie ihr … wie …« Kuisl stockte. Sein Gesicht war plötzlich aschfahl.
»Vater, was hast du?«, fragte Magdalena ängstlich.
Jakob Kuisls Finger krallten sich um den Tischrand. Er versuchte aufzustehen, der Schemel glitt ihm weg. Polternd stürzte der alte Mann zu Boden.
»Großvater!«, schrie Sophia. »Was ist mit dem Großvater? Stirbt er?«
Simon sprang auf. »Lasst mich zu ihm!« Er beugte sich über seinen Schwiegervater und öffnete ihm das Hemd. Schaum stand Kuisl vor dem Mund, er zuckte am ganzen Leib.
»Ich fürchte, es ist ein Schlagfluss«, sagte Simon. Er hielt sein Ohr an Kuisls bebenden Leib. »Vielleicht auch das Herz …«
»Dann tu doch was!«, schrie Magdalena. »Verdammt, tu was, du … du bist Arzt! Wir … wir können doch nicht hier sitzen und darauf warten, dass er … dass er stirbt!«
Paul stand da wie erstarrt, währenddessen eilte Peter seinem Vater zu Hilfe. »Branntwein!«, verlangte er. »Wir brauchen Branntwein! Schnell!«
Magdalena stürzte zu einem der Schränke. Sie wühlte darin, etliche Krüge und Teller fielen um, gingen zu Bruch. Endlich reichte sie Peter die tönerne Flasche mit dem Branntwein, und er begann, den massigen Oberkörper des Großvaters damit einzureiben. Ab und zu hielt er inne, legte das Ohr an die behaarte Brust und lauschte auf Kuisls Atem. Die anderen schwiegen in banger Erwartung, nur Sophia weinte leise. Schließlich wandte Peter sich wieder an seine Mutter.
»Er ist nicht mehr bei Besinnung, doch zumindest scheint er jetzt wieder ruhiger zu atmen. Davon abgesehen …« Er und Simon wechselten einen sorgenvollen Blick.
»Was ist?«, hauchte Magdalena. »Wird er … wird er sterben? Bitte sagt mir die Wahrheit! Wird … wird mein Vater sterben?«
»Mehr können wir Ärzte nicht machen«, sagte Simon zu Magdalena. Er sah sie traurig an. »Jetzt hilft nur noch beten. Dein Vater ist in Gottes Hand.«
Als Magdalena und Simon sich diese Nacht endlich zur Ruhe legten, war nichts mehr so wie noch am Morgen. Nach dem schrecklichen Vorfall hatte Simon seine Praxis geschlossen und die murrenden Patienten nach Hause geschickt. Der heftige Streit zwischen Paul und seinem Vater war vergessen, zumindest vorübergehend. Man sah Paul an, wie sehr es ihn bekümmerte, dass es ausgerechnet sein Wutausbruch gewesen war, der dem Zusammenbruch des Großvaters vorausgegangen war. Seit Stunden sprachen alle nur noch leise miteinander, wenn sie denn überhaupt etwas sagten. Magdalena fühlte sich wie bei einer Beerdigung. Dabei lebte ihr Vater noch!
Peter und Paul teilten sich ein Bett, so wie früher, und Sophia hatte darauf bestanden, mit ihren großen Brüdern im Zimmer zu schlafen. Jakob Kuisl schlief drüben in der Kammer. Sie hatten die Türe offen gelassen, damit sie seinen Atem hören konnten. Jedes Mal, wenn er kurz aussetzte, glaubte Magdalena, es könnte der letzte Atemzug gewesen sein. Vorhin hatte ihr Vater im Schlaf gemurmelt, es klang so, als hätte er den Namen seiner geliebten Frau Anna Maria vor sich hingesprochen, die schon vor vielen Jahren von ihnen gegangen war. Dann hatte Kuisl unter Stöhnen und Keuchen noch einen anderen Namen ausgestoßen, Magdalena hatte ihn nicht genau verstanden. War es überhaupt ein Name gewesen?
Es hatte eher wie ein Fluch geklungen.
Ihr Vater war zäh, das wusste Magdalena. Aber er war auch nicht mehr der Jüngste. Viele in seinem Alter waren längst schon bei Gott. Der Tod holte sich seine Beute auf vielerlei Weise, nach einem Fieber, einem bösen Husten, wegen entzündeter Zähne, nach schwerem Durchfall, einem Blutsturz oder einfach wegen eines wunden Zehs. Manche Kranken verdorrten wie Blumen ohne Wasser, ihre Muskeln schwanden einfach dahin, keiner wusste, warum. Oder sie starben, weil das Herz aufhörte zu schlagen, von einem Augenblick auf den anderen. Gerade alte Menschen wurden oft gefällt wie Bäume, mitten aus dem Leben heraus, man sprach dann vom Schlagfluss. Manche überlebten, doch es blieben oft Lähmungen zurück, oder sie konnten nicht mehr sprechen. Magdalena wusste nicht, welche Vorstellung schlimmer war: dass ihr Vater starb oder dass er für den Rest seines Lebens ans Bett gefesselt war. Wer würde sich um ihn kümmern? Georg wohl kaum. Vielleicht dessen junge, streitlustige Gattin Crescentia, die den Vater schon im gesunden Zustand nicht leiden konnte? Schon der Gedanke daran ließ Magdalena schaudern.
Und wenn er bei uns in München bleibt? Dann würde ich mich um ihn kümmern, tagein, tagaus …
Simon schien zu spüren, dass es in ihr arbeitete. Er rutschte unter der dicken Daunendecke näher an sie heran und umarmte sie fest. Es war kalt, die Glut im Kachelofen längst erloschen. Draußen tropfte der Regen vom Dach hinunter auf die Gasse.
»Dein Vater ist stark«, sagte Simon leise. »Der lässt sich nicht so einfach vom Tod auf den Karren packen. Ich war mit dem Peter vorhin noch einmal bei ihm. Er schläft jetzt ruhig, das Herz schlägt regelmäßig. Ich kenne viele Patienten, die sich nach so einem Anfall wieder erholt haben.«
»Wir wussten alle, dass dieser Tag irgendwann einmal kommen würde«, murmelte Magdalena. »Aber ich dachte immer, der Vater sei … er sei …«
»Unsterblich? Weil er so groß und stark ist? Weil er dein Vater ist? Keiner ist unsterblich, Magdalena, keiner! Das weißt du. Der Herrgott gibt uns allen nur eine gewisse Zeit hier auf Erden, bevor wir ins Jenseits einziehen.«
»Aber du bist Arzt! Was bringt all das Studieren, wenn es am Ende doch nur in Gottes Hand liegt, ob jemand lebt oder leidet, dahinsiecht und stirbt? Dein Schwiegervater liegt dort drüben, und du kannst ihm nicht helfen. Im Grunde weißt du nicht einmal, was ihm fehlt. Was … was bist du nur für ein Quacksalber!« Die letzten Worte taten ihr leid, kaum dass sie sie ausgesprochen hatte.