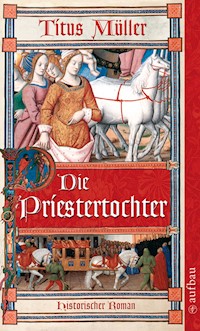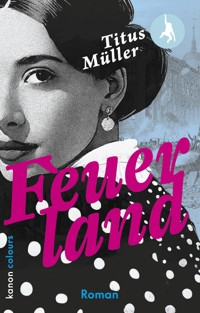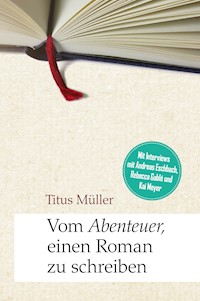10,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Heyne Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Die Spionin-Reihe
- Sprache: Deutsch
Tage der Entscheidung
1989. Ria Nachtmann hat ihre große Liebe geheiratet und sich als Spionin zur Ruhe gesetzt. Ihre Tochter Annie verfolgt derweil einen gewagten Plan: Sie will eine Doku des DDR-Widerstands drehen und sie in den Westen schmuggeln. Als sie und ihr Freund Michael dabei versehentlich zwei Männer einer KGB-Geheimoperation filmen, gerät alles außer Kontrolle. Der in Dresden stationierte russische Agent Wladimir Putin hängt sich an ihre Fersen. Mutter und Tochter stehen bald zwischen allen Fronten und müssen erkennen, dass es um nichts weniger geht als um den Sturz der DDR-Regierung und die Zukunft Deutschlands.
Das große Finale der gefeierten Spionin-Trilogie von Bestsellerautor Titus Müller
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 461
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Das Buch
Herbst 1989: Während sich die Regierung auf die Feierlichkeiten zum 40. Jahrestag der DDR vorbereitet, wächst in der Bevölkerung angesichts manipulierter Wahlen und der sich verschlechternden Wirtschaftslage der Unmut.
In Ostberlin trifft die Krankenschwester Annie ihre Jugendliebe Michael wieder. Beeindruckt von seinem politischen Engagement, schließt sie sich der Protestbewegung an – und zieht so die Aufmerksamkeit der Stasi auf sich.
In Dresden bekommt der KGB-Agent Sascha einen neuen Partner zugeteilt, den er nicht einschätzen kann. Wladimir Putin ist bestens vernetzt und scheint überall seine Finger im Spiel zu haben. Aber welche Pläne verfolgt er in der DDR wirklich?
In Westberlin führt die einstige Spionin Ria seit ihrer Flucht aus der DDR ein weitgehend ruhiges Leben. In ihre alte Heimat kann und will sie nicht zurückkehren. Doch ein Hilferuf ihrer Tochter Annie verändert alles. Ria macht sich bereit für einen letzten Auftrag im geteilten Deutschland.
Der Autor
Titus Müller, geboren 1977, studierte Literatur, Geschichtswissenschaften und Publizistik. Mit 21 Jahren gründete er die Literaturzeitschrift Federwelt und veröffentlichte seither mehr als ein Dutzend Romane. Er lebt mit seiner Familie in Landshut, ist Mitglied des PEN-Clubs und wurde u. a. mit dem C.S.-Lewis-Preis und dem Homer-Preis ausgezeichnet. Seine Trilogie um »Die fremde Spionin« brachte ihn auf die SPIEGEL-Bestsellerliste und wird auch von Geheimdienstinsidern gelobt.
Lieferbare Titel
Der Kalligraph des Bischofs
Die Brillenmacherin
Die Todgeweihte
Die Jesuitin von Lissabon
Nachtauge
Berlin Feuerland
Der Tag X
Die goldenen Jahre des Franz Tausend
Die fremde Spionin
Das zweite Geheimnis
TITUS MÜLLER
Der
letzte
Auftrag
ROMAN
WILHELMHEYNEVERLAG
MÜNCHEN
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Der Verlag behält sich die Verwertung der urheberrechtlich geschützten Inhalte dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44 b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.
Liedtext
Ernst Hansen, »Herr deine Liebe ist wie Gras und Ufer«
mit freundlicher Genehmigung der Strube Verlag GmbH, München
ADN-Meldung
Mitteilung der Presseabteilung des Ministerium des Innern
zitiert aus Neues Deutschland, 11.10.1989, Seite 2
© 2023 by Titus Müller
Copyright © 2023 dieser Ausgabe by Wilhelm Heyne Verlag, München,
in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH,
Neumarkter Str. 28, 81673 München
Vermittelt durch die Literarische Agentur Michael Gaeb
Redaktion: Gunnar Cynybulk
Covergestaltung: favoritbuero, München,
unter Verwendung von Motiven von © Vintage Germany
(Karen Meyer-Rebentisch) und © Shutterstock.com (Vidal25)
Klappe U2: favoritbuero, München,
unter Verwendung eines Motivs von © shutterstock.com/Peteri
Satz: KCFG – Medienagentur, Neuss
ISBN 978-3-641-27070-4V005
www.heyne.de
1
Dieses Zimmer, in dem sich entschied, ob sich die Lebenszeit der Kinder nur in Tagen bemaß oder in Jahrzehnten, war der einzige Ort auf der Welt, an dem Annie glücklich war.
Die Inkubatoren rauschten leise. Sie strahlten Wärme ab. Der Sauerstoff, den sie an die Säuglinge verströmten, war kein Allheilmittel. Dosierte man ihn zu hoch, erblindeten die Kinder.
Annie beugte sich im ultravioletten Licht der Lampen über eine Couveuse. Luisa war jetzt acht Tage alt, sie bekam zum ersten Mal Vitamin D. Aus einer Ampulle verabreichte Annie ihr einen Tropfen Dekristol in öliger Lösung.
Das Kind in der nächsten Couveuse hatte heute früh eine Lungenblutung erlitten, ihm war schaumiges Sekret aus Mund und Nase gedrungen. Annie hatte ihm vorsichtig Mundhöhle, Rachenraum und Luftröhre abgesaugt, und der Arzt hatte intramuskulär Vitamin K gespritzt. Sie wusste, es brauchte Ruhe. Es war noch nicht verloren. Erschöpft lag es da und schlief.
Einige der Kinder waren so winzig, dass Annie sie in einer Hand halten konnte. Manche hatten Fehlbildungen, die liebte Annie noch mehr. Sie tunkte den Wattetupfer in die blaue Lösung und pinselte Kathleens weiße Soorflecken ein, sie wucherten als Nebenwirkung des Antibiotikums. Kathleen sah sie aus staunenden hellen Augen an.
»Ihr werdet viel zu wenig berührt«, sagte Annie und streichelte ihr den Bauch.
Die Hautabszesse bei Lukas waren ein schlechtes Zeichen, seine Widerstandskraft war zu gering. Er würde noch eine Bluttransfusion brauchen. Sie desinfizierte vorsichtig seine Haut, tupfte sie trocken und gab ein antibiotisches Puder darauf.
Ihre Ziehmutter Helga war ein einziges Mal wirklich nett zu ihr gewesen. Da war Annie klein gewesen, sie waren zu Besuch in Magdeburg, und eine Kolonne sowjetischer Armeefahrzeuge donnerte vorüber, die Panzerketten zerschrammten das Straßenpflaster, und die Dieselmotoren dröhnten, und die Stiefmutter hatte gesagt: »Wenn du Angst hast, nimm meine Hand.« Jetzt nahm sie Lukas’ Hand. Er war schon wieder so gelb. Sie strich sanft über seinen kleinen Handrücken. Er musste sondiert werden, obwohl er doch schon selbst getrunken hatte. Auch wenn eine nicht ausgereifte Leber bei Frühgeborenen häufig war, machte sie sich Sorgen. Lagerte sich der Gallenfarbstoff im Hirnstamm ab, konnte es schwere neurologische Störungen geben.
Beim nächsten Kind jubilierte sie im Stillen. Sarah wog über zweitausendfünfhundert Gramm. Man würde sie morgen nach Hause entlassen. Annie kitzelte ihr die Fußsohlen. »Bist du meine süße Sarah? Bist du meine Süße?«
Die Stationsschwester betrat den Raum. Sie warf Annie einen tadelnden Blick zu. »Du bist nicht zum Spaß hier. Füttern, wickeln. Vor dem Schichtwechsel musst du durch sein.«
Draußen hörte sie das Telefon klingeln. Sie hörte, wie die Schwesternschülerin sagte: »In Ordnung, wir kommen.«
Ein Ruf der Entbindungsabteilung. Ein Frühchen war geboren worden. Annie sagte: »Ich gehe.«
Jetzt wechselte der Gesichtsausdruck der Stationsschwester. »Annie, du solltest nicht –«
»Ich gehe!« Sie nahm draußen den Wäschekorb, den die Schwesternschülerin gerade mit Wärmflaschen ausstattete. Kopfkissen, Decke, eine Mullwindel als Kopfstütze und eine als Schulterstütze lagen bereits darin. Annie fragte: »Ist die Sauerstoffflasche gefüllt?«
Die Schülerin bestätigte.
Sie nahm die Bereitschaftstasche, das Gewicht passte, es war sicher alles drin, Handbeatmungsgerät, Endotrachealtuben, steriler Mull zum Dazwischenlegen bei erforderlicher Mund-zu-Mund-Beatmung, Laryngoskop. »Wärmt schon mal eine Couveuse vor«, sagte sie.
Sie würde das Kind in der Entbindungsstation rektal messen, dann würde sie es behutsam in die Decke wickeln, in den Transportkorb legen und zu beiden Seiten und am Fußende eine Wärmflasche platzieren. Es durfte auf dem Weg in die Frühgeborenenstation keinesfalls auskühlen.
»Annie!«, rief ihr die Stationsschwester nach, aber sie tat, als höre sie es nicht, und ging.
Unten vor dem Kreißsaal hielt Dr. Struck sie am Oberarm fest. »Sie haben hier nichts verloren.«
»Ich habe nicht –«
Er sah ihr scharf ins Gesicht.
»Ich war nicht im Kreißsaal.«
»Halten Sie sich von den Schwangeren fern.«
»Ja, Dr. Struck.«
Die Tür zum Kreißsaal ging auf. »Annie, alles in Ordnung?« Eine Hebamme trat besorgt auf sie zu.
Dr. Struck sagte: »Ich will sie nicht noch einmal hier sehen. Sorgen Sie dafür, dass sie sich an das Verbot hält.« Er ging in den Kreißsaal.
»Du fehlst uns.« Die Hebamme probte ein Lächeln.
»Hattet ihr heute Kinder, die …«
»Annie, du solltest das hinter dir lassen. Es ist die Entscheidung der Ärzte. Du tust dir selbst keinen Gefallen.«
Was hatte sie erwartet?
Die Hebamme nahm ihr den Korb aus der Hand. »Ich tue dir den Kleinen rein. So halten wir uns an die Regel, und du betrittst nicht den Kreißsaal.«
Minutenlang wartete Annie. Als sich die breite Tür wieder öffnete und die Hebamme ihr den Korb mit dem Kind übergab, war sie den Tränen nahe. Sie trug den Kleinen nach oben. »Du stirbst nicht«, sagte sie. »Dafür sorgen wir.«
Oben erwartete sie die Öse mit strengem Stationsschwesternblick. Aber da sie das Kind brachte, schwieg sie.
Annie saugte ihm den Nasen-Rachen-Raum ab, dann kam Dr. Struck und sondierte mürrisch den Magen, um eine Stenose oder eine Atresie der Speiseröhre auszuschließen, anschließend gab er dem Kleinen ein Milligramm Vitamin K.
Ihre Schicht war zu Ende, und sie war müde. Trotzdem wollte sie nicht gehen. Ihre Stiefmutter war tot seit letztem Jahr, sie hatte den Stiefvater nur um sechs Monate überlebt. Und ihre echte Mutter, Ria, hatte sie sechzehn Jahre nicht gesehen, seit ihrer Flucht in den Westen. Jetzt war niemand mehr da. Sie verabschiedete sich missmutig, absolvierte die Schleuse, zog die Straßenkleidung an. Schließlich stand sie draußen.
Müllmänner sammelten Abfall ein. Sie sah an der Krankenhausfassade hoch. Die beiden Hausmeister befestigten, sich gefährlich hinausneigend, im dritten Stock ein Tuch zwischen den Fenstern:
Gruß und Dank allen Werktätigen für ihren Beitrag zum Werden und Wachsen unserer Deutschen Demokratischen Republik!
Was, wenn man ihr kündigte? Man würde sie zur Bewährung in den VEB Fortschritt in die Wäscheproduktion stecken. Oder sie hätte in Oberschöneweide am Fließband Batterien zu prüfen. Wer würde dann noch die Neugeborenen im Inkubator streicheln? Wer leise mit ihnen reden, während sie tröpfchenweise Milch tranken?
Aber sie konnte nicht anders. Sie ging zur Haltestelle und formulierte in Gedanken einen Brief an die Krankenhausleitung.
Ich möchte Ihnen nochmals schildern … Es bewegte sich im Schieber, der Deckel hob sich. Wir sind verpflichtet, auch als Kinderkrankenschwestern …
Die 18 kam. Sie stieg in die moderne Tatra-Gelenkbahn mit orangeroten Schalensitzen, ging im Waggon nach hinten. Der elektrische Motor trieb sie vorwärts, ein Gefühl wie beim Flugzeugstart, nur wenn die Beschleunigung aufhörte, knallte es jedes Mal, was aber kein Defekt zu sein schien, alle neuen Bahnen taten das. Sie fuhren am Sport- und Erholungszentrum mit seinen Glaswänden vorbei, die einen in das Gebäude blicken ließen. Für einen Freitagnachmittag war die Schlange vor dem Eingang nicht lang, eine Stunde würden die Leute höchstens anstehen. Dafür bekamen sie ein Spaßbad mit Wellenbecken, eine Rollschuhbahn, Restaurants und einen Kindersportgarten, wo Eltern ihre Kinder ohne Voranmeldung abgeben konnten, um ungestört ihre Freizeit zu genießen. Das SEZ war einzigartig in der ganzen DDR. Und es war Augenwischerei. Es sollte die Stimmung heben, sieben Tage die Woche von früh bis spät teuer subventionierter Spaß zur Beruhigung. Dabei fehlte es in Wahrheit an allem, in den Läden herrschte Mangel, und überall bröckelte die Bausubstanz.
Vermutlich war sie unfair. Unsportlich, hätte ihr früherer Trainer gesagt. Aber war das nicht verständlich, wenn der einzige Mensch, dessen Nähe sie sich wünschte – ihre Mutter Ria, ihre leibliche Mutter, mit der sie sich liebend gern einmal die Woche auf einen Tee getroffen hätte, deren Rat sie brauchte und die ihre Familie war –, wenn dieser einzige Mensch in der unerreichbaren Hälfte der Stadt lebte und wegen früher verübter Spionagetätigkeit auch selbst nie die Grenze überqueren durfte?
Komm schon, Mädel, dachte sie. Du findest auch Gründe, hier glücklich zu sein. Die Tatra fuhr zum Beispiel nicht überall. Da konnte sie froh sein, ihr Arbeitsweg war eine Paradestrecke, auf anderen Strecken fuhren die alten ockergelben Bahnen, deren Türen sich nach dem Klingelschrillen krachend schlossen, bevor sie weiterfuhren, so laut, dass man nach ein paar Haltestellen ganz gestresst war.
Sie sprang auf. Michael? Ihre Nase stieß an die Scheibe der Straßenbahn, sie sah ihm nach. Die Bahn hielt. Sie drückte den Knopf und sprang raus, hastete den Gehweg entlang.
Vor dem SEZ nahm er eine Frau in Empfang. Die Frau verabschiedete sich von drei anderen Frauen, sie lachten, umarmten sich. Dann ging Michael mit ihr Richtung Dimitroffstraße. Groß war die Frau, mindestens einen Kopf größer als Annie, schlank und blond.
Ihr Herz krampfte sich zusammen.
»Werd glücklich«, sagte sie leise. Aber sie konnte sich nicht lösen, sie ging den beiden weiter nach. Was würde sie sagen, wenn er sich umdrehte und sie sah?
Sein Gang war noch derselbe, federnd, die Schritte lang. Er machte Zwischenschritte, um der Frau Gelegenheit zu geben mitzuhalten.
Sie spazierten weit. Die Frau bewegte beim Reden die Hände, sie lachte ihn an. An der Greifswalder Straße bogen sie links ein, dann rechts in die Jablonskistraße. Hier blieben sie vor einem Haus stehen. Der Putz war dunkel und verwittert vom Braunkohleruß. Wenn Michael hier wohnte, war das Haus trotzdem etwas Besonderes.
Er schien sich zu verabschieden. Die Frau küsste ihn. Sie ging in das Haus.
Annie wurde zur Steinsäule. Sie atmete nicht mehr. Michael kam auf sie zu. Er ging an ihr vorüber. Er sah sie nicht.
Erleichtert und zugleich bitter blickte sie ihm hinterher. Es hatte andere Zeiten gegeben. Sein Gesicht hatte jedes Mal aufgeleuchtet, wenn sie sich trafen. So sollte er sie in Erinnerung behalten, die Annie von damals, die Leistungsturnerin, sportlich, frisch, vergnügt. Er sollte nicht von ihr denken als von einer, die ihm verzweifelt nachschlich.
Trotzdem tat es weh. Sie war aus seiner Erinnerung gefallen. Ein vergangenes Kapitel, eine Fremde bloß noch.
Wie von selbst setzten sich ihre Beine in Gang. Michael ging vor zur Winsstraße, dann bog er in die Chodowieckistraße ein. Sie folgte ihm. Als er auf das Haus Nr. 26 zutrat und in der Tasche nach dem Schlüsselbund grub, sagte sie seinen Namen.
Er drehte sich um. Stutzte. »Annie?«
»Donnerlittchen, oder?«
»Ist das schön, dich zu sehen.« Er lächelte. »Siehst gut aus nach all den Jahren.«
Es wurde warm in ihrem Bauch. Auch sie lächelte. »Gehen wir einen Kaffee trinken?«
Wladimir Putin würde sein Kollege heißen, hatten sie ihm gesagt. Utin-Putin, du wirst ihn mögen. Teilst mit ihm ein Zimmer. Er redet nicht viel.
Eine Woche sei Putin fort, ein Einsatz. Was es genau sei, wisse man nicht, aus Gründen der Konspiration. Der Generalmajor wisse es, aber der werde es ihm auch nicht sagen. Er habe seine Informanten und Utin-Putin andere. Putin sei es lieber, das getrennt zu halten.
Sascha nutzte die Woche, ließ sich einweisen, Treffpunkte, Parolen, Zuträger. Ein Wechsel in der Aufklärergruppe war aufwendig, es galt, die Informanten zu beruhigen.
Es gab nicht mehr viele, die mit der kommunistischen Idee sympathisierten und voller Begeisterung für die Sowjetunion arbeiteten. Inzwischen zählte das Geld. Bei anderen musste er die Zügel straff halten und mit eisernem Gesicht nach dem Wohlbefinden von Frau und Kindern fragen oder ihnen offen drohen.
Während sich Russen unweigerlich in die Deutschen verliebten, beruhte diese Liebe oft nicht auf Gegenseitigkeit. Man erklärte ihm, die Menschen in der DDR seien ernüchtert. Sie hätten allenfalls Mitleid, weil sie begriffen, dass auch die Sowjetmenschen, die man in der DDR stationiert hatte, Opfer des Systems waren.
Er war müde nach dieser Woche, müde am Freitag, an dem Putin zurückkommen sollte. Angespannt sah er ihrer ersten Begegnung entgegen. Putin war bereits zweimal befördert worden, seit er hier in der DDR im Einsatz war, erst zum Major und dann zum Oberstleutnant, das war ungewöhnlich, eigentlich gab es nur eine Beförderung je Fünfjahresdienst im Ausland. Die Spitznamen konnten ihn nicht einlullen, Utin-Putin oder Wolodja, mochten sie ihn nennen, wie sie wollten – er sah den Respekt in ihren Gesichtern, wenn sie von ihm sprachen.
Putin hatte Jura studiert und war gleich nach dem Diplom vom KGB angeworben worden, erfuhr er. Auch das war untypisch. Üblicherweise ließen sie einen zwei Jahre im Beruf arbeiten, so war es bei ihm gewesen und bei allen aus dem Geheimdienst, die er kannte. Putin ging nicht den gewöhnlichen Weg. Fast zehn Jahre hatte er in Leningrad in der Spionageabwehr gearbeitet, hieß es. Dann war der Ruf ergangen, den jeder von ihnen ersehnte. Vorbereitung auf den Auslandseinsatz. Deutsch lernen. Auffrischungskurse in der Agentenführung.
War er enttäuscht gewesen, dass er nicht in die BRD geschickt worden war, sondern bloß in die DDR?
Auch ihn, Sascha, hatten sie bis zuletzt im Ungewissen gelassen. Und dann war es nicht einmal Berlin geworden, wo er auch mal in den Westteil der Stadt hätte fahren können, sondern die Provinz, Dresden.
Was machte einer wie Putin hier?
Er schrak zusammen. Der General sah ihn an. »Ich weiß nicht, wie ihr es in Kaliningrad handhabt?«
Verdammt, was hatte er gefragt? Er hätte zuhören müssen, auch wenn es bloß eine Routine-Parteischulung war. »Ganz ähnlich«, sagte er ins Blaue hinein.
»Gut. Wir reden hier nämlich Klartext miteinander.« Der General zog eine Notiz hervor. »Ihr werdet das in keiner Zeitung lesen. Es ist eine Information, die nur für Parteimitglieder vorgesehen ist. Gorbatschow hat auf einer Tagung des ZK über das beschämende Zurückbleiben der UdSSR auf allen Gebieten gesprochen. Er sagte: ›Wir können nichts anderes als Gas und Öl auf dem Weltmarkt verkaufen, das ist alles, was zur Exportqualität der UdSSR zu sagen ist.‹ Was haltet ihr davon?«
Die KGB-Offiziere schwiegen betreten.
»Er hat natürlich recht. Und seine Offenheit wird das Land aus der Erstarrung retten, sage ich euch. Aber wie? Was meint ihr? Wie wird man die Missstände beseitigen?« Der General sah sie herausfordernd an.
»Wir brauchen einen Aufschwung im Maschinenbau«, sagte einer. »Eine neue Generation von Maschinen, die alles schneller und in besserer Qualität herstellen als im Kapitalismus.«
Der General lobte den Ansatz. Er erinnerte an Durchbrüche durch die Luftfahrttechnik und die Elektrifizierung.
In diesem Augenblick ging die Tür auf. Ein Mann trat ein. Breite Schultern, Schmolllippen, Seitenscheitel. Eine längliche Nase, schön geformte Pferdenüstern.
Sascha sah auf die Armbanduhr. Putin war eine halbe Stunde zu spät zur Parteischulung eingetroffen. Der General würde ihn zusammenfalten. Würde etwas brüllen von Disziplin, Tschekistenehre, Kollegialität. Er war gespannt, wie Putin darauf reagierte.
Aber General Schirokow nickte nur freundlich. Dann redete er weiter über Maschinenbau. Niemand baue so viele Traktoren und Mähdrescher wie Uralmasch, und bei der Stahl- und Zementproduktion seien sie Spitzenreiter, trotz allem. Am Ende werde der Kommunismus siegen, auch wenn derzeit die praktische Ausführung noch Mängel aufweise. Dank Perestroika und Glasnost seien sie bald behoben, und die Sowjetunion werde in alter Kraft auferstehen.
Sascha konnte kaum noch zuhören vor Verwunderung. Warum ließ er Putin das durchgehen? In jeder KGB-Aufklärergruppe der Welt hätte es mindestens eine Standpauke gegeben.
Putin zog sich einen Stuhl zurecht und setzte sich. Ihn umgab ein Ernst, der selbst das Zuspätkommen zu einer nicht zu hinterfragenden Dienstsache machte.
Jetzt sah er zu Sascha herüber. Wusste er, dass er der neue Kollege war? Putin nickte ihm nicht zu. Er musterte ihn nur starr.
Als der General geendet hatte, meldete sich Putin zu Wort. »Es wird nichts dabei herauskommen.«
Entsetzte Stille folgte.
Jetzt, endlich, zeigte der General Anzeichen von Wut. Sein Kinn war breit, die Kiefermuskeln ausgeprägt, das Gesicht wirkte fast rechteckig dadurch. Er zog die Mundwinkel herab und riss die Augenbrauen hinauf, was seine Stirn bedrohlich furchte. »Lässt du uns an deiner Weisheit teilhaben, wieso deiner Ansicht nach die Bemühungen Gorbatschows scheitern werden?«
»Nicht das Zurückbleiben im Maschinenbau ist die Ursache für unsere Misere. In Leningrad, wo ich herkomme, leben einige Seeleute, die im internationalen Seeverkehr arbeiten. Die haben unser Land schon vor fünf Jahren auf den Müllhaufen der Geschichte geworfen. Wir begreifen zu langsam, wie weit wir zurückgeblieben sind.«
Der General wurde rot im Gesicht. »Und einige Seeleute können das beurteilen?«
»Weil sie mit dem westlichen Lebensstil in Berührung gekommen sind. Weil sie begreifen, was in der Welt vor sich geht.«
»Besser als wir? Besser als der KGB?«
Putin schwieg.
»Du behauptest also, letzten Endes wird es mit dem Kommunismus nicht funktionieren?« Etwas Lauerndes war in die Stimme des Generals getreten. Ein Gefängnisaufenthalt war Putin sicher. Seine ganze Familie würde bestraft werden.
»Das habe ich nicht gesagt«, erwiderte er ruhig. »Wir müssen ihn nur mit den westlichen Ideen verbinden, mit Konkurrenz und Märkten.«
»Wolodja«, setzte der General an, »wir kennen deine Stärken. Aber deine Ansichten sind …«
Der Kollege von der Abteilung »T« sah Sascha Hilfe suchend an. Rette deinen Kollegen Putin, schien er zu sagen.
Sascha spürte sein Herz gegen die Rippen schlagen. Er fragte: »Wer ist eigentlich der Parteisekretär unserer Gruppe?« Es ging hier um Fragen der Lehre, sicher konnte der Parteisekretär helfen.
Die roten Wangen des Chefs verfärbten sich noch stärker. Nur Sergej von der Spionageabwehr, Abteilung »K«, grinste. Da begriff Sascha. Parteisekretär war Putin.
Später saßen sie in ihrem Dienstzimmer zum ersten Mal zu zweit zusammen. »Das hätte ins Auge gehen können«, sagte er.
Putin wiegelte ab. »Nicht einmal annähernd.«
»General Schirokow hält große Stücke auf dich.«
»Den meisten in der Runde gefällt die Perestroika. Aber sie ziehen nicht die richtigen Schlüsse. Schon das neue Mitglied im Politbüro, Jakowlew, macht sie nervös. Er ist zu gebildet, zu mutig.« Er löste sein Halfter und nahm die Makarow heraus. Mit schnellen Handgriffen entlud er die Pistole.
Eigentlich waren ihre Waffen immer beim General im Safe. Man kriegte sie nur für Außeneinsätze ausgehändigt. Irgendwie hegte er den Verdacht, Putin dürfe seine Makarow dauerhaft tragen.
»Überspringen wir den Teil, in dem du mir sagst, dass du Sascha heißt, und ich dir sage, dass ich Wolodja bin.«
»In Ordnung.«
»Wo haben sie dich geschult? Moskau? Das Andropow-Institut?«
Er nickte.
Putin legte die Waffe auf den Schreibtisch. Metall knallte auf Holz. »Sie haben dir beigebracht, dass jeder von uns seine Informanten für sich führt. Je weniger andere wissen, desto besser. Tja, vergiss das. Wenn wir Quellen gewinnen wollen, werden wir zusammenarbeiten. Und wir werden nicht so vorgehen wie in der Schulung.«
Wieso hatten sie ihm genau das Gegenteil davon über Putin gesagt? Sie hatten doch behauptet, er werde keine Informanten mit ihm teilen. War er mit seinem Vorgänger anders verfahren? Sascha gefiel nicht, was Putin da sagte, und wie er es sagte noch weniger. Dennoch ließ er sich nichts anmerken, Mimik und Körpersprache hielt er ruhig, so wie er es gelernt hatte.
Seiner Erfahrung nach hatte Geheimdienstarbeit mehr mit Regeln eiserner Logik zu tun als mit Erfindungsreichtum. Die Regeln waren nicht umsonst aufgestellt worden. Sie schützten die Informanten. Und sie schützten die Führungsagenten. Wenn Putin anders vorging, setzte er nicht nur die Quellen aufs Spiel, sondern auch ihrer beider Karriere.
»Morgen kommst du mit mir«, sagte Putin, als sei es schon beschlossene Sache. »Ich habe einen Fisch vor der Angel, einen Wissenschaftler aus Stuttgart. Du wirst dafür sorgen, dass er anbeißt.«
2
Die sanierten Bürgerhäuser der Husemannstraße bildeten einen Kontrast zu den abblätternden Fassaden der umliegenden Straßen. Annie sah vom Kollwitzplatz aus in die Prunkstraße hinein. Man hatte sogar die Firmenschilder in Frakturschrift gemalt. Die Straße hätte die Kulisse für einen historischen Kostümfilm bilden können, abgesehen von den parkenden Trabis und Wartburgs.
»Da führen sie die Besucher aus dem Ausland lang«, sagte Michael. »Wenn du mich fragst, ist es idiotisch. Man kann doch nicht bloß eine Straße sanieren. Jetzt springt erst recht ins Auge, wie schlimm die Häuser ringsum zerfallen.« Er ging vier Treppenstufen hoch und hielt ihr die Tür einer Gaststätte auf. »Warst du schon mal im Neunzehnhundert?«
Restauration 1900, stand über der Tür.
Sie schüttelte den Kopf.
Seine Augen funkelten. Die Antwort gefiel ihm.
Gemeinsam traten sie ein. Drinnen war es eingerichtet wie vor hundert Jahren, mit Stühlen von dunklem Holz und altmodischen Bildern an den Wänden, obwohl der Laden offenkundig neu war. Michael wartete nicht darauf, vom Kellner platziert zu werden, er ging einfach hinein und grüßte im Vorbeigehen einige Bekannte.
»Wer ist das?«, fragte sie, als sie sich gesetzt hatten.
»Die sind Schauspieler vom Deutschen Theater.«
Sie sah sich um. Manche Männer im Lokal trugen Vollbart und Nickelbrille, andere lasen in einem Buch oder von Manuskriptseiten. An den Tischen redete man leise. Die Frauen waren in Herbstfarben gekleidet.
Der Kellner kam, und Michael bestellte schwarzen Tee mit Zitrone. Sie wählte Mokka, ein Kännchen.
Sie begann von früher zu sprechen, vom Drill an der Sportschule »Werner Seelenbinder«, vom straffen Trainingsprogramm und davon, wie er heimlich die Pillen nicht schluckte und ihr das ebenfalls ausgeredet hatte.
Vordergründig machten sie da weiter, wo sie damals aufgehört hatten. Aber es war offensichtlich, dass ihr Leben sehr verschieden verlaufen war nach ihrer Trennung. »Du lebst jetzt also im angesagten Prenzlauer Berg«, sagte sie.
»Meine Wohnung hat klapprige Fenster. Und ich muss im Winter jeden Tag einen Eimer Kohlen aus dem Keller hochschleppen, um die Öfen zu heizen. Wenn du das angesagt nennst … Wohnst du noch in Lichtenberg?«
»Ich bin nach Marzahn gezogen.«
Er schnaubte. »Plattenbau?«
»Immerhin muss ich nicht auf den Hof, wenn ich zur Toilette will.«
»Im Mittelalter leben wir hier auch nicht.«
»Entschuldige. Du musst wahrscheinlich nur zur halben Treppe runter und teilst dir das Klo mit den Nachbarn. Das ist natürlich was anderes.«
Er lachte. Dann wurde er ernst. »Hast du Kinder?«
»Ich will gar keine.«
Der Kellner brachte ihre Bestellung.
Michael schwieg. Als der Kellner fort war, sagte er: »Du bist eine schlechte Lügnerin.«
»Ich bin Krankenschwester. Ich arbeite im Drei-Schicht–System. Was mache ich, wenn ich Nachtschicht habe? Oder Spätschicht bis um zehn? Ich bringe kein Kind zur Welt, um es dann in die Wochenkrippe zu stecken. Für mich kommt das nicht infrage, mein Kind am Montag abzugeben und erst am Freitag wieder nach Hause zu holen. Dann habe ich lieber keine Kinder.« Sie zögerte. »Abgesehen davon, dass mir der richtige Partner fehlt.«
Flüchtig sahen sie sich in die Augen.
»Und du?«, fragte sie und griff nach ihrer Tasse. Liebst du jemanden, wollte sie sagen. Ist es ernst mit dieser Blondine? Aber sie brachte es nicht heraus. »Hast du Kinder?«
»Ja. Nein. Also, ich bin mit jemandem zusammen, Franziska, und sie hat einen Sohn.«
»Und was machst du beruflich?« Ihre Stimme verriet sie. Hörte er heraus, wie eng ihr die Kehle wurde?
»Dokumentarfilme.«
»Wirklich? Habe ich mal was von dir gesehen? Ich fasse es nicht, dass Sachen von dir im Fernsehen –«
»Hör auf«, unterbrach er sie, »du hast das missverstanden. Die senden nichts von mir. Wenn ich einen Film einreiche, der eine Stunde lang ist, wird er von ihnen zusammengestrichen auf zwanzig Minuten. Sie nehmen alles Kritische heraus, spielen fröhliche Musik darüber, streichen die stillen Passagen. Und am Ende wird nicht mal die zensierte Fassung ausgestrahlt.«
»Noch nie?«
»Nie.«
»Wovon handeln deine Filme?«
»Ich hab die falschen Themen. Das weiß ich selbst.«
»Welche denn?«
»Lass uns über was anderes reden.«
»Hast du Film studiert?«
Er rührte in seinem Tee und sah böse aus dabei. Schließlich sagte er: »Regie. Aber ich wollte meinen Hochschulfilm nicht ändern, ich hab ihre Zensurversuche abgewehrt, und daraufhin haben sie den Film nicht zum Diplom angenommen, als Einzigen des Jahrgangs. Ich habe also nicht mal einen Abschluss.«
Sie konnte nicht anders. Sie musste lachen.
»Was findest du daran so toll?«
Du bist immer noch der Alte, dachte sie. Und ich habe schon befürchtet, ich hätte dich verloren.
Er trat unter dem Tisch nach ihr. »Ich hab Berufsverbot, und du freust dich darüber!«
»Michael, so etwas kann nur dir passieren.«
Eine Frau, die schon öfter neugierig herübergesehen hatte, stand auf und kam zu ihnen an den Tisch. Sie hatte sich ein Tuch um den Kopf gewunden. Jede Kinderkrankenschwester erkannte auf den ersten Blick, dass es eine Windel war, grün gefärbt zwar, aber eine Windel. Trotzdem sah es gut aus an der Frau, das grüne Tuch und der wirre Haarschopf und die kurze freche Nase. »Na, ihr habt ja Spaß hier«, sagte sie.
Michael stellte Annie vor. »Wir waren früher zusammen auf der Sportschule.«
Die Frau fragte Michael, ob er heute Abend zum Friedenskreis käme.
»Denke schon. Da werde ich wenigstens nicht ausgelacht.« Wieder versuchte er, Annie zu treten.
Diesmal wich sie nicht aus. Es tat ein bisschen weh, aber es war Michaels Fuß, sie wollte ihn spüren.
Die Frau sah von ihm zu ihr, musterte sie. »Ich lasse euch mal. Bis nachher, Michael.«
»Friedenskreis, ja?« Annie rieb sich das Schienbein. »Das hat noch nicht viel bewirkt bei dir. Gewalt ist keine Lösung.«
»Über die Gruppe wollte ich ursprünglich einen Film machen. Dann bin ich da irgendwie hängen geblieben.«
Die Frau hatte »kommst du« gesagt, nicht »kommt ihr«. Möglicherweise ging Michaels Freundin dort nicht hin. »Kann ich mitkommen? Mir das ansehen?«
Er zögerte. »Annie, ich bin … Ich freue mich, dich zu sehen. Aber ich würde Franziska nie hintergehen.«
»Ist klar. Ich will’s mir nur angucken. Ich setz mich auch nicht neben dich.«
Putin hatte die Bank gut ausgewählt. Das Gesträuch in den Waschbetontrögen schirmte sie gegen Blicke aus Richtung der Technischen Universität ab, und von links schützte sie eine Telefonzelle.
Es fiel Sascha schwer, sich zu konzentrieren. Seit er den ersten Wocheneinkauf gemacht hatte, dachte er fortwährend über die Sowjetunion nach. Sie hatten den Zweiten Weltkrieg gewonnen und lebten doch im Vergleich zur DDR in bitterer Armut. Die Vielzahl der Produkte in der Kaufhalle! Man kam sich vor wie im Paradies. Zuhause in Kaliningrad fehlte es an Brot, Wurst, Kühlschränken, Autos, Schuhen, Strumpfhosen, an allem. Man brauchte Schmiergelder, brauchte Beziehungen, selbst um sich beim Schuster die Schuhe reparieren zu lassen oder nach einem Todesfall einen Sarg zu erwerben.
Hier aber gab es alles. Sicher nicht wie in Westdeutschland, und doch waren die Läden voll in der DDR, und dann die sauberen Straßen, die ordentlich an Leinen aufgehängte Wäsche und die blitzenden, jede Woche geputzten Fenster.
Auch Dresden schätzte er inzwischen anders ein, mit den Großbauten von August dem Starken und dessen Sohn Friedrich August II., der Brühlschen Terrasse, der Kunstakademie, dem Ständehaus und der Hofkirche wirkte es eher herrschaftlich als provinziell auf ihn. Zugleich war die Stadt modern, was vor allem abends auffiel, wenn die bunten Leuchtreklametafeln aufflammten.
»Bist du bei der Sache?«, fragte Putin.
»Natürlich.«
»Wie gut ist dein Polnisch?«
»Wie bitte?«
»Wir sind aus Polen. Das wird ihm sympathischer sein. Solidarność, darauf stehen sie im Westen.«
»Sprichst du denn Polnisch?«
Putin strich sich die Krawatte glatt. »Ein paar Brocken. Aber er spricht auch kein Polnisch, darauf kommt es an. Wir verwenden das Polnische als Legende für deinen Dialekt.«
Ein guter Schachzug. Während Putin hervorragend Deutsch sprach, hörte man ihm die Herkunft deutlich an.
Ein Mann tauchte auf, klein, dick, mit zerknittertem Sakko. Das Leder seiner braunen Aktentasche war abgestoßen. Er trug eine teure Armbanduhr.
Putin erhob sich und reichte ihm die Hand. »Professor Enskat.«
»Na, na! Professor bin ich noch nicht.«
»Aber es wird nicht lange dauern. Davon bin ich überzeugt. Ich habe Ihre letzten Aufsätze gelesen. Konzise, brillant und der Zeit voraus.«
»Wollen wir uns setzen?«
Sie nahmen auf der Bank Platz. Während Putin sich noch einmal mit Blicken ihrer Ungestörtheit versicherte, lenkte Sascha die Aufmerksamkeit des Wissenschaftlers auf sich. »Ich weiß nicht, was mein Freund Ihnen schon gesagt hat. Es ist so: Unsere Stiftung würde gern das Recht erwerben, Ihre Aufsätze in polnischer Sprache zu drucken, in einem Sammelband in Polen.«
»Da wäre es sicher am besten, Sie würden sich an den Verlag –«
»Sie kennen doch«, unterbrach ihn Putin freundlich, »die Vorbehalte im Westen gegenüber dem Ostblock, was Hochtechnologie angeht.«
»Aber was ich schreibe, das ist ja bereits veröffentlicht, es steht in jeder Bibliothek.«
Putin tat, als hätte er Dr. Enskats Argument nicht gehört. »Und der Verdienst für Sie wäre auch größer, wenn wir es auf diesem Weg klären. Wir würden Ihnen gern achttausend Dollar anbieten.«
»Dollar?«
»Ich denke, mit Złoty kommen Sie nicht weit.« Er schlug Dr. Enskat spielerisch gegen den Ellenbogen.
Der Wissenschaftler war bereits verloren. Sascha las es in seinem Blick: Dr. Enskat malte sich aus, was er mit den achttausend Dollar anfangen würde.
Putin hatte ihn geschickt an seiner Schwachstelle gepackt. Immer war Enskat gegenüber den Professoren benachteiligt worden, sowohl was die Aufmerksamkeit anging, die man seinen Arbeiten widmete, als auch den Verdienst. Er war gut, und er wusste das und wollte entsprechend wertgeschätzt werden. Genau das boten sie ihm an. Endlich war er auch international gefragt.
Sascha zog den Verlagsvertrag aus der Tasche. »Wären Sie bereit, uns das zu unterschreiben?«
Der Wissenschaftler nahm die Seiten entgegen und las sie aufmerksam. Es war ein ordentliches Dokument, ohne Fallstricke.
Putin ergänzte: »Und eine Quittung bitte, dann können wir das mit dem Geld gleich erledigen.«
Dr. Enskat staunte. »Sie haben es bar dabei?« Er nestelte fahrig an seiner Uhr. »Wissen Sie, vielleicht wäre es besser, wenn ich doch mit meinem Verlag darüber spreche und eine Nacht darüber schlafe.«
Sascha spürte, wie ihm der Mund trocken wurde. Dr. Enskat meinte sicher nicht bloß den Verlag. Er würde die Polizei oder den BND benachrichtigen. Ein kritischer Moment. Der Mann war nicht dumm. Früher oder später hatte es ihn wundern müssen, dass etwas so Offizielles auf einer Parkbank abgehandelt wurde.
»Selbstverständlich. Das können Sie machen.« Putin lächelte verbindlich. »Wir wollen Sie keinesfalls überrumpeln.«
Sascha öffnete seine Tasche, als wollte er den Vertrag wieder einstecken.
Jetzt sah Dr. Enskat die achttausend Dollar aus seiner Reichweite schwinden. Was, wenn es morgen nur noch sechstausend waren? Es arbeitete in seinem Gesicht. »Ich meine nur, wie konnten Sie wissen, ob ich Ja sagen würde?«
»Wussten wir nicht«, sagte Sascha. »Aber Sie sind viel beschäftigt und sicher nicht dauerhaft in Dresden. Da dachten wir, bereiten wir besser alles vor. Außerdem sind Auslandsüberweisungen teuer. Aber wirklich, es ist kein Problem, die Sache zu vertagen.«
Die Stirn des Wissenschaftlers glänzte jetzt von Schweiß. »Ach, wissen Sie was? Warum sollte ich bei etwas so Schönem nicht einfach spontan zusagen.« Er griff in die Innentasche seines Sakkos und zog einen schwarzen Füllfederhalter heraus. Er schraubte ihn auf. Als er den Vertrag unterschrieb, blitzte die vergoldete Feder in der Sonne.
Sascha schob ihm die Quittung hin. »Hier bitte noch, dass Sie das Geld erhalten haben.« Gleichzeitig reichte er ihm einen großen braunen Umschlag.
Dr. Enskat warf nur einen kurzen Blick in den Umschlag. Die Gier passte nicht zum Selbstbild, das er von sich hatte. Vermutlich beschönigte er sie bereits in seinen Gedanken und plante zur Gewissenswäsche einige wohltätige Käufe und Spenden.
Dabei, das begriff Sascha in diesem Moment, war das Gewinnstreben der Menschen genau die unglaubliche Kraft, dank der die technologische Entwicklung des Westens so rasend schnell voranschritt, während die sozialistische Planwirtschaft mit weitem Abstand hinterherhinkte.
Der braune Umschlag verschwand in Dr. Enskats Tasche.
Vor ein paar Tagen hatte Sascha noch geglaubt, er müsse sich hocharbeiten, bis er aus der Provinz nach Ostberlin versetzt wurde, wo tausend KGB-Offiziere den Feind direkt an der Grenze nach Westberlin bekämpften. Inzwischen war er überzeugt, dass Dresden ebenso wichtig war im Kampf der Weltmächte.
Hier befand sich das Zentrum von Robotron, dem größten Elektronikhersteller der DDR, und das hieß, dass nicht nur Computer oder elektronische Geräte hergestellt wurden, sondern auch, dass hier der Hightech-Schmuggel über die Bühne ging: Man beschaffte sich Blaupausen und westliche Hightech-Komponenten durch die Kontakte von Robotron in den Westen, um mit der fortschrittlichen Technik des Westens mitzuhalten, allein schon aus militärischen Gründen, und natürlich auch, um in der Wirtschaft nicht abgehängt zu werden. Der Westen hatte Hightech-Exporte in den Ostblock verboten. Trotzdem war es schon in den Siebzigern gelungen, den IBM-Computer des Westens zu klonen, und es gab partnerschaftliche Verbindungen mit Siemens.
Die Technische Universität Dresden und das Kombinat Robotron boten mit ihren Kontakten zu Firmen wie Siemens und IBM und westlichen Geschäftsleuten, Ingenieuren und Wissenschaftlern ideale Bedingungen für den Technologieschmuggel und den Schwarzhandel mit Hightech-Komponenten. Außerdem gab es die Gelegenheit, Agenten anzuwerben und Quellen für modernste Technologie zu erschließen.
Wäre nicht Anfang der Achtziger Wladimir Wetrow von der »Direktion T« in den Westen übergelaufen! Er hatte die Namen von 250 KGB-Mitarbeitern in Botschaften auf der ganzen Welt verraten, die am Technologieschmuggel beteiligt waren. Das war ein herber Rückschlag gewesen.
Umso wertvoller war eine neue Quelle in diesem Bereich. Dr. Enskat würde ihnen viel nützen. Die Sowjetunion hatte einfach nicht die Ressourcen, um mit dem Westen auf dem Gebiet der Hochleistungstechnologie zu konkurrieren. Erkenntnisse zu stehlen, war bedeutend billiger.
»Können wir denn weiterhin auf Sie zählen? Durch die Veröffentlichung wird Ihr Name in Polen bekannt werden im Bereich der Elektrotechnik und Computerwissenschaft. Wir würden gern auch Ihre zukünftigen Arbeiten übersetzen.«
»Natürlich.«
»Vielleicht können wir uns hier und da einmal treffen, in Dresden oder gern auch in Stuttgart oder in Böblingen, wenn Sie wieder einmal bei IBM sind. Dann stoßen wir auf unsere Zusammenarbeit an.«
Unter oberflächlichen Höflichkeitsbekundungen, Nicken und Händeschütteln verabschiedete Enskat sich. Vielleicht sagte sein Unterbewusstes ihm bereits, dass er nicht gut gehandelt hatte, jedenfalls wollte er den Ort des Geschehens offenkundig rasch verlassen.
Als er fort war, standen auch sie auf und begannen ihren Weg durch die Südstadt. »Wird das Zentrum die Übersetzung bezahlen?« Zentrum, so hatten sie zumindest in Kaliningrad die KGB-Zentrale in Moskau genannt.
»Unsinn.« Putin sah ihn an wie ein enttäuschter Lehrer. »Die Sachen werden nicht übersetzt und auch nicht veröffentlicht.«
»Aber das wird er merken. Wir wollen ihn doch langfristig an uns binden.«
»Wir haben ihn längst an den Eiern. Er hat Geld genommen und quittiert. Er hat Hightech-Informationen an uns verkauft. Beim nächsten Treffen wollen wir unveröffentlichte Forschungsergebnisse und geben ihm zwölftausend Dollar, versprechen aber, sie erst nach der deutschen Erstveröffentlichung zu publizieren. Dann lassen wir durchsickern, dass wir Russen sind und nicht Polen, und beim vierten Treffen platzt die Bombe. Er wird aus Scham weiter mitmachen. Und aus Angst, dass seine Kollegen erfahren, dass er sich für Geld mit dem KGB eingelassen hat. Irgendwann stumpft auch sein Gewissen ab. Er wird sich an das zusätzliche Geld gewöhnen, das wir ihm geben, und wird es vor sich selbst rechtfertigen. Er wird sich vielleicht sagen, dass die Universität ihn schlecht behandelt und dass er auf dem letzten Kongress benachteiligt oder von den Kollegen geschnitten wurde und ihm dieser und jener Posten längst zugestanden hätte.«
»Und wenn er aussteigen will?«
»Wir haben seine Unterschrift. Er hat das Geld. Denkst du, er will ins Gefängnis gehen? Sascha, Sascha!« Putin legte ihm den Arm auf die Schulter, zog ihn plötzlich an sich und drückte so fest zu, dass er kaum noch Luft bekam.
Als Putin ihn wieder losließ, schmerzte der Adamsapfel höllisch. Er bemühte sich, äußerlich die Fassung zu bewahren. Typen wie Putin durfte man keine Schwäche zeigen. Sonst wurde man zum Opfer.
Sie kehrten in ihr Wohnhaus in der Radeberger Straße zurück, einen unauffälligen Plattenbau mit vielen Parteien, in dem auch etliche Stasi-Leute wohnten. Er verabschiedete sich kumpelhaft und schloss seine Wohnung auf. Drinnen setzte er sich an den Küchentisch. Ihm zitterten die Hände.
3
Die Kirchenwand aus Feldsteinen war mit einem Anarchiesymbol beschmiert, einem Kreis aus zerlaufener weißer Farbe mit einem fetten A. Drumherum standen Punks mit wilden Frisuren und Nietenarmbändern. Dazu einige Leute, die zum Friedenskreis gehörten, jedenfalls war die Frau mit dem grünen Windelkopftuch dabei. Auch die Pfarrerin kam.
Einer der Punks sagte: »Das ist doch Scheiße, so was. Wir waren das nicht. Echt nicht.«
Die Pfarrerin besah die Wand. »Ausgerechnet auf dem alten Teil der Kirche.«
»Wir haben doch eh immer Stress auf der Straße. Letztens haben die Bullen den Toffi hops genommen, einfach aus der Straßenbahn raus, und ihm auf die Fresse gehauen und den Iro abgeschnitten. Wir haben eine Beschwerde gemacht, aber das hat nichts gebracht. Die kontrollieren unsere Ausweise alle fünf Minuten, jeder Bulle hat den Auftrag, unseren Ausweis zu kontrollieren. Egal, wo wir auftauchen. Kaum hat man sich irgendwo hingesetzt und ein Bier aufgemacht, kommen sie an: Mal die Ausweise bitte!«
»Ist sicher kein Zufall, dass sie das heute machen«, sagte die Pfarrerin.
Es wurde schon dunkel, die Straßenlaternen brannten.
»Wegen Friedenskreis, oder?«, fragte einer mit rot gefärbtem Irokesenkamm. »Sie glauben uns, Frau Pfarrerin, oder?«
»Das war die Stasi«, sagte sie.
»Aber warum schmieren die unsere Sachen auf die Kirche?«
»Um einen Keil zwischen uns zu treiben.«
»Scheiße, ich hab doch schon Alexanderplatz-Verbot und einen PM-12. Was denn jetzt noch alles? Meine Freundin haben sie wegen ›Störung sozialistischen Zusammenlebens‹ und ›Herabwürdigung‹ verknackt, und letzte Woche, Mann, da kamen die in den Hinterhof mit dreißig Bullen und zwanzig FDJlern mit Armbinden und haben mit Knüppeln auf uns eingedroschen. Ich bin müde, einfach null Bock. Bin total runter.«
Die Frau mit dem Tuch drehte sich um. »Hey, Annie, richtig? Du bist gekommen. Schön. Michael hast du nicht mitgebracht?«
»Er kommt gern mal zu spät.«
Die Frau lachte. »Ich bin Sandy, übrigens.« Sie gingen zusammen über die Breite Straße und ins Gemeindehaus. Auch die Punker kamen mit. Annie fragte leise, was ein PM-12 sei.
»Den kriegst du, wenn sie deinen Personalausweis einziehen«, sagte Sandy. »Man muss sich regelmäßig auf dem Polizeirevier melden und darf die Stadt nicht verlassen.«
Sie sah sich um. Die Wände waren weiß gestrichen, aber irgendwie uneben. Es standen einfache Holzstühle im Kreis. Weil sie nicht genügten, holten die Leute weitere Stühle aus dem hinteren Teil des Raumes und bauten damit eine zweite Reihe um den Kreis herum. Sandy und Annie setzten sich. Sandy sagte: »Eigentlich müssten sie den Punk fördern. Er kommt doch aus dem Arbeitermilieu. Aber die Bonzen glauben, er käme aus der kapitalistischen Gesellschaft.«
Einige junge Leute begrüßten Sandy mit flüchtigen Wangenküssen. Auch andere im Raum umarmten sich zur Begrüßung. Es erschien ihr westlich, irgendwie, in der DDR war doch der proletarische Händedruck üblich.
Zwei Männer hatten lange Haare, die meisten trugen Jeans. Mindestens drei Leute besaßen eine Umhängetasche aus Jute, die sie jetzt neben ihrem Stuhl abstellten oder über die Lehne hängten. Die Kleider der Frauen schienen größtenteils selbst genäht zu sein, auf jeden Fall waren sie nicht das, was man ständig sah.
Einen einzigen Rentner sah sie und zwei Teenager. Die meisten waren Ende dreißig. Und sie duzten sich.
Sandy begann, ihre Leute vorzustellen. Da war ein Biochemiker, dessen wissenschaftliche Laufbahn Schaden genommen hatte, als er sich 1980 weigerte, eine Zustimmungserklärung zum sowjetischen Einmarsch in Afghanistan zu unterschreiben. Zwei andere waren über den evangelischen Kindergarten zum Friedenskreis gekommen.
Besonders faszinierte Annie ein Künstler. »Es war alles vorbereitet«, erklärte er gerade der Pfarrerin und einigen anderen und nahm sie und Sandy mit in die Zuhörerrunde auf. »Die Ausstellung im Märkischen Museum stand. Die Vernissage war ein Riesenerfolg! Einen Tag später haben sie das Museum geschlossen wegen angeblicher Krankmeldungen beim Aufsichtspersonal. Ich habe das noch geglaubt und habe angeboten, mit einigen Freunden einzuspringen. Da haben sie behauptet, dass die Heizung ausgefallen ist. Die Ausstellung ist bis heute geschlossen. Unsere Kunst macht ihnen Angst. Sie verstehen sie nicht, und deshalb macht sie ihnen Angst.«
Sandy sagte: »Du musst dich beschweren. Mach eine Eingabe!«
»Ich hab an den Kulturstadtrat geschrieben und an das VBK-Bezirkssekretariat.«
Wo blieb Michael? Sie sah zur Tür. Nach und nach setzten sich alle. Jemand gab Liedzettel herum. Auch Sandy und Annie nahmen Platz. Zwei Gitarren spielten, und die Leute begannen zu singen. Der Liedtext erschien ihr hintergründig, wenn man bedachte, worüber sie gerade gesprochen hatten.
Herr, deine Liebe ist wie Gras und Ufer,
Wie Wind und Weite und wie ein Zuhaus.
Frei sind wir, da zu wohnen und zu gehen.
Frei sind wir, Ja zu sagen oder Nein.
Wir wollen Freiheit, um uns selbst zu finden,
Freiheit, aus der man etwas machen kann,
Freiheit, die auch noch offen ist für Träume,
Wo Baum und Blume Wurzeln schlagen kann.
Und dennoch sind da Wände – jemand rief laut: »Mauern« – zwischen Menschen,
Und nur durch Gitter sehen wir uns an.
Unser versklavtes Ich ist ein Gefängnis
Und ist gebaut aus Steinen unsrer Angst.
Herr, du bist Richter! Du nur kannst befreien,
Wenn du uns freisprichst, dann ist Freiheit da.
Freiheit, sie gilt für Menschen, Völker, Rassen,
So weit, wie deine Liebe uns ergreift.
Als die letzten Akkorde verklungen waren, las einer der Teilnehmer einen Bibeltext vor und erzählte etwas dazu. Die Pfarrerin hörte bloß zu. Es beeindruckte Annie, dass sie still zuhörte und andere machen ließ.
Die Tür ging auf. Michael.
Er war nicht allein. Die große blonde Frau war bei ihm. Unsicher sah sie sich um. Franziska war zum ersten Mal hier, das war deutlich.
Der Künstler, neben dem ein Stuhl frei war, rutschte ein Stück und zog einen weiteren freien Stuhl neben sich in den Kreis. Michael und Franziska setzten sich. Es dauerte eine Weile, bis Michael kurz Annies Blick erwiderte.
Franziska fasste nach seiner Hand.
Es wurde ein Gebet gesprochen. Annie schloss nicht die Augen wie die meisten, sie sah auf Franziskas Hand, umschlossen von Michaels, ihre Finger ineinandergeschoben. Nach dem Gebet raunte Sandy ihr zu: »Wer die Andacht leitet, kriegt oft Ärger im Betrieb. Mindestens ein donnerndes Kadergespräch. Ist echt mutig, das hier zu machen.«
Die Pfarrerin sagte: »Heute haben wir keinen geladenen Referenten, sondern die Arbeitsgruppe Wahlen stellt sich vor.«
Ein Mann mit Brille stand auf. Er erklärte, dass viele den Kommunalwahlen am 7. Mai keine besondere Aufmerksamkeit widmen würden, weil sie meinten, dass sie dabei doch nichts bewirken könnten. Er und seine Arbeitsgruppe aber fänden, dass es Zeit sei, etwas zu unternehmen.
Annie hörte nicht mehr zu. Sie sah zum Fenster und überlegte, ob sie aufstehen und gehen sollte.
Sie dachte an die Beziehung mit dem Rocker, der ihre Lebenslüge schnell durchschaut hatte: »Du bist ein bisschen fixiert auf diesen Michael, wie?« Danach hatte es kaum noch vier Wochen gehalten mit ihnen. Dann wieder das Alleinsein, die imaginären Gespräche, die sie mit Michael führte, oft spät in der Nacht, geflüstert in ihrem Schlafzimmer oder am Fenster zu Sternen und Mond hinaufgesprochen.
Ihr war klar, dass sie nie wirklich zusammen gewesen waren. Bevor es hatte ernst werden können mit ihnen, hatte Michael damals die Reißleine gezogen. Er will mich nicht, dachte sie.
Vielleicht tat es deshalb bis heute weh. Cat Stevens hatte recht, the first cut is the deepest. Und weil ihre Liebe nie erfüllt worden war, konnte sie keinen Frieden darüber finden. Aber das zu wissen, half ihr nicht.
Er schlage vor, sagte der Mann mit der Brille, die Stimmen zu zählen, im Wahllokal. »Dann können sie uns nicht länger betrügen.«
Erstaunen in der Gruppe. Ängstliche Gesichter, aber auch vorsichtige Euphorie. Michael fragte: »Und wie kommen wir an eine Liste der Wahllokale mit den Adressen?«
Der Mann mit der Brille gab zu, das werde schwierig werden. »Die geben sie aus gutem Grund nicht raus«, sagte er. Und wenn man nur in ein paar nachzähle, bringe es nichts, man brauche am besten in jedem Wahllokal jemanden, dann könnte man einen Betrug nachweisen.
Sandy sprang auf. »Einen Tag vor der Wahl werden die Wahllokale vorbereitet, oder nicht? Wir fahren mit dem Fahrrad kreuz und quer und notieren uns, wo es Wahllokale gibt. Dann sprechen wir ab, wer von uns in welches Wahllokal geht.«
Einer der Punker sagte: »Ich würd mitmachen. Wir lassen uns von denen doch nicht anscheißen! Ich kenne auch welche von der ›Kirche von unten‹. Die würden helfen, jede Wette.«
Der Mann nahm die Brille ab und begann, sie mit dem Hemdzipfel zu putzen. Er lächelte.
Annie sah, dass Michael seine Unterlippe kaute. »Und wie kommen wir rein in die Wahllokale?«, fragte er. »Und wie verhindern wir, dass sie uns rauswerfen?«
Der Mann setzte rasch die Brille wieder auf und sah in seine Notizen. »Das hat Evelyn Zupke vom Friedenskreis Weißensee alles rausgefunden. Sie müssen uns nach Paragraf …, nach Paragraf …« Er suchte, fand die Stelle aber nicht. »Jedenfalls müssen sie uns bei der Auszählung zusehen lassen. Die ist laut Wahlgesetz öffentlich.«
»Das Wahlgesetz gibt es überhaupt nicht.« So war Michael schon immer gewesen, unnachgiebig in der Sache, und zornig, wenn er den Eindruck hatte, jemand gebe etwas falsch wieder. Sie sah es genau, wie sich sein Halsansatz rötete.
»Doch«, widersprach der Mann mit der Brille. »Evi hat mir das alles erklärt. Man kann es nur in Fachbibliotheken finden, und dort muss man es sich alles mühsam aus dem DDR-Gesetzblatt zusammensuchen. Ihre Leute haben das gemacht. Es gibt keine eigenständige Textausgabe davon, das stimmt. Man will auch gar nicht, dass jemand erfährt, wie die Wahl im Gesetz bestimmt ist. Ein Bürgerrechtler, der ihr helfen wollte, hat sich die Haare gerauft. Es ist wohl nicht mal geregelt, was als gültiger Stimmzettel gilt und wann ein Zettel als Nein-Stimme zu werten ist, die Entscheidung darüber liegt ganz bei den Wahlvorständen vor Ort im Wahllokal. Ein Wahnwitz eigentlich.«
Michael brummte etwas und schien zufrieden.
Sie beschlossen, den Friedenskreis in Weißensee zu unterstützen. Stadtweit würden sie nicht alle Wahllokale abdecken können, aber wenn sie sich auf einen Bezirk konzentrierten, war es zu schaffen. Beobachter sollten zur Auszählung gehen und das verkündete Ergebnis notieren. Dann wolle man die Ergebnisse zusammenzählen.
Die Pfarrerin ging, um Papier für Listen zu holen, in die sich jeder eintragen konnte, der mitmachen wollte.
»In der Sowjetunion wählen sie schon freie Kandidaten«, erzählte der Künstler. »Gorbatschow hat ein Konkurrenzwahlsystem eingeführt.«
Sandy sagte: »Und bei uns haben sie den Sputnik verboten.«
»Wir werden politisch entmündigt!«, rief jemand.
Der Künstler schlug vor, ein Flugblatt zu entwerfen mit dem Slogan: Von der Sowjetunion lernen heißt wählen lernen. Die Runde lachte. »Mach das«, rief jemand. »Unbedingt!«
Als die Listen auslagen, stand Michael auf und trug sich ein. Annie beobachtete ihn. Sie mochte es, dass er eine solche Bestimmtheit ausstrahlte.
Als er sich wieder setzte, zischte ihm Franziska etwas zu. Sie stritten flüsternd.
Annie stand ebenfalls auf und trug sich in die Liste ein, direkt unter Michael.
Michael begann ein Gespräch mit dem Künstler. Hilflos und verärgert sah sich Franziska um. Immer wieder blieb ihr Blick an Annie hängen. Schließlich stand sie auf und kam herüber. »Du bist also Annie? Ihr habt früher zusammen Sport gemacht, richtig?«
Sie musste etwas gespürt haben. Oder hatte Michael sie mitgenommen, um sich vor sich selbst zu schützen?
Franziska wirkte aus der Nähe zerbrechlich. Ihre Haut war blass, die Augen hell. Um die schmalen, langgliedrigen Hände beneidete Annie sie.
Franziska war hergekommen, weil ihr Michael etwas bedeutete. Das konnte man ihr nicht übel nehmen.
»Nein«, sagte Annie. »Ich war bei den Turnerinnen und er bei den Leichtathleten. Wir sind nur zusammen zur Straßenbahn gelaufen.«
4
Der neue Gebäudekomplex roch immer noch nach Estrich und dem Linoleum der Fußböden. Ingo Beckmeier empfand den Geruch als streng, der Geruch rief zu Sachlichkeit und Fleiß auf und machte Druck. Jetzt auch noch Vorsprechen beim Abteilungsleiter. Das hieß nichts Gutes.
Was würde ihm Wippert vorwerfen? Wahrscheinlich, dass er während der Mittagspause die Dienststelle verlassen hatte, um eine Besorgung zu machen. Am Haupteingang war eine Kamera installiert, eigentlich, um den Besucherverkehr am Eingang zu überwachen, aber offenbar beobachteten sie auch, wer wann das Gelände verließ. Oder hatte der Pförtner ihn verpfiffen? Dem würde er was husten, dem Kollegenschwein.
Oberst Wippert war zuzutrauen, dass er einen Strengen Verweis erteilte, wenn er sich so richtig aufregte. Dann war das kaum mehr auszulöschen. Bloß kein Strenger Verweis. Am besten gleich demütig auftreten. Er war einer von tausendfünfhundert Hauptamtlichen in der HAVIII, er war ersetzbar, die hatten genug Leute wie ihn.
Er klopfte.
»Herein!« Wippert war in mieser Stimmung, das hörte man deutlich.
Ingo trat ein und schloss die Tür hinter sich. Er grüßte.
Wippert erwiderte den Gruß nicht, sondern schob ihm wortlos einen Zettel über den Schreibtisch.
Er nahm ihn hoch und las. Sein Konto war überzogen um 1,40 Mark. »Das … das tut mir leid. Meine Frau hat viel Kinderkleidung eingekauft. Und ich habe ein neues Aquarium, und das Schlauchboot, die Kinder haben es sich so sehr gewünscht. Das muss ich natürlich sofort ausgleichen. Ist ja nicht viel.«
Wippert zog eine Augenbraue hoch. Er wartete eisige Sekunden. »Sie wissen, warum wir Kontoüberziehungen nicht dulden können?«
»Weil uns finanzielle Schwierigkeiten erpressbar machen könnten. Wir wären käuflich für feindliche Dienste. Aber in meinem Fall, ich meine, bei einer Mark vierzig …«
»Jemand, der sich notorisch verschuldet, wird in meiner Diensteinheit keine Zukunft haben, Genosse Beckmeier.«
»Na ja, notorisch, ich meine …«
»Und es sagt einiges über Sie aus. Nicht mit Geld umgehen zu können, ist eine charakterliche Schwäche, die zu einer sozialistischen Persönlichkeit nicht passt.«
»Ich habe doch nur … Könnten Sie nicht ein Auge zudrücken bei der kleinen Summe?«
Wippert brüllte: »Ich drücke überhaupt kein Auge zu! Sie haben Ihr Konto überzogen. Sie gefährden die innere Sicherheit unserer Einrichtung!«
Ingo schluckte. Es lief schlecht.
Wenn er eine Disziplinarstrafe erhielt, dann würde die nächste Beförderung auf Eis gelegt werden. Eigentlich müsste er im Herbst Oberleutnant werden, er hatte Katrin schon versprochen, dass sie sich die Schrankwand kaufen würden vom Vergütungsbonus für den Dienstgrad, plus Dienstalterzuschlag, er käme fast auf zweitausend Mark im Monat, hatte er sich ausgerechnet. Wenn Wippert ihm einen Tadel verpasste oder sogar einen Verweis, wurde er nicht befördert. So lange, bis die Disziplinarstrafe aus den Akten gelöscht wurde, und wer wusste schon, ob und wann sie das taten. »Ich bin natürlich bereit, die Konsequenzen …«
Wippert wandte sich ab. Die Sache war für ihn erledigt.
»Darf ich frei sprechen, Genosse Oberst? Es wird nie wieder vorkommen. Und ich bringe das gleich in Ordnung. Ich habe mir doch all die Jahre nie eine Unzuverlässigkeit geleistet.«
Wippert sah ihn zweifelnd an. Scharf sagte er: »Bekommen Sie das in den Griff?«
»Darauf können Sie sich verlassen.«
»Wegtreten.«
Er wollte sich zur Tür umwenden.
»Halt! Nehmen Sie das mit, als Erinnerung.« Oberst Wippert hielt ihm den Zettel hin.
Ingo nahm ihn. »Danke, Genosse Oberst.«
Er verließ das Büro. Vom Bankgeheimnis hatten sie noch nichts gehört. Offenbar überprüfte die Kassenstelle die Kontoaktivitäten, registrierte alles Interessante und gab es weiter.
Er verstand ja, dass er aus Gründen der Konspiration verpflichtet war, sein Konto bei der internen Kassenstelle der Sparkasse zu führen. So mussten es alle MfS-Mitarbeiter machen, sonst hätten gegnerische Geheimdienste anhand der Kontodaten herausfinden können, wer sein Gehalt von einer Diensteinheit des MfS erhielt, sie hätten nur eine Angestellte einer Sparkassenfiliale anzapfen müssen. Und praktisch war es auch, dass sich die Filiale gleich im Dienstobjekt befand.
Aber dass man seinem Vorgesetzten meldete, wenn er mal sein Konto um eine Mark vierzig überzog?
Er schützte diesen Staat und kämpfte für eine bessere Welt. Diese peniblen dienstlichen Bestimmungen, Direktiven, Instruktionen und Richtlinien, die verdarben alles. Jede Kleinigkeit galt gleich als Verstoß gegen die militärische Disziplin.
Eine unerlaubte Fahrt mit dem Dienst-Pkw. Der Besuch eines Klassentreffens, an dem womöglich auch ehemalige Klassenkameraden teilnahmen, die Kontakt zu Westdeutschen hatten. Den Schlüssel im Panzerschrank stecken zu lassen. Auch wenn momentan nur Schulungsmaterial darin lag, kam der Verstoß gegen die Dienstvorschriften zur Geheimhaltung in die Akte. Es hätten ja Unbefugte an das Schulungsmaterial herankommen können.
Manchmal erschien es ihm, als verbrauchten sie die Hälfte ihrer Arbeitszeit damit, sinnlos das Straßenpflaster zu polieren.
Die Schriftschablonen der Kinder lagen auf dem Boden herum, wenn da einer drauftrat, würde das dünne Plastik zerknacken. Die Kleine spielte wild Triola. Der Große sortierte seine Abziehbilder, während die Kleine um ihn herumtanzte. Dass er die Bilder irgendwo hätte hinkleben können, kam ihm nicht in den Sinn. Manchmal fragte er sich, ob der Junge richtig im Kopf war.
Katrin war sichtlich erschöpft. »Ich hab sie schon vor zwei Stunden aus dem Kindergarten abgeholt. Wo warst du so lange?« Sie wartete keine Antwort ab. »Die olle Kreke aus dem Ersten blockiert schon wieder die Leitung. Ich will meine Mutter anrufen, die wartet auf den Anruf. Und die ganze Zeit ist die Leitung tot.«
Er setzte müde seine Tasche ab. Ging in die Hocke. »Süße, kannst du die Triola mal weglegen? Ich möchte mit deiner Mutter sprechen.«
Aber Jana drehte sich bloß weg und spielte weiter. Sie sah nicht in das Heft mit den farbigen Noten, sie spielte eine wirre Folge von Tönen. Es kam ihm vor, als spielte sie, um die Eltern zu ärgern.
»Geh runter und sag der Kreke, sie soll auflegen.« Katrin sah ihn wütend an. »Mach’s bitte gleich, sonst platze ich!«
Seit Langem warf sie ihm vor, dass sie bloß einen Zweieranschluss erhalten hatten. Zwei Nummern auf eine Telefonleitung geschaltet, wer hatte den Quatsch erfunden? Man nahm den Hörer ab, und es gab kein Freizeichen, der Apparat war wie tot, solange der andere telefonierte.
Anfangs hatte er sich auch darüber geärgert. Aber er hatte im Gegensatz zu Katrin irgendwann damit Frieden geschlossen. Ihr fiel es schwer, mit überhaupt irgendetwas Frieden zu schließen. Sie hatte ihn so lange bedrängt, bis er herausgefunden hatte, wer auf ihre Leitung geschaltet war, und seitdem richtete sich ihr Hass auf Frau Kreke und auf ihn gleichermaßen.
Katrin schnaubte. »Eh du mal in die Pötte kommst!« Sie riss die Wohnungstür auf, stampfte die Treppe hinunter, und er hörte, wie sie unten an die Tür der Kreke hämmerte. »Könnten Sie bitte endlich auflegen?«
Er wartete. Dann hob er den Telefonhörer ab. Das Freizeichen ertönte. »Ist frei«, rief er ins Treppenhaus.
Katrin kam wieder hoch, setzte sich auf das Telefonbänkchen im Flur und wählte. »Mach den Kindern Abendbrot«, sagte sie. Sie klang wie Oberst Wippert.