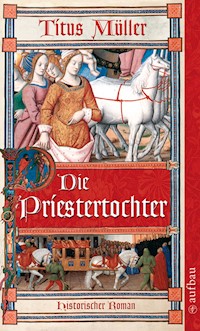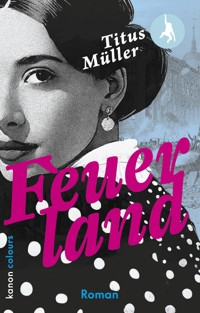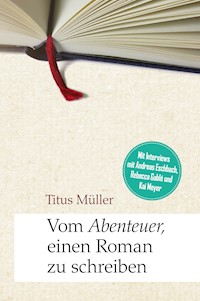14,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 14,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 14,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Heyne Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Mit Fakten und Fiktion erzählt Titus Müller eine große Geschichte vor dem Hintergrund historischer Ereignisse
Asta arbeitet als Dolmetscherin im Kurhotel »Palace« in Mondorf-les-Bains, wo die US-Armee gefangengenommene Nazi-Größen interniert. Am 20. Mai 1945 reist ein neuer Gast an. Er bringt 16 Koffer, eine rote Hutschachtel und seinen Kammerdiener mit. Es ist Hermann Göring, Oberbefehlshaber der Luftwaffe und Hitlers designierter Nachfolger. Asta übersetzt bei den Verhören, reist dann mit nach Nürnberg zu den Prozessen und wird jeden Tag im Gerichtssaal anwesend sein, die abscheulichsten Dinge zu hören bekommen und sie zudem ins Englische übertragen müssen. Umso empfänglicher ist sie für Leonhard, ein junger, sensibler Mann, der ihr sanft den Hof macht. Doch seine Vergangenheit ist undurchsichtig und er stellt verdächtig viele Fragen zu den Prozessen ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 455
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
TITUS MÜLLER
DIE DOLMETSCHERIN
ROMAN
WILHELMHEYNEVERLAGMÜNCHEN
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.Der Verlag behält sich die Verwertung der urheberrechtlich geschützten Inhalte dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.
Originalausgabe 08/2025
Copyright © 2025 dieser Ausgabe by
Wilhelm Heyne Verlag, München in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Straße 28, 81673 München
(Vorstehende Angaben sind zugleich Pflichtinformationen nach GPSR)Alle Rechte vorbehalten.Coverdesign: Favoritbuero unter Verwendung von Trevillion Images (CollaborationJS), ullstein bild (Walter Frentz)
Redaktion: Tamara Rapp
Satz: Uhl + Massopust, Aalen
ISBN 978-3-641-32975-4V002
www.heyne.de
1
Die Gefangenen saßen verstreut auf dem Rasen. Sie hatten Decken ausgebreitet und sich darauf niedergelassen. Manche von ihnen hatten sich bis zum Bauch entblößt, sie saßen mit geschlossenen Augen da, rückwärts auf die Hände gestützt, und genossen die Sonnenwärme auf ihrem behaarten Körper. Andere hatten Klappstühle herausgetragen und sie zu kleinen Runden zusammengestellt, sie plauderten. Als sie Asta bemerkten, verstummten die Gespräche.
»Wie war Ihr Flug?«, fragte der amerikanische Sergeant, der sie zum Hotelgebäude begleitete.
»Wir wurden ziemlich durchgeschüttelt.« Sie warf erneut einen Blick auf die Gefangenen. War es ihre Unbeschwertheit? Das Selbstbewusstsein, das sie zur Schau stellten? Die Männer so zu sehen, ließ ihr die Galle hochkommen.
Die Gerüchte waren falsch. Weder waren die Naziführer nach Südamerika geflohen, noch versteckten sie sich in den Alpen, um sich neu zu formieren. Sie waren hier im Badeort Mondorf-les-Bains. Reichsminister, hohe Funktionsträger und Generäle.
Die Szenerie glich einem fröhlichen Picknick. Der Stacheldraht, der das elegante luxemburgische Hotel umgab, war mit Stoffbahnen und Tarnnetzen behängt. Über den blauen Himmel zogen Schäfchenwolken.
»Die Nazis wohnen hier im Hotel?«, fragte sie, als sie in den Schatten des Gebäudes traten.
»Sie haben Zimmer im dritten und vierten Stock.« Der Sergeant war jung. Seine Augen saßen unter buschigen blonden Brauen. »Unten sind die Verhörräume und der Speisesaal.«
Gewöhnliche Kriegsgefangene schliefen in Massenunterkünften, in Baracken oder schlammigen Zelten. Warum behandelte man die Naziführer so freundlich, ausgerechnet diese Männer, die den Weltkrieg zu verantworten hatten?
Sie lagerten beieinander wie Raubtiere nach getaner Jagd, zufrieden und satt gefressen. Unter dem friedlichen Himmel, beim Tschilpen der Spatzen im Gebüsch, hockte das Böse auf der Wiese, es hatte sich eingenistet, es klebte wie Schlamm an den Gräsern.
Sich Zugang zu diesem Ort zu verschaffen, war nicht leicht gewesen. . Sie hatte lügen müssen, hatte Dinge tun müssen, die sie verwerflich fand. Aber es war ihr gelungen, alle Widerstände zu überwinden.
Der Sergeant hielt ihr höflich die Tür auf. Die Sessel in der Lobby waren abgenutzt, der Teppich an einigen Stellen verschlissen. Trotzdem besaß der Raum Eleganz. Schwere samtene Vorhänge schmückten die Fenster, und Trockenblumensträuße aus vergangenen Zeiten sorgten für Behaglichkeit. Hinter dem Tresen der Rezeption blinkten Dutzende goldener Haken, an denen einst Schlüssel gehangen hatten.
Ein älterer Offizier verlangte ihre Papiere. Nachdem er sie kurz studiert hatte, reichte er ihr einen Schlüssel. »Zimmer Nummer vierzehn, im Nebengebäude. Mahlzeiten um sieben, um zwölf und sechs Uhr am Abend.« Sein Englisch war gestochen scharf, das Englisch eines Mannes, der sein Leben dem Militär gewidmet hatte.
Als sie wieder draußen waren, fragte sie: »Die Gefangenen speisen nicht mit uns, oder?«
Der junge Sergeant trug ihren Koffer. Er ging auf ihre sarkastische Bemerkung nicht ein, er lächelte nur. Schließlich sagte er: »Sie … tragen keinen Ring.«
»Ich bin verlobt. Den Ring habe ich nur für die Reise abgenommen.«
»Aber Sie sind allein aus Amerika gekommen, oder? Lässt Ihr Verlobter Sie einfach nach Europa ziehen? Dann hat er Sie nicht verdient.«
»Wenn Sie so weitermachen, laden Sie mich als Nächstes zum Essen ein.«
»Würden Sie denn –?« Plötzlich unterbrach er sich, stellte den Koffer ab und nahm Haltung an, die Hände flach an der Hosennaht. Er salutierte.
Asta drehte sich um. Ein Colonel mit Adlern am Hemdkragen musterte sie kalt. »In mein Büro.«
Hatte er das Gespräch mitgehört? Wie ärgerlich. So hatte sie sich ihren Start hier nicht vorgestellt.
»Sergeant, bringen Sie das Gepäck auf ihr Zimmer«, befahl der Colonel. Dann wandte er sich wieder an Asta: »Mitkommen.«
Sie gab dem Sergeant ihren Schlüssel. Die Sache war ihm sichtlich unangenehm, seine Wangen hatten sich gerötet.
Notgedrungen folgte sie dem Colonel. Burton C. Andrus stand auf dem Schild neben der Tür seines Büros. Er umrundete den Schreibtisch und ließ sie davorstehen wie eine Schülerin, die zum Direktor gerufen worden war.
Umständlich nahm er den grünen Lackhelm ab und stellte ihn auf den Tisch. »Sie sind aus Milwaukee, Wisconsin.« Er rückte die Nickelbrille zurecht, blätterte in einer Akte. Schließlich holte er ein Blatt heraus, das ihr Foto trug. Er überflog den dazugehörigen Text.
»Geboren bin ich in Deutschland.« War ihr Englisch sauber genug? In den Staaten hatten sie ihr wiederholt gesagt, dass sie akzentfrei sprach. Aber es war eine besondere Situation, wenn es um genau das ging: die Sprache.
»Das sehe ich. Und Sie haben bei einer Airline gearbeitet bis vor wenigen Wochen.«
»Bei der Pan Am. Als Travel Representative.«
»Was, denken Sie, qualifiziert Sie, Verhöre von deutschen Kriegsverbrechern zu übersetzen?« Er legte das Blatt weg und musterte sie mit ernstem Gesicht.
Hatte er ihre Testergebnisse nicht gelesen?
»Wir sind hier nicht irgendein Kriegsgefangenenlager«, sagte er. »Als Zivilistin dürften Sie nicht mal von der Existenz dieses Hotels wissen. Davon abgesehen glaube ich nicht, dass Sie Männern gewachsen sind, die gegnerische Staatschefs an der Nase herumgeführt haben und in der Lage waren, Millionen von Deutschen einer Gehirnwäsche zu unterziehen.«
»Ich wurde im Pentagon Tests unterzogen.«
»Die werden wohl kaum aus einer Luftfahrtangestellten eine Linguistin gemacht haben. Ich brauche hier Experten, die mit den sprachlichen Feinheiten so vertraut sind, dass sie diese Ausgeburten des Bösen der Lüge überführen können. Dafür sind Sie nicht geeignet.«
Sie hätte ihn bitten müssen, ihr eine Chance zu geben. Ihm das Gefühl vermitteln müssen, ihr großer Förderer zu sein. Aber wie er da über ihrer Akte thronte und sie abservierte, ohne auch nur annähernd gründlich mit ihr gesprochen zu haben, ja ohne überhaupt den Versuch zu unternehmen, ihre Fähigkeiten zu überprüfen, machte sie zornig. Sie sagte: »Ich bin gerade von New York auf die Azoren, dann nach Lissabon und weiter nach Marseille und Luxemburg geflogen, habe Zwischenlandungen, Stürme und pausenlos palavernde Mitreisende ertragen. Ich war über eine Woche unterwegs, nicht mit dem Stratoliner, sondern mit der DC-3, falls Ihnen das was sagt. Es war kalt und laut, und wir wurden von jedem kleinen Wind herumgeworfen. Jetzt bin ich endlich hier, und Sie sagen mir, dass ich wieder heimkehren soll?«
Unbeeindruckt hielt er ihren Blick. »Ich habe Sie nicht gerufen.«
»Colonel Dostert hat mich hergeschickt, der persönliche Übersetzer von General Eisenhower.«
Andrus’ Schnurrbart zuckte verächtlich. »Ich kann mir schon vorstellen, wie das abgelaufen ist. Er hat Sie auf einem Flughafen getroffen und war davon beeindruckt, wie gut Sie Deutsch und Englisch sprechen, und er fand Ihre Erscheinung entzückend, also hat er Sie ins Pentagon eingeladen. Er arbeitet doch noch für das OSS?«
Sie hatte geglaubt, die Fürsprache eines so mächtigen Mannes wie Dostert würde ihr sämtliche Türen öffnen. Doch offenbar verschaffte ihr Dosterts Unterstützung hier keine Vorteile. Im Gegenteil. Dass sie von Dostert kam, schien sie zu disqualifizieren.
»Das OSS soll sich nicht so aufplustern«, sagte der Colonel. »Dostert wird Ihnen großartige Geschichten aufgetischt haben, was er in Afrika geleistet hat. Aber glauben Sie mir, kaum die Hälfte davon ist wahr. Hier in Europa hatte der Military Intelligence Service direkt mit den feindlichen Streitkräften zu tun, die Agenten haben hinter der Front Gefangene verhört, um etwas über die feindliche Kampfstärke und ihre Absichten zu erfahren. Sie haben Foto-Aufklärung aus der Luft betrieben. Und sie sind es, die jetzt die führenden Nazis verhören, nicht das OSS. Oh, So Secret!«, spottete er.
Wie armselig, sich mit einem albernen Spruch über das Office of Strategic Services lustig zu machen. MIS und OSS sollten eigentlich auf derselben Seite stehen.
Der Colonel wirkte wie ein erfahrener Offizier, aber da war auch etwas, das sie nicht näher benennen konnte, eine Fahrigkeit, ein unvermitteltes Zucken der Finger. Sein Schreibtisch quoll über, Dokumente lagen kreuz und quer darauf. Mittendrin stand der Aschenbecher, und etliche zerdrückte Zigarettenstummel lagen darin. Er war entweder länger nicht ausgeleert worden, oder der Colonel hatte heute bereits einiges geraucht. Das Telefonkabel hatte sich am Bein des grünen Sessels verheddert, Andrus musste auf und ab und im Kreis gegangen sein beim Telefonieren. Souveränität bedeutete ihm alles, und dennoch fehlte sie ihm.
Sie musste ihm nur das Richtige anbieten.
Das Durcheinander auf dem Schreibtisch zeigte, Andrus war überfordert. Er musste geradezu nach dem Gefühl dürsten, obenauf zu sein, die Dinge im Griff zu haben. Vielleicht nach einer Unterstützung, die ihm Erleichterung verschaffte? Sie sagte: »Ich bin mir sicher, Sie haben hier eine Menge zu tun. Ich habe im Büro gearbeitet, ich kann Ordnung schaffen und Briefe tippen, kann Ihre Termine koordinieren und für Sie Berichte entwerfen. Könnten Sie nicht etwas Hilfe gebrauchen?«
Er sah trübe in die Ferne, die Hand auf die Magengegend gelegt. Lange verharrte er in der Pose, schien nachzudenken. »Also gut. Ich werde versuchen, für Sie eine Aufgabe zu finden.« Er nahm die Hand herunter und sah sie an. »Aber ich warne Sie. Halten Sie sich von den Häftlingen fern. Sonst sitzen Sie wieder im Flugzeug nach Hause. Sie bleiben die nächsten Tage in Ihrem Zimmer und verlassen es nur für die Mahlzeiten.«
Der erste Schritt war gemacht.
»Und hören Sie auf, meinen Männern den Kopf zu verdrehen.«
»Ich bin verlobt«, sagte sie. Es war nur eine halbe Lüge, vielleicht kam sie damit durch.
In ihrem Zimmer hievte sie den Koffer auf das dafür vorgesehene Bänkchen, löste die Spannbänder, die ihn bei all den Reisestrapazen zusammengehalten hatten, öffnete ihn und begann, ihre Kleidung in den Schrank zu sortieren.
Sie sah aus dem Fenster auf die Wachtürme mit den schwer bewaffneten Posten. Die GIs hielten die Maschinengewehre nach draußen gerichtet, als fürchteten sie einen Angriff auf das Hotel.
Dieser Stacheldrahtzaun, wie hoch war der? Sicher fünf Meter. Warum hatte man ihn mit Stoffbahnen und Tarnnetzen behängt? Wäre es nur darum gegangen, eine Flucht zu verhindern, hätte nackter Stacheldraht genügt. Nein, sie wollten nicht, dass jemand auf das Gelände blickte. Am Tor waren ihre Papiere dreimal geprüft worden, bevor man sie hineinließ, obwohl sie in einem Jeep der US Army und in Begleitung eines amerikanischen Offiziers angekommen war.
Sie presste die Lippen zusammen. Statt sich vor Angreifern von außen zu schützen, sollten sie lieber ihre Gefangenen ins Visier nehmen. Das Picknick sprach Bände. Die Amerikaner kriegten es nicht hin, genau wie man es ihr gesagt hatte. Jemand musste ihnen die Nazis vor die Flinte treiben. Sie wusste, wie gut sie darin waren, auszuweichen, sich zu verstellen, sich neu zu erfinden.
Sie griff nach den Camels, klopfte eine Zigarette aus der Schachtel und zündete sie sich an. Mit untergeschlagenen Beinen setzte sie sich aufs Bett und nahm den Aschenbecher auf den Schoß.
Sie hätte Mrs. Holder sein können. Hätte schon nächstes Jahr ein Kind haben können und dann weitere, hätte sie aufziehen, für Denny kochen, das Haus putzen, ein schönes Zuhause schaffen können.
Am Wochenende hätte ihre Familie sie besucht, Mutter hätte ihre Kleinen bewundert, Friederike und Hansi hätten mit ihnen geschäkert. Mutter hätte ihr Ratschläge gegeben: Lass sie nicht kalt werden, bei diesem Wetter und ohne Mütze! Du musst sie regelmäßig füttern, damit sie sich an Pünktlichkeit gewöhnen. Singst du ihnen abends vor? Das hat bei dir immer Wunder gewirkt.
Und wenn Denny vom Poolbillard heimgekommen wäre und hätte ihr, leicht angetrunken, an den Hintern gefasst, hätte sie sich gefragt: Warum habe ich diesen Mann geheiratet? Später hätte sie sich aus dem Ehebett geschlichen und im Kinderzimmer die Kleinen zugedeckt und auf ihren leisen Atem gelauscht.
Vielleicht wäre es schön geworden, manchmal. Aber die Unruhe wäre immer da gewesen. Die Erinnerungen. Das deutliche Empfinden, dass sie ihre Aufgabe nicht erledigt hatte.
Sie stand auf und stellte den Aschenbecher auf den Waschtisch. Drückte die Zigarette aus. Beugte sich über das kleine Waschbecken, drehte den Hahn auf und warf sich Wasser ins Gesicht. Sie trocknete sich ab.
Die Endgültigkeit der Entscheidung stand ihr klar vor Augen. Dennoch war es richtig und nötig gewesen. Wenn diese Verbrecher davonkamen, wenn allen voran er davonkam, würde sie niemals Frieden finden.
Zuerst musste sie Informationen über die Gefangenen erlangen. Dann brauchte sie Zugang zu den Verhörprotokollen, um sich vorzubereiten. Vom Colonel würde sie kein grünes Licht erhalten, Andrus brauchte sie nur zum Kaffeekochen oder für Sekretärinnendienste. Für ihn war sie ein devotes Mädchen vom Land.
Sie konnte es also auf zwei Arten angehen: Entweder wartete sie, bis er sie rufen ließ, und folgte dann über Wochen oder gar Monate brav seinen Anweisungen, in der Hoffnung, dass sie im Büro auf interessante Dokumente stieß. Oder sie tat genau das, was er ihr untersagt hatte, und zeigte ihm, wozu sie in der Lage war. Was das Risiko in sich barg, dass er sie anschließend feuerte.
Dieses Risiko war hoch. Männer wie er mochten es nicht, wenn man auf eigene Faust vorpreschte, und noch weniger, wenn man dabei ihre Befehle missachtete.
Aber ihr Führungsoffizier hatte Ergebnisse innerhalb von einer Woche gefordert. Die waren ganz sicher nicht durch Fügsamkeit zu erlangen.
Mit dem deutlichen Gefühl, etwas Verbotenes zu tun, trat sie aus dem Zimmer. Im Flur war der Boden nass. Ein abgemagerter Mann in grauem Uniformhemd und geflickter Hose tauchte einen Lappen in einen Eimer und wrang ihn aus.
Der Mann hängte den Lappen über den Eimerrand und stand auf, langsam, fast andächtig. Hager war er, knochig. So schmutzig wie der Wischlappen. Er hielt die nassen Hände vor dem Hosenbund verschränkt und schwieg.
Sie verschloss ihr Zimmer, steckte den Schlüssel ein und wandte sich im Flur nach links.
»Vorsicht«, sagte er hinter ihr. »Rutschen Sie nicht aus.«
Es war das erste Mal, dass sie Deutsch hörte, seit sie in Europa gelandet war. Es verblüffte sie.
Sie drehte sich um. »Woher wussten Sie, dass ich Deutsch spreche?«
»Nur so ein Gefühl.«
Sie zögerte. »Sind Sie Häftling hier?«
»Im Kriegsgefangenenlager hinter dem Hotel.«
»Verstehe.«
Seine Augen waren dunkel. In ihnen saß ein Schmerz, der sie betroffen machte.
Sie überlegte, was zu sagen war, aber es ließ sich nichts sagen. Auch er betrachtete sie nur still und traf keine Anstalten, ein Gespräch zu beginnen.
»Danke«, sagte sie.
Er nickte.
Sie ließ ihn stehen und trat aus dem Gebäude. Auf der Wiese waren keine Naziführer mehr zu sehen. Das Abendlicht hatte die Bäume in Orange getaucht. Eine Amsel sang. Vor dem Hoteleingang standen zwei Wachen. Ihre Uniform wurde von weißen Gürteln gehalten, und ihre Helme saßen ordentlich, die weißen Gurte straff unter dem Kinn. Als sie sich näherte, sagte der Linke: »Sie dürfen das Hotel nicht betreten.«
Es fühlte sich an wie eine Ohrfeige. Trotzdem bemühte sie sich um einen sachlichen Ton. »Colonel Andrus hat Ihnen wohl noch nicht Bescheid gegeben. Ich gehöre jetzt zur Mannschaft. Ich bin Dolmetscherin.«
»Sie brauchen einen Passierschein, Miss.«
Genügte nicht das scharf bewachte Einfahrtstor? Und überhaupt, der Sergeant hatte vorhin auch keinen Schein vorgezeigt. »Den habe ich nicht, ich bin gerade erst angekommen.«
»Tut mir leid, Miss.«
Wenn sie kein Aufsehen erregen wollte, sollte sie besser gehen. Sie schluckte die Enttäuschung herunter und kehrte ins Nebengebäude zurück. Der Flur vor ihrem Zimmer war schon halb getrocknet, es gab nur noch einige feuchte Stellen, die im Licht der Deckenlampen glänzten. Der Kriegsgefangene war fort. Sie lauschte. Im Treppenhaus hörte sie das Aufklatschen des Lappens.
Sie stieg langsam die Treppe hoch, bis sie ihn entdeckte. »Wischen Sie auch dort drüben?«, fragte sie. »Im Hotel?«
Er bejahte.
»Macht es Ihnen nichts aus, den Dreck der Leute aufzuwischen, die Sie in den Krieg geschickt haben?«
»Ich hab mich nicht darum beworben.«
In diesem einen Satz steckte das Dilemma eines Mannes, der zur Front eingezogen worden war, mühevoll die Kriegsjahre überlebt hatte und jetzt dafür büßen musste.
Er war nicht immer Soldat gewesen. Sie musterte ihn genauer. Nach harter körperlicher Arbeit sah er nicht aus. Vielleicht war er Briefbote oder hatte Melkmaschinen repariert. Oder er war Straßenbahnschaffner gewesen. Er hatte vermutlich eine Schwester irgendwo, Eltern, ein Zuhause.
»Erzählen Sie mir etwas über die Gefangenen.«
Er blickte nach oben, die Treppe hinauf. »Sie sollten nicht mit mir reden. Das ist verboten.«
»Wer ist drüben im Hotel? Ist Schirach darunter? Göring? Ich habe sie auf der Wiese nicht gesehen.«
Er stützte sich mit der nassen Hand auf das Treppengeländer. »Rauchen Sie?«
»Ab und an.«
»Wenn Sie Kippen haben, könnten Sie mir die geben?«
»Kippen?«
»Schbreizn. Stummel.«
»Was wollen Sie damit?«
»Da ist ein Rest Tabak drin, der nicht verbrannt ist. Den hole ich raus und rolle neue Zigaretten mit Zeitungspapier. Ich hab mir das Rauchen abgewöhnt, aber im Lager sind Zigaretten Gold wert.«
»Ich mache Ihnen ein Angebot: Ich hole eine ganze Schachtel Camel, amerikanische Zigaretten. Ungeraucht. Die können Sie haben. Und dafür sagen Sie mir alles, was Sie wissen.«
Er war einverstanden. Ohne dass sie ihn dazu aufgefordert hatte, hängte er den Wischlappen über den Eimerrand und ging ihr hinterher. Als sie das Zimmer betrat, folgte er ihr hinein.
»Was soll das?«
Leise schloss er hinter sich die Tür. »Ich tu Ihnen nichts.« Er schaute sich um.
»Gehen Sie! Was haben Sie hier drin verloren? Habe ich Sie etwa reingebeten?«
Er legte die Hand auf das Bett, drückte es etwas herunter. »So weich. Und diese Ordnung. Ein Schrank. Ein Waschtisch.«
Längst bereute sie, ihn angesprochen zu haben. Männer, die aus dem Krieg kamen, hatten ihren moralischen Kompass verloren. »Gehen Sie sofort, oder ich schreie. Es sind amerikanische Soldaten in der Nähe, die machen kurzen Prozess mit Ihnen.«
Er blinzelte verwirrt. »Warum denn schreien? Sie wollen doch was von mir.«
»Aber nicht … das!«
»Da draußen können wir nicht reden. Das ist alles. Ich dachte, es ist besser, wenn man uns nicht sieht. Ich würde großen Ärger bekommen, und Sie genauso.«
»Das nächste Mal fragen Sie, bevor Sie ein Zimmer betreten.«
Er streckte die Hand aus. »Geben Sie mir die Zigaretten, und ich sage Ihnen, was ich weiß.«
Draußen war er ihr hilfsbedürftig erschienen. Jetzt wirkte er schroff und unnahbar. Sie holte die Zigarettenschachtel aus dem Schrank und gab sie ihm.
»Also Göring interessiert Sie, ja?«
»Zum Beispiel.«
»Er ist im Hotel. Am 20. Mai angereist. Hat sechzehn Koffer und eine rote Hutschachtel mitgebracht – und seinen Kammerdiener. Außerdem, heißt es, hatte er bündelweise Geld bei sich. Und eine Reisetasche voll mit Paracodin-Tabletten. Seine Fuß- und Fingernägel trägt er rot lackiert. Andrus hat ihm einen Drogenentzug verordnet. Er ist auf der Krankenstation.«
»Göring ist einfach so hergekommen? Woher wusste er überhaupt von dem geheimen Hotel?«
Der Kriegsgefangene schüttelte den Kopf. Natürlich war Göring nicht einfach so angereist. »Er hatte sich in Berchtesgaden verkrochen«, erklärte er, »in Hitlers Ferienhaus. Dann ist es ihm ungemütlich geworden. Zuerst haben die Alliierten mit Bombern angegriffen, und dann hat ihn die SS festgesetzt.«
»Die SS hat den Reichsmarschall festgenommen?«, unterbrach sie ihn irritiert.
»Hitler soll ihn kurz vor seinem Tod noch als Verräter bezeichnet haben. Das soll sogar über das Radio verkündet worden sein. Ich war da schon Kriegsgefangener, ich habe es nicht selbst gehört.«
»Also war Göring entthront.« Warum hatte sie nichts davon erfahren? Vor vier Wochen musste das gewesen sein.
»Möglicherweise. Er wurde jedenfalls von der SS festgesetzt.«
»Das wissen Sie sicher?«
»Im Lager kursiert das Gerücht. Bis zum Schluss soll unklar gewesen sein, ob er erschossen wird. Er hatte Hilfe, sonst wäre er aus dem Arrest nicht entkommen.«
Göring musste begriffen haben, dass der Krieg verloren war und man ihn irgendwann erwischen würde, entweder die SS oder die Alliierten. »Wie ist er hierhergekommen?«
»Er hat über seinen Adjutanten ein Treffen mit der US-Armee verabredet und sich in einem gepanzerten Mercedes hinfahren lassen. Dann wurde er von den Amerikanern per Kuriermaschine nach Augsburg geflogen und schließlich hierher nach Mondorf. Mit seinem ganzen Gepäck.«
Das waren genau die Informationen, die sie brauchte. »Und er ist immer noch drogenabhängig, sagen Sie?«
Der Kriegsgefangene stutzte. »Kennen Sie ihn?«
»Nicht persönlich.« Sei bloß vorsichtig, ermahnte sie sich. Auch wenn sie eigentlich mehr über Göring erfahren wollte, lenkte sie das Gespräch jetzt auf die anderen. Sie fragte nach, und der Kriegsgefangene zählte die weiteren hochrangigen Häftlinge auf.
Ob auch sie sich selbst gestellt hätten, wollte sie wissen.
Da lachte der Mann kurz und trocken auf. »Hans Frank«, sagte er, »den kennen Sie? Er hat grausam über Polen geherrscht. Man hat ihn im ›Haus Bergfrieden‹ in Neuhaus am Schliersee gefasst. Wissen Sie, was er bei sich hatte? Kunstwerke von Rembrandt, Rubens und Leonardo da Vinci.«
Kaltenbrunner hatte sich in einer Jagdhütte in den österreichischen Alpen versteckt, berichtete er. Er hatte falsche Papiere bei sich, die ihn als Arzt auswiesen, als »Dr. Josef Unterwoger«. Aber in der Asche im Ofen hatte man Reste seines Ausweises und seiner Erkennungsmarke gefunden.
Ley war von amerikanischen Soldaten in einer Hütte bei Berchtesgaden verhaftet worden. Er hatte sich dort unter dem Namen »Dr. Ernst Distelmeyer« mit falschen Papieren versteckt.
Und Streicher wurde von amerikanischen Truppen in Tirol gefasst. Er hatte wohl versucht, sich als Künstler auszugeben, hatte sich »Sailer« genannt und sich einen Bart wachsen lassen, um als Maler durchzugehen.
Draußen hörte man Schritte. Der Kriegsgefangene unterbrach mitten im Satz, lauschte. Die Schritte entfernten sich. »Ich muss gehen.« Er drehte die Schachtel Camel in den Händen. »Wenn ich etwas zu Göring erfahre, sage ich es Ihnen.«
»Nicht nur zu Göring. Auch die anderen interessieren mich. Sie machen den Naziführern die Zimmer sauber?«
»Nein. Ich wische nur den Speisesaal. Ihre Zimmer müssen sie selbst in Ordnung halten. So will es Andrus.« Er steckte sich die Zigarettenschachtel in den Hemdausschnitt und ließ sie zum Bauch hinunterrutschen. »Aber es gibt einen guten Buschfunk.« Er wandte sich zur Tür und lauschte erneut.
Dann drehte er sich um und musterte Asta. »Warum machen Sie das eigentlich? Dolmetschen, meine ich. Sie sind gerade erst angekommen. Andere würden sich ausruhen, aber Sie sind voller Elan.«
»Woher wissen Sie, dass ich gerade erst angekommen bin?«
»Ich hab Sie vom Fenster aus beobachtet.« Sein Blick wurde samtig, und er schlug die Augen nieder.
»Ich war schon immer zielstrebig«, sagte sie.
Er lächelte. »Also ist es Ihnen ein Herzensanliegen, Verbrecher zu verhören?«
»Ich verhöre sie ja nicht, sondern dolmetsche nur.«
»Geht mich auch nichts an.«
»Wie heißen Sie?«, fragte Asta, als er sich zum Gehen wandte.
»Leonhard. Sagen Sie Leo.« Er zog die Tür auf. »Und Sie?«
»Ich bin Asta.«
Er wiederholte es leise. »Schön. Also bis bald, Asta.«
Als er fort war, verharrte sie einige Minuten in der Erwartung, dass es militärisch streng an ihrer Tür klopfen könnte. Aber es blieb still. Ihr Treffen schien unbemerkt geblieben zu sein. Sie notierte alles, solange die Erinnerung noch frisch war. An den Rand schrieb sie in winzigen Buchstaben: Leo. Dann radierte sie es wieder aus. Er sollte nicht in Schwierigkeiten geraten, falls man die Notizen bei ihr fand.
2
Beim Abendessen sah sie keinen Dolmetscher. Sie saß an einem Tisch mit amerikanischen Soldaten, 391st Anti-Aircraft Artillery Battalion, wie die Männer ihr stolz erklärten. Man hatte sie als Wachen für das Hotel und das Kriegsgefangenenlager abkommandiert. Asta hatte Mühe, sich der Soldaten und ihrer jungenhaften Scherze zu erwehren. Sie ging bald auf ihr Zimmer.
Immer wieder dachte sie an den Kriegsgefangenen. Wieso wusste Leo so viel? Und wie gelangten die Informationen in das Kriegsgefangenenlager? Gern hätte sie ihn nach Gerüchten über einen Befreiungsversuch gefragt. Die Soldaten hatten nichts davon gewusst. Aber die Sicherheitsvorkehrungen mussten einen Grund haben.
Nach einer unruhigen Nacht erwachte sie durch Motorengeräusche. Sie trat barfuß zum Fenster, spähte hinaus. Im Morgennebel sah sie Andrus in einen wartenden Militärjeep steigen. Der Jeep fuhr zum Tor, es wurde geöffnet.
Mit einem Schlag war sie wach. Andrus verließ das Gelände. Wer so früh am Morgen aufbrach, ging auf eine längere Fahrt. Sicher war er für Stunden fort.
Sie wusch sich über der Schüssel und kleidete sich an. Im Frühstücksraum fragte sie einen Kellner nach den Dolmetschern, und er brachte sie in ein Nebenzimmer. Die Männer dort unterschieden sich deutlich von den Soldaten. Sie waren älter, und sie redeten in gedämpftem Tonfall.
»Nehmen Sie mich mit zu Ihrem Captain?«, fragte sie. »Ich spreche fließend Englisch und Deutsch. Andrus hat mich eingestellt.«
Sie wechselten sofort zu Deutsch und fragten sie bei Toast mit Erdbeermarmelade, Rührei und Apfelkompott begeistert aus. Nach ihrer Kindheit in Hannover, dem Umzug 1937 in die USA, als sie dreizehn Jahre alt gewesen war, nach ihren Erfahrungen bei der Pan Am und ihren Verwandten in Deutschland.
Sie fand auch einiges über den Werdegang der anderen heraus. Einer hatte im Krieg für den Militärgeheimdienst gearbeitet. Ein anderer, ein Exportkaufmann aus Köln, war nach New York ausgewandert. Der dritte war Jurist. Sie drückten sich wortgewandt aus, und sie sprachen klug über das Thema Schuld. Linguistik hatte keiner von ihnen studiert. Das ärgerte sie. Wieso hatte Andrus von ihr etwas verlangt, das die anderen genauso wenig boten?
Sie lenkte ihre Aufmerksamkeit wieder auf das Gespräch. Der Exportkaufmann sagte gerade: »Wer bei Kriegsende nicht aus dem Gefängnis oder dem Konzentrationslager kam, ist mitverantwortlich. Punkt.«
»Zumindest alle, die Hitler zugestimmt haben«, sagte der Jurist. »Jetzt müssen sie selber wissen, ob sie aus dem Elend wieder aufstehen und ihre Schuld abtragen wollen.«
»Schuld abtragen?« Der Geheimdienstmann lachte. »Ich kenne nicht einen schuldbewussten Nazi, nicht einen einzigen. Sie schreien alle: ›Ich bin Opfer, mir wurde übel mitgespielt!‹ Genauso wie sie früher ›Heil Hitler!‹ geschrien haben.«
»Das Beunruhigende«, sagte der Jurist, »ist nicht, dass die Nazis Monster oder Wahnsinnige gewesen sind. Sondern dass sie ganz normale Menschen waren.« Er sah Asta an. »Was meinen Sie?«
Sie wiegelte ab. »Ich komme gerade aus den USA.«
»Sie müssen doch eine Meinung haben.«
Bleib ruhig, dachte sie. Um Zeit zu gewinnen, nahm sie ein Toastbrot und lud Rührei darauf. Sie schnitt eine Ecke davon ab, spießte sie mit der Gabel auf und steckte sie in den Mund. Sie kaute. Jeder hatte über die Schuldfrage nachgedacht, schon während des Krieges. Die Dolmetscher hatten ihre Einstellung dazu gefunden. Ihre eigene musste sie verheimlichen, wenn sie nicht auffliegen wollte. Als sie heruntergeschluckt hatte, sagte sie: »In Amerika sind die Westernfilme schwer in Mode. In denen gibt es Gut und Böse, und man weiß immer, wer was ist. Die Guten tragen weiße Hüte, die Bösen tragen schwarze. Am Ende ist alles aufgeräumt.«
»Aber keiner will den schwarzen Hut tragen«, sagte der Exportkaufmann. »Sie haben die Leute hier nicht gehört. Selbst stramme Nazis behaupten, sie wären schon immer dagegen gewesen. Sie hätten dem Stammtisch gesagt, ohne ein Blatt vor den Mund zu nehmen, dass man so nicht mit den Menschen umgehen darf. Sie waren niemals gegen die Juden. Und natürlich haben sie keinem ein Haar gekrümmt. Bloß wenn man nachhakt, geben sie zu, dass es in ihrem Ort keine Juden mehr gibt, seitdem sie eines Nachts alle zum Bahnhof getrieben und dort in Viehwagen verladen wurden. Aber wir hatten Fremdarbeiter, sagen sie, verschleppte Franzosen, und die haben es bei uns gut gehabt, fast so, als würden sie zur Familie gehören. Und dann fangen die Nazis an zu weinen. Nicht weil man im Verhör laut geworden ist, sondern weil sie von ihrer eigenen Güte so durchdrungen sind, dass es sie zu Tränen rührt. Sie erzählen von ihrer Liebe zu ihrem Hund und von den Blumen vor ihren Fenstern und wie sie mal ein verletztes Eichhörnchen aufgezogen haben.«
»Reden so die Naziführer?«, fragte sie.
»Nein. Ich spreche vom Unterbau. Von kleinen Ortsbürgermeistern oder den Inhabern niedriger Parteiämter.«
Sie konnte nicht länger an sich halten. »Wir sind viel zu weich mit ihnen. Das ist meine Meinung.«
Jetzt blickten sie auf.
Asta sprach leise, aber ihren Zorn konnte sie schwer verhehlen. »Jeder Mensch weiß, was Mord ist. Jeder spürt, dass das Leben heilig ist. Dass es nicht in Ordnung ist, jemanden zu töten. Diese Männer haben persönliche Gegner und Menschen, die ihnen nicht gepasst haben, ins Konzentrationslager geschickt. Sie haben ihren Tod befohlen.«
»Das haben sie vergessen«, sagte der Jurist. »Auch wenn es erst letztes Jahr war. Sie haben es bewusst vergessen, weil es ihnen egal ist.«
Sie musste sich in den Griff bekommen. Ihre Gefühle durften sie nicht noch einmal überrumpeln. Schöpften die Dolmetscher vielleicht schon Verdacht?
Als sie nach dem Essen zur Vorbesprechung der Verhöre gingen, nahmen sie Asta einfach mit. Sie sagten, Colonel Andrus hätte sie eingestellt.
Ihr Captain war skeptisch. »Davon weiß ich nichts.« Er musterte Asta. »Haben Sie die Sicherheitsfreigabe?«
»Ich bin vom Pentagon geprüft worden, im OSS.«
»Warum hat mir Colonel Andrus nichts davon mitgeteilt?«
»Ich bin erst gestern eingetroffen.«
»Verstehe.« Er kratzte sich das Kinn. »Eigentlich trifft sich das gut, dann können wir ein weiteres Verhör führen.« Je einer von ihnen würde das Protokoll schreiben, erklärte er, der andere die Fragen der amerikanischen Geheimdienstoffiziere übersetzen. Es gebe sechzehn Verhörräume.
Er teilte Asta und den Juristen zum Verhör von Julius Streicher ein.
Ausgerechnet Streicher. Vor der Begegnung graute ihr. Sie rückte am Tisch im Verhörraum immer wieder das Papier zurecht, drehte den Füllfederhalter in den Händen, schraubte an der Kappe herum.
Als Streicher den Verhörraum betrat, wandte sie die Techniken an, die ihr beim NKWD für den Fall eines Lügendetektortests beigebracht worden waren: Sie drückte die Fußspitzen fest auf den Boden und atmete kontrolliert, während sie ihr Gesicht entspannte.
Er war glatzköpfig bis auf einen kleinen Rest von Haaren am Hinterkopf. Er setzte sich, zupfte nervös seinen Hemdkragen zurecht, nickte den Männern zu. Dann blieb sein Blick an ihr hängen. Er sagte: »Rassisch sehen Sie gut aus.«
Es war, als hätte er ihr auf den Mund geschlagen. Nach einem ersten Schreckmoment kam die Wut. »Was man von Ihnen nicht behaupten kann«, erwiderte sie.
Er lachte: »Nein? Ich wollte Sie nicht kränken, ich habe Ihnen doch ein Kompliment gemacht. Und ich bin rein arisch. Meine Haare waren früher blond, und meine Augen sind blau.«
Der Geheimdienstoffizier, der kein Deutsch sprach, blickte verdutzt von ihr zu Streicher und wieder zurück. Es war unüblich, dass der Verhörte zuerst einen Schlagabtausch mit der Protokollführerin absolvierte.
»Do you know him?«, fragte er. »I mean, personally?«
Sie verneinte.
Streicher trug ein kleines Oberlippenbärtchen, nicht konturiert wie bei Hitler, sondern grau und schwammig. Sein Schmierblatt »Der Stürmer« hatte ihn zum Millionär gemacht. Es hatte fast kein anderes Thema gehabt als den Hass auf die Juden. Extra großflächig und plakatartig war es gestaltet gewesen, damit es in den überall aufgestellten »Stürmer«-Kästen attraktiv aussah, Kästen, die in den Städten an allen wichtigen Straßenkreuzungen und Plätzen gestanden hatten.
Als Kind hatten Asta die Kästen wegen der Illustrationen angezogen. Auch ihre Freundinnen waren um sie herumgeschwärmt wie Fliegen um faulendes Obst. Die Juden waren darin abstoßend gezeichnet, mit widerlichen Gesichtern. Artikel hatten von Vergewaltigungen erzählt, angeblichen üblen Zuständen in Synagogen oder jüdischen Altersheimen und Wohnungen, von Betrug und »Ritualmorden«. Sie hatten die »Verschwörung des internationalen Finanzjudentums« behauptet. So hatten sich Krämer, Handwerker und gebeutelte Kleinbürger die Welt erklären sollen: Sie waren Opfer der Juden, ihre magere wirtschaftliche Situation war allein mit der Raffgier der Juden zu erklären. Kapitalismus, Konkurrenz und Preismechanismen gab es nicht – an allem waren die Juden schuld.
Schon damals hatte sie geahnt, dass das Unsinn war. Bis die Lehrer dasselbe behaupteten. Und die Nachbarn. Zweifel schlichen sich ein. Was, wenn es doch stimmte? Sie schämte sich bis heute über das leise innere Fragen. Jetzt saß er vor ihr, der Mann, der das Herz der kleinen Asta vergiftet hatte und die Herzen von so vielen anderen.
Das Verhör begann. Streicher behauptete, er habe sich fünfundzwanzig Jahre dem Studium des Judenproblems gewidmet und wisse mehr darüber als irgend jemand sonst.
Asta schrieb mit, das Dolmetschen übernahm der Jurist; er machte seine Sache gut, manche Nuance hätte sie so nicht erkannt. Als der Geheimdienstoffizier nach den Konzentrationslagern fragte, stritt Streicher ab, irgendetwas darüber zu wissen. Was dort geschehen war, darüber sei er nicht informiert gewesen und habe auch nicht nachgefragt. Streicher war schweißig im Gesicht und an den Händen, aber das war schon seit Beginn des Verhörs so, er wirkte nicht, als hätte ihn diese Frage sonderlich erschüttert.
Warum bohrte der Offizier nicht nach? Wie konnte er Streicher das durchgehen lassen?
Zu den Reichsparteitagen hatte Julius Streicher damals »Sondernummern« herausgegeben mit einer Auflage von zwei Millionen. Er hatte jüdische Geschäftsleute mit der Drohung erpresst, er werde eine »größere Sache« über sie veröffentlichen. Natürlich wusste er von den Konzentrationslagern.
Nach dem Verhör, als man Streicher fortgebracht hatte, fragte sie den Geheimdienstoffizier: »Er lügt Ihnen ins Gesicht. Wieso springen Sie nicht härter mit ihm um?«
Er gab die knappe Antwort: »Noch ist ihm nicht der Prozess gemacht worden.«
An dieser Antwort kaute sie lange herum.
Kaum war der Offizier fort, redete ihr der Jurist ins Gewissen. Sie solle nie wieder einen Verhörspezialisten kritisieren. Sie seien hier als Dolmetscher, ein Dolmetscher sei unsichtbar, er nehme keinen Einfluss auf den Inhalt des Verhörs. »Sie führen ihre Verhöre entlang von Fragebögen«, erklärte er, »und die werden ihnen vom Alliierten-Hauptquartier übermittelt. Es geht nicht um die Schuldfrage.«
Worum ging es dann?
Erst hatte Streicher den Lesern Angst vor den Juden gemacht, dann diese Angst geschickt in Hass verwandelt. Genauso hatte man in den Südstaaten der USA Propaganda gegen Schwarze gemacht – und es wirkte.
Er zeigte keine Reue, keine Einsicht. Und sie sollte zu seinen Lügen schweigen. Aber nicht mehr lange, dachte sie. Sie musste sich konzentrieren. Es folgten zwei weitere Verhöre, die sie zu protokollieren hatte.
Wilhelm Keitel sprach man respektvoll als Generalfeldmarschall an, und Karl Dönitz nannte man Reichsminister und Großadmiral. Beide gaben sich keineswegs, als hätten sie sich etwas zuschulden kommen lassen. Sie saßen da in ihrer Uniform und beschwerten sich über die Unterbringung und die Verpflegung und drohten, Briefe an Eisenhower, an Premierminister Winston Churchill und Präsident Harry S. Truman zu schreiben. »Man behandelt mich wie einen Verbrecher«, echauffierte sich Dönitz. »Das werde ich nicht vergessen. Vielleicht wird die Geschichte einmal anders darüber denken.«
Asta begriff bald die Stoßrichtung der Fragen. Man wollte den Aufbau der Ministerien und Organisationen verstehen, die Finanzierung des Krieges. Man wollte den Stand des deutschen Nuklearprogramms ergründen, fragte nach dem Einsatz von Fremdarbeitern und dem Kunstraub in den besetzten Gebieten.
Ging es um die Konzentrationslager und die Ermordung der Juden oder überhaupt um die vielen Toten im Krieg, redeten die Generäle und Armeeführer nie von sich selbst. Sie blieben im Allgemeinen, sie ließen alle Schuld von sich abgleiten. Sie sagten: »es wurde befohlen«, »die Pläne wurden aufgestellt«, »man« tat etwas.
Auch die Zerstörung in Deutschland und das Leid, das sie über ihr eigenes Volk gebracht hatten, kamen in den Gesprächen nicht vor. Die Männer, die das Land geführt hatten, scherten sich nicht darum.
Manchmal arbeiteten sie sich an Hitler ab, das war bequem, denn Hitler war tot. An ihm konnten sie sich die blutigen Hände abwischen. Sie seien eigentlich schon immer gegen ihn gewesen, sagten sie. Sie hätten ihre Schwierigkeiten mit ihm gehabt.
Fassungslos schrieb Asta in die Protokolle, dass sich die führenden Nazis als Opfer des Nationalsozialismus empfanden. Das konnte nicht die deutsche Elite gewesen sein! Sie wirkten kleinbürgerlich, wenn sie von ihren Leistungen sprachen, davon, wie sie es im Grunde gut gemacht hätten, wenn bloß die Umstände nicht gewesen wären.
Am späten Nachmittag kehrte Colonel Andrus zurück. Es dauerte keine Stunde, und sie wurde in sein Büro befohlen.
Er erwartete sie im Stehen, kerzengerade, blass vor Wut. »Ich hatte gesagt, halten Sie sich von den Häftlingen fern. Wir sind hier beim Militär, nicht im Büro irgendeiner Airline, wo man sich Eigenmächtigkeiten erlaubt!«
Eigentlich hatte sie vorbringen wollen, dass sie beim Frühstück mit den Dolmetschern zusammengesessen und es sie dann einfach hingerissen habe, dass sie nicht habe widerstehen können, und sie werde ja auch gebraucht. Aber sie sah, dass er kurz davor war, zu explodieren, und entschied, dass es besser war, den Mund zu halten.
»Wenn Sie Soldatin wären, hätte Ihr Ungehorsam ernsthafte Folgen für Sie. Ist Ihnen das klar?«
»Ja, das ist mir klar«, sagte sie.
Jetzt setzte er sich doch. Ihr erschien es, als verstrichen zwanzig Minuten, auch wenn es wohl nur zwei waren. Sein Schweigen, während er in den Papieren blätterte, war unerträglich. Schließlich sagte er: »Ihre Protokolle sind gut. Sehr gut sogar. Aber ich kann Sie nicht bleiben lassen. Nicht nach diesem Alleingang.«
»Das heißt, Sie werfen mich raus?«
»Sie lassen mir keine Wahl.«
Eine kleine Eigenmächtigkeit, und er streifte sie von der Schulter wie eine Laus. Als wäre sein Laden hier makellos, als würden ihm keine Fehler unterlaufen. »Die Maschine schnurrt, da soll eine Querulantin nicht stören, hm?«
Er blickte sie scharf an. »Was erlauben Sie sich!«
»Schicken Sie mich weg, meinetwegen. Aber die haben Menschen umgebracht, Menschen, die ihre Kinder geliebt haben, die Talent hatten, Menschen mit Weltanschauungen und Träumen und Güte in sich, die haben sie ausgelöscht, ihnen den Hals durchgeschnitten, sie vergast, sie zu Tode geknüppelt und anschließend in Asche verwandelt – und Sie lassen es ihnen durchgehen. Ihre Verhöre sind ein Hohn. Wenn Sie so weitermachen, kriegen Sie keinen einzigen von denen. Die halten Sie zum Narren, merken Sie das nicht?«
»Ach, und Sie wüssten, wie es besser geht, ja?«
»Allerdings.«
Er schob das Papier zur Seite und faltete die Hände. »Dann haben Sie vielleicht die Freundlichkeit, mich zu erhellen.« Seine Mundwinkel zuckten in Vorfreude auf ihre Blamage.
Der Zorn ließ es in ihrem Kopf rauschen, das Denken fiel ihr schwer. Er hatte zugestanden, dass sie gut war. Dass er sie gebrauchen konnte. Und trotzdem schickte er sie weg, allein aus dem Grund, dass sie nicht aufs Wort gefolgt hatte wie ein Hund.
Sie hatte Details zum deutschen Nuklearprogramm gehört, die sie dem NKWD überbringen konnte, aber in ihrer eigenen Sache war sie kaum vorangekommen. Sie war hier noch längst nicht fertig. »Erstens«, sagte sie, »die Häftlinge sprechen sich ab. Wieso lassen Sie die Gefangenen zusammen essen und im Garten spazieren gehen? Sie schmieden Strategien und gleichen ihre Aussagen aneinander an.«
»Über unsere psychologische Vorgehensweise muss ich mich Ihnen gegenüber nicht rechtfertigen.«
Dachte er wenigstens darüber nach? Sie versuchte es in seinem Blick zu lesen, wurde aber nicht schlau daraus. »Zweitens: Die Häftlinge werden verhätschelt.«
Der Colonel schnaubte. »Jetzt kommt diese Chose. Aus den Zimmern der Gefangenen hat man alles Mobiliar entfernt. Wir haben nur Feldbetten und Spinde reingestellt. Sie schlafen ohne Kopfkissen und haben ausschließlich kaltes Wasser. Und das Essen –«
»Diese Männer stolzieren in einen Speisesaal, als wären sie Hotelgäste! Ich bin sicher, sie fühlen sich auch so.«
»Vielleicht ist das ja Absicht? Haben Sie daran mal gedacht?«
»Drittens: Die Häftlinge lügen im Verhör. Es wird nicht nachgehakt. Wenn Sie denen auf die Schliche kommen wollen, brauchen Sie Fakten, Sie brauchen Dokumente, Sie müssen die Scheißkerle ins Kreuzverhör nehmen.«
»Sind Sie fertig?«
Sie hatte jedes Wort so gemeint, wie sie es gesagt hatte. »Wenn es hier nicht darum geht, den Naziführern den Prozess zu machen, dann weiß ich nicht, wo es überhaupt noch Gerechtigkeit geben soll auf der Welt. Und Sie haben völlig recht, dann bin ich am falschen Ort.«
3
Zwei Pärchen hatten sich am Fluss, der durch Mondorf führte, Boote ausgeliehen. Die Männer ruderten, die Frauen sonnten sich. Kurgäste flanierten durch den Park. An der Quelle reichte man einem gut frisierten Mann einen Becher Heilwasser. Niemand wusste, dass er Russe war, bis auf Asta, die hinter ihm anstand. Auch ihr wurde ein Becher mit Heilwasser gereicht. Beide tranken, das Wasser von Mondorf-les-Bains sollte bei gastrischen Störungen helfen, ein Becher jeden Morgen, das empfahlen die Ärzte.
Sie gingen einige Schritte und wechselten belanglose Worte über das Wetter. Falls sie von den Umstehenden jemand beobachtete, musste er glauben, dass sich eine Urlaubsromanze anbahnte. Es gab eine Klinik und ein Dutzend Hotels und Gasthöfe im Ort, da kam es häufiger vor, dass sich Kurgäste kennenlernten und verliebten.
Niemand hätte angesichts dieser freundlichen jungen Gesichter geahnt, was sie sprachen, sobald sie außer Hörweite waren.
Semjon Kortschagin, der fast einen Kopf kleiner war als Asta, sagte: »Das sind brauchbare Ergebnisse, die Sie da liefern. Besonders die Angaben zum deutschen Nuklearprogramm sind nützlich.«
»Hätten Sie mich nicht gedrängt, wäre ich den Job jetzt nicht los.« Asta sprach leise und schnell. »Es war falsch, so schnell Ergebnisse zu erwarten. Ich hätte mich länger bei Colonel Andrus einschmeicheln müssen.«
»Im Moment finden die entscheidenden Verhandlungen über einen Prozess statt. Wir müssen wissen, was die Amerikaner im Köcher haben.«
»Ist das so wichtig? Ich sollte doch Fuß fassen als Dolmetscherin.«
»Zerbrechen Sie sich nicht unseren Kopf.« Hinter Semjons Brillengläsern, dick wie Flaschenböden, wirkten die Augen winzig. »Davon abgesehen glaube ich nicht, dass er Sie so einfach gehen lässt. Warten Sie ab. Sie sind wertvoll für ihn.«
Hatte der Russe Informationen, von denen sie nichts ahnte? Sie wurde aus ihm nicht schlau. Aber so musste man wohl sein, wenn man als Führungsagent arbeitete. Undurchschaubar und überlegen.
In Amerika hatte Semjon sie davon zu überzeugen versucht, dass sie nicht länger eine ungerechte Gesellschaftsordnung unterstützen könne. Jetzt fragte sie sich manchmal, ob es nicht klüger gewesen wäre, sich das neue Leben in der Sowjetunion erst einmal anzusehen. Semjon Kortschagin hielt sie an der kurzen Leine. Nach Freiheit fühlte sich das nicht an.
Fest stand, er gab die Sache nicht verloren. »Danke«, sagte sie, »spasiba.« Das einzige russische Wort, das sie beherrschte.
Seine Kiefernmuskeln spielten. »Kein Russisch. Nicht hier. Verstanden?«
Der Junge saß auf einem kleinen Hügel. Er beobachtete das Krähennest im Baum und wünschte sich, die Krähe zu sein. Er breitete seine Arme aus, schloss die Augen und stellte sich vor, den Wind im Gefieder zu spüren. Die Krähe zeigte ihm, wie das Fliegen ging. Er träumte davon, fortzufliegen und seinen Vater zu suchen, er würde von Lager zu Lager fliegen, bis er ihn gefunden hatte. Dann würde er ihn hochheben und mit ein paar Flügelschlägen über den Zaun in die Freiheit tragen. Er würde ihm den Weg nach Hause zeigen.
Vaters Foto stand zu Hause auf der provisorischen Kommode. Dank dem Bild wusste er, wie Vater aussah. Mutter räumte es nicht weg, auch wenn sie längst mit Horst zusammenlebte. Das Foto wegzunehmen wagte sie nicht, weil es sonst gewirkt hätte, als wünschte sie sich, dass Vater tot wäre. Robert schaute sich das Foto jeden Tag an. Er glaubte fest daran, dass Vater lebte.
Die Krähe spähte vom Baum herunter. Krah!
»Ich bin’s nur«, sagte er.
Er grub in seiner Hosentasche und holte die rote Glasscherbe heraus, die er nahe der Elisabethkirche gefunden hatte. Sie war rund geschmolzen und blinkte wunderbar im Sonnenlicht. Er legte sie auf einen Stein.
Schon flatterte die Krähe vom Baum und hüpfte neugierig näher. Sie beäugte die Scherbe, stieß sie mit dem Schnabel an. Krähen waren neugierig wie die Elstern und an kleinen Schätzen immer interessiert.
»Die schenk ich dir«, sagte er.
Die Krähe schnappte sich die Scherbe mit dem Schnabel und flatterte hinauf in den Baum.
Vielleicht würde sie die rote Scherbe von Zeit zu Zeit betrachten. Dachte sie dann an ihn?
Wenn nur nicht sein Magen so knurren würde. Robert stand auf. Er wusste, wo Löwenzahn wuchs. Vor dem Krieg waren das schöne Blumen auf der Wiese gewesen. Jetzt war jeder froh, wenn er Löwenzahn fand. Hier draußen wusste er noch gute Stellen. Er kauerte sich hin und grub die erste Pflanze aus. Die Blätter würde die Mutter als Salat zubereiten, die Wurzeln konnte sie mit heißem Wasser aufbrühen und Tee davon machen. Oder sie schnitt sie klein, trocknete und röstete sie, um Kaffee daraus zu kochen. Als er fünf Pflanzen hatte, ging er hinüber zu den Büschen.
In ihrem Schatten standen einige Brennnesseln. Immer von unten greifen. Er pflückte sie vorsichtig. Trotzdem verbrannte er sich ein bisschen. Die Brennhaare wachsen nur oben an den Blättern, hieß es. Von wegen! Es stach. Dann juckte es.
Er machte sich auf den Heimweg.
Die Brennnesseln würde Mutter für Spinat oder für eine Suppe verwenden. Vielleicht gab sie die Brennnesseln auch zum Salat dazu, dann musste sie die Blätter erst in warmes Wasser legen und danach in einem Tuch auswringen, sonst tat es weh beim Essen. Das hatte er letzte Woche beobachtet und sehr spannend gefunden. Dass das Auswringen genügte, damit die Brennhaare essbar wurden, hätte er nicht gedacht. Er hatte die ersten Blätter so vorsichtig gegessen, dass Mutter ihn auslachte.
Je weiter er in die Stadt hineinlief, desto deutlicher wurde der Verwesungsgeruch. Seit das Juniwetter so warm geworden war, wurde es schlimmer.
Eigentlich war die Stadt still. Es gab keinen Verkehrslärm mehr. Hier aber stand eine Menschenschlange vor einer Bretterbude an. Ein ausgebombter Ladenbesitzer hatte sie neben seinem zerstörten Geschäft errichtet und verkaufte Brot. Wie gern hätte Robert sich ebenfalls angestellt. Aber selbst mit Geld hätte er kein Brot bekommen, Mutter hatte die Brotkarten schon aufgebraucht für diese Woche. Neben der Bretterbude bot jemand Kleidung an und Töpfe und Pfannen. Gebraucht natürlich. Bestimmt hatte er sie aus den Luftschutzkellern geborgen. Oder er schickte seine Kinder los, und die suchten jeden Tag nach Beute in den Ruinen.
In einer alten Margarinekiste, an der man Räder befestigt hatte, saß ein Invalide. Männer mit nur einem Arm hatte Robert oft gesehen in letzter Zeit, auch welche auf Krücken. Aber dieser hatte keine Beine mehr. Er stieß sich mit den Armen ab wie ein Flößer und lenkte sein trauriges Verkehrsmittel durch die Trümmerlandschaft.
Robert blieb stehen.
Der Invalide hielt ebenfalls an. »Was glotzt du so?« Sein Gesicht glich dem eines Äffchens.
Robert reichte ihm den Löwenzahn. »Wollen Sie? Daraus kann man Salat machen.«
Der Invalide starrte verblüfft auf die Pflanzen. »Ich kann dir nichts dafür geben.«
»Ist ein Geschenk.«
Immer noch musterte der Mann verwundert das grüne Büschel. Schließlich nahm er es. »Danke. Bist ein guter Junge.«
Robert bemerkte, dass die Hände des Invaliden verschrammt und krustig waren. »Sind Sie von weit her gekommen?«
»Aus der Hölle, Junge. Der Hölle.« Er legte den Löwenzahn behutsam vor sich in die Margarinekiste, dann rollte er weiter.
Burton Andrus hielt nichts von Geheimdienstleuten. Sie fanden immer Gründe, die Regeln zu verbiegen oder nur zum Schein einzuhalten. Eine Regel war eine Regel. So funktionierte die Welt. Eine Regel galt für alle, sonst endete es im Chaos.
Hier in Mondorf war er für die Regeln zuständig. Die Geheimdienstleute nannten das Hotel das »6824 Detailed Interrogation Center«, das sprach schon Bände. Für sie war es ein Verhörzentrum, eine Anstalt mit der Aufgabe, den Häftlingen Informationen zu entlocken, ob nun im klassischen Verhör oder mit versteckten Mikrofonen.
Dabei lautete die offizielle Bezeichnung »Kriegsgefangenenlager Nr. 32«. Auch wenn die Gefangenen auf den Müllhaufen der Geschichte gehörten – deshalb nannte er selbst sein Gefängnis insgeheim »Camp Ashcan« –, waren sie entsprechend der Regeln und Befehle zu behandeln.
Rasierklingen hatte er gleich am ersten Tag verboten, ebenso Krawatten. Als Besteck gab es nur Löffel. Die Glasfenster hatte er durch vergittertes Plexiglas ersetzen lassen, um zu verhindern, dass die Häftlinge in den Besitz scharfkantiger Scherben gelangten. Hans Frank, einer von ihnen, hatte bei seiner Festnahme ein Fenster eingedroschen und sich mit einer Scherbe in die Kehle geschnitten, um dem, was da folgen würde, zu entgehen. Man hatte ihn wieder zusammengeflickt. So etwas durfte nicht wieder vorkommen. Also hatte er befohlen, den Naziführern Schuhbänder und Gürtel abzunehmen, und ihre Brillen durften sie nur im Leseraum unter Aufsicht tragen.
Er ließ sie regelmäßig medizinisch untersuchen, verschaffte ihnen sogar Süßigkeiten, um sie bei Laune zu halten. Trotzdem beklagten sie sich über das Essen, diese Waschlappen.
Tja, und nun musste er sie täglich den Geheimdienstlern zum Fraß vorwerfen.
Die Sache mit dem »deutschen« Haus, dem neuen Geheimprojekt in Dalheim, sechs Kilometer von Mondorf entfernt, wurmte ihn. Er hätte da nicht mitmachen sollen, so etwas gehörte sich nicht.
Er prüfte den Sitz des Stahlhelms, korrigierte ihn, klemmte sich die Reitpeitsche unter den Arm und klopfte.
Major Rhodes bat ihn herein.
Andrus setzte sich gar nicht erst. »Ich möchte, dass Sie sie weiter beschäftigen.«
»Dazu ist es zu spät.«
»Sie kennen doch die Tricks. Eine andere Frisur, eine Brille. So etwas wirkt Wunder.«
»Sie hat sich in mehrere Verhöre eingeschlichen und Protokoll geführt. Die Gefangenen haben sie von Nahem gesehen. Da helfen keine ›Tricks‹. Sie kommt für Dalheim nicht mehr infrage.«
»Ich weiß, sie sollte unsichtbar bleiben. Ich habe ihr gesagt, sie soll ihr Zimmer nicht verlassen. Hätten wir sie nicht gleich einweihen können? Dann wäre sie vorsichtiger gewesen.«
Eine Zornesfalte entstand zwischen Rhodes’ Augen. »Sie hätte unseren Plan durchstechen können. Von Geheimhaltung verstehen Sie nichts, Andrus. Wir mussten erst ihre Herkunft prüfen.«
Er überlegte, Rhodes hinzuknallen, dass er ein halbes Jahr lang eine Sicherheitsabteilung der Armee geleitet hatte. Selbstverständlich war ihm klar, was Geheimhaltung bedeutete und warum sie wichtig war. Aber er wusste auch, was Menschenführung bedeutete und dass man seinen Mannschaften klare Anweisungen geben musste, sonst lief der Laden nicht.
Er las es in Rhodes’ Gesicht: Jetzt würde eine Belehrung folgen. Warum nur hatte er ständig das Gefühl, dass Rhodes sich für überlegen hielt? Er war bloß ein gewöhnlicher Major! Aber er hatte die hässliche Eigenart, sich aufzuführen wie ein Vater, der zu einem dummen Jungen redete. Das war oft das Problem mit den Geheimdienstlern. Sie fühlten sich allwissend.
Rhodes leitete die Verhörtruppe und hielt Kontakt zum MIS. Aber er, Andrus, war der Gefängniskommandant. Wenn hier einer der Häftlinge entkam, wer war dann verantwortlich? Wenn es von außen einen Angriff auf das Hotel gab, wenn alte Seilschaften versuchten, ihre Führer zu befreien, wer hatte die Verteidigung zu befehligen?
Rhodes lächelte. »Sie sind von der Kavallerie, deshalb sehe ich es Ihnen nach. Wir haben hier ein besonderes Kaliber, diese Jungs sind nicht mit Offenheit zu gewinnen. Wir müssen klug vorgehen.«
»Sie merken ja, dass das Vorgehen kaum klug war.«
»Es gibt aber nicht nur dieses Hotel, es gibt auch eine Welt da draußen. Während Sie nur kümmert, ob es hier drin gut läuft, habe ich die Außenwelt im Blick zu halten. Und da ist die Stimmung nicht besonders gut, was uns angeht. Die Russen mokieren sich über unseren Umgang mit den Naziführern, die Amerikaner wollen kein PR-Desaster, und wenn unser kleines schmutziges Geheimnis in Dalheim ans Licht kommt, können wir einpacken.«
»Das ›deutsche‹ Haus war Ihre Idee.«
»Spielt keine Rolle. Wenn wir untergehen, dann gemeinsam.«
Sie maßen sich mit Blicken. Noch nie war Andrus ein derart aufmüpfiger Offizier begegnet. Einen Machtkampf mit Rhodes konnte er zügig zu seinen Gunsten beenden, da war er sicher. Allerdings konnte er solche Verwerfungen momentan nicht gebrauchen. Sie würden nur Aufmerksamkeit auf das Lager lenken, in Kreisen, die sowieso schon unzufrieden mit ihm waren. »Darüber wird zu sprechen sein. Vorerst geht hier niemand unter.«
Er wollte Asta behalten, sie war jung und klug und versprühte einen Idealismus, der rar geworden war nach zwei Weltkriegen. Jetzt, wo Rhodes sie abservieren wollte, lag ihm noch mehr an ihr. Das Problem war nur, dass er sie nirgendwo mehr einsetzen konnte. Sie war hochgefährlich. Er durfte sie kein weiteres Porzellan zerschlagen lassen.
Asta nahm ihre Sachen aus dem Schrank und legte sie in den Koffer. Sie faltete das blaue Kleid neu zusammen. Ihre Bewegungen waren ruckhaft und energisch. Sie legte die Strümpfe ans obere Ende des Koffers. Ein Paar ließ sie draußen, für morgen früh.
Mutter schuftete jeden Tag an der Dampfpresse; sie hasste ihren Job in der Leinenherstellung, aber sie erledigte ihn, ohne zu klagen. Sie forderte das Leben nicht heraus. Mutter hatte immer akzeptiert, was ihr das Leben vorgesetzt hatte, und sich damit zufriedengegeben.
Vor der Abreise hatten sie gestritten. Wenn du so weitermachst, hatte Mutter zu ihr gesagt, bist du irgendwann eine gescheiterte Existenz. Immer mehr, immer besser – das geht nicht. Man muss auch mal irgendwo ankommen. Deine überzogenen Vorstellungen führen zu nichts.
Damit hatte sie die Trennung von Denny gemeint.
Andere hatten sehr wohl das Recht und die Aufgabe, etwas zu bewirken auf der Welt. Ihr hingegen wollte man es nicht zugestehen.
Sie nahm die Blusen aus dem Schrank und ließ sie in den Koffer fallen. Schleuderte die Unterhosen hinterdrein.
Der Russe hatte sich geirrt. Der Rauswurf blieb in Kraft. Sie war gescheitert.
Bei ihrer Abreise hatten die Schwestern geheult, Johanna hatte gefleht: »Geh nicht, bitte.« Sie hatte Asta umarmt, sich regelrecht an sie geklammert.
»Wir sehen uns doch wieder, Hansi«, hatte Asta gesagt. Und doch hatte sie schlucken müssen, weil sie so gerührt war von der Liebe ihrer Schwestern. Für Friedi und Hansi würde sie alles tun. Manchmal glaubte sie, die Zwillinge hatten als Einzige bemerkt, dass Asta sich geändert hatte. Dass sie eine gewagte Entscheidung getroffen hatte, um Gerechtigkeit zu schaffen.
Mutter wusste bis heute nicht, weshalb Asta hier war. Sie glaubte, es gehe um eine Karriere als Dolmetscherin. Und wenn sie es wüsste?, dachte Asta. Sie würde sagen: Gegen solche Männer kommst du nicht an.
Lieber brachte sie den Atlantik zwischen sich und Hermann Göring und schwieg und buckelte und nahm hin. Aber Asta glaubte nicht länger, dass man machtlos war als Einzelne.
Sie war Göring so nahe. Nur ein paar Schritte und wenige Türen trennten sie voneinander.
Mit bebenden Fingern riss sie eine Schachtel Zigaretten auf. Sie musste das Feuerzeug viermal zünden, so sehr zitterte sie. Endlich brannte die Zigarette. Sie sog daran. Der Rauch füllte ihre Lungen.
»Du windest dich nicht raus, das verspreche ich dir«, sagte sie halblaut in den Raum hinein. Noch einmal würde sie ihn nicht verlieren. Beim nächsten Anlauf blieb sie an ihm dran.
Sie klopfte nachdenklich mit den Fingern auf die Schachtel. Rauchte die Zigarette zu Ende. Dann stand sie auf.
Das Kriegsgefangenenlager befand sich, von einigen Baumreihen verborgen, hinter dem Hotel. Asta näherte sich dem Stacheldrahttor.
Sie wurde durch Militärpolizisten aufgehalten. »Sie können hier nicht lang, Miss.«
Sie seufzte. »Ich könnte Sie jetzt belügen und behaupten, Colonel Andrus hätte mich geschickt. Aber die Wahrheit ist, er hat mich gerade gefeuert, und ich werde abreisen. Ich wollte mich vorher bei einem der Kriegsgefangenen bedanken, der mir geholfen hat.«
»No fraternizing between US troops and the Germans.« Er hatte auch davor Englisch gesprochen, aber diesen Satz sagte er besonders breit und nachdrücklich, als wäre auch die Sprache eine Barriere, die nicht zu übertreten war.
Hielt er sie für eine Amerikanerin? Hatte er keinen Akzent herausgehört bei ihr? Sie versuchte, ihr Englisch noch geschmeidiger zu machen. »Erstens gehöre ich nicht zur Armee.« So, und jetzt die Bombe zünden. »Und zweitens bin ich Deutsche.«
Er riss die Augen auf.
Tatsächlich! Er hatte es nicht herausgehört. Sie sagte: »Deutsche dürfen mit Deutschen fraternisieren, oder?« Werd nicht kratzbürstig, ermahnte sie sich. So erreichst du nichts. Sie lächelte warm. »Ich will mich doch nur bedanken.«
»Sie dürfen das Kriegsgefangenenlager nicht betreten. Tut mir leid, das sind die Vorschriften.«
Ein dritter MP