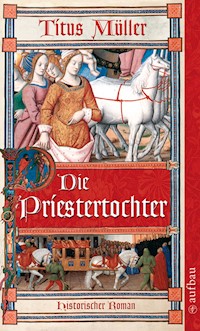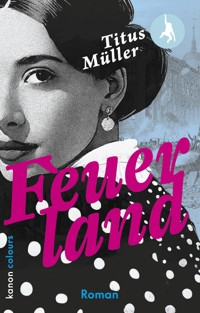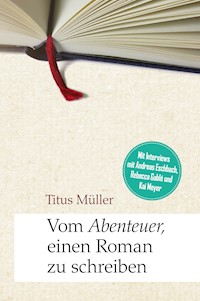10,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Heyne Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Die Spionin-Reihe
- Sprache: Deutsch
Wer fliehen will, kann niemandem trauen. Nicht mal der eigenen Familie.
Zwölf Jahre nach dem Mauerbau führt Ria Nachtmann ein weitgehend angepasstes Leben in Ostberlin. Niemand würde vermuten, dass sie einst als Spionin für den Bundesnachrichtendienst aktiv war. Nur eines hat die Jahre überdauert: ihre Liebe zu Jens, einem westdeutschen Journalisten. Doch Verbindungen mit dem Klassenfeind sind streng verboten. Als Ria ein geheimes Treffen arrangiert, wird sie bereits beobachtet. Ein gefährliches Katz-und-Maus-Spiel beginnt ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 482
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Das Buch
Frühjahr 1973: Ostberlin bereitet sich auf die Ausrichtung der Weltfestspiele der Jugend vor. Neun Tage lang soll die Stadt zu einer gigantischen Festivalmeile werden. Zehntausende Besucher aus aller Welt werden erwartet. Die DDR präsentiert sich als weltoffen und bunt.
Doch ihre Bürgerinnen und Bürger sind Gefangene im eigenen Land. An der Grenze zur Bundesrepublik hindern Sperranlagen die Menschen daran, in den Westen zu gelangen. Als der Grenzsoldat Henning Nowak zu fliehen versucht, gerät auch seine Schwägerin Ria Nachtmann ins Visier der Staatssicherheit. Sie steht unter Verdacht, Henning geholfen zu haben.
Was die Stasi nicht ahnt: Tatsächlich war Ria vor Jahren als Spionin für den westdeutschen Bundesnachrichtendienst tätig. Noch immer verfügt sie über erstaunliche Fähigkeiten. Und sie hat sich geschworen, ihre Familie um jeden Preis zu verteidigen.
Der Autor
Titus Müller, geboren 1977 in Leipzig, schreibt Romane und Sachbücher. Er ist Mitglied des PEN-Clubs und wurde u. a. mit dem C.-S.-Lewis-Preis, dem Sir-Walter-Scott-Preis und dem Homer-Preis ausgezeichnet. Seine große Spionin-Trilogie erzählt die Geschichte einer mutigen Frau – und drei Jahrzehnte deutsch-deutscher Geschichte.
www.titusmueller.de
Lieferbare Titel
Der Kalligraph des Bischofs
Die Brillenmacherin
Die Todgeweihte
Die Jesuitin von Lissabon
Nachtauge
Berlin Feuerland
Der Tag X
Die goldenen Jahre des Franz Tausend
Die fremde Spionin
TITUS MÜLLER
DASZWEITE
GEHEIMNIS
Roman
WILHELMHEYNEVERLAG
MÜNCHEN
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Der Verlag behält sich die Verwertung der urheberrechtlich geschützten Inhalte dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44 b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.
Gedicht aus Wolf Biermann: Mensch Gott! (Suhrkamp, 2021) mit freundlicher Genehmigung von Wolf Biermann
Originalausgabe 05/2022
Copyright © 2022 by Titus Müller
Copyright © 2022 dieser Ausgabe by Wilhelm Heyne Verlag,
in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Straße 28, 81673 München
Redaktion: Gunnar Cynybulk
Covergestaltung: Favoritbüro, München, unter Verwendung von Motiven von Vintage Germany,
Bridgeman Images (Everett Collection, CSU Archives), Shutterstock.com (Vidal25)
Satz: KCFG – Medienagentur, Neuss
ISBN 978-3-641-27067-4V004
www.heyne.de
1
Die Grenze nahe Großtöpfer, Kreis Heiligenstadt. Henning Nowak lag im nassen Gras und fror. Er hörte dem Gesang der Vögel zu, entdeckte seltene Vogelstimmen, einen Girlitz, einen Sprosser, einen Trauerschnäpper. Aus dem benachbarten Wald trotteten Wildschweine.
Nur wenige Schritte entfernt begann der Westen. Zwei Stacheldrahtzäune davor, ein paar Meter verbotenes Land. Neben ihm lag der Postenführer im Gras. Henning wusste über ihn, dass er die Zusage für einen Studienplatz erhalten hatte – Schiffsmaschinenbau in Rostock –, frisch verheiratet war und seine 18 Monate Dienstzeit fast vollständig abgeleistet hatte. Vom Maßband für die letzten 150 Tage, von dem er jeden Tag einen Zentimeter abschnitt, war nur noch ein kleiner Rest geblieben. Er würde bald nach Hause gehen und studieren und mit seiner jungen Frau leben. Er wollte keinen Ärger.
Der Postenführer stand auf und streckte sich. Er verlangte, dass Henning vor ihm lief. Sie gingen los. Als Henning sich umsah, winkte ihm der Postenführer mit der Maschinenpistole, er solle weitergehen.
Argwohn zwischen gemeinsam vergatterten Grenzsoldaten war normal, es gehörte zur üblichen Methode, die Soldaten jeden Tag in anderer Kombination loszuschicken. Bekam der Spieß mit, dass zwischen zweien von ihnen mehr als eine lockere Bekanntschaft zu entstehen drohte, wurden sie nie wieder gemeinsam eingeteilt.
Er kannte die Regeln. Er selbst war ja Spieß gewesen.
Sie liefen in Richtung der Straße nach Bebendorf, um einen neuen Beobachtungspunkt zu beziehen. Die kalte Morgenluft kroch durch die Uniform. Sechs Uhr erst, verdammt. Er hätte nicht auf die Uhr sehen sollen. Es war immer ein Fehler, auf die Uhr zu sehen. Hatte man einmal damit angefangen, guckte man dauernd, und dann verging die Zeit gar nicht mehr. Am besten war es, einfach darauf zu warten, dass der Himmel heller wurde und die Zeit zum Einrücken kam. Das waren die besten Nächte, wenn man es schaffte, vorher nicht auf die Uhr zu sehen.
Sie mussten unter der stillgelegten Bahnstrecke von Geismar nach Friede hindurch, der Postenführer ließ ihn vorgehen in den kleinen Tunnel, ließ eine Gewehrlänge Abstand zwischen ihnen, ihre Schritte knirschten, die Tunnelwände warfen den Hall zurück, dann kamen sie auf der anderen Seite wieder hinaus. Es ging einen schmalen unbefestigten Weg hoch, zur linken Seite dichter Wald, zur rechten der sechs Meter breite Kontrollstreifen und die Zäune aus Stacheldraht, dahinter das Gebiet der Bundesrepublik. Zwischen den Zäunen waren Minen vergraben, aber nicht überall. Allmählich kam er dahinter, wo vermintes Gelände war und wo nicht.
Henning wusste, was über ihn geredet wurde. Er sollte was mit der Frau seines Kompanieführers gehabt haben. Oder er hatte gesoffen. Um vom Rang eines Hauptfeldwebels zum einfachen Soldaten degradiert zu werden, musste man sich einiges geleistet haben. Manche sagten, dass er das Ansehen der Grenztruppen geschädigt haben musste, Befehle nicht ausgeführt oder die Dienstpflichten vernachlässigt hatte. Dann wieder hieß es, er habe sicher gegen die Parteidisziplin verstoßen, grobe ideologische Verfehlungen, und sei anschließend aus der Partei geworfen worden. Wo er stationiert gewesen war, wussten sie nur gerüchtehalber. Und was er getan hatte, ging nur ihn selbst etwas an.
Er begutachtete wortlos den Kontrollstreifen, sechs Meter glatt geharkte Erde, eine kilometerlange Wunde im Boden. Ein Grenzverletzer musste hier seinen Fußabdruck hinterlassen, wenn er keine Flügel besaß, anders gelangte man nicht zum Stacheldrahtzaun.
Dort vorn die Spur eines Hasen. Der Postenführer sagte: »Nimm dir einen Ast, Henning, und mach das weg.«
Henning holte einen Ast aus dem Wald und verwischte die Hasenspur.
Der Postenführer rauchte.
Henning schwieg.
»Weiter«, sagte der Postenführer, schnippte seine weggerauchte Kippe auf den Wachpfad und trat sie aus. Er winkte Henning mit der Maschinenpistole.
»Gefällt mir nicht, wie du mit der Waffe wedelst«, sagte Henning.
»Hat dich keiner gefragt«, sagte der Postenführer.
Diese Jungspunde hatten keine Vorstellung davon, was man alles falsch machen konnte, wenn man mit der Maschinenpistole hantierte, dreißig Schuss scharfe Munition, er wusste, was die Kugeln anrichten konnten. Und er wusste, was die Minen taten, träumte immer noch von dem jungen Flüchtling, den er hatte abtransportieren müssen, ohne Beine, ein blutender Rumpf mit schlaff herabhängenden Armen.
Sie näherten sich der Hundelaufanlage. Der Postenführer sagte etwas versöhnlicher: »Halt dich von den Hunden fern. Das sind tückische Biester.«
»Ich bin nicht zum ersten Mal an der Grenze.«
»Hab schon gehört. Warst ein großer Ansager, hm? Was mich betrifft, bist du Soldat und nichts weiter.«
Zwischen zwei Böcken im Abstand von achtzig Metern war mannshoch das Stahlseil gespannt. Daran hing, mit einem Ring verbunden, die Laufleine eines kaukasischen Schäferhunds. Er näherte sich rasch, der Ring pfiff über den Stahl.
»Zurück«, befahl der Postenführer, aber Henning tat das Gegenteil, er ging auf den Hund zu. Der Postenführer warnte: »Willst du dir die Kehle zerfetzen lassen?«
Henning kauerte sich hin, holte seine Brotbüchse heraus und entnahm ihr ein Schinkenbrot. Jetzt erreichte ihn der Hund.
»Wie oft füttert ihr die?«, fragte Henning, während der Hund ihm das Schinkenbrot aus der Hand schnappte und es verschlang. Sein Fell war struppig und verklebt.
»Das ist Sache der Hundeführer, da mische ich mich nicht ein.« Der Postenführer spuckte aus. »Ich geb dir einen Rat. Hör auf, so zu tun, als wärst du noch Unteroffizier. Du bist nicht auf Kontrollstreife hier, du bist ein billiger Achtziger, du hast nichts mehr zu melden. Wenn der Kuchen spricht, haben die Krümel zu schweigen. Gewöhn dich daran.«
»Sechsmal die Woche Trockenfutter«, fragte Henning, »und Montag nur Wasser, als Stehtag?«
Der Hund wirkte abgemagert, das messingfarbene Fell zitterte über den Rippen. Henning fuhr ihm über den Kopf und kraulte ihm die Ohren. Der Kaukasier wedelte mit dem Schwanz. »Willst du Boy heißen, mein Kleiner?«, fragte Henning leise. Die Laufleine, die den Hund mit dem Drahtseil verband, erregte sein Mitleid. Kein Wunder, dass die Hunde hier draußen unberechenbar und böse wurden. Sie waren einsam. Tag und Nacht im Wald, angekettet und allein. Das musste ihnen auf die Seele schlagen.
Der Wassernapf vor dem hölzernen Unterstand war umgestoßen. Henning ging hin und stellte ihn wieder auf. Wie lange soff das Tier schon dreckiges Regenwasser aus den Pfützen? Er goss aus seiner Thermoskanne Tee hinein. »Koste das mal, Boy, mein Guter.«
Der Hund trottete heran und schleckte. Er musste großen Durst haben. Der Arme gehörte genauso zu Gottes Schöpfung wie die Menschen.
Der Postenführer sagte scharf: »Schluss jetzt. Spiel woanders Tierheim. Wir müssen Meldung machen.«
Er steuerte den nächsten Mast des Grenzmeldenetzes an, zog den Hörer aus der Tasche, koppelte ihn ans Meldenetz und sagte: »Hier Paula Paula drei an der vierzehn, Otto Anton einer Gustav Viktor.« Er presste sich den runden, mit Gummi ummantelten Hörer ans Ohr und behielt Henning im Blick.
Ob er wusste, dass man Westradio hören konnte, wenn man nur einen Kontakt des Hörers in die Buchse steckte und den anderen mit den Fingern berührte? In seiner alten Kompanie hatten sie das Buchstabieralphabet nachlässiger genutzt und sagten im Klartext »Postenpaar« statt »Paula Paula« und »ohne Anzeichen einer Grenzverletzung« statt »Otto Anton einer Gustav Viktor«.
Offenbar gab die Einsatzleitung neue Befehle. Der Postenführer sagte: »Verstanden, bewegen uns Richtung Berta Samuel.« Nachdem er den Hörer abgezogen hatte, warf er Henning »Beobachtungsstand« hin, für den Fall, dass er die Codierung nicht verstand.
Sie liefen durch den Wald. Dann ging es den Schlossberg hoch, vierhundert Meter. Als sie den Beobachtungsstand erreichten, schwitzte der Postenführer kräftig. Wäre er noch Spieß, er hätte dem Kerl und der ganzen Kompanie einen Tausend-Meter-Lauf in voller Ausrüstung verordnet und anschließend fünfzehn Kilometer Eilmarsch, davon sechs Kilometer unter der Gasmaske. Soldaten hatten körperlich fit zu sein.
»Hier oben«, erklärte der Postenführer, um seine Atemlosigkeit zu kaschieren, »hat es früher eine Ritterburg gegeben, da drüben, die Ruine.«
Henning hörte nicht zu. Er öffnete die Metalltür des Beobachtungsstands und stieg die Leiter hoch. Oben öffnete er die hölzerne Luke zur Kanzel und kletterte hindurch. Der Blick weitete seine Brust.
Er sah zur Kaserne des Bundesgrenzschutzes hinüber.
Der Postenführer, der hinter ihm die Kanzel erklommen hatte, sagte: »Eschwege. Durchs Fernglas erkennst du sogar einen, der vor der Kaserne Wache schiebt.« Er hängte sich die Maschinenpistole um, schraubte seine Thermoskanne auf und trank einige Schluck Kaffee. Dann angelte er ein kaltes Würstchen aus seiner Brotdose und aß es.
Henning blickte angestrengt in die Morgendämmerung.
»Hast du Familie?«
Er will mich auf die Probe stellen, dachte Henning. »Zwei Kinder. Und eine Frau.« Wer Frau und Kinder hat, will nicht abhauen.
»Nett. Ich bin verlobt.« Der Postenführer kaute. »Sind sie sauer, dass du hierher versetzt wurdest?«
»Kann man wohl sagen.« Er sprach leise über die Brüstung des Beobachtungspostens in die kühle Luft hinein, als ginge es um ein anderes Leben, nicht um seines.
»Tja, ist hart, sich nur alle paar Wochen zu sehen. Wem sagst du das. Ich verbringe halbe Tage im Zug. Kaum bin ich bei meiner Verlobten angekommen, muss ich mich schon auf den Weg zurück zur Kaserne machen.«
Drüben in Hessen sah man eine kleine Fabrik. Seinen Recherchen nach hieß der Ort Wanfried. Beim Schichtwechsel hatte er Arbeiter aus dem Tor kommen sehen und sich vorgestellt, er wäre einer von denen und auf dem Heimweg von der Arbeit.
Ein schwarzer Schatten schwebte lautlos vorüber und verschwand zwischen den Baumwipfeln. Eine späte Fledermaus vielleicht. Die Grenze zwischen den zwei Machtblöcken scherte sie nicht. Wie eine Märchengestalt wechselte sie mit Leichtigkeit vom Osten in den Westen.
Der Postenführer konnte von der Stasi auf ihn angesetzt worden sein. Er hatte ihn zwar bisher nie das Dienstzimmer betreten sehen, das in der Kompanie von den Mitarbeitern der Staatssicherheit genutzt wurde. Aber was hieß das schon? Sie trugen dieselbe Uniform wie die Grenzer. Vielleicht hatte er sich einfach nur klug angestellt und gehörte doch zur Hauptabteilung 1 des MfS, die Grenzsoldaten kontrollierte, Telefongespräche abhörte, die Post überwachte. Oder er war inoffizieller Mitarbeiter. Die erledigten die Drecksarbeit, das Aushorchen und Verraten.
Henning erstarrte. »Hörst du das?«
Es klang nach dem Motorengeräusch eines Lkw, von hinten, freundwärts. Es wurde rasch lauter. Das Fahrzeug näherte sich mit halsbrecherischer Geschwindigkeit.
»Das muss die Alarmgruppe sein!« Der Postenführer öffnete die Klappe und stieg hastig die Leiter hinunter. Henning folgte ihm. Sie schlugen hinter sich die Tür zu und spurteten zum Grenzsignalzaun im benachbarten Waldstück, waagerechte Drähte, die von Schwachstrom durchflossen wurden und an eine zentrale Alarmanlage angeschlossen waren. Wurden zwei Drähte überbrückt, löste das Grenzalarm aus.
Ein Hubschrauber kam näher, die helle, leichte SA 318C Alouette des Bundesgrenzschutzes. Jetzt startete auch im Osten der Hubschrauber der Grenztruppen, das große Ungetüm, der sowjetische MI 8. Seine Rotorblätter zerteilten die Luft, Henning spürte das Dröhnen bis tief in seine Gehörgänge hinein.
Der MI 8 kam über den Wald heran und flog zum Feind an der Grenze. Die stählernen Raubvögel aus Ost und West beäugten sich. Dann zog die Alouette gen Norden ab. Der MI 8 folgte ihr. Sie wurden kleiner, bis sie von fliegenden Käfern nicht zu unterscheiden waren. Die Stille kehrte zurück und mit ihr das Vogelzwitschern.
Als sie ankamen, waren die Scheinwerfer des Lkw bereits auf den Zaun gerichtet, und sechs Grenzer standen im Kreis und sahen zu Boden. Vier von ihnen hielten zur Absicherung die Waffen im Anschlag.
Hennings Herz jagte los. Sein Postenführer rief die aktuelle Parole, damit man nicht auf sie schoss. Beklommen trat Henning in den Kreis. Am Boden, inmitten der Grenzer, lag ein Reh in einer Blutlache, die immer größer wurde. Es zappelte mit den Beinen und verdrehte vor Angst so stark die Augen, dass das Weiß darin sichtbar wurde.
Die Grenzer beobachteten seinen Todeskampf. Immer wieder versuchte es aufzustehen.
Die Munition war abgezählt, offenbar wollte keiner dem Reh den Gnadenschuss versetzen und dafür nach Schichtende Verhöre über sich ergehen lassen. Hennings Hände zitterten. Er durfte sich keine Auffälligkeiten mehr leisten.
Wie in Trance hob er die Waffe. Er schoss.
Die erschrockenen Rufe der anderen, ihre Vorwürfe, ihr Wutgeschrei hörte er kaum. Mit Tränen in den Augen wandte er sich ab.
2
Die Brandung spülte Ria über die Füße, zog mit neugierigen Fingern den Sand zwischen ihren Zehen fort und saugte im Zurückweichen Kanäle unter ihre Sohlen. Zu wissen, dass die Menschen in Berlin froren, ließ die bulgarische Wärme unwirklich erscheinen. Sie erschien ihr wie Magie. Ein Sonnenzauber. Die blonden Härchen auf ihren Armen wurden von der Brise gestreichelt. Ria sah, wie sie sich beugten und wieder aufrichteten. In Berlin waren es laut Radio-Wetterbericht regnerische 8 Grad. Hier schien bei 19 Grad die Sonne.
Sie zog sich zurück von den Wellen und lief neben der Brandung im Trockenen. Der Sand war an der Oberfläche warm, darunter war er kühl. Ihre Fußsohlen konnten nicht genug bekommen von diesem Temperaturwechsel. Mal grub sie die Füße tiefer in den Boden, indem sie beim Auftreten eine seitliche Wühlbewegung machte, mal ging sie ein paar Schritte behutsam nur auf dem oberen, weißen, von der Sonne erhitzten Sand.
Charlotte lachte. »Du bist wie ein Kind, Ria!« Sie meinte es gut, ihr Gesicht war voller Wärme dabei.
Ulrike ging zwischen die beiden, hakte sich bei ihnen unter und zog sie weiter. Sie sahen gut aus, alle drei, und sie wussten es. Sie waren in ihren selbst genähten Kleidern California Girls.
Ria wollte es nicht mehr kompliziert haben. Es war Zeit, dass sie lernte, das Leben zu genießen. Sie freute sich über das Licht, das auf den Wellen glitzerte. Kinder bauten eine Kleckerburg. Ihre Eltern plauderten entspannt und tranken Limonade.
Im Sommer würden dicht an dicht gelbe Sonnenschirme auf dem Strand stehen, darunter Luftmatratzen und Badehandtücher und Urlauber aus ganz Europa. Aber ihr gefiel es jetzt im Mai besser, mit Platz zwischen den Familien. Das Meer, in dem niemand schwamm, war endlose blaue Weite. Nichts störte, bis auf einen dunklen stählernen Buckel, der draußen mit Dieselgetucker vorüberzog: ein sowjetisches U-Boot. Möwen kreisten am Himmel. Vor einer Imbissbude aßen Urlauber Bouletten und Salat.
Die Westfrauen mit ihren bauchfreien Blusen und ihren Frottierjäckchen konnten einpacken. Sollten sie ruhig neidisch von den Balkonen ihrer weißen Strandhotels runtergucken. Hier kamen sie! Die California Girls!
Ria wusste, was sie verdrängte. Sie wusste es, und deshalb gelang es nicht recht. Zum Beispiel, dass DDR-Bürger in Bulgarien nur in der Nebensaison gern gesehen waren, also immer dann, wenn sich nicht genug westliche Gäste gewinnen ließen.
Sie waren auch jetzt in der Minderheit. Ria hörte Holländisch, Schwedisch, Englisch. Es tat ihr gut, die Welt sprechen zu hören. Sie fühlte sich zugehörig, auch wenn sie aus einem abgeschotteten Zwergland kam. Waren nicht alle hier eine große Urlaubsfamilie?
Nein, das waren sie nicht.
Die Westdeutschen erkannte sie an ihrer modischen Kleidung und dem selbstbewussten Benehmen. Sie traten fester auf. Lachten laut und ohne Rückbehalt. Und im Laden verlangten sie, was sie kaufen wollten, während die DDR-Bürger schüchtern auf alles zeigten und vorsichtige Wünsche äußerten. Nicht bei jeder Familie war Ria sofort sicher, welchem Land sie zuzuordnen war. Sah sie genauer hin, erkannte sie die ostdeutsche Kleidung, und es traten die feinen Unterschiede zutage, so wie sie für die Kellner in den Restaurants offenbar waren, die zielsicher die westdeutschen Gäste hofierten und die aus der DDR wie nebenbei und mit weniger Begeisterung bedienten.
Die Westdeutschen reisten spottbillig nach Bulgarien, 300 Mark, zwei Wochen Vollpension, gebucht über Neckermann. Junge Familien waren froh, dass es Rabatte für die Kinder gab und die Kosten für Restaurantbesuche abgedeckt waren, als Pauschalurlauber erhielten sie für jeden Aufenthaltstag einen bestimmten Betrag ausgezahlt, sechs oder sieben Lewa in einer speziellen Touristenwährung, die in allen Lokalen akzeptiert wurde. Damit konnten sie mehr Essen bestellen, als sie überhaupt zu verzehren in der Lage waren.
Dennoch klagten die Westdeutschen darüber, dass es in allen vierzig Restaurants gleich schmecke und dass die Toiletten unsauber seien und stinken würden und dass man überhaupt nur die Toilette im eigenen Hotelzimmer benutzen könne. Sie ergingen sich über die Möbel in ihrem Hotel, die Spiegel blind, Bett und Schrank billig, und statt einer Dusche gebe es nur eine tropfende Handbrause über dem Waschbecken, was jeden Tag für Überschwemmungen im Zimmer sorge. Dem Kellner in blauer Kunstseidenjacke, der, gleich wenn es bei ihnen etwas lauter wurde, besorgt herbeieilte und mehrmals fragte, ob alles zu ihrer Zufriedenheit sei, gaben sie dennoch ein Trinkgeld in Westmark, wofür er sich mit Verbeugungen und freundlicher Begleitung bis zur Tür bedankte.
Ulrike war auf der Jagd, aber Charlottes Blick war nach innen gekehrt, sie lächelte wie ein frisch verliebter Backfisch.
Ria fragte: »Wie lange hast du ihn nicht gesehen?«
»Eine Ewigkeit. Ich sag dir, das ist eine Qual. Und jedes Jahr zittere ich, ob ich einen Urlaubsplatz in Bulgarien bekomme.«
»Lasst euch bloß nicht erwischen«, sagte Ulrike.
Ria seufzte. »Ich hatte auch mal einen Westfreund.«
»Und was ist mit ihm?«
»Das ist vorbei.«
Jens. Bei einer tropfenden Handbrause fühlte er sich zu Hause. Ein billiges Bett, ein billiger Schrank – so lebte er selbst. Bulgarien könnte ihn nicht erschrecken. Er trug die Welt im Kopf. Er sah Dinge. Er liebte das Leben in seiner Widersprüchlichkeit mit allen komischen und tragischen Seiten. Er bemerkte Augenblicke unerhörter Schönheit, die ihr entgingen.
Acht Jahre hatten sie sich nicht gesehen. In dieser Zeit hatte seine unmögliche Frisur gewiss bei zahllosen Frauen den Gedanken geweckt, »den rücke ich mir noch zurecht«. Er wirkte ungefährlich, tollpatschig. Im Sommer konnte sie ihn sich nicht anders als mit einer schief sitzenden Badehose vorstellen. Heute trug er wahrscheinlich ein verwaschenes T-Shirt und ausgefranste kurze Hosen. Das Gute war, dass man ihm so das Westlersein nicht ansah.
Sie musterte die Familien am Strand. Der Reiseleiter hatte die Gruppe gewarnt: Jeder, der fortging, hatte sich abzumelden. Wer sich weiter als zehn Kilometer vom Hotel entfernte, werde »nach Hause geschickt«. Jeder wusste, was das bedeutete.
Dass in der Reisegruppe einer von der Staatssicherheit mitfuhr, der aufpasste, war ihr am Flughafen Schönefeld aufgegangen. Sie waren in Gruppen von dreißig Leuten zusammengestellt worden, hatten Verpflegungscoupons und Taschengeld bekommen. Diese Gruppenbildung war nicht notwendig, es war ihr wie im Kindergarten erschienen, aber genau so war es gedacht: Man wollte sie im Auge behalten.
Die Stasi wusste, dass Familienangehörige, die durch die Mauer getrennt waren, Reisen nach Bulgarien als heimliche Möglichkeiten zur Begegnung nutzten. Oder Liebespaare zwischen Ost und West.
Gerüchteweise hieß es, dass am Strand sogar Ehefrauen und Kinder von Stasioffizieren im Einsatz waren, in bester Tarnung. Die da mit dem roten Eimerchen? DDR-Urlauber, die vom Goldstrand ins Seebad Drushba gingen, wo vornehmlich westliche Touristen wohnten, standen sicher stärker unter Beobachtung. Deshalb hatten sie am Telefon vereinbart, dass Jens hierherkam, zu ihr.
Die Macht, die seine Stimme immer noch über sie hatte. Seine gute, warme Stimme.
Eigenartig, dass sie sich nur in diesem fernen Land sehen konnten, am Strand eines fernen Meeres.
Ulrike sagte: »Komm, du suchst doch. Du siehst dich doch nach hübschen Männern um!«
Gut, wenn es diesen Eindruck machte. Zur Hälfte war sie California Girl und genoss den Strandspaziergang. Aber gleichzeitig beobachtete sie. Prägte sich die verdächtigen Gestalten ein, die Läufer, die Späher der Staatssicherheit. Manche waren armselig schlecht getarnt, sie gafften den Leuten ins Gesicht wie auf der Suche nach einem Urlaubsflirt, aber starrten dabei Männer und Frauen gleichermaßen an und machten nicht einmal Unterschiede beim Alter ihrer Opfer. Andere fingen es klüger an, sie gaben sich den Anschein einer Beschäftigung, und doch waren es schlecht ausgebildete Allerweltsüberwacher. Seit einer halben Stunde machte sich ein Mann an einer Luftmatratze zu schaffen, die offensichtlich ein Loch hatte und die Luft nicht halten konnte. Er zeigte dabei viel zu wenig Ärger, es war offensichtlich, dass er selbst das Loch zu verantworten hatte. Weiter oben am Strand cremte einer seine Ehefrau ein, ohne je einmal hinzusehen.
Schlechter überwacht war die Straße oberhalb des Strands, und bei den Toiletten machte sie gar keinen Späher der Staatssicherheit aus.
»Aber da ist doch was«, sagte Ulrike, und ihre Augen funkelten frech. »Du hast dich heute besonders schick gemacht.«
»Urlaub! Das ist alles. Und ich will mich schön fühlen.«
»Ja, ja. Von wegen. Als hättest du das nötig. Was haltet ihr von einem Sektchen?«
Charlotte sagte: »Im Lokal von gestern mit dem süßen Kellner? Sofort.«
Aber Ria seufzte. »Mir brummt der Schädel. Ich gehe ins Hotel zurück. Macht ihn ohne mich glücklich, Mädels.«
»Zu viel Wein gestern?« Ulrike kniff sie noch einmal in den Arm, bevor sie ihre Umklammerung löste.
»Kann sein.«
Die drei lachten.
Charlotte sagte: »Wenn ich in einem Nobelhotel wohnen würde wie du, würde ich meinen Sekt auch dort trinken.«
Aus dem Augenwinkel nahm Ria einen Mann wahr, der parallel zwischen den Sonnenschirmen entlangschlenderte. Man war auf sie aufmerksam geworden, oder der Aufpasser ihrer Gruppe hatte entschieden, sie überwachen zu lassen.
Der Beobachter breitete eine Decke aus und setzte sich. Er sah nicht nach Urlaub aus. Sie konnte nicht sagen, was es war. Die Art, wie er die Unterarme auf die Knie legte, die teure Armbanduhr? Dass er so stur geradeaus sah und nicht einmal kurz den Blick hob, als sie an ihm vorübergingen?
Jedenfalls war er kein Teil der Menge, die die Restaurants bevölkerte und im Meer badete, Kreuzworträtsel löste und Romane las, er war fremd. Sie war es genauso, sie gehörte ebenso wenig hierher, sie war immer noch das Mädchen, das man aus seiner Familie gerissen hatte und das allein durch die Welt spazierte wie ein unwillkommener Gast. Kein Lachen bei einem Geschäftsessen mit Dr. Schalck und seinen Außenhändlern konnte etwas daran ändern, keine Liebschaft, kein Sommer. Hatte sie nicht ein wenig Wiedergutmachung verdient? Ein wenig Rückzahlung nach dem, was die DDR ihr angetan hatte?
Es war wie ein Fluch, den sie nicht wieder loswurde.
Die hatten sie ein für alle Mal aus dem Leben gerissen, als sie Vater und Mutter festnahmen und Jolanthe, ihre geliebte kleine Schwester, in einer fremden Adoptivfamilie vor ihr versteckten und Ria zwangen, den Namen Nachtmann anzunehmen und zu wildfremden Menschen Papa und Mama zu sagen.
Aber die Fremdheit machte sie auch stark. Sie öffnete ihr die Augen.
Sie verabschiedete sich und stapfte hoch zur Straße, als wollte sie den Bus zurück zum Hotel nehmen. Bei den Toiletten bog sie ab, verschwand darin. Es stank nach Urin. Sie wusch sich die Hände, sah im schwachen Licht, das oberhalb ihres Kopfes durch die schlitzartigen schmalen Fenster fiel, auf ihre Uhr.
Das Toilettenhaus war ein fürchterlicher Ort, um sich wiederzusehen. Aber noch mehr als der unromantische Uringestank machte ihr Sorgen, dass Jens zu Recht wütend auf sie sein würde. Das schlechte Gewissen pochte in ihr wie ein giftiges, schweres Herz. Sie hatte ja alles kaputt gemacht damals.
Wie hatte sie Jens das antun können?
Sie trat nach draußen, hielt sich aber im Schatten des Toilettenhäuschens. Der Beobachter war weg. Vielleicht war er Ulrike und Charlotte gefolgt. Oben an der Straße waren nur Einheimische und zwei unverdächtige Touristen. Der Strandabschnitt sah ebenfalls gut aus.
Sie sah noch einmal auf die Uhr.
Jens war immer pünktlich gewesen früher. Was, wenn er gar nicht nach Bulgarien gekommen war? Wenn er sie ein wenig leiden lassen wollte als gerechte Strafe für einen kleinen Teil dessen, was sie ihm angetan hatte?
Ein alter Schmerz öffnete ihre Brust, sie war plötzlich wieder Kind. Wenn er nicht kam, würde sie sich schrecklich allein fühlen, sie hatte es nicht besser verdient, man verließ sie, weil sie es nicht wert war.
Unsinn.
Da. Das war Jens.
Er hatte sich nicht verändert. Er ging wie ein sanfter Bär, und er hatte dieselben großen Hände und den Mund, der sie so liebevoll geküsst hatte. Wie hatte sie ohne ihn überleben können?
Die Stoppeln seines Dreitagebarts waren grau geworden. Jens trug braune Cordhosen, deren Beine er hochgekrempelt hatte bis zur Hälfte der Unterschenkel. An seinen Zehen hing der Sand.
Noch einmal prüfte sie die Lage. Keine Gefahr. Sie überlegte, sich ihm trotzdem nicht zu zeigen, abzureisen. Das Wiedersehen war zu viel für sie. Sie hielt diese Gefühle nicht aus. Musste es nicht in einem kolossalen Schmerz enden? Die Aussicht darauf machte ihr Angst.
Sie trat aus dem Schatten, hob die Hand.
Jens sah sie. Er kam den Strand hinauf.
Plötzlich schämte sie sich, dass sie die Sandaletten am Riemen in der Hand hielt, sie hätte die doch irgendwo ablegen können, ein kleines Lager, ein Handtuch, die Sandaletten darauf, fertig. Sie strich sich mit der freien Hand die Haare aus der Stirn. Zog sich wieder in den Schatten zurück.
War er genauso nervös wie sie? Ob er sie noch liebte, würde sie in seinen Augen lesen, gleich, wenn sie sich gegenübertraten.
Etwas stimmte nicht an der Art, wie er sie ansah.
Sie schwiegen beide.
Sie wollte fragen, ob er mit ihr ein wenig an der Straße entlangspazieren wolle, aber sie brachte keinen Laut heraus, ihre Zunge und ihr Mund gehorchten nicht.
Jede ihrer Liebschaften, die sie gehabt hatte, war nach kurzer Zeit unpassend geworden. Jede Hand, die sie gehalten hatte, war falsch gewesen, weil es nicht seine Hand gewesen war. Jetzt stand sie dem Mann gegenüber, in dessen Nähe sie sich all die Jahre geträumt hatte, und er sah sie an wie ein Ärgernis.
Schließlich fragte er: »Hier? Nach acht Jahren?« Er klang verletzt.
Sie schluckte. Besser, wenn man uns nicht sieht – das wollte sie sagen, aber sie wusste, wenn sie es tat, würde er gehen. Er würde zu Recht glauben, dass sie immer noch in derselben Lage waren wie damals. Und waren sie das nicht auf gewisse Weise?
Sie deutete zur Straße hinauf und sah ihn fragend an. Ihre Unterlippe zitterte. Wie sie sich vor ihm schämte!
Sie gingen nebeneinander hügelan. Wie das Offensichtliche täuschte. Sie glichen einem Liebespaar im Urlaub, aber sie waren längst kein Liebespaar mehr, sie waren einander Fremde geworden.
Er sagte: »Du kannst nicht einfach nach acht Jahren anrufen.«
»Ich weiß.«
Dem Anruf waren aufgewühlte Wochen vorangegangen, ein Liebestaumel, in dem sie stündlich an Jens gedacht hatte, eine plötzlich aufwallende, sie immer stärker in Besitz nehmende Sehnsucht. Seit Kurzem konnte man wieder direkt in den Westen telefonieren, indem man einfach selber wählte. Sie hatte sich das verboten, Privatanrufe in den Westen wurden auf den wenigen Leitungen, die es in die Bundesrepublik gab, sicher abgehört. Tag um Tag war sie stark geblieben, obwohl der Ozean in ihrem Bauch wogte. Dann, im Büro der Kommerziellen Koordinierung, hatte sie in einem schwachen Moment doch seine Nummer gewählt in der Hoffnung, dass die Telefonleitungen der KoKo nicht überwacht würden und man es nicht wagte, das mächtige, im Graubereich und mit Unterstützung der Staatssicherheit handelnde Unternehmen abzuhören. Schlimmer, es war ihr egal gewesen, für gefährliche zehn Minuten hatte es sie nicht geschert, ob man ihr zuhörte.
»Aber du bist gekommen.« Sie hätte gern seine Hand genommen oder gleich seinen Arm.
»Was willst du von mir, Ria?«
Ein kurzes, eigenartiges Telefonat war es gewesen, wenn man bedachte, dass sie einander acht Jahre nicht gesprochen hatten. Als sie seine Stimme hörte, war es ihr durch und durch gegangen. Während sie vor Nervosität an ihren Fingern kaute, hatte sie ihm gesagt, dass sie nach Bulgarien in den Urlaub fahre, und gefragt, ob er auch kommen wolle.
Die Straße war staubig. Die Autos ebenfalls. Viele waren verrostet, mit Hanfstricken waren ihre Stoßstangen festgebunden, Seitenspiegel fehlten, sie hätten in der DDR überhaupt nicht mehr fahren dürfen.
»Ich bin einsam ohne dich«, sagte sie leise.
»Bist du den Sumpf mit den Geheimdiensten los?«
»Ja, bin ich.« Es schmerzte sie, wie er das beurteilte. Ohne die Geheimdienste hätte sie ihre Schwester nie wiedergefunden. Aber aus seiner Sicht – natürlich. Der Bundesnachrichtendienst war es gewesen, der ihre Trennung verlangt hatte.
»Wirklich, du bist jetzt frei von denen?«
Sie nickte.
Er schwieg eine Weile. Dann fragte er, schon freundlicher: »Hast du einen Mann?«
»Würde ich mich dann mit dir hier treffen?«
»Hattest du einen? Also, warst du verheiratet?«
»Es gab Männer, aber ich habe nicht geheiratet. Und du?«
»Ob es eine Frau in meinem Leben gab? Niemanden nach dir. Du hast mich verdorben für sie alle. Ich wollte nur noch dich.«
Sie blieb stehen. Keinen Schritt konnte sie mehr machen. Sie schluckte, blinzelte Tränen fort. »Jens, ich …«
Sie wünschte sich die Jugend zurück, die Zeit, als noch alles offen war und man sich, was das Leben betraf, im Frühling befand, die Blüten waren eben dabei, sich zu öffnen, das Gras stand noch nicht hoch, und man verspürte eine ungestüme Zuversicht.
Aber sie war nicht mehr zwanzig, und die Dinge waren komplizierter geworden.
Auch Jens blieb stehen. »Warum bin ich hier, Ria?« Er sprach jetzt leise, so wie damals, als sie wegen ihrer Geheimdienstarbeit manche Gespräche nur bei laufendem Radio führten.
»Weil ich dich liebe.«
Er strich sich mit der Hand über die Stirn. Oder wischte er über die Augen? »Ich tauge nicht zu einem Urlaubsflirt. Wir könnten uns einmal im Jahr am Strand in Bulgarien treffen, aber das kannst du nicht ernsthaft vorschlagen. Ich kann nicht das Beste daraus machen, kann nicht die Tage genießen, die wir haben. Es reißt Wunden in mir auf. Und wenn der Urlaub vorbei ist …«
»Ich habe jetzt einen Reisepass, Jens. Bisher darf ich nur ins sozialistische Wirtschaftsgebiet, aber irgendwann werden sie mich auch ins westliche Ausland reisen lassen, wenn ich mich als zuverlässig erweise.«
»So zuverlässig wie jetzt gerade?«
Er scherzte wieder. Das war ein gutes Zeichen. »Wenn ich das KA im Pass habe, also die Reisegenehmigung fürs kapitalistische Ausland, komme ich zu dir. Nach Westberlin. Und bleibe.«
Er sah auf das Meer hinaus. »Ich würde das so gern glauben.« Seine Stimme klang rau.
»Bitte versuche es.«
»Und die Geheimdienste?«
»Mit denen bin ich fertig.«
Er musterte sie ungläubig.
»Ich habe seit Jahren keinen Kontakt mehr zum BND. Ich hab denen klar meine Meinung gesagt. Für mich war es immer etwas Persönliches. Wenn der BND damit nicht klarkommt, wenn er nur Machthungrige und Kampfmaschinen und Ideologen gebrauchen kann, dann passe ich da nicht hin.«
»Was ist mit der anderen Seite?«
»Dem KGB? Die haben mich als wertlos abgeschrieben.«
»Sei dir da nicht so sicher.«
»Komm heute Abend zu mir«, sagte sie leise. »Ich bin im Grandhotel in Warna, Zimmer dreihundertzwölf.«
Seine Ohren röteten sich. Sie wusste, was in ihm vorging, sie konnte es beinahe körperlich spüren. Der Wunsch, wieder mit ihr zusammen zu sein. Die Angst, verletzt zu werden wie damals.
»Vertrau mir«, bat sie.
»Du spielst kein Spiel mit mir?«
»Mit nichts im Leben ist es mir so ernst wie mit dir. Es ist mir todernst. Wirklich.« Sie rührte sanft an seinen Arm, dann machte sie kehrt und ging Richtung Bushaltestelle. Von einem der Restaurants drang Flamenco-Musik herüber, die Töne wurden durch die offene Tür nach draußen getragen.
Der Bus hielt, und sie stieg ein. Mit lautem Zischen schlossen sich hinter ihr die Türen. Ein Kind lächelte sie an. Sie nickte ihm zu, dann sah sie aus dem Fenster. Sie zitterte am ganzen Körper. Mühsam versuchte sie, es zu unterdrücken. Versuchte, sich auf die Welt da draußen zu konzentrieren und nicht an Jens zu denken und an die Frage, ob er ihr noch einmal vertrauen konnte.
Alte Männer saßen am Straßenrand, die ausrangierte technische Geräte zu verkaufen versuchten, gebrauchte Kabel, ausgelatschte Schuhe, Dinge, die in Berlin im Müll gelandet wären. Hühner in Käfigen, daneben auf dem Verkaufstisch ein zerfetztes Akkordeon und Obst.
Schließlich kamen sie hinein nach Warna und waren bald umgeben von Verkehr, Gestank und Lärm. Was tat Jens jetzt? Er würde dastehen und auf das Meer hinaussehen und sich fragen, warum es so schwierig war mit dem Leben und mit den Frauen und vor allem mit ihr. Packte er heute Abend seinen Koffer? Reiste er ab? Bitte, Jens, gib mir noch eine Chance, sagte sie in Gedanken auf, wieder und wieder, wie einen Zauberspruch.
Aus dem Busfenster sah sie DDR-Urlauber, die ihre prall gefüllte Tasche öffneten, als wollten sie die Kleidungsstücke darin sortieren, und gleich von Einheimischen umringt waren. Die Bulgaren bekamen hier vieles nicht, sie waren froh über Nylonstrumpfhosen, Blusen, Röcke oder Pullover aus der DDR-Produktion. Den ostdeutschen Urlaubern wiederum reichte das Taschengeld in der Ortswährung nicht, das sie zu Beginn der Reise erhalten hatten, und DDR-Mark nahm man hier nicht einmal am Wechselschalter. Also behalfen sie sich mit ein wenig Tauschhandel.
Das Grandhotel kam in Sicht. Ria stieg aus. Touristen schlichen an der weißen Prunkfassade des Hotels vorbei und versuchten, einen Blick in den Garten mit Swimmingpool zu erhaschen. Sie warfen Ria, die auf das Eingangsportal zutrat, bewundernde Blicke zu.
Hätte sie hier wohnen dürfen ohne Dr. Schalcks Fürsprache? Sicher nicht. Sein Flüstern drang aus Berlin bis nach Bulgarien.
Am Goldstrand wohnten die Ostler in hölzernen Campinghütten, die über das Waldufer verstreut waren. Und doch waren auch sie privilegiert. Sie hatten nur deshalb einen der raren Urlaubsplätze zugeteilt bekommen, weil sie Beziehungen besaßen. Ein Normalsterblicher wusste gar nicht, an welchem Tag die Reisegutscheine verkauft wurden. Außerdem erkundigte sich das Reisebüro über jeden, der eine Auslandsreise zu buchen versuchte, bei den staatlichen Stellen, um nachzuprüfen, ob die Anfragenden politisch tragbar waren und ob der Staat ihnen die Reise gestattete. Erst dann kassierte es 1500 Mark pro Person für 14 Tage ab.
Was war sie also? Eine Privilegierte unter Privilegierten? Sie ging in der Lobby unter dem schweren Kronleuchter aus Glas hindurch, passierte antike Möbel, unbezahlbare Gemälde an den Wänden und gut gekleidete Leute, die sich gedämpft unterhielten. Das Hotel hatte es schon gegeben, als die Stadt noch Stalin hieß. Der Teppich in aristokratisch blauer Farbe schluckte jeden Laut ihrer Schritte in den Goldsandaletten, sie sah verstohlen nach, ob sie etwa eine Spur von weißem Sand darauf hinterließ, aber wenn es so wäre, würde sicher binnen Minuten eine Reinigungskraft erscheinen und den Teppich absaugen.
Das Hotel würde Jens nicht im Geringsten beeindrucken. Allein schon dafür liebte sie ihn.
Der dunkel getäfelte Fahrstuhl brachte sie nach oben. Sie schloss ihr Zimmer auf. Während ihrer Abwesenheit hatte das Personal das Bett gemacht, die Decke aus Spitzensatin lag ordentlich darauf. Durch das hohe Fenster fiel sanftes Nachmittagslicht.
Sie zog die Sandalen aus und ging ins Bad. Der Marmorboden empfing kühlend ihre nackten Sohlen. Sie wusch sich die Hände. Als sie in den Spiegel sah, schob sie die Unterlippe vor. Sie war zweiunddreißig, immer noch im besten Alter. Aber sie sah das Verletzliche in ihrem Blick. Sie bereitete sich für einen großen Sprung vor. Konnte sie wagen, ihn auszuführen?
Die DDR war ihre Heimat. Eine verdrehte, heuchlerische Heimat, und doch ihr Zuhause. Weil sie im Osten geboren und aufgewachsen war, weil dort ihre Wiege gestanden hatte, nur aus diesem unwichtigen Grund, der auf einem Zufall beruhte, fühlte sie sich in der DDR heimisch. Das Schlangestehen war zur Gewohnheit geworden, das Buckeln in den Ämtern, der Kohlegeruch und das Gefühl, einer Leidensgemeinschaft anzugehören, in der man sich gegenseitig aushalf.
Die DDR war ihr Kindheitsland. Es zog in ihrem Bauch, wenn sie daran dachte. Jeder liebte doch seine Heimat. Das Kindheitsland hatte sie nicht haben wollen. Dieses Land hatte versucht, sie zu zerstören.
Aber wenn sie ging, würde sie nicht nur das Land verlieren, sie würde auf Jahre ihre Tochter nicht wiedersehen. Annie war jetzt 16, sie machte ihren Weg. Und sie hatte Ria nie wirklich an sich herangelassen. Trotzdem, würde es Annie nicht treffen, erneut verlassen zu werden von ihr? Sie vertraute ihr nicht, und wer konnte es ihr verübeln. Wie sollte sie einer Mutter vertrauen, die sie als Neugeborenes in fremde Hände gegeben hatte.
Auch Jolanthe wäre verletzt. Ria ging zurück ins Zimmer und setzte sich an den Schreibtisch. Sie klappte die braunlederne Mappe auf, strich mit der Hand über das herrlich glatte, chamoisweiße Hotelbriefpapier. Sie zog den Kugelschreiber aus der Halterung und schrieb:
Liebste Joli,
2. Mai 1973
verzeih deiner dummen Schwester. Familie ist doch das Wichtigste. Wir halten zusammen! Ich bin am 19. Mai zurück in Berlin. Am 20., das ist Sonntag, komme ich zu dir, versprochen. Bleib tapfer. Wir kriegen das mit Henning schon wieder hin.
Das Kleid, das sie trug, hatte sie mit Jolanthe genäht. Ich hätte in Amsterdam leben können oder in Paris oder London, dachte sie. Aber ich bin geblieben, um meine Heimat zu bekämpfen. Und um Joli und Annie nahe zu sein. Wie nahe war ich ihnen wirklich in den vergangenen Jahren?
Und was hatte es gebracht, dass der Westen dank ihrer Arbeit ein paar Stunden vor dem Mauerbau informiert gewesen war? Vielleicht hatte der BND noch ein paar Leute rausholen und ein paar andere einschleusen können. Was hatten die Wirtschaftsinformationen gebracht, die sie ihrem Führungsoffizier vom BND durchgegeben hatte?
Angeblich halfen sie, Rückschlüsse auf die Rüstung der DDR zu ziehen. Aber das genügte ihr nicht. Das war nicht, was sie wollte. Immer noch schnüffelte die Staatssicherheit überall herum, immer noch wurden Existenzen zerstört, Familien zerrüttet, Telefongespräche abgehört, Beziehungen vernichtet.
Und sie, Ria, hatte den Bundesnachrichtendienst von sich gestoßen. Hingehalten hatten sie sie, hatten versucht, ihr Jens auszureden, und sie hatte ihnen glauben wollen, aus Angst, an Jens’ Nähe zu verbrennen, abhängig zu werden von ihm, ihn zu sehr zu lieben. Ein Fehler. Sie hatte in Dr. Schalcks Windschatten gelebt und versucht, sich zu arrangieren. Hatte versucht zu vergessen.
Sie beschloss, kein Make-up aufzulegen. Sie schwärzte sich nicht einmal die Wimpern. Willst du nicht, dass er dich zurücknimmt?, warnte eine Stimme in ihr.
O doch, ich will es. Aber er soll mich sehen, wie ich bin. Er soll die Wahrheit kennen.
Und warum dann die schöne Unterwäsche?, fragte die Stimme spöttisch.
Sie aß nicht zu Abend, sondern blieb im Zimmer, um Jens auf keinen Fall zu verpassen. Gegen sieben klopfte es leise an ihrer Tür. Er ist gekommen, dachte sie. Sie fühlte sich plötzlich federleicht.
Sie öffnete.
Jens.
Sie bat ihn herein.
Es hatte etwas Jungenhaftes an sich, wie er sich scheu im Zimmer umblickte. »Du bist also noch beim Ministerium.«
»Du meinst das Hotel?«
»Würde mich nicht wundern, wenn nebenan Willy Brandt oder Präsident Nixon wohnen.«
Sie schloss die Tür, ging zum Radio und schaltete es an. Zur Sicherheit ging sie ins Bad und drehte zusätzlich die Hähne von Badewanne und Waschbecken auf, jetzt rauschte es kräftig. Sie kehrte zu Jens zurück.
»Alte Gewohnheit, hm?« Er lächelte schief. Sein Gesicht besaß neue freundliche Falten, die es vor Jahren noch nicht darin gegeben hatte.
Sie sagte: »Ich habe keine Getränke hier. Entschuldige.«
»Ich bin nicht wegen der Getränke gekommen.«
Sie setzte sich aufs Bett, im Schneidersitz, wie als junges Mädchen. »Weswegen dann?«
Er setzte sich neben sie. Strich sanft über ihre Stirn und die Augenbrauen.
Sie nahm sein Gesicht in beide Hände und küsste ihn. Ein Fremder war er und doch unendlich vertraut.
Als er ihre Küsse erwiderte und seine Lippen tiefer wanderten, auf ihren Hals, auf ihr Schlüsselbein, verschwanden die Jahre.
»Also bist du mir nicht mehr böse?«, fragte sie.
»Hättest mal schreiben können«, sagte er und schob sie sanft, bis sie auf das Bett sank.
Sie zog die Bluse aus. »Ich weiß.«
Als er ihren Bauch küsste, vergaß sie alle Worte.
Sie liebten sich wie Ertrinkende, die sich aneinander festhielten, und ließen sich auch danach nicht los. Zum ersten Mal nach all den Jahren fühlte sich Ria wieder geborgen.
Jens blieb diese Nacht bei ihr, er blieb bis zur Frühstückszeit und ging auch dann nur, nachdem sie sich für ein Wiedersehen in zwei Stunden am Hafen verabredet hatten. Es gab keine Fragen mehr in ihr. Nur Antworten. Und jede davon trug seinen Namen.
3
Wenn die Grenzer da sind, gibt es guten Umsatz. Sie haben nicht oft Ausgang, also versuchen sie, in die Stunden, die sie aus der Kaserne dürfen, möglichst viel Freude zu pressen. Freude lässt sich aber schlecht pressen. Und kaufen lässt sie sich schon gar nicht. Das wird sie denen aber nicht sagen.
»Evi, noch ’ne Runde!«
Evelyn geht zu ihnen an den Tisch und schenkt nach, sie ist großzügig und füllt die Schnapsgläschen bis zum Rand. Ihr Spitzname ist nicht Evi, sondern Lix, aber das geht die nichts an.
Die Grenzsoldaten heben die Schnapsgläschen. Ein Neuer ist dabei, sein Glas war noch halb voll. Er trinkt nicht richtig, und an der Unterhaltung beteiligt er sich auch nur sporadisch. Wäre er mit einer Frau hier, würde sie der leise ins Ohr flüstern: »Pass auf, der will dich betrunken machen.« Aber es sind alles Grenzer, wer weiß, vielleicht bekommt ihm der Schnaps nicht so, und er will trotzdem vor den Kameraden nicht wie eine Lusche dastehen.
Sie reden über Luftkissen, die der Kompaniechef verboten hat, obwohl jeder Grenzer eines braucht, um nicht stundenlang auf dem kalten Waldboden sitzen zu müssen. Jetzt klagen sie über das Frieren in der Nachtschicht. Männer sind solche Jammerlappen. Die sind doch alle jung! Bis auf den Neuen, der wird fast fünfzig sein, auch wenn er noch sehr sportlich aussieht, hat sich gut gehalten, und hübsch ist er auch. Hat einen wachen Blick, braune Augen, das mochte sie schon immer bei Männern.
Sie lacht in sich hinein. Alle fürchten im Dorf die jungen Soldaten, sie bewachen ihre Töchter regelrecht. Ist ja klar, dass die gern mit den Mädchen ins Heu wollen, und wenn sie eine geschwängert haben, dann hauen sie ab, sobald die Dienstzeit vorüber ist. Sie hat selber Ellen und Christa scharf gewarnt, bisher ist es gut gegangen, Gott sei Dank. Und jetzt verguckt sie sich in einen von denen?
Er hebt das Glas, aber trinkt nicht, bestenfalls hat er einen winzigen Schluck genommen.
Der Regen sei das Schlimmste, sagt einer, er habe die kompletten acht Stunden Grenzdienst Regen gehabt, am Ende sei er trotz Regenumhang durchnässt gewesen, und das Wasser habe ihm in den Stiefeln gestanden, und dann hätten die Offiziere bei der Kontrolle auch noch beanstandet, dass er die Maschinenpistole unter dem Umhang getragen habe und nicht feuerbereit gewesen sei.
So viel hat sich Evelyn schon über den Grenzdienst anhören müssen, dass sie selbst Schichten an der Grenze schieben könnte, ohne etwas falsch zu machen. Sie würde sich sogar in der Kaserne zurechtfinden, oft genug haben die Trinkenden beschrieben, wie eng und bescheiden es ist in der Baracke, die Spinde nicht in der Stube wie in einer richtigen Kaserne, sondern auf dem Flur wegen des Platzmangels, und die Eisengestelle der Doppelstockbetten quietschen bei der kleinsten Bewegung. Im Winter pfeift der Wind durch die Ritzen der dünnen Bretterwände.
Aber die Zusatzverpflegung!, sagt jetzt einer der Soldaten. Jede Woche der Beutel mit Bananen, Apfelsinen, Schokolade und Keksen, »der Fluchtverhütungsbeutel«, sagt er und hebt lehrerhaft den Finger, und sie lachen.
Das lässt einer, den der Neue vorhin scherzhaft-ernst als »Postenführer« bezeichnet hat, nicht auf sich sitzen. »Früher! Hat man mit den westlichen Grenzern! Durch den Zaun hindurch! Tauschhandel getrieben!« Er wisse das von seinem Vater. Südfrüchte und Schallplatten seien über den Draht gereicht worden, und die DDR-Grenzer hätten sich revanchiert mit Souvenirs aus der Bekleidungs- und Ausrüstungskammer der Grenzkompanie.
Die anderen sehen ihn ungläubig an. Sich über den Kompaniechef aufzuregen ist das eine, aber Tauschhandel mit dem Klassenfeind? Was, wenn jemand dieses Gespräch an die Staatssicherheit berichtet? Vielleicht sogar einer von ihnen? Sie kann ihnen den Gedanken förmlich von den Gesichtern ablesen. Von einem Moment zum anderen sind sie verwandelt, nicht mehr prahlende Grenzsoldaten, sondern Chemiefacharbeiter, Bäcker, Elektriker, Abiturient, und sehen in ihren Uniformen sehr jung aus.
Der Postenführer erbarmt sich und trinkt das Glas des Neuen leer. Der Neue hat lange nichts gesagt. Sie findet, dass er blass geworden ist. Jetzt springt er auf, presst sich eine Hand vor den Mund und rennt aus der Gaststube.
Die Grenzer lachen. Sonst geht zu den Toiletten immer ein Kamerad mit, aus Sorge vor Übergriffen aus der Bevölkerung. Aber sie lassen den Neuen allein, wahrscheinlich finden sie, dass er beim Kotzen keine Zuschauer braucht. Sie bestellen noch eine Runde, Evelyn gießt nach, sie lassen die Gläschen aneinanderklirren.
Halblaut beginnen sie, über den Abwesenden zu reden. Der Spieß habe behauptet, er hätte längst als Oberleutnant eine eigene Kompanie befehligen können, wenn er sich nicht so anstellen würde.
Gemeinsam malen sie sich aus, wie die Kompanie des Neuen angetreten war und der Politstellvertreter ihn vor die Front treten ließ, um ihm seine Vergehen aufzuzählen, und wie der Befehl erteilt wurde, ihm die Schulterstücke zu entfernen, und dass man ihn wie einen Verbrecher abgeführt hatte, »geben Sie Ihre Uniformen ab, und verlassen Sie anschließend das Objekt!« Aber so kann es nicht gewesen sein, wendet einer ein, Henning ist ja noch bei den Grenztruppen – so heißt er also, Henning –, wenn auch im niedrigsten Rang und versetzt hierher nach Großtöpfer, in die vergessene Kompanie mit der zugigen Baracke. Schon das sei eigenartig, sagen sie. Ein Unzuverlässiger dürfe noch Grenzdienst schieben? Die Geschichte stimme doch hinten und vorne nicht.
Es ist gemütlich in der Gaststube, und der Schnaps treibt ihnen die Hitze in die Gesichter. Draußen bei der Toilette ist es kalt. »Der bleibt wohl an der frischen Luft«, sagt der Chemiefacharbeiter, »um sich vom Saufen zu erholen.«
Vor vier Wochen ist der Chemiefacharbeiter zum Gefreiten befördert worden, das hat sie beim vorigen Saufgelage mitbekommen. Jetzt kriegt er nicht mehr 80 Mark Sold im Monat, sondern 100, dazu 35 Mark Grenzzulage. Er hat fest vor, sich im nächsten Urlaub ein Motorrad zu kaufen. Nur noch neun Wochen bis zum Motorrad. Das setzt man nicht leichtfertig aufs Spiel.
Der Postenführer steht auf und sagt: »Ich gucke nach ihm.« Gehört sich auch so. Vielleicht ist er ohnmächtig geworden oder so etwas. Hat sie hier alles schon erlebt. Wobei, so wenig, wie der getrunken hat, steht er wohl eher im Hof und starrt den Mond an und denkt wehmütig an seine Frau oder so etwas. Hat er eine Frau? Oder ist er noch zu haben?
Sie geht ebenfalls nach draußen. »Haben Sie ihn gefunden?«
Der Postenführer schüttelt den Kopf. Im Hof ist er also schon mal nicht. Der Postenführer tritt vor das Haus. Sie folgt ihm. Großtöpfer liegt verschlafen da, die meisten der dreihundertfünfzig Einwohner schlafen.
Das hat sie gleich gesehen, dass dieser Henning mit den Gedanken woanders ist. Dass der was plant.
Was, wenn er zu fliehen versucht? Dann kann sie ihm nur Glück wünschen.
Soweit sie mitbekommen hat, gibt es drei Möglichkeiten, als Grenzsoldat nach drüben zu fliehen.
Man kann versuchen, seinen Kameraden zu entwaffnen. Während man flieht, bedroht man ihn mit der Maschinenpistole, sodass er nicht eingreifen kann. Das ist hier schon mal einem geglückt, auch wenn es verboten ist, über diesen Vorfall zu sprechen. Meistens eskaliert der Entwaffnungsversuch, und der Soldat wird von seinem eigenen Partner erschossen.
Zweitens kann man seinen Kameraden dazu bewegen, die Flucht zu tolerieren oder ebenfalls zu fliehen. Dazu muss man versuchen, in Erfahrung zu bringen, wie er zur DDR steht. Solche unbeholfenen Gesprächsversuche hat sie in der Gaststube auch schon mitgehört. Das Problem ist dabei, dass einen der andere anzeigen kann, wenn man verdächtige Fragen stellt, und dann wird einem eine lange Haftstrafe aufgebrummt. Es gibt gute Kameraden, die sich unter vier Augen sagen, »nee, lass mal«, und dem Spieß kein Sterbenswörtchen von ihrer Unterredung petzen. Aber nicht alle sind so. Die wollen nichts riskieren, das Ganze könnte ja eine Falle sein, mit der man nur prüfen will, ob sie den Vorfall melden oder nicht.
Tja, und drittens kann man sich unter einem Vorwand vom Partner entfernen und außerhalb von dessen Sichtweite die Grenzanlagen überwinden. Das ist hier nie mehr gelungen, seit es unter strenger Strafandrohung verboten ist, sich im Grenzdienst voneinander zu trennen.
Aber Henning hat gerade keinen Dienst. Was hast du vor, Braunauge?, denkt sie und trocknet sich an der kalten Luft die vom Abwaschen geröteten Hände mit dem Geschirrtuch.
»Scheiße«, sagt der Postenführer.
Sie kehren in die Gaststube zurück. Der Postenführer fragt die Kameraden, ob Henning allein zur Kompanie zurückgelaufen sei? Ohne Bescheid zu sagen?
Die Kameraden werden blass.
»Wir müssen das melden«, sagt der Chemiefacharbeiter.
»Erst wird bezahlt«, sagt sie streng. Das gibt ihm einen kleinen Vorsprung.
Auf dem Rückweg sahen sie in den Straßengräben nach, in den Hauseingängen. Sie fluchten. Wenn sie ihn im Bett vorfanden, würde er Prügel beziehen, das schworen sie sich.
Am Kasernentor wurde ihnen mulmig. Der diensthabende Offizier fragte streng nach dem fehlenden Mann. Zu sechst waren sie gegangen, als halber Zug, und kehrten nur zu fünft zurück. Die Soldaten stotterten. Henning war offenbar nicht hier eingetroffen.
»Also, was ist los?«, fragte der Offizier, der allmählich die Geduld verlor.
Einer der Soldaten nahm seinen Mut zusammen. »Er ist verschwunden, Genosse Feldwebel.«
Der Wachhabende rannte zum Haus gegenüber der Kaserne. Er klingelte Sturm beim Kompaniechef. In Zivil erschien der Kompaniechef an der Tür, im Unterhemd mit dunklen Hosenträgern, er hatte bereits beim Feierabend mit seiner Frau gesessen.
Bebend erstattete der Feldwebel ihm Meldung.
»Sofort Grenzalarm auslösen«, befahl der Kompaniechef, »die Grenze abriegeln, und telefonieren Sie mit dem Stab des Grenzbataillons in Geismar! Die Grenzkompanien Weidenbach, Pfaffschwende, Hildebrandhausen und Katharinenberg müssen genauso dichtmachen.«
Der Feldwebel salutierte. Kurz darauf gellten Befehle über den Hof. Die Alarmgruppe bestieg den LO 1800. Auch die Heimkehrer wurden trotz ihrer Schnapsfahne vergattert, sie erhielten Kalaschnikow-Maschinengewehre RPK mit langem, massivem Lauf. Die schwere Bewaffnung bedeutete: Der Kompaniechef traute Henning alles zu, auch Kameradenmord.
Henning Nowak kraulte den Kaukasischen Schäferhund, um ihn zu beruhigen. Der Hund leckte ihm die Hand. Bevor der Schäferhund hier an die Laufanlage gekommen war, war ein Hundeführer mit ihm täglich das Sperrgebiet abgelaufen, um Deserteure der Sowjetarmee oder flüchtende DDR-Bürger aufzuspüren, die sich im Wald nahe der Grenze versteckten und auf einen günstigen Moment für die Flucht warteten – dafür war der Hund trainiert worden. Wieder einmal ein Beweis dafür, dass die Grenzsicherung sich nicht gegen äußere Feinde richtete, sondern gegen die eigenen Bürger. Der Hund wurde regelrecht auf Flüchtlinge abgerichtet, es ging nicht um uniformierte Feinde: Bevor der Trainer ihn verprügelte, um ihn scharf zu machen, zog er jedes Mal die Uniform aus. Er prügelte in Zivilkleidung auf ihn ein, deshalb hasste der Hund Zivilisten.
Laut Vergatterung hätte Henning hier freie Bahn haben sollen. Stattdessen hielten keine zwanzig Meter entfernt zwei Posten Wache. Der Hundeunterstand, neben dem er kauerte, gab ihm Deckung, und der Hund war ruhig, aber ihm lief die Zeit davon.
Ein Postenpaar am Abschnitt unterhalb des Schlossbergs, eines zur Sicherung an die Frieda, eines an die Zufahrtsstraße nach Döringsdorf zur Kontrolle einfahrender Autos und das vierte Paar in den Beobachtungsbunker Richtung Eschwege, so war es geplant gewesen.
Die 3. Grenzkompanie hatte neun Kilometer Grenze zu schützen, 23 Postenpunkte, die man auswendig gelernt hatte, um sich rasch im Gelände orientieren und den Befehlen gehorchen zu können. Unmöglich konnte überall jemand stehen an der kilometerlangen Grenze.
Der Feldwebel musste die Posten zur Hundelaufanlage verlegt haben, während er in der Gaststube gewesen war. Verdammt! Er hatte gehofft, dass sie der Hundelaufanlage vertrauten. Wenn die beiden nicht in den nächsten fünf Minuten weitergingen, würde er sich zurückziehen müssen. Ein Rascheln, ein Knacken oder ein Laut des Hundes genügte, und sie würden ihn stellen.
Henning gefror zu Eis. Motorbrummen näherte sich, und das Licht von Scheinwerfern. Grenzalarm. Sie hatten sein Fehlen bemerkt. Der Hund grub seine Schnauze in Hennings Taschen, er hatte Hunger. Henning hatte bereits alles verfüttert, was er mitgenommen hatte. Der Hund winselte.
Die Posten drehten sich nach ihm um. »Siehst du den Hund?«, fragte der eine leise.
»Hier stimmt was nicht. Und da hinten kommt die Alarmgruppe.«
»Die fahren an uns vorbei. Das muss woanders sein mit dem Alarm.«
»Und der Hund?«
Henning hörte den Verschluss der Tasche schnappen, der Kerl holte ein Handleuchtzeichen heraus. In die Sicherungskappen waren Fühlzeichen eingeprägt, man konnte auch im Dunkeln das passende Geschoss ertasten, drei Sterne rot hieß: versuchter Grenzdurchbruch, ein Stern grün rief nach der Alarmgruppe, ein Stern bat den benachbarten Posten um Hilfe, aber der holte sicher die dicke Berta heraus, 40 mm, erst Verschlusskappe abschrauben, dann Handleuchtzeichen vom Körper weghalten und kräftig an der Schnur ziehen.
Henning fasste einen Entschluss. Er legte die Hand an den Karabinerhaken am Halsband des Hundes. Als die Leuchtrakete fauchend die Geschosshülse verließ und in die Höhe stieg, löste er den Haken vom Halsband. Die Dicke Berta zerplatzte am Himmel, und es wurde hell. Henning konnte die Sperrzäune erkennen. Der Schäferhund sprang irritiert in die Höhe und jaulte. Dann sank der gelbe Stern herab, er hing an einem kleinen Fallschirm, das Waldgebiet war in sein gespenstisches Licht getaucht.
Die Posten kamen auf die Hundehütte zu, riefen nach dem Hund, der bereitwillig zu ihnen gelaufen kam. Sie staunten, dass seine Kette schlaff am aufgespannten Drahtseil hing und er frei war. Aber sie fürchteten ihn nicht, wie er gehofft hatte, und zogen sich nicht zurück.
Henning wartete, bis der gelbe Stern zu Boden gesunken war und es wieder dunkel wurde, dann sprang er hoch und rannte auf die Grenze zu.
»Halt, stehen bleiben!«
Er rannte.
Der Hund kam ihm nach, und Henning hörte, wie die Posten ihre Maschinenpistolen durchluden. »Stehen bleiben, oder wir schießen!«
Warnschüsse knallten durch die Nacht. Der LO 1800 der Alarmgruppe machte mit quietschenden Reifen halt. Soldaten sprangen ab, riefen. Sie wollten ihn nicht holen, damit er Feierabend machen konnte, sie wollten ihn als Leiche abtransportieren, nachdem sie ihm Kugeln in den Leib gejagt hatten.
Die Ehrenpflicht, das sozialistische Vaterland und den Frieden gegen jeden Feind zuverlässig zu schützen.
Henning rannte. Zweige peitschten ihm ins Gesicht. Er sah den Hund an seiner Seite, der Hund biss nicht nach seinen Beinen, der rannte mit ihm. Henning versuchte, Bäume zwischen sich und Boy und die Posten zu bringen. Sie würden jetzt scharf schießen, so war der Drill, so hatten sie es gelernt. Sie hatten das Einstechen auf Stoffpuppen geübt, Angriffe mit dem Messer, mit dem Spaten. Der Gegner, das war er.
Ich gelobe, der Deutschen Demokratischen Republik, meinem Vaterland, allzeit treu zu dienen und sie auf Befehl der Arbeiter- und Bauernregierung … Grenzsoldaten der DDR stehen an der Staatsgrenze auf Friedenswacht …
Die beiden Wachposten würden genauso viel Adrenalin im Blut haben wie er, ihnen würden die Hände zittern. Der Befehl lautete, Grenzverletzer »fluchtunfähig« zu schießen. Aber er wusste, die Kalaschnikow streute stark, selbst wenn sie auf seine Beine zielten, mit Leichtigkeit wurde auch der Brustkorb getroffen. Oder sie zielten gleich auf seinen Kopf. Ein toter Grenzverletzer passte besser ins Konzept. Er war das Wild. Und die Jäger waren zahlreich.
Heisere Befehle gellten. Jemand jagte drei rote Sterne in den Himmel, das Signal für versuchten Grenzdurchbruch. Im roten Schein sah er die rostigen Stacheldrahtzäune, die Trennlinie zwischen den zwei größten Militärblöcken der Erde. Er hatte es ausgekundschaftet, hier lagen zwischen den zwei Grenzzäunen keine Dornenmatten mit Stahldornen, kein »Stalinrasen«.
Eine einzige Regel spielte ihm in die Hände: Es durfte nicht über die Grenze hinweg geschossen werden, um nicht versehentlich Soldaten des Bundesgrenzschutzes zu treffen oder gar einen Krieg auszulösen. Er kannte die Bestimmungen. Er war am Zaun, er wand sich hindurch, der Stacheldraht zerriss ihm die Uniform und riss ihm die Haut auf.
Man würde ihm in die Beine schießen, und währenddessen würde der zweite Schütze versuchen, seitlich von ihm zu kommen, um Sperrfeuer vor ihn zu legen.
Aber er war schon zwischen den zwei Zäunen. Er musste die Stelle am zweiten Zaun finden. »Nicht schießen«, rief er.
»Pflicht ist Pflicht.« Die Stimme seines Verfolgers bebte.
»Die haben uns alle reingelegt. Denkt mal nach!« Er fand die Stelle. Boy war plötzlich bei ihm, er musste sich ebenfalls durch den ersten Stacheldrahtzaun gewunden haben, er blutete aus zahlreichen Wunden, sie glänzten im Licht der Sterne. Henning war so froh, ihn hierzuhaben, dass ihm deswegen Tränen in die Augen schossen.
Das tiefe Dröhnen des Grenzhubschraubers kam näher, die MI 8, man wollte ihn aus der Luft beschießen. Deutlich hörte er das Donnern, mit dem die Rotorblätter die Luft zerteilten.
»Komm, Boy, komm mit!« Als er sich ein wenig aufrichtete, um zwischen den scharfkantigen Graten des zweiten Zauns hindurchzukriechen, spürte er den Hieb einer Axt. Er wusste, es war keine Axt, es war ein Schuss, der seinen Leib durchbohrt hatte. Er schob sich weiter, drüben konnten sie ihm helfen, sie würden ihn ins Krankenhaus bringen. Sein Puls setzte aus, etwas wich aus seinem Körper. Er wollte weiter, er musste. Aber es ging nicht.
Jolanthe. Er hatte sie sich zurechtbiegen wollen, hatte versucht, sie seiner verstorbenen ersten Frau ähnlicher zu machen. Warum hatte es so lange gedauert, bis er begriffen hatte, dass er sie um ihretwillen liebte und genau so liebte, wie sie war?